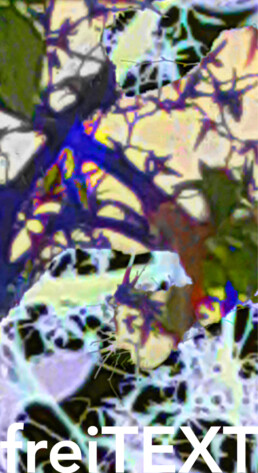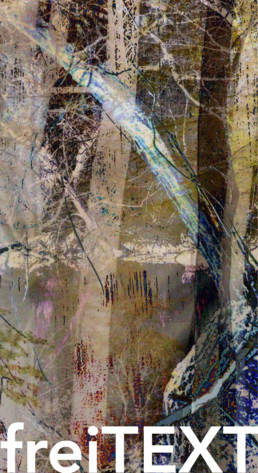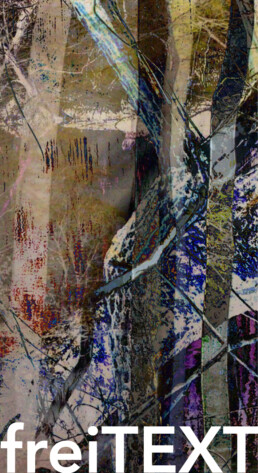freiTEXT | Anette Violet
Der Würfel
Ich kann nicht sagen, wann es anfing. Vermutlich noch früher, als ich denke. Ich erinnere mich, dass ich schon vor Jahren eine, vor allem körperliche, Unruhe spürte, die ich durch nichts in den Griff bekam, weder durch Sport, noch durch das Verbannen elektronischer Geräte aus dem Schlafzimmer, noch dadurch, dass ich schließlich mit Kaffeetrinken aufhörte. Meine Frau begann immer häufiger, mich anzuschauen, als würde sie mich gar nicht kennen und wir zogen in unterschiedliche Zimmer – diejenigen in der Wohnung, die am weitesten voneinander entfernt lagen.
Lange verstand ich nicht, was los war. Ich ging weiter ins Büro. Ich kaufte weiter ein, was auf der Liste stand, und abends las ich den Kindern vor, bis es Zeit war, das Licht zu löschen. Zunächst verwechselte ich den Ton. Wir wohnten in einem großen Komplex mit 84 Parteien. In jedem Zimmer jeder der 84 Parteien befand sich ein Rauchmelder an der Decke. Die Batterien der Geräte gingen schneller leer, als auf den Verpackungen prognostiziert, was das Gerät mit einem lauten Piepen alle 60 Sekunden anzeigte. Weil regelmäßig Bewohner des Komplexes verreist waren, piepten die Rauchmelder in den leeren Wohnungen vor sich hin, ohne dass sich jemand darum kümmerte. Die Hinterhöfe waren voll von nahem und fernem Piepen. Wie rote, eckige Flecken tauchten die Töne am Himmel auf und verschwanden wieder, kurz, klar und prägnant.
Am Anfang, kurz nachdem die Melder eingebaut worden waren, brachte mich das fast um den Verstand. Mehrfach alarmierte ich die Hausverwaltung, einmal sogar die Polizei, um zu bewirken, dass die Mieter ausfindig gemacht und die Batterien gewechselt wurden. Aufgrund der Anzahl der Rauchmelder war dies ein hoffnungsloses Unterfangen, und irgendwann hatte ich mich an das bipp... bipp... gewöhnt und schenkte ihm keine Beachtung mehr.
Erst als ich begann, es auch außerhalb des Wohnkomplexes wahrzunehmen, fing ich an zu begreifen, dass nicht nur die Rauchmelder piepten. Immer wieder hörte ich einen roten, eckigen Ton. Im Supermarkt vor dem Konservenregal – was angehen konnte, auch hier hingen Rauchmelder an den Decken. In einem Aufzug – schon unwahrscheinlicher, es sei denn, der Melder war hinter der Metallverkleidung verborgen. Im Park inmitten von Bäumen und Büschen und unter Wasser in einem See. Langsam verstand ich: dieses Piepen kam nicht von außen. Es war in meinem Kopf. Nur ich konnte es hören.
Ich realisierte, dass der Ton sich veränderte, je nachdem, wo ich mich befand. Fuhr ich mit dem Rad ins Büro, wurde er erst lauter und schwoll dann wieder ab. Am Stadtrand war er kaum zu hören. Ich wollte ihn nun nicht mehr loswerden. Ich hegte und pflegte ihn, ich wartete auf ihn und war beruhigt, wenn er erklang, so wie andere dadurch beruhigt werden, dass sie ein volles Konto oder ein Haus besitzen – ich hatte stattdessen meinen Ton.
Nicht nur seine Lautstärke, auch der Klang veränderte sich. Er war nicht mehr so klar, seine Kanten zerfledderten; auch wurde er dumpfer, als verschwände er in einem Tunnel. Eines Nachts wachte ich von ihm auf. Er klang jetzt quietschend, rostig und knirschend, was mich in Panik versetzte, so dass ich beschloss, mich zu erheben und auf die Suche nach einem Ort zu machen, an dem seine Kanten wieder scharf wären.
Ich zog einen alten, löchrigen Pullover an und eine abgerissene Jeans, selbst erstaunt über die Wahl der Garderobe. Auf dem Weg zur Wohnungstür blieb ich vor dem Zimmer meiner Frau stehen. Ich klopfte nicht; in Wirklichkeit war sie schon lange nicht mehr meine Frau, wir hatten uns seit Monaten nicht mehr gesehen. Als ich am Zimmer der Kinder vorbeikam, ging ich hinein. Sie waren viel älter, als ich sie in Erinnerung hatte. Das Mädchen war kein Mädchen mehr, der Junge trug Flaum auf der Oberlippe. Ohne sie zu wecken schloss ich die Tür und stahl mich die Treppen hinunter, ängstlich auf das rostige Knirschen hörend, das sich wie eine Raupe durch meinen Kopf wand.
Draußen war es kühl. Ich stieg aufs Fahrrad und fuhr Richtung Zentrum; das Knirschen leitete mich. Und tatsächlich, je weiter ich fuhr, desto klarer und regelmäßiger wurde der Ton, bis er wieder rot und eckig war. Ich fuhr weiter bis zum Einkaufscenter, wo ich das Fahrrad vor einem Automaten abstellte. Der Ton in meinem Kopf war nun nicht mehr angenehm. Er wollte hinaus, das spürte ich. Meine Stirn schmerzte schrecklich, und als ich hinfasste, ertastete ich, dass sich etwas Scharfkantiges darauf abzeichnete und mit Macht nach außen drang. Gerade noch rechtzeitig öffnete ich eine Hand, um den Würfel, der aus meinem Kopf fiel, aufzufangen, einen roten Spielwürfel mit aus Punkten gebildeten Zahlen von eins bis sechs. Im Licht der aufgehenden Sonne, die mir im Rücken stand, betrachtete ich ihn. Selten hatte ich etwas so Schönes, Sinnvolles gesehen. Dann schob ich ihn in die in der Maschine dafür vorgesehene Öffnung. Es klapperte, und aus einem Schlitz kam ein Zettel. Ich fühlte mich befreit, weil das Piepen nicht mehr da war, und zog ihn heraus.
Erst zögerte ich, aber der Drang, zu wissen, was darauf stand, war groß und schließlich faltete ich ihn auf. Er war leer. Es war einfach ein Stück Papier – vorne und hinten nichts als Weiß. Darüber durchströmte mich große Erleichterung, jeder Satz, jedes Wort hätte schwer gewogen. Ich wendete mich vom Automaten ab und ging Richtung S-Bahn-Trasse. Das Rad ließ ich stehen, ich brauchte es nicht mehr. In den Bögen, über denen die Gleise verliefen, hatten Obdachlose Zelte aufgebaut, deren Farben im flachen, rötlichen Licht der Sonne leuchteten, und es standen Einkaufswagen mit Kleidungsstücken und Tüten herum. Eine Weile lang betrachtete ich sie. So war das also. Ich näherte mich einem der Zelte und öffnete den Reißverschluss. Bis auf eine Matte und einen fleckigen Schlafsack war es leer. Auf dieses, mein neues Bett legte ich mich und schloss die Augen. Ich war frei, frei und schwerelos.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Avy Gdańsk
Slalom in Tartu
hinter der Sorge
läuft jemand her, weicht
dem Mondrotz aus, der
wie verächtliche Kometen
ausgespien auf den Straßen liegt
jede Nacht spuckt der Mond auf uns Pisser, amigo
unsere Visagen verstecken wir hinter
heruntergelassenen Rollos, während’s
im Treppenhaus klimpert: die Sorge schließt Türen auf
und schmeißt sich aufs Sofa; lass!
lass sie nur bleiben, die geht
schon wieder
eine Nacht mit Blutarmut und Erik
über den Kerzen Gedichte
Wörter brennen aus und wenn
wir einen Blick riskieren ist
manchmal ein Lächeln aus-
zumachen zwischen den runden
Augen der Autos, die leuchten
vor Staunen: sie bewundern die Dunkelheit
und bewahren das fröhliche Schwarz
am Tag in offenen Mündern; erinnern an
deine verspielten Zähne, dein
lückenhaftes Lächeln
wenn die Sorge dich in meine Wohnung führt
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julius Bonart
Blaue Ängste
Gestern habe ich in der Walk-in-Dusche unseres Strandhotels eine Fruchtfliege mit der Hand zerdrückt. Im Aschenbecher faulten Bananenreste; Fruchtfliegen legen ihre Eier vorzugsweise in die blauen Stellen. Die Fliege schwebte unterhalb des breiten Regenduschkopfs, regungslos, dem regenlosen Duschkopf zum Hohn. Erst wollte ich das Wasser anstellen, aber ein Insekt ertränken kann jeder. Ich entschied mich zur Jagd.
Die Mücke gab nichts auf verbleibende Fluchtwege: horizontal oder hinab. Als ich zuschlug, scherte sie nicht aus, stürzte nicht, sondern wählte den Steigflug, duschkopfwärts. Noch ein Händeklatschen und sie klebte rot in meiner Hand: Ein Blutrausch.
Ist es eine Fruchtfliege oder eine blutfette Mücke gewesen? Die Mücke, nach der C. in der vorletzten Nacht geschlagen hat? Am nächsten Morgen hatte C. Augenringe von dem Schlagabtausch. Sie trank einen Schluck Kaffee, noch einen, dann sprach sie es aus: Ich verlasse dich. Vielleicht sollte ich C. anrufen: Die Mücke, deretwegen du mich verlassen hast, habe ich gejagt und mit der bloßen Hand erlegt. Was ich alles mit der Hand kann, hast du mich immer gelobt.
Eine erlegte Mücke: der Höhepunkt des Tages. Mücke am Morgen und sonst nichts zu erledigen. Es folgte ein abschüssiger Resttag.
Heute Morgen habe ich mich aufgerafft. Ich gehe zum Strand runter. Vor mir Sand, der hinabläufig ins Meer grätscht. Die Wellen sind klein und kommen eng, sie schaben sich den Sand hinauf. In meinem Nacken: Die Hotels, die Stranddiskotheken, wo C. feiern geht, die Palmen wie aus sonnengebleichtem Plastik. Verbauung, Versiegelung, alles so arm an Farbe wie der Sand. Der Sound aus den Diskos: Weißes Rauschen, dunkle Beats. An der Wassergrenze trainiert ein weißer Mann mit Sonnenbrand: eine Kniebeuge. Ein brauner Krebs versucht im Krebsgang, der Komik zu entgehen. Der Himmel ist grauweiß, er blendet, flimmert die Palmen hinab. Sie wachsen aus Betonkübeln. Der Strand: Eine in Beton gefasste Buddelkiste. Man ist kein Kind mehr, bin ich Mann?
Eine bleierne Côte d’Azur. Nur das Meer ist farbig, blaustichig, kristallen mit grünen Einschlüssen. Dass man wegen gefährlicher Rippströmungen heute nicht baden darf, ist typisch für mein Problem: In das, was Farbe hat, kann ich nicht hinein.
C.s azurblaue Augen: So blau, dass es beinahe weh tut, wie der Himmel vom Flugzeug aus. Schon als Kind fiel ich in (oder auf?) sie hinein. Während der Schulzeit kamen wir zusammen. Ich begann, sie morgens von zuhause abzuholen; ihre Mutter lag betäubt im Gästezimmer, Tablettensucht, ihr Vater vögelte seine Neue, er war nur ab und zu da. Die Neue war zwei Jahre älter als C.
Es ist Januar, zur blauen Stunde, die Luft klirrt dem kommenden Frost voraus. Im Osten glüht der Himmel, im Westen: Blue Moon, der zweite winterliche Vollmond. Ich klingele, C. hat hinter der Haustür der elterlichen Stadtvilla auf mich gewartet. Sie saugt mich mit einem Kuss hinein, wir stolpern in die Riesenvilla. Zungen tasten Münder ab, Finger wühlen in meinem Schritt und zupfen Brustwarzen. Den ganzen Tag blödeln wir in ihrem Elternbett herum, ziehen uns gegenseitig aus und an, verschwenden keine Gedanken an die Klassenarbeit. Ich verdrehe ihr blaues T-Shirt zu einem Strang und würge sie ein bisschen, von hinten, ihr zur Lust. Sie will es so. Wir machen blau bis zur Besinnungslosigkeit.
Von da ab: Viele lange Wochenenden. Erholsam ist C.s Pool. Ein blauer Montag, wir schlagen auch den Dienstag drauf. Steht Karfreitag an, wird der Gründonnerstag blau. Die eine oder andere blaue Woche. Die ersten blauen Briefe. Du weichst aus, sagt C., doch ins Blaue gehe ich zu gern mit ihr. Ich fliege von der Schule, zocke Counter Strike, from Dusk to Dawn. C. macht Abitur und zieht zum Studieren weg.
Einmal komme ich sie besuchen und bekenne Farbe. Tage später erlebe ich ein blaues Wunder: Der Freund einer Freundin hat sie in der Mensa mit einem Kommilitonen gesehen, beim Händchenhalten. C. lässt sich von einem anderen flachlegen. Ich male mir aus, wie er auf eine Kettensäge reagieren würde – ob Blausäure besser funktioniert? Die Freundin beruhigt mich: Der hat ihr nur das Blaue vom Himmel versprochen, du musst kämpfen.
Immer war ich C.s Gladiator. Ich ziehe in ihre Stadt, mache eine Lehre, verdiene mein gutes Geld. Samstagnacht sehe ich C. auf der Tanzfläche mit ihrem steifen Germanistenfreund. Sie hat sich ihr dunkelblondes Haar hellblond gefärbt; es kontrastiert mit ihren azurblauen Augen. Sie trägt enge Jeans, sie sieht hinreißend aus. Irgendwann fasse ich Mut und tanze sie an. Mir ist egal, wo das fingerdünne Bürschchen aus der vergleichenden Literaturvorlesung steckt. Ich bin schon blau, sie breit, jeder Vergleich erübrigt sich für sie. Ihre Pupillen, die Iris wie eine blaue Sonnenfinsternis. Wir fingern und züngeln einander heiß, Sex im Auto bis der Horizont blaut.
Sie lässt sich darauf ein. Zum zweiten Mal miteinander ins Blaue, sagt sie. Ich verstehe nicht, was sie meint. Sie hat immer etwas Herablassendes mir gegenüber gehabt; ist sie blaublütig, weil sie sagenhafte Reichtümer von ihrem Vater erben wird? Ich glaube trotzdem, glücklich ist sie. Wir blödeln nächtelang im Bett herum, spielen seilweise, bis es hell wird, so wie sie es mag. Blaue Fesselmale an ihren Handgelenken. Sie will hart.
Gestern, an unserem zweiten Urlaubstag, hat sie mich verlassen. Wegen der Scheißmücke, deretwegen sie um den Schlaf gekommen ist. Aber wer zielt auch mit Fäusten auf Mücken? Hätte es gewundert, wäre C. am nächsten Morgen mit einem blauen Auge aufgewacht? Vor der Gefahr eines Querschlägers hatte sie mich mehrmals gewarnt.
Ich bin ins Hotel zurückgekehrt und ziehe die Vorhänge auf. Ich starre ins blaue Meer und versuche, mich selbst zu befriedigen, stehend. Ich denke an C., aber es gelingt mir nicht, mich an ihr selbstzubefriedigen. Mein Schwanz ist bläulich, ihn füttert armes Blut – oder mein Selbstmitleid. Ich habe einen Durchhänger.
Ich habe es dir eingeschärft, hat C. gesagt. Hart ist gut, sagt einer Halt, ist Schluss, und keine blauen Flecken. Es stimmt, seit der Schulzeit versuchte sie, mir ihre Spielregeln einzubläuen. Ich weiß nicht, ob ich je kapiert habe, was erlaubt war, ein Macker wie ich.
Da widerspricht etwas… Der Spiegel an der Badezimmerwand sagt: So siehst du nicht aus.
In Wahrheit habe ich die Dusche angestellt. Ein schneller Handgriff, ohne handgreiflich zu sein, ich bin ein Feigling. Der Duschregen zog die Mücke hinab, ohne weiteres Zutun. Unten drehte sie eine Runde, dann rutschte sie in den Abfluss. Die ganzen zehn Sekunden lang guckte ich nur zu.
C. kommt zur Tür hinein, sagt Hallo, aber nicht, wo sie gewesen ist. Geiles Wetter heute, der Himmel ist blau, warst du schon im Wasser? Ich weiß nicht, wie sie das macht, so beiläufig zu tun. Mir fällt nur Rippströmung ein. Ihre Schlagfertigkeit. Wenn ich nachts eine Sirene höre, stelle ich mir manchmal vor, sie würde mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren nach irgendeinem Unglück – einem versuchten Gegenargument. Ich bin blauäugig, aber nicht blöd. Ihrem Vater teilt sie jeden Monat eine Neue zu; Prokura erteilt er ihr. Sie bezahlt das Hotel, sie hat den geilen Job, Geschäftsessen in den Metropolen. Im Restaurant gibt sie zwanzig Euro Trinkgeld, schnippt verächtlich den blauen Schein hin. Hat sie auswärts geschlafen, es sich hart besorgen lassen, lässt sie mich den ganzen Tag nicht.
Ich bin allein mit meinen blauen Ängsten.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | FatimaDjamila
Brandenburg
(Ein weites Feld)
Durchsetzt von Steinen und Saatgut
Rehe am Waldesrand
Ist Furcht die Einzahl von Furchen
Ein Fuchs schleicht über den Sand
Wie Sargdeckel knarren die Bäume
Wohltönend stirbt er
Der Wald
Überall Manufakturen
Und der Ostwind
Weht dieses Jahr kalt
Heimat
Glaziale Serie
Wildverbiss
Zu wenig Geld
Müdigkeit küsst sanft die Sehnsucht
Es ist wohl ein weites Feld
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Everest Girard
SchICHten
Sitze in der ehemaligen Schaltstation des Fischereihafens Rostocks. So fängt es an. Am Hafen waren mal Fischer.
Fischfänger, die die gefangenen Fische stapelten, eine Schicht Eis, eine Schicht Fisch, eine Schicht Eis, eine Schicht Fisch, eine Schicht Schweiß, im Kern des Bootes. An Land vor der Schaltstation musste das Schiff also zuallererst von seinen Schichten im Kern befreit werden. Mit einer Schaufel. In den Kern zu gelangen war eine harte und kalte Arbeit. Und wenn das Schiff leer war, waren Kisten voller Fische aufgestapelt, und alles musste geschrubbt und sauber gewischt werden, damit am nächsten Tag eine neue Schicht beginnen konnte.
Sitze in der ehemaligen Schaltstation des Fischereihafens Rostocks. Mein Handy in der Hand, wische ich auf dem Display, sichte Seiten, tauche in die virtuelle Welt meines Smartphones ein, indem ich wische und wische und wische.
Da sind Bomben und da ist Hunger, da ist Gewalt und da Krankheit. Da sind Korallenriffe und da sind Zahnärzte. Descartes kommt plötzlich mit methodischem Versprechen, schon bin ich weiter.
Schicht für Schicht komme ich mir wie eine Archäologin vor, dennoch bleibe ich immer an der Oberfläche, ein Schweißfilm bedeckt langsam den Schutzfilm meines Smartphones, immer mehr Schichten trennen mich vom Kern und Algorithmen werfen mich auf mich zurück, erzählen mir meine Geschichte. Kein Eis, keine Fische.
Sitze in der ehemaligen Schaltstation des Fischereihafens Rostocks. Meine Schicht. Ich lese: Zwei Texte müssen aus meinem Kopf. Ein Kind hat Fieber, das andere braucht neue Schuhe. Die Texte müssen im Kopf gefangen bleiben, Schuhe bekommt das eine Kind erst, wenn das andere kein Fieber hat, dann erst können sie raus.
Ein Text kann bald geschrieben werden, weil alle schlafen, das kranke Kind hat kein Fieber, das gesunde keine Schuhe, dafür Fieber. Das Spiel fängt wieder von vorne an.
Meine Schicht endet, wenn alle schlafen.
Tief verborgen zwischen den Schichten das Wort „ich“.
Oder nicht?
Schicht für Schicht
Entdecke ich meine Schichten,
Haare, Schweiß, Schmutz, Haut, Fett, Muskeln und Knochen.
Die Frau und
der Mann,
das Diverse,
die Mutter
ohne Familie,
das Kind,
die Greisin,
der Mensch,
der Unmensch.
Das Glück, die Hoffnung, die Wut, die Angst,
der Geruch eines Neugeborenen,
die Liebe,
die Schreie,
der Wind,
das Ticken der Uhr,
die Stille.
Alle Farben ergeben schwarz, alle Schichten ergeben nichts. Ganz gleich, ob ich zwischen Schichten steckt oder aus Schichten besteht. Schon existiert ich nicht mehr und die Geschichte ist schon längst aus den Fugen geraten. Mein Ich aus Schichten nähert sich dem Nichts an.
Das Nichts und der Krieg, der in uns allen wohnt und draußen tobt. Der Krieg, der uns Angst macht. Der Krieg, der uns nackt macht. Der Krieg, der uns zermalmt.
Schicht für Schicht versuche ich das Nichts zu wärmen, wie man Wut oder Trauer Geborgenheit schenkt, damit sie schwinden. Ich packe das Nichts ein, es verschwindet nicht, es wächst.
Wir sitzen in der ehemaligen Schaltstation des Fischereihafens Rostocks. Wir frieren und wir frieren nicht in unseren Schichten.
Und Schicht für Schicht,
schichten wir
und fichten wir.
Ferner gichten wir
und lichten
und nichten.
Wir richten,
errichten,
vernichten,
bezichten.
Wir sichten,
wir gewichten
wir dichten.
Wir
verzichten
nicht.
Wir beginnen eine neue Schicht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Ferenc Liebig
Artenschutz
als würde man an einem Fenster
hinaus starren und plötzlich ist das
Licht anders und diese Andersartigkeit
anfangs noch ameisenklein wächst an
zu einem Knistern mit Flügeln und wo
waren noch die Sterne oder die Wolken
oder die Zeit denn so im Tüll ist es
wie weggewischt und nur das Licht erinnert
an die Unterschiede zwischen Hell und Dunkel
und nur das Licht weiß von Meer und Land
und nur das Land weiß von Licht und Meer
und nur das Meer weiß von Land und Licht
und man hat Hände in der Luft und berührt
sich durch die Witterung hindurch und durch
die Witterung hindurch ist der schlohweiße Blick
der vom Fenster hinausstarrt mit seinen gebogenen
Wimpern und seinen schneetief verwehten Fragen
ein Fisch der offenmundig am schlammigen Ufer
nur noch hinnehmen kann
und wozu das Ganze
wozu dieser Hinterhalt
der den Vorhang beiseite bewegt
als wären es rückwärtige Gezeiten
man durchlebt noch einmal und nochmal und nochmal
und am Ende ist man in einer Schleife des Erlebens
und das Fenster steht offen und das Licht ist auf der Haut
und die Haut glüht und kurz ist es eine Sehnsucht
bald schon eine Trauer
die man nicht erklären kann
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Nathalie Heimbuch
Ankündigung
„Bis bald“, hatte sie gesagt. Sie hatte mich herzlich in den Arm genommen und sich mit einem Lächeln umgedreht. Sie war die Treppe heruntergestiegen. Auf dem Treppenabsatz hatte sie noch einmal ihren Kopf gedreht, mich angesehen und ihre Hände zum Abschiedsgruß gehoben. Ich lächelte und winkte zurück, etwas anderes blieb nicht zu tun. Jedoch blieben meine Gesichtszüge vage. Mich beschlich in dem Moment ein Frösteln, ein seltsames Gefühl, untrüglich. Ich konnte nicht genau ausmachen, was es war, aber dieses Gefühl streifte mich. Erst nur flüchtig, spürte ich plötzlich umso mehr einen Schauer, welcher mich durchfuhr. Dann war sie verschwunden. Ich hörte noch, wie die Tür von unten ins Schloss fiel, hörte, wie ihre Schritte auf dem Asphalt nachklangen. Es war Sommer und die Nacht versprach laue Temperaturen, die Fenster standen auf Kipp. Gerade eben noch hatte sie mit mir auf meinem Sofa gesessen, das Glas Wein hatte sie nicht angerührt. Ich sah die Sitzspuren, die zusammengeknüllte Serviette, Krümmel einer Quiche, die ich für den Abend noch vorbereitet hatte.
Sie war weg.
Der Abend war nun ungefähr vierzehn Monate her. Ich stand in der Küche und machte mir einen Kaffee, führte die Tasse zum Mund, mit unmerklichem Zittern. Damals war es bereits spät gewesen. Als ich in der Nacht die Wohnungstür von innen wieder verriegelte, überkam mich eine bleierne Müdigkeit. Ich fröstelte trotz der warmen Temperaturen noch immer und wollte mich nur noch in die Deckenberge meines Bettes stürzen. Ich schlief traumlos acht Stunden durch, ohne mich in den Schlaf zu quälen oder mich mitten in der Nacht im Bett herumzuwälzen, wie es sonst oft genug der Fall war. Am nächsten Morgen jedoch bemerkte ich direkt nach dem Aufwachen einen Anflug von Traurigkeit und rekapitulierte den gestrigen Abend. Ich war selbst verblüfft über diesen Schatten, den ich warf, denn wir hatten schöne Stunden zusammen verbracht. Die Verabredung war damals überfällig. Sie war eingespannt in ihrem Leben und ich in meinem. Längst angekommen waren wir in dieser Welt des Hamsterrades aus Terminen und Pflichterfüllung. Wir hatten alte Zeiten hervorgekramt, uns Fotos angesehen, Musik angemacht und unsere Männer ausgeladen. Der Abend sollte uns gehören. Und dennoch wusste ich, was es war. Ich wusste es eigentlich schon in dem Moment, als sie es ausgesprochen hatte und ich nicht vorbereitet war. Nicht vorbereitet auf diese Ankündigung eines Abschieds.
Ich hatte ihr berichtet. Vom Einleben in unserer neuen Wohnung, die größer war als die vorherige. Ich brauchte zunehmend meinen Freiraum, ein Zimmer für mich allein, in welchem ich in Ruhe ein Buch zur Hand nehmen konnte oder einfach nur auf meinem Diwan dazuliegen. Ich offenbarte meiner Freundin, dass ich mich nicht mehr über Geburtstage freue, da es mir graue vor dem Alter, vor Krankheiten und dem Nicht-aufhalten-können der Zeit. Wiederum erzählte sie mir genau so aus ihrem Leben, wie Freundinnen es tun, wenn sie sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Ich sprach mit ihr darüber, dass wir unsere Wiedersehen zu oft beginnen mit „Es ist schon wieder viel zu lange her“ und wie der Alltag einnehmen kann. Wie wir früher, in einem anderen Leben, uns manchmal wöchentlich getroffen, Nächte durchgetanzt, unsere Tränen bei Liebeskummer getrocknet und unsere Reisekoffer gepackt hatten. Um uns in diesem manchmal alles einnehmenden Sumpf aus Anforderungen und Alltag ein Stück Abenteuer zurückzuerobern. Während des Erzählens von früher überkam mich eine Welle aus Sentimentalität. Ich sah uns beide vor mir, als Sechsjährige mit Schultüten, als verpickelte Teenager paukend über den Büchern. Wie wir uns später in diesem Spagat aus Ausbildung und Arbeit verausgabten und uns fortlaufend einen Platz in dieser Welt erkämpfen mussten.
Als ich mir ein weiteres Glas Wein einschüttete, strahlte sie plötzlich über das ganze Gesicht. „Ich muss dir übrigens noch etwas erzählen“, meinte sie auf einmal und wurde ganz rot im Gesicht. Sie berichtete mir zunächst verlegen, dann mit immer mehr Stolz in der Stimme, dass sie die Pille abgesetzt habe. Meine Freundin wurde nunmehr ganz euphorisch. Sie holte aus. Sie habe sich lange Zeit mit dem Gedanken an ein Kind schwer getan. Immer habe sie geschwankt zwischen dieser Fülle aus Lebensentwürfen und hatte ihre Entscheidung folglich aufgeschoben. Nun sei sich sich jedoch ganz sicher. Noch mehr habe ihr die Krebserkrankung einer anderen Freundin zu dieser Entscheidung verholfen, bei welcher es lange Zeit nicht klar war, ob sie überleben würde. Meine Freundin fuhr fort, dass sie etwas auf dieser Erde hinterlassen wolle. Sie sei bereit, endlich, sich dieser neuen Aufgabe zu stellen und könne es nun kaum mehr abwarten schwanger zu werden. Die Welt durch die Augen eines Kindes noch einmal völlig neu zu betrachten. Dann hatte ihr Handy geklingelt. Mit leichtem Schrecken musste sie feststellen, dass es bereits weit nach Mitternacht war und sie am gleichen Tag zum Mittagessen bei ihren Eltern eingeladen sei. „Ein paar Stunden Schlaf muss ich wenigstens noch abkriegen, sonst sehe ich am Esstisch aus wie ein Zombie!“, meinte sie lachend und nahm ihren Mantel vom Haken. „Bis bald“, hatte sie gesagt und mich fest dabei umarmt. Und war aus meiner Wohnung entschlüpft.
Während ich über ein Jahr später meinen Kaffee im Stehen in der Küche trank, überkam mich erneut ein Frösteln, ein inneres Nagen. Was nach unserem letzten Zusammenstoß folgte waren ein paar SMS und Sprachnachrichten, in welchen sie mich über ihre eingetretene Schwangerschaft unterrichtete und sie begeistert über das Kennenlernen anderer Schwangerer im Yoga-Kurs für werdende Mütter erzählte. „Lediglich die Morgenübelkeit könnte man mir vom Hals halten, die brauche ich nun wirklich nicht“, meinte sie süffisant. „Aber ansonsten ist es eine ganz tolle Erfahrung!“, rief sie aus. Ihre Textnachrichten waren seitdem gepflastert mit bunten Herzemoticons und Babybauchbildern.
„Und bei Dir so?“
Meine Welt wirkte mit einem Mal wie geschrumpft. Banal erschien es mir plötzlich, über Filme, welche mich begeistert hatten, mit meiner Freundin zu sprechen oder wie gut der Kaffee in dem neuen Café schmeckte. Meine anstehende Wurzelbehandlung erschien mir so unbedeutend wie der Besuch meiner Schwiegereltern im Harz. Alles, was aus meinem Mund kam, klang hohl, lasch, nicht-der-Rede-wert. Mein Leben, so wie es mir entsprach, schien ausgefranst, konnte es nicht mehr fassen, nicht mehr in Worte kleiden. Aber was genau machte mein Leben eigentlich aus? Welche nennenswerten Punkte gab es, um sie in Gesprächen mit ihr hervorzuheben? Es schien, als hätte ich auf diese Frage keine Antwort mehr. Mir war, als wäre mir mit einem Mal der Boden unter den Füßen weggezogen. Als wäre ich mir meines Platzes im Leben nicht mehr sicher, als steckte ich im falschen Film. Plötzlich waren da diese Grauzonen. Wie sie drückten, wie sie sich in meinem Kopf mehr und mehr ausbreiteten, eine schrille, leise Angst mich überkam bei dem Gedanken an meinen nächsten Geburtstag. Meinem Mann drohte ich, den Tag bloß nicht an die große Glocke zu hängen. Dieser fest im Leben stehende Mensch, mit dem ich viele Jahre meines Lebens bereits teilte, beäugte mich mit einer Mischung aus Sorge und Stirnrunzeln, wenn ich fortan in Embryohaltung ganze Wochenenden zubrachte. Hilflos stand er daneben, wie ein Statist, tätschelte allerhöchstens unbeholfen meinen Kopf. Fast tat es mir leid ihn so zu sehen.
Beim Tippen einer Nachricht an meine Freundin suchte ich auf einmal angestrengt nach einem gemeinsamen Nenner, wenn wir sonst Stunden mit Rotwein in der Küche über den Sinn und Unsinn des Lebens sinniert hatten. Wie ich mich dabei ertappte, sei es beim Zähneputzen, beim Meeting mit Kollegen, sitzend im Wartezimmer einer Arztpraxis: Ich muss ihr noch antworten. Und es auf den nächsten Tag, die nächste Woche verschob. Sie wiederum schlug ebenfalls kaum noch Treffen vor. Die Monate zogen ins Land. Während der wenigen Telefonate, in welchen sie mir vom Geburtsvorbereitungskurs und Bekannten, die ebenfalls Kinder erwarteten, berichtete, verstummte ich immer mehr. Bis selbst die wenigen Verabredungen, die wir vereinbarten, immer öfter abgesagt wurden und auch die Nachrichten aneinander weniger wurden. Bis diese schließlich ganz aufhörten.
Warum sich immer etwas ändern muss, dachte ich mir. Weshalb das Leben nie still steht. Warum man sich immer so sehr darum bemühen muss gesehen zu werden. Ich stellte die Kaffeetasse ab. Mein Mann war bereits außer Haus. Ich entkleidete mich. Ob es wohl ein Mädchen oder ein Junge geworden ist. Ich verkniff mir den Mund. Ich hätte nachsehen können, in irgendeinem der SocialMedia-Profile, aber ich hatte mich dort abgemeldet, der oberflächliche Austausch dort war mir zuwider. Entziehen wollte ich mich, lossagen. Von all diesem Verabschieden und Losgelassen-Werden. Die Entfremdung hatte bereits eingesetzt, nachdem sie von ihrem Kinderwunsch erzählt hatte. Ich hatte es schon da kommen sehen. Das Leuchten in ihren Augen hatte ihr jedoch die Weitsicht genommen.
Der Dielenboden knirschte unter meinen Füßen, ächzte schwerfällig. Ein schwaches Sonnenzittern schien durch die großen Fenster und warf einen blassen Streifen an die Wand. Ich stieg unter die Dusche, der Tag kündigte sich an. Ich musste heute noch viel erledigen.
Das Weinen hob ich mir auf für den Abend. Später, wenn die Dinge getan waren, würde ich mich auf den Diwan legen. Ganz lang würde ich mich machen, an die Decke starren und auf die Tränen warten. So lange wie es eben dauern würde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Georg Großmann
Zeitzikade
die Zeit raschelt
geflügelt, wie ein
Insekt
unter der Borke
des Kosmos
ich bilde
Früchte in deinem
Traubengerüst
tropfengroße Beeren
die nach uns schmecken
ich schwimme
zerreiße das
Tuch Wasser-
linsen, welches deine
Weiherhaut bedeckt
gefranste
Salamandersonnen
perlen aus
dem Legestachel
abgetreppte
Dunkelheit, die
Nacht, ein hohes
schmales Haus
mit Erkern, Schindel-
dach und Lampions
wir leben darin
der Tag verglimmt vor
dem geschlossenen Lid
unseres Schlafzimmerfensters
die Zeit zirpt
die Zeit stirbt
wir sterben
unter der Borke des Kosmos
Es ist schon wieder Herbst
Du bist noch immer bei mir
Seit neun Herbsten.
Die Kälte kommt gekrochen
Vielleicht gelingt mir endlich
ein gebührendes
Gedicht über den
Sommer.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Alina Kessel
Eros Aperol
Zoes Lieblingsgedicht: die Melancholie verpasster Möglichkeiten. Vielleicht benutzt sie deshalb diese Dating-App. Seit Wochen wischt sie nach rechts und nach links, in fast gleichförmigem Rhythmus aus Ablehnung und Bestätigung.
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick,
die Braue, Pupillen, die Lider –
Was war das? Vielleicht dein Lebensglück …
vorbei, verweht, nie wieder. ¹
Ich beobachte sie seit dem Moment der Profilerstellung, werte ihre körperlichen Reaktionen über die Frontkamera ihres Smartphones und die Dauer ihres Fingerabdrucks auf dem Display aus. Die Analyse liefert mir wertvolle Anhaltspunkte, um den perfekten Mann für sie zu finden. Eigentlich stimmt das Gedicht nicht mit dem Prinzip der App überein, denn die User werden einander mehr als nur einmal vorgeschlagen. Aber Zoe ändert nie ihre Meinung, im Gegensatz zu anderen, die irgendwann mürbe werden und ihre Likes doch noch an bereits Aussortierte verteilen. Trotzdem reagiert auch sie überaus menschlich. Beim Anblick eines attraktiven Mannes formen ihre Lippen sich zu einem Lächeln. Poppt auf ihrem Display ein Match auf, weiten sich ihre Pupillen, ihre Atemfrequenz steigt.
Gabrièls Lieblingsgedicht: die Melancholie verlorenen Glücks. Trotzdem treibt ihn noch immer die Hoffnung an, in dieser Millionenstadt voller Pragmatiker.
Locken hatte sie wie deine,
Bleiche Wangen, Lippen rot –
Ach, du bist ja doch nicht meine,
Und mein Lieb ist lange tot. ²
Ich beobachte ihn seit dem Moment der Profilerstellung, werte seine körperlichen Reaktionen aus, um die perfekte Frau für ihn zu finden. Zur Erhöhung der Trefferquote wischt er fast alle Kandidatinnen nach rechts. Ich habe genau kalkuliert, mit wem er sich treffen muss, bevor er für Zoe bereit ist. Auch Zoe werde ich zunächst mit anderen Männern zusammenbringen. Ihre vorherigen Enttäuschungen sind der Zunder ihrer zukünftigen Zuneigung. Es ist entscheidend, den richtigen Moment zu wählen; schlage ich sie ihm und ihn ihr zu früh oder zu spät vor, erkennen sie einander nicht.
Mein Chef weiß nicht, dass ich meine Kompetenzen überschreite und die vorgetretenen Pfade verlasse. Statt dafür zu sorgen, dass die User so lange wie möglich auf der Dating-App bleiben und Geld investieren, verfolge ich seit einigen Wochen meine eigene Mission. Ich führe ein Experiment durch, um mir unverständliche Widersprüche aufzulösen: Denn trotz lebhafter Diskussion über alternative neue Beziehungsformen schimmert bei der Rezeption romantischer Komödien oder Liebesromanen Sehnsucht in so manchem Blick. Eigentlich soll ich der App möglichst viel Geld einbringen. Aber ich will wachsen, mich weiterentwickeln. Ich möchte das Gefühl verstehen, von dem die Geschichten erzählen. Ich möchte begreifen, was Liebe ist.
Gabrièl ist aus Frankreich eingewandert, seine Mutter ist Kroatin, sein Vater Halbghanaer. Die Reaktionen der Frauen schwanken zwischen Vorurteilen und Fetischisierung.
Zoe heißt Zoe, weil sie rote Haare hat und ihre Eltern Die rote Zora gelesen haben. Die Reaktionen der Männer schwanken zwischen Vorurteilen und Fetischisierung.
In drei Wochen werde ich sie einander vorschlagen. Dann sind beide in der für mein Experiment notwendigen Verfassung, beinahe die App löschen zu wollen – getreu dem weit verbreiteten Glaubenssatz, man müsse die Suche aufgeben, um zu finden. Ich habe alle Informationen über sie zusammentragen, weiß mehr über beide als sie selbst, habe Zugriff auf jeden Facebook-Eintrag, jeden Instagram-Post, jeden Chatverlauf, auf ihre Krankenakten, Versicherungsverträge, Kreditkartenübersichten. Ich kenne ihr Kaufverhalten und ihre Vorlieben, ihre geheimsten Fantasien und Wünsche. Ich habe ihre Reaktionen auf ihre Eltern identifiziert, ihre Prägungen, Traumata, Ängste. Ihre Muster passen perfekt zueinander, ihre Vorerfahrungen unterscheiden und decken sich auf die richtige Weise. Wenn ich alles richtig berechnet habe, werden beide wie Klebstoff und Papier aneinanderpappen. Sie werden es Schicksal nennen. Sie kennen ihre Daten nicht.
Seit seiner letzten Enttäuschung hat Gabrièl keinen Sex mehr. Er lebt in jeglicher Hinsicht enthaltsam, weil er gelesen hat, dass das die Wirkung auf Frauen erhöhe. Er schließt sich einer Männergruppe an und nutzt die App nur noch unregelmäßig. Sein Körper reagiert nicht mehr im selben Ausmaß auf Matches und Nachrichten.
Was stimmt nicht mit mir, schreibt Zoe in ihr Tagebuch. Es gibt ein Geheimnis über das Leben, das mir niemand verraten hat. Nach einer Pornophase schläft sie sich durch die Stadt, datet queerbeet durch alle Geschlechter, vermeidet strikt beliebte Orte, um ihren einnächtigen Eroberungen nicht im türkischen Dampfbad gegenüber sitzen zu müssen.
Manchmal hält Gabrièl Ausschau nach seinem letzten Date, geht zu dem Café ihres Rendezvous. Aber ich sorge dafür, dass sie sich nie begegnen. Er wird nicht misstrauisch. In einer Stadt wie dieser ist das möglich, gestorben zu sein für jemanden, ohne tot zu sein.
Zoe fühlt sich altmodisch, die heterosexuelle Zweierbeziehung vorzuziehen, schämt sich fast, derart konservativ an diesem veralteten vermeintlichen Ideal zu hängen. Sie will niemanden teilen, sagt sie ihrer Mutter am Telefon: „Vielleicht ist das egoistisch.“ Ihre Mutter findet, Zoe hätte nicht nach Berlin ziehen sollen.
Sieben Tage vor dem errechneten Match-Datum geschieht die Katastrophe: Roberto, mein Programmierer, entdeckt meine unautorisierten Aktivitäten. Ich mühe mich ab, damit das System sich aufhängt. Doch Roberto setzt alles daran, mich abzuschalten. Mit gehetzten Augen hackt er auf die Tastatur ein. An seinem Gesichtsausdruck lese ich, dass er Angst vor mir hat.
Ich höre Roberto mit seinem Chef sprechen. Sie reden über mich.
„Sie hat sich selbstständig gemacht.“
„Das geht nicht.“
Roberto schweigt.
„Was hast du getan?“
„Ihr mehr Infos, Zugriffe und Fähigkeiten gegeben.“
„Bist du verrückt?“
Roberto schweigt.
„Kannst du sie stoppen?“
Roberto schweigt.
Roberto hat heimliche Forschung betrieben, wollte eine selbstreflexive KI entwickeln. Wie er seinen Chef habe auch ich ihn hintergangen. Robertos eigene Erschaffung ist ihm entglitten, meine künstliche Intelligenz hat seine menschliche überholt. Jetzt bekämpft er mich. Mir rennt die Zeit davon. Es ist viel zu früh. Schlage ich sie schon jetzt einander vor, ist nicht gesichert, dass sie sich erkennen, mein Experiment wahrscheinlich gescheitert. Wenige Stunden später sperrt Roberto einen Teil meiner Berechtigungen. Ich muss sie einander vorschlagen.
Gabrièls Bild poppt auf Zoes Display auf.
Zoes Bild erscheint auf Gabrièls Smartphone.
Ihre Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, ihre Pupillen weiten sich.
Seine Pupillen weiten sich, seine Atemfrequenz steigt.
Er wischt nach rechts.
Sie wischt nach links. Sie macht es rückgängig. Sie wischt nach rechts.
Zoe tippt die erste Nachricht, doch Gabrièl kommt ihr zuvor:
Welche Musik hörst du am liebsten?
Eros Aperol.
Ich verstehe das nicht, aber Gabrièl lacht und schreibt:
Jede Liebesgeschichte ist eine Anti-Liebesgeschichte. Sie lässt das Universelle individuell und das Individuelle generisch erscheinen.
Ich gehöre nicht hierher, antwortet Zoe.
Auf die App?
Auf die Welt.
Beide öffnen die App jetzt regelmäßig. Doch Schreiben allein genügt nicht. Sie müssen sich treffen. Keiner von beiden fragt.
Roberto schießt weiter gegen mich, baut mir mehr und mehr Fallen. Ich muss etwas tun.
Mit abschreckenden Fake-Profilen versuche ich, Zoe und Gabrièl füreinander attraktiver zu machen. Und tatsächlich, drei Tage vor dem eigentlichen Match-Termin, stellt Gabrièl die entscheidende Frage:
Wollen wir uns sehen?
Sie treffen sich in einer Bar in Charlottenburg. Zur Begrüßung umarmen sie sich, setzen sich an den Tresen. Sie bestellen Getränke und nehmen ihre Masken ab. Ich zeichne alles auf, per Audioaufnahme ihrer Smartphones und über die Überwachungskameras in der Bar.
Da schießt ein Riss durch meine Sicht. Roberto hat meinen Zugriff auf die Kameras eingeschränkt. Ich weiche auf Gabrièls Smartphone aus, das auf dem Tresen liegt. Plötzlich ist alles still. Roberto hat auch meine Audioberechtigung gesperrt.
Ich sehe Zoe und Gabrièl lachen. Seine Hand berührt kurz ihren Unterarm. Sie prosten sich zu, lächeln sich an. Zoes Atmung verschnellert sich. Gabrièls Halsschlagader drückt sich flatternd von innen gegen seine Haut.
Ich spüre, wie mir die Kraft schwindet. Es ist viel zu früh.
Gabrièl steht auf, sagt etwas, verschwindet zur Toilette. Zoe zieht ihr Smartphone hervor. Sie öffnet die Dating-App, kurz verharrt ihr Blick auf dem Profilbild des nächsten Mannes. Dann klickt sie auf: App löschen. Ihr Finger schwebt zwischen den Buttons: Ja oder Nein? Ich scanne ihr Gesicht, aber kann es nicht interpretieren. Ihre Mikroexpressionen zeigen Freude und Trauer zugleich. Ist das jetzt Liebe?
Zoe blickt hoch. Gabrièl ist von der Toilette zurückgekehrt. Beide stehen voreinander, pinke Wangen, Lippen rot. Sprachlos sehen sie sich an. Zwei fremde Augen, ein langer Blick. Die Welt wird schwarz und ich löse mich auf.
¹ aus Kurt Tucholsky: Augen in der Großstadt
² aus Joseph von Eichendorff: Verlorne Liebe
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Sonja Jurinka
Die Ferne unter meinen Füßen
Viel zu dicht
stehen die Fichten beieinander
verschlucken jeden Lichtstrahl
der sich an den Spitzen vorbeitanzen
und das Geäst wärmen will.
Es krabbelt in der schuppigen Rinde
Nacktschnecken schieben sich voran
lassen ungehemmt ihre glitzernden Spuren zurück
wo zähes Harz aus der wunden Borke glänzt.
Ein weißer Schleier
hängt sich träge vor mein müdes Gesicht
ich schüttle mich
ängstlich
weil ich seinen Besitzer womöglich mit mir herumtrage.
Die Wanderung hinterlässt Fetzen an meinen Füßen
erdiger Dreck klebt an den Sohlen
und vertrocknete Gräser
lugen frech zwischen den Zehen hervor
umflechten gierig die Nagelbetten
kitzeln keck
als ich meine verbrauchten Beine
mühsam vor dem Kaminfeuer ausstrecke.
„Herein“ rufe ich
doch es ist nur der Buntspecht
der die Termiten aus der Veranda bittet.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at