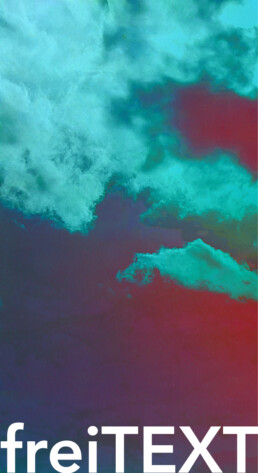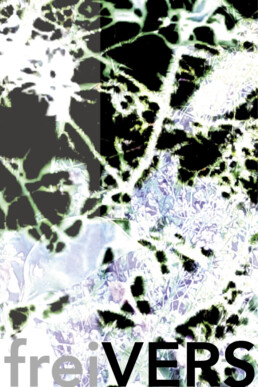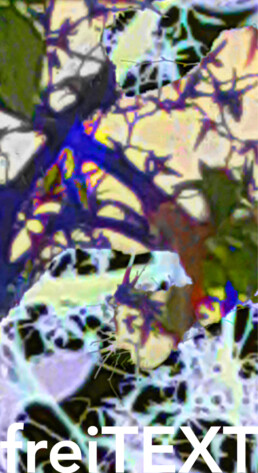freiTEXT | Leonie Höckbert
Junimond
Janni träumt von der perfekten Trennung. Sie träumt davon, dass alles ganz unkompliziert sein kann. Wie in Filmen und Serien. Wo Paare, die jahrelang zusammen waren, sich einfach eines Abends an den Küchentisch setzen können und sagen können: Das war’s. Und dann geht einer von beiden und die andere bleibt am Küchentisch zurück und gießt sich ein Glas Wein ein und trinkt es nachdenklich, aber nicht unbedingt todtraurig, aus. In manchen Filmen, besonders in französischen, findet Janni, besprechen die in Trennung befindlichen Paare sogar ganz am Ende noch ganz Wesentliches, sagen dem Anderen nochmal ein paar ernste Worte über die Persönlichkeit oder das Verhalten oder das Leben und Beziehungen im Allgemeinen und dann entsteht daraus gar kein Streit oder tiefe Verletzung und Beleidigung, sondern ein wertschätzender Austausch, an dessen Ende sich die Trennung wie der ganz richtige Schritt für beide anfühlt. So soll das für Janni sein. Ohne Tränen. Wenigstens, bis die Szene im Film vorbei ist. Sie sehnt sich nach dem Moment nüchterner Klarheit, in dem beide Parteien zugleich erkennen: Aus uns wird nichts mehr. Wir sollten nachts kein Bett mehr teilen. Wir sollten morgens keinen Kaffee mehr füreinander machen. Die Formulierung eine Szene machen erscheint Janni sinnlos. Eine Szene nach ihren Vorstellungen wäre gerade das Gegenteil von dem, was gemeint ist.
Ihre Trennungsgeschichte hat in der fünften Klasse angefangen und ihre Standards gleich zu Beginn hoch angesetzt. Jonas aus der Parallelklasse hatte ihr in der großen Pause ein KitKat Chunky White gekauft. In der nächsten großen Pause hatten sie Händchen gehalten und sich nach der Schule darauf geeinigt, miteinander zu gehen. Ungefähr drei Wochen lang hatten sie Händchen gehalten und Schokoriegel geteilt, bis Jonas nach der Schule sagte, er wolle nicht mehr zusammen sein. Seine Freunde fänden, sie sollten sich küssen, aber er habe keine Lust da drauf. Janni hatte auch eigentlich keine Lust da drauf und genug Taschengeld, um sich selbst KitKat zu kaufen. Sie sagte okay, wir machen Schluss, und Jonas rannte zu seinen Freunden und mit ihnen zum Bus. Statt Enttäuschung hatte Janni eine gewisse Erleichterung gefühlt.
Eine Beziehung überhaupt anzufangen, ist die entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Trennung, deswegen sucht Janni immer wieder auf Dating-Plattformen nach Männern, von denen sie sich trennen kann. Jannis erste Beziehung im Studium ging zwei Jahre lang und als sie sich trennte, war es furchtbar, voller Tränen und Vorwürfe, Gemeinheiten und Selbsterniedrigung. Danach nahm sie sich vor, zu üben.
Sie betrachtet sich selbst auch als eine Art Trainingseinheit für ihre Kurzzeitpartner. Wie ein Kurs im Fitnessstudio oder bei der Volkshochschule. Wer mit ihr fertig ist, oder besser – mit wem sie fertig ist, der kann sich als weitergebildet betrachten und ist dementsprechend gewappnet für die nächste Beziehung. Dass eine Beziehung bestenfalls nicht vom Ende her anfängt, kommt Janni nicht in den Sinn. Heiraten ist für sie nur der Auftakt zu einer Trennung mit mehr Schritten.
Sie probiert verschiedene Methoden aus. Eine Trennung über Textnachricht kommt ihr zwar nicht so moralisch verworfen vor wie immer behauptet, ist aber auch nur die Fälschung des Gefühls, nach dem sie sucht. Sie hat es probiert und obwohl das für sie ruhig und überlegt abgelaufen ist, fehlt ihr die Perspektive des Verlassenen, der natürlich trotzdem völlig verzweifelt sein könnte. Die Trennung muss im Gespräch passieren. Am besten spontan, nicht von langer Hand geplant. Aus einem Impuls heraus, der den Partner auch ganz plötzlich erkennen lässt, dass sie wirklich nicht zusammenpassen. In einem nachlässig im Schlafzimmer versteckten Notizbuch dokumentiert Janni ihre Versuche. Es liegen immer einige Monate oder wenigstens Wochen zwischen den einzelnen Einträgen, um überhaupt einen gewissen Spannungsaufbau für die Trennungsübung sicherstellen zu können. Trotzdem sind zwei Versuche mit der etwas peinlichen Notiz versehen, dass die Internetbekanntschaft, der Janni die Trennung unterbreitete, bei diesem Anlass überhaupt das erste Mal davon gehört hat, dass sie zusammen gewesen wären.
In inzwischen einigen aktiven Jahren Forschung und Proben brachte sie es auf ungefähr zwölf ernstzunehmende Datensätze. Davon war genau eine Trennung auch nur in die Nähe einer soliden Filmszene gekommen. Da waren sie zu zweit nach sechs Monaten regelmäßiger Treffen in einem gerade aufblühenden Sommer in den Park gegangen und hatten so lange schweigend auf einer Parkbank gesessen, dass unumstößlich klar geworden war, dass alle weiteren Treffen drückende Stille wären, sie hatten sich nach sechs Monaten einfach nichts Neues mehr zu sagen. Er sagte, es wäre nicht unangenehm, mit ihr zu schweigen, aber er würde dabei auch nichts Besonderes fühlen. Janni bestätigte. Sie nahmen sich an der Hand und schwiegen noch, bis es dämmerte. Danke, dass du es angesprochen hast, sagte Janni, bevor sie in verschiedene Richtungen aufbrachen. Danke, dass du keine Szene gemacht hast, sagte der Mann, der in sechs Monaten anscheinend gar nichts über Janni gelernt hatte.
Einer ihrer Partner hat gefleht, sie solle ihn nicht verlassen. Drei haben sich von ihr getrennt, bevor sie ihre letzten Worte gut sortiert hatte. Zwei haben sie nach einigen Monaten geghosted und so ein auf andere Art besonders unbefriedigendes Ende geschaffen. Einem Mann hat sie zuvor von ihrer Sehnsucht nach der perfekten Trennung erzählt und als sie es dann versucht hat, hat er sich an das Gespräch erinnert und ist zynisch geworden. Die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht, die Orte sind falsch oder die Dinge, die gesagt werden, unpassend; das Gefühl von entromantisierender Ernüchterung ergibt sich nicht, wird oft überschattet von Jannis Erleichterung, eine ihr längst unbequem gewordene Übungsbeziehung endlich ihrem Zweck zuführen zu können. Viel zu oft wurde geweint. Das ist besonders falsch, dieser Schmerzausdruck, der eine unmittelbare Schuldzuweisung enthält. Wer sich gegenseitig nichts vorhält, sollte nicht heulen, findet Janni.
Auf der Arbeit klickt sie sich den ganzen Tag durch Excel-Tabellen. Neben ihr auf dem Schreibtisch liegt ihr Handy, stummgeschaltet, und leuchtet immer wieder auf, wenn sie eine Nachricht von Tinder oder Bumble bekommt. In der Phase nach einer Trennung wirft sie Netze in alle Richtungen aus, unterhält vier, fünf Konversationen parallel. Erst seit ein paar Wochen arbeitet sie in der Datenanalyse, es ist ihr erster Vollzeitjob, sie lernt viel für ihre eigenen Daten und notiert sich oft Analyseverfahren für den Privatgebrauch. Der Job ist ruhig genug, um nebenher fast identische Nachrichten an mehrere potentielle Trennungsübungspartner zu schicken.
Als der Chef sie Montag morgens ins Büro ruft, ist es das erste Mal, dass Janni den Raum wieder betritt seit ihrem Bewerbungsgespräch. Der Chef bietet ihr einen Kaffee an und einen der Stühle am Schreibtisch, keinen der gemütlichen Sessel in der Ecke. Als der Kaffee vor ihr steht, vor ihm nur ein Espresso, klappt er seinen Laptop zu und sagt, er wolle nicht drumherum reden. Ob sie sich bei ihnen in der Firma wohlfühle? Janni nickte, etwas überrascht von der Frage. „Wir haben nicht den Eindruck“, sagt der Chef und nippt am Espresso. „Sie bringen sich wenig ein und scheinen Schwierigkeiten mit dem Teamgeist unserer Einrichtung zu haben.“ Wer ist eigentlich „wir“, denkt Janni, während sie nichts sagt. „Leider muss ich ihnen mitteilen, dass wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Stellen in ihrem Arbeitsbereich einsparen müssen. Das bedeutet, dass wir uns von Ihnen verabschieden müssen, so leid es mir tut.“ Er trinkt seinen Espresso in einem Zug leer. „Können Sie das nachvollziehen?“ „Ja“, sagt Janni, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Sie sind noch in der Probezeit. Daher gilt ihre Kündigung fristlos. Ich möchte Sie bitten, ihren Platz aufzuräumen.“ Er steht auf und reicht ihr die Hand. „Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Weg.“
Janni lässt ihren Kaffee unberührt stehen und geht zurück zu ihrem Platz, wo ihre letzte Aufgabe noch auf dem Bildschirm offen ist. Es dauert nur wenige Minuten, ihr Handy, ihren Thermosbecher und ihre wenigen anderen privaten Gegenstände in ihre Tasche zu packen und alle privaten Daten vom Rechner zu löschen. Ihre Kollegen scheinen in Mittagspause zu sein, jedenfalls nickt Janni auf dem Weg raus nur der Empfangsdame zu, die als einzige auf ihrem Platz sitzt. Es ist alles ganz unkompliziert. Die perfekte Trennung, denkt sie anerkennend. Und wartet mit den Tränen, bis sie auf der Straße steht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Stefanie Adamitz
flugversuche. eine utopie.
in jeder wohnung wackeln blätterschatten
rauschen blätterzucken
zappeln kleine schattenkinder
sprühen chancen, setzen samen
wuchern üppig feuchte zonen
decken sanft mit licht
was noch nicht
in jeder wohnung wohnt ein komposthaufen
nahrhaft prall und weit und breit
gefüllt mit euren sanften blicken
und tiere atmen schlafes wind
der eine trägt. wohin?
in jeder wohnung wächst ein pflanzenkeim
keimt jeden tag ein neues sein
kein reim,
eine braucht nur sein.
sein weichstes und innerstes
ein pelz aus dir
in jeder wohnung traut eine sich jetzt
ICH zu sagen
das ist deine stimme:
ich bin in jeder wohnung
ich bin ein wort, das dir gefällt
das du sagst und dann im hall
schnallst du seine flügel an
aus jeder wohnung starten flugversuche
wachsen schanzen wacklig in den wind
jedes haus ein igel mit gespreizten stacheln
worte schallen, treiben auf
flieg hoch hinaus und
nimm mich mit
ich bin ein wort im zappelnden wind
im blätternen rauschen
bin ich schatten und licht
bin ich keim und kompost
bin ich zappeln und wind
in jeder wohnung wackel ich blätterschatten
rausche zuckend
und zappel kleine schattenkinder
bin der pelz, der um dich liegt
und dein schatten,
vor dem du dich erschreckst
und lachst
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sonja Kittel
Approximation
Sie sitzt mit angezogenen Knien auf einem Stuhl und wartet. Der Hund hat sich am Boden eingerollt und schließt sich dem Warten an. Zwei Feuerkäfer krabbeln an seiner Schnauze vorbei. Einen Moment bleibt sie noch sitzen, hofft, dass doch ein Einfall kommt, ein Anfang. Stattdessen tippt sie etwas in die Suchmaschine, verliert sich in den Nachrichten des Tages. Bald klappt sie den Laptop zu, geht ins Haus und beginnt die Abendroutine. Nicht verhasst, nicht einmal unangenehm, nur Routine, die sie ein weiteres Mal nicht durchbrechen kann.
Markus lief die Treppe hinunter und raus aus der Tür. Er drehte sich nicht um, blieb nicht stehen, wurde nicht langsamer. Er hatte sich viel vorgenommen für diesen Abend. Schon am Anfang der Woche hatte er begonnen sich vorzustellen, wie es ablaufen würde. War Dialoge in seinem Kopf durchgegangen und Musik, die sie hören würden, hatte die Begrüßung in verschiedenen Varianten durchgespielt. Ein Händedruck oder eine Umarmung, die ein bisschen zu lang dauert.
Die ersten Sätze sind geschafft. Der erste Absatz fertig. Plötzlich ist er aus ihrem Kopf gepurzelt. Weitere fügen sich unaufgefordert hinzu. Sie hat eine vage Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Es fühlt sich nicht euphorisierend an. Es ist kein Flow. Viel mehr ermahnt sie das Trommeln und Schnaufen der Waschmaschine, dass sie bald geleert werden will.
Markus hatte Robert vor zwanzig Jahren kennengelernt. In einer Vorlesung über „Approximation“. Sie hatten begonnen sich kleine Zahlenrätsel zu stellen. Markus hatte das Papierkügelchen-hin-und-her-schieben an seine Schulzeit erinnert und die Vorlesung war fast zu schnell vorbei gewesen. Sie hatten sich in die Mensa gesetzt und gemeinsam Mittag gegessen – Kohlrabicremesuppe, Lasagne, Erdbeerkuchen – gefolgt von stundenlangem Austausch über gute und schlechte Entscheidungen im Leben. Dieser Tag war der Anfang einer Freundschaft gewesen, die sie durch das Mathematikstudium trug.
Fast eine Woche hat sie nichts geschrieben. Jetzt legt sie dem Hund das Geschirr an und geht mit ihm raus. Durch den Wald, an der Kletterwand vorbei, die heute einsam da steht, und weiter bis zur kleinen Kapelle. Dort setzt sie sich auf eine Bank. Der Hund bleibt stehen und hechelt. Die Schwarzkiefern knacksen und krachen unter der Hitze des Sommertags. Sie wollte immer schreiben. Es ist das, was ihr am meisten Spaß macht. Es ist das eine Kontinuum, das sich durch ihr Leben zieht. Sie zwingt sich, an den Text zu denken.
Sie wohnten zusammen, sie radelten zusammen, sie reisten gemeinsam nach Andalusien und wanderten durch die Sierra Nevada. Sie betranken sich am Ende jeder missglückten Beziehung und stießen auf jede neue Liebe an. Sie gingen auf Tocotronic-Konzerte, brüllten „Hi Freaks“ in die Nacht hinaus und dann war plötzlich alles vorbei. Der Abschluss des Studiums riss ihre Welt auseinander und teilte sie in zwei neue, deren Umlaufbahnen einander nicht tangierten. Robert zog nach Zürich, wo er als Doktorand an der Technischen Hochschule forschte. Markus entschied sich fürs Lehrerdasein, lange Sommerferien und geregelte Tage. Am Anfang telefonierten sie noch ab und zu, dann begann die Verbindung immer loser zu werden, bis sie irgendwann riss.
Sie hat ihr Notizbuch herausgenommen und schreibt schnell ihre Gedanken auf. Lange waren die Seiten leer geblieben. Sie jetzt mit Buchstaben, Worten, Sätzen zu füllen macht sie glücklich. Sie streichelt dem Hund über den Kopf, steckt das Büchlein ein und geht weiter. Ein leichter Wind kommt auf. Die Luft knistert. Der Hund beginnt zu zittern. Er spürt das nahende Gewitter. Erst im Alter hat er begonnen Angst davor zu haben. Heute dreht er hechelnd und zitternd seine Runden, wenn der erste Donner grollt. Sie geht schneller, läuft schon fast. Als sie das Gartentor öffnet, landen die ersten Regentropfen. Sie setzt sich auf den Teppich und krault den Hund. Sie klappt den Laptop auf und schreibt.
Acht Jahre hatten sie nichts voneinander gehört. Dann war da diese Feier. Das Geburtstagsfest einer gemeinsamen Freundin. Markus wollte gar nicht hingehen, hatte sich aber nach zwei einsamen Bier auf seinem Balkon doch einen Ruck gegeben. Als er den Garten des Heurigen betrat, berührte ihn die Szenerie. Bunte Lampions erhellten die gerade eintreffende Nacht. Die Gäste saßen dicht nebeneinander auf den Bänken, Weingläser, Zigaretten, Gesten zwischen den Händen. Es spielte ein Lied, das er einmal geliebt hatte, und er quetschte sich zwischen die feiernden Körper und ließ sich mitreißen in eine längst vergessen geglaubte Vergangenheit. Dann sah er ihn. Robert saß zwischen zwei ehemaligen Kommilitoninnen und lachte. Ein Lachen, das er so oft gehört hatte, dass es ihm zu einer zweiten Heimat geworden war. Jetzt verursachte es ein brennendes Ziehen zwischen seinen Rippen.
Sein erster Impuls war, sich zu ducken, zwischen den Tischen und Bänken hindurch zu krabbeln, unbemerkt zu entkommen. Doch schon hatte Robert ihn entdeckt, stand auf und ging zu ihm rüber. Er nahm ihn in den Arm, zog ihn neben sich auf die Bank. Er war vor ein paar Tagen nach Wien gekommen. Hatte gehofft, Markus hier zu treffen. Die anfängliche Befangenheit wich schnell dem intensiven Gespräch, das sie von Anfang an verbunden hatte. Die Bänke leerten sich, doch Markus bemerkte es nicht, weil er fokussiert war auf einen Menschen, den er so lange nicht mehr gesehen hatte und der ihm trotzdem sofort nah war, näher als zuvor.
Sie öffnet ihr E-Mail-Programm und ordnet Mails in verschiedene To-Do-Ordner. Neben sich sieht sie den Stapel Briefe liegen, der darauf wartet bearbeitet zu werden. Sie öffnet einen nach dem anderen. Der Hund legt sich brummend auf die Seite und streckt sich. Als sie nichts mehr davon abhalten kann, wendet sie sich wieder dem Bildschirm zu und schreibt.
Markus und Robert redeten die ganze Nacht. Sie schlossen nahtlos an das an, was sie gehabt hatten. Gute und schlechte Entscheidungen in ihrem Leben, Zahlenrätsel, „Hi Freaks“. Als sie auseinandergingen, war trotzdem alles anders. Markus konnte nicht aufhören, an Robert zu denken. Alles in ihm zog auseinander. Er wollte zurück in diese Nacht, zurück an die Seite von Robert, zurück in das Gespräch.
Markus lag auf der Couch und starrte sein Handy an. Wartete auf eine Nachricht, verzehrte sich nach einer Nachricht. Doch es kam nichts. Er schaltete den Fernseher an. Zappte von Programm zu Programm. Schaute wieder aufs Handy. Nichts. Er tippte ein paar Worte in sein Telefon, löschte sie wieder. Er schloss die Augen, versuchte, zu verstehen, was passiert war. Dann schrieb er doch eine Nachricht: „Hey, war schön gestern. Wie lang bist du noch da?“ Erst ein Häkchen, dann zwei, dann blau. Keine Antwort. Markus wurde wütend. Er schaltete das Handy aus und ging unruhig in seiner Wohnung hin und her. Aus seinem Verlangen wurde Zorn. Er hasste Robert. Er hasste ihn dafür, dass er damals weggegangen war. Er hasste seine Forschungsambitionen, sein Fernweh, sein Lachen.
Als er abends das Handy wieder einschaltete, war die Antwort da. „Ja, war schön. Bin noch bis Ende der Woche da. Komm doch Freitag vorbei. Ich koche was.“ Die Wut war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war. Seine Finger kribbelten, sein Gaumen kitzelte. Markus biss sich auf die Zunge, um dem ein Ende zu setzen, das er sich nicht erklären wollte. Er zwang sich dazu, nicht gleich zurückzuschreiben. Fünf Minuten später machte er es doch. Er käme gerne. Er freue sich. Er setzte sich an den kleinen Tisch auf seinem Balkon, rauchte eine Zigarette und begann sich vorzustellen, wie es ablaufen würde.
Der Hund kratzt an der Tür. Sie lässt ihn in den Garten, setzt sich gleich wieder an ihren Text. Die Push-Nachrichten auf ihrem Handy hat sie deaktiviert, später das Handy ganz abgeschaltet. Sie tut es endlich. Sie schreibt einen Text, sie hält eine Deadline ein. Sie weiß jetzt, dass sie es schaffen wird.
Die Tage vergingen zu langsam und viel zu schnell. Am Freitag machte Markus dann alles so, wie er es schon so viele Male in seinem Kopf durchgegangen war. Nach der Arbeit eine Runde laufen, duschen, das hellblaue Hemd mit Rundkragen. Ein Glas Wein für die Nerven. Er setzte sich in die Straßenbahn, lehnte den Kopf an die Scheibe und betrachtete die Menschen draußen. Bei Robert angekommen klingelte er, öffnete die Tür, als das Surren erklang, und stieg die Treppen hinauf. Mit jeder Stufe schlug sein Herz schneller.
Die Tür stand offen. Robert rief ihm aus der Küche zu, er solle es sich schon mal bequem machen. Das Essen – Kohlrabicremesuppe, Lasagne, Erdbeerkuchen – begleiteten Gespräche über Roberts Forschungsprojekte und Markus‘ Alltag als Lehrer. Markus bat Robert um ein bisschen Musik. Er schaltete das Radio ein. Sie gingen auf den Balkon eine rauchen, schauten auf die gegenüberliegende Hauswand, konnten das Gespräch zum ersten Mal nicht am Laufen halten. Markus ging ins Badezimmer und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er schaute sein Spiegelbild an und versuchte, ihm und sich Mut zu machen.
Als er aus dem Badezimmer trat, stand Robert vor ihm. Er hatte Markus Jacke in der Hand. Er wolle ihn nicht rausschmeißen, aber morgen müsse er früh raus. Der Rückflug nach Zürich, vorher das Apartment räumen. Markus nahm seine Jacke wie in Trance. Er zog seine Schuhe an, öffnete die Tür und stand schon auf dem Gang, als Robert ihn nochmal zurückzog. Einen kurzen Moment zögerten beide und schauten sich an. Dann drückten sie sich kurz. Schön war es gewesen, ihn wieder zu sehen, und er solle doch ab und zu etwas von sich hören lassen. Markus lief die Treppe hinunter und raus aus der Tür. Er drehte sich nicht um, blieb nicht stehen, wurde nicht langsamer.
Sie klappt den Laptop zu, es ist geschafft. Für heute hatte sie sich die Deadline gesetzt. Entweder du schreibst diese Geschichte fertig, oder du vergräbst deinen Traum in einem tiefen Loch und holst ihn nie wieder hervor. Am Abend wird sie ihren Geburtstag feiern. Sie hat viele Menschen eingeladen, einige davon hat sie schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Als sie den Garten des Heurigen betritt, berührt sie die Szenerie. Bunte Lampions erhellen die gerade eintreffende Nacht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Eline Menke
Warte nicht
bis die Tage wie Türen an
unsere Sprache schlagen.
Im Zugwind fällt mein
Wort ins Schloss.
Du hast die Fenster des
Schweigens geöffnet,
scheuchst Erinnerung wie
einen Dieb aus dem Haus.
Er lässt seine Beute
unter dem Birnbaum
fallen, ich lese sie mit
dem Fallobst auf.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Susanne Schmalwieser
du kadaver wolltest zuckerbäcker werden
mein grosser vorsatz wäre
nicht wie eine verrückte dir zu verfallen
er ist schon immer gewesen nicht verrückt zu sein wie das blutgetriebene muttertier
einen anzug tragen und ein paar stunden lang vergessen dass die haut darunter sich ablöst dass ich ein reptil bin wenn man mich
(nur als solches behandelt)
als ein solches klassifizierbar macht
ich also zerlegbar bin in meine einzelteile du also zerlegbar bist in deine einzelteile
dass dort drüben sie dir gerade
vielleicht ja einen zahn ausschlagen oder das blut ausschlagen den schädelknochen anhand der zu erwartenden bruchlinien spalten ohne die friedliche sorgfalt des sezierbestecks und dass du schreist wie eine schlachtsau
wir sind verschiedener mütter oder bloss weil einmal ein paar menschen mit dem geodreick und der landkarte ein spiel überlegt haben jetzt durcheinander jetzt verschieden
meine heimat der abdruck eines whiskeyglases im atlas
deine ausgebrannt ein historienort ein zigarrenfleck
kein fensterglas mehr in den häusern die jetzt mit vielen dunklen augen starren wo sie kein blick mehr fasst
es ist die flugzeugstille und du mir wie in irgendeinem traum dahingerafft
oder vor mir ausgerollt wie strudelteig
irgendein gratis wlan erkenne ich wieder und in deiner wohnung ist mir alles fremd geblieben
ein stempel im reisepass ein paar digitalisate unserer polaroidbilder ein kochrezept das mir nie recht gelingen will
natürlich hat der vater recht behalten dass ich einen ganzen menschen nicht besitzen kann
kölsches schokolademuseum und die reisegruppen die sich mir in den bauch stossen
machete im glassturz
(interaktiver creative space)
als ob wir erleben um es auszustellen
oder als knochensammlung ausgestellt zu werden
grabbeigaben oder auf der flucht noch hastig
nach dem handy gegriffen, ein paar münzen und dem
hochzeitsfoto der grosseltern
historische einblicke eine multimedia
experience du hast noch versucht anzurufen
anzurufen als man dich analogisiert
(zu staub oder in alle deine pixel zerfallen)
ist ja normal dass ich dich noch etwas hin und her spüle wie mundwasser zu weit hineingerutscht zu spät dich auszuwürgen
heimlichmanöver
kein wunder dass mir oder wem du mehr gewesen bist schaudert vor dem leeren sarg dieser schreckensfantasie
und weil du erdnüsse nicht verträgst hab ich schon manchmal viel abstrakter gefürchtet dass du sterben musst
diese mayaschen 5 tage nach dem ende aller monate
sogar die zeit ist also erfunden worden
analytisch betrachtet gibt es nichts
bis auf das ende einer prophezeiung
aztekische schattengestalt auf rot, in der hand eine kakaofrucht vor saftigkeit beinahe berstend
historisch gesehen gibt es uns alle immer wieder
du kadaver wolltest zuckerbäcker werden
ich in der schokoladenfabrik gedenke deiner hülle in eine fahne gewickelt von ein paar engerlingen kompostiert vermutlich irgendwann
einer aussaat zugestreut, vielleicht einem weizenfeld,
vielleicht nach noch ein zwei metamorphosen einer zuckerrübe oder einer theobroma
(einem gott dich über dem nachtisch zu zermalmen)
ich will alles nur nicht ein letztes mal so tun als wäre es mir peinlich
wenn du mich mit der hand am oberarm nimmst und in eine richtung drängst bloss nicht überlegen müssen wann unser letzter streit und ob mein letztes wort an dich zu streng gewesen ist nicht jedes wort bereuen
das ich an dich verschwendet habe wo ich doch einfach hätte sagen
wie schön du mir bist oder schweigen können
ich stell mir deine tagträume vor
du hast eine liste gemacht mit wünschen für die kremierung
stell dir vor der himmel bräche später
und was du tätest mit einem letzten tag in deiner alten welt
stelle vor der himmel bräche nie
ein blechschiff voll augen mich in der trauer zu bestaunen
oder gaffend in diesem gefühlszwischenraum
der sich meistens auftut wenn du leben musst
oder noch leben darfst
und die jännerkälte in spitzen vektoren auf dich zufährt, die spitzen unters fleisch fährt
ein land vor dem ofen erdacht unter frostbeulen geschaffen worden;
als ob wir nicht nach dem minutenlangenkreisen auf der weltuhr
(einmal mit den körpern)
etwas neues zu erzählen vermögen
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Nasima Razizadeh
Flucht in den Flieder
Es bebt der Baum von
zwei kleinen Körpern,
im Flieder zueinander geflohen,
die Welt in der Schale fällt zu Boden,
liegt reglos nah des Stamms und
oben, hoch oben, huschen
hinauf, hinterher, hinaus,
von Zweig zu Zweig, bis an die äußersten Zweigspitzen,
zwei kleine Körper,
meinen Händen gleich.
Meinen Händen gleich
fürchten sie nicht die Luft,
nicht das Beben,
nicht die Regung,
meinen Händen gleich
reizen sie die Zweige,
rufen sie die Zweige
fort von dem Schalen, den
Schalen des Samens, der den Stamm
nicht hinauf kann, der den Flüchtigen, den
spitzohrigen Obrigkeiten,
nicht zu folgen vermag, der es
nicht aus der Schale schafft,
einhäusig da liegt,
einsilbig das eigene Wachsen darlegt,
dem Verstand gleich
nicht hinaus kommt, nie hinaus.
Zwei kleine Körper raufen,
brechen im Spiel den Friedensfluch des Flieders,
draußen bebt ein Baum,
wie nur ein Baum beben kann
Für R.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anette Violet
Der Würfel
Ich kann nicht sagen, wann es anfing. Vermutlich noch früher, als ich denke. Ich erinnere mich, dass ich schon vor Jahren eine, vor allem körperliche, Unruhe spürte, die ich durch nichts in den Griff bekam, weder durch Sport, noch durch das Verbannen elektronischer Geräte aus dem Schlafzimmer, noch dadurch, dass ich schließlich mit Kaffeetrinken aufhörte. Meine Frau begann immer häufiger, mich anzuschauen, als würde sie mich gar nicht kennen und wir zogen in unterschiedliche Zimmer – diejenigen in der Wohnung, die am weitesten voneinander entfernt lagen.
Lange verstand ich nicht, was los war. Ich ging weiter ins Büro. Ich kaufte weiter ein, was auf der Liste stand, und abends las ich den Kindern vor, bis es Zeit war, das Licht zu löschen. Zunächst verwechselte ich den Ton. Wir wohnten in einem großen Komplex mit 84 Parteien. In jedem Zimmer jeder der 84 Parteien befand sich ein Rauchmelder an der Decke. Die Batterien der Geräte gingen schneller leer, als auf den Verpackungen prognostiziert, was das Gerät mit einem lauten Piepen alle 60 Sekunden anzeigte. Weil regelmäßig Bewohner des Komplexes verreist waren, piepten die Rauchmelder in den leeren Wohnungen vor sich hin, ohne dass sich jemand darum kümmerte. Die Hinterhöfe waren voll von nahem und fernem Piepen. Wie rote, eckige Flecken tauchten die Töne am Himmel auf und verschwanden wieder, kurz, klar und prägnant.
Am Anfang, kurz nachdem die Melder eingebaut worden waren, brachte mich das fast um den Verstand. Mehrfach alarmierte ich die Hausverwaltung, einmal sogar die Polizei, um zu bewirken, dass die Mieter ausfindig gemacht und die Batterien gewechselt wurden. Aufgrund der Anzahl der Rauchmelder war dies ein hoffnungsloses Unterfangen, und irgendwann hatte ich mich an das bipp... bipp... gewöhnt und schenkte ihm keine Beachtung mehr.
Erst als ich begann, es auch außerhalb des Wohnkomplexes wahrzunehmen, fing ich an zu begreifen, dass nicht nur die Rauchmelder piepten. Immer wieder hörte ich einen roten, eckigen Ton. Im Supermarkt vor dem Konservenregal – was angehen konnte, auch hier hingen Rauchmelder an den Decken. In einem Aufzug – schon unwahrscheinlicher, es sei denn, der Melder war hinter der Metallverkleidung verborgen. Im Park inmitten von Bäumen und Büschen und unter Wasser in einem See. Langsam verstand ich: dieses Piepen kam nicht von außen. Es war in meinem Kopf. Nur ich konnte es hören.
Ich realisierte, dass der Ton sich veränderte, je nachdem, wo ich mich befand. Fuhr ich mit dem Rad ins Büro, wurde er erst lauter und schwoll dann wieder ab. Am Stadtrand war er kaum zu hören. Ich wollte ihn nun nicht mehr loswerden. Ich hegte und pflegte ihn, ich wartete auf ihn und war beruhigt, wenn er erklang, so wie andere dadurch beruhigt werden, dass sie ein volles Konto oder ein Haus besitzen – ich hatte stattdessen meinen Ton.
Nicht nur seine Lautstärke, auch der Klang veränderte sich. Er war nicht mehr so klar, seine Kanten zerfledderten; auch wurde er dumpfer, als verschwände er in einem Tunnel. Eines Nachts wachte ich von ihm auf. Er klang jetzt quietschend, rostig und knirschend, was mich in Panik versetzte, so dass ich beschloss, mich zu erheben und auf die Suche nach einem Ort zu machen, an dem seine Kanten wieder scharf wären.
Ich zog einen alten, löchrigen Pullover an und eine abgerissene Jeans, selbst erstaunt über die Wahl der Garderobe. Auf dem Weg zur Wohnungstür blieb ich vor dem Zimmer meiner Frau stehen. Ich klopfte nicht; in Wirklichkeit war sie schon lange nicht mehr meine Frau, wir hatten uns seit Monaten nicht mehr gesehen. Als ich am Zimmer der Kinder vorbeikam, ging ich hinein. Sie waren viel älter, als ich sie in Erinnerung hatte. Das Mädchen war kein Mädchen mehr, der Junge trug Flaum auf der Oberlippe. Ohne sie zu wecken schloss ich die Tür und stahl mich die Treppen hinunter, ängstlich auf das rostige Knirschen hörend, das sich wie eine Raupe durch meinen Kopf wand.
Draußen war es kühl. Ich stieg aufs Fahrrad und fuhr Richtung Zentrum; das Knirschen leitete mich. Und tatsächlich, je weiter ich fuhr, desto klarer und regelmäßiger wurde der Ton, bis er wieder rot und eckig war. Ich fuhr weiter bis zum Einkaufscenter, wo ich das Fahrrad vor einem Automaten abstellte. Der Ton in meinem Kopf war nun nicht mehr angenehm. Er wollte hinaus, das spürte ich. Meine Stirn schmerzte schrecklich, und als ich hinfasste, ertastete ich, dass sich etwas Scharfkantiges darauf abzeichnete und mit Macht nach außen drang. Gerade noch rechtzeitig öffnete ich eine Hand, um den Würfel, der aus meinem Kopf fiel, aufzufangen, einen roten Spielwürfel mit aus Punkten gebildeten Zahlen von eins bis sechs. Im Licht der aufgehenden Sonne, die mir im Rücken stand, betrachtete ich ihn. Selten hatte ich etwas so Schönes, Sinnvolles gesehen. Dann schob ich ihn in die in der Maschine dafür vorgesehene Öffnung. Es klapperte, und aus einem Schlitz kam ein Zettel. Ich fühlte mich befreit, weil das Piepen nicht mehr da war, und zog ihn heraus.
Erst zögerte ich, aber der Drang, zu wissen, was darauf stand, war groß und schließlich faltete ich ihn auf. Er war leer. Es war einfach ein Stück Papier – vorne und hinten nichts als Weiß. Darüber durchströmte mich große Erleichterung, jeder Satz, jedes Wort hätte schwer gewogen. Ich wendete mich vom Automaten ab und ging Richtung S-Bahn-Trasse. Das Rad ließ ich stehen, ich brauchte es nicht mehr. In den Bögen, über denen die Gleise verliefen, hatten Obdachlose Zelte aufgebaut, deren Farben im flachen, rötlichen Licht der Sonne leuchteten, und es standen Einkaufswagen mit Kleidungsstücken und Tüten herum. Eine Weile lang betrachtete ich sie. So war das also. Ich näherte mich einem der Zelte und öffnete den Reißverschluss. Bis auf eine Matte und einen fleckigen Schlafsack war es leer. Auf dieses, mein neues Bett legte ich mich und schloss die Augen. Ich war frei, frei und schwerelos.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Avy Gdańsk
Slalom in Tartu
hinter der Sorge
läuft jemand her, weicht
dem Mondrotz aus, der
wie verächtliche Kometen
ausgespien auf den Straßen liegt
jede Nacht spuckt der Mond auf uns Pisser, amigo
unsere Visagen verstecken wir hinter
heruntergelassenen Rollos, während’s
im Treppenhaus klimpert: die Sorge schließt Türen auf
und schmeißt sich aufs Sofa; lass!
lass sie nur bleiben, die geht
schon wieder
eine Nacht mit Blutarmut und Erik
über den Kerzen Gedichte
Wörter brennen aus und wenn
wir einen Blick riskieren ist
manchmal ein Lächeln aus-
zumachen zwischen den runden
Augen der Autos, die leuchten
vor Staunen: sie bewundern die Dunkelheit
und bewahren das fröhliche Schwarz
am Tag in offenen Mündern; erinnern an
deine verspielten Zähne, dein
lückenhaftes Lächeln
wenn die Sorge dich in meine Wohnung führt
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julius Bonart
Blaue Ängste
Gestern habe ich in der Walk-in-Dusche unseres Strandhotels eine Fruchtfliege mit der Hand zerdrückt. Im Aschenbecher faulten Bananenreste; Fruchtfliegen legen ihre Eier vorzugsweise in die blauen Stellen. Die Fliege schwebte unterhalb des breiten Regenduschkopfs, regungslos, dem regenlosen Duschkopf zum Hohn. Erst wollte ich das Wasser anstellen, aber ein Insekt ertränken kann jeder. Ich entschied mich zur Jagd.
Die Mücke gab nichts auf verbleibende Fluchtwege: horizontal oder hinab. Als ich zuschlug, scherte sie nicht aus, stürzte nicht, sondern wählte den Steigflug, duschkopfwärts. Noch ein Händeklatschen und sie klebte rot in meiner Hand: Ein Blutrausch.
Ist es eine Fruchtfliege oder eine blutfette Mücke gewesen? Die Mücke, nach der C. in der vorletzten Nacht geschlagen hat? Am nächsten Morgen hatte C. Augenringe von dem Schlagabtausch. Sie trank einen Schluck Kaffee, noch einen, dann sprach sie es aus: Ich verlasse dich. Vielleicht sollte ich C. anrufen: Die Mücke, deretwegen du mich verlassen hast, habe ich gejagt und mit der bloßen Hand erlegt. Was ich alles mit der Hand kann, hast du mich immer gelobt.
Eine erlegte Mücke: der Höhepunkt des Tages. Mücke am Morgen und sonst nichts zu erledigen. Es folgte ein abschüssiger Resttag.
Heute Morgen habe ich mich aufgerafft. Ich gehe zum Strand runter. Vor mir Sand, der hinabläufig ins Meer grätscht. Die Wellen sind klein und kommen eng, sie schaben sich den Sand hinauf. In meinem Nacken: Die Hotels, die Stranddiskotheken, wo C. feiern geht, die Palmen wie aus sonnengebleichtem Plastik. Verbauung, Versiegelung, alles so arm an Farbe wie der Sand. Der Sound aus den Diskos: Weißes Rauschen, dunkle Beats. An der Wassergrenze trainiert ein weißer Mann mit Sonnenbrand: eine Kniebeuge. Ein brauner Krebs versucht im Krebsgang, der Komik zu entgehen. Der Himmel ist grauweiß, er blendet, flimmert die Palmen hinab. Sie wachsen aus Betonkübeln. Der Strand: Eine in Beton gefasste Buddelkiste. Man ist kein Kind mehr, bin ich Mann?
Eine bleierne Côte d’Azur. Nur das Meer ist farbig, blaustichig, kristallen mit grünen Einschlüssen. Dass man wegen gefährlicher Rippströmungen heute nicht baden darf, ist typisch für mein Problem: In das, was Farbe hat, kann ich nicht hinein.
C.s azurblaue Augen: So blau, dass es beinahe weh tut, wie der Himmel vom Flugzeug aus. Schon als Kind fiel ich in (oder auf?) sie hinein. Während der Schulzeit kamen wir zusammen. Ich begann, sie morgens von zuhause abzuholen; ihre Mutter lag betäubt im Gästezimmer, Tablettensucht, ihr Vater vögelte seine Neue, er war nur ab und zu da. Die Neue war zwei Jahre älter als C.
Es ist Januar, zur blauen Stunde, die Luft klirrt dem kommenden Frost voraus. Im Osten glüht der Himmel, im Westen: Blue Moon, der zweite winterliche Vollmond. Ich klingele, C. hat hinter der Haustür der elterlichen Stadtvilla auf mich gewartet. Sie saugt mich mit einem Kuss hinein, wir stolpern in die Riesenvilla. Zungen tasten Münder ab, Finger wühlen in meinem Schritt und zupfen Brustwarzen. Den ganzen Tag blödeln wir in ihrem Elternbett herum, ziehen uns gegenseitig aus und an, verschwenden keine Gedanken an die Klassenarbeit. Ich verdrehe ihr blaues T-Shirt zu einem Strang und würge sie ein bisschen, von hinten, ihr zur Lust. Sie will es so. Wir machen blau bis zur Besinnungslosigkeit.
Von da ab: Viele lange Wochenenden. Erholsam ist C.s Pool. Ein blauer Montag, wir schlagen auch den Dienstag drauf. Steht Karfreitag an, wird der Gründonnerstag blau. Die eine oder andere blaue Woche. Die ersten blauen Briefe. Du weichst aus, sagt C., doch ins Blaue gehe ich zu gern mit ihr. Ich fliege von der Schule, zocke Counter Strike, from Dusk to Dawn. C. macht Abitur und zieht zum Studieren weg.
Einmal komme ich sie besuchen und bekenne Farbe. Tage später erlebe ich ein blaues Wunder: Der Freund einer Freundin hat sie in der Mensa mit einem Kommilitonen gesehen, beim Händchenhalten. C. lässt sich von einem anderen flachlegen. Ich male mir aus, wie er auf eine Kettensäge reagieren würde – ob Blausäure besser funktioniert? Die Freundin beruhigt mich: Der hat ihr nur das Blaue vom Himmel versprochen, du musst kämpfen.
Immer war ich C.s Gladiator. Ich ziehe in ihre Stadt, mache eine Lehre, verdiene mein gutes Geld. Samstagnacht sehe ich C. auf der Tanzfläche mit ihrem steifen Germanistenfreund. Sie hat sich ihr dunkelblondes Haar hellblond gefärbt; es kontrastiert mit ihren azurblauen Augen. Sie trägt enge Jeans, sie sieht hinreißend aus. Irgendwann fasse ich Mut und tanze sie an. Mir ist egal, wo das fingerdünne Bürschchen aus der vergleichenden Literaturvorlesung steckt. Ich bin schon blau, sie breit, jeder Vergleich erübrigt sich für sie. Ihre Pupillen, die Iris wie eine blaue Sonnenfinsternis. Wir fingern und züngeln einander heiß, Sex im Auto bis der Horizont blaut.
Sie lässt sich darauf ein. Zum zweiten Mal miteinander ins Blaue, sagt sie. Ich verstehe nicht, was sie meint. Sie hat immer etwas Herablassendes mir gegenüber gehabt; ist sie blaublütig, weil sie sagenhafte Reichtümer von ihrem Vater erben wird? Ich glaube trotzdem, glücklich ist sie. Wir blödeln nächtelang im Bett herum, spielen seilweise, bis es hell wird, so wie sie es mag. Blaue Fesselmale an ihren Handgelenken. Sie will hart.
Gestern, an unserem zweiten Urlaubstag, hat sie mich verlassen. Wegen der Scheißmücke, deretwegen sie um den Schlaf gekommen ist. Aber wer zielt auch mit Fäusten auf Mücken? Hätte es gewundert, wäre C. am nächsten Morgen mit einem blauen Auge aufgewacht? Vor der Gefahr eines Querschlägers hatte sie mich mehrmals gewarnt.
Ich bin ins Hotel zurückgekehrt und ziehe die Vorhänge auf. Ich starre ins blaue Meer und versuche, mich selbst zu befriedigen, stehend. Ich denke an C., aber es gelingt mir nicht, mich an ihr selbstzubefriedigen. Mein Schwanz ist bläulich, ihn füttert armes Blut – oder mein Selbstmitleid. Ich habe einen Durchhänger.
Ich habe es dir eingeschärft, hat C. gesagt. Hart ist gut, sagt einer Halt, ist Schluss, und keine blauen Flecken. Es stimmt, seit der Schulzeit versuchte sie, mir ihre Spielregeln einzubläuen. Ich weiß nicht, ob ich je kapiert habe, was erlaubt war, ein Macker wie ich.
Da widerspricht etwas… Der Spiegel an der Badezimmerwand sagt: So siehst du nicht aus.
In Wahrheit habe ich die Dusche angestellt. Ein schneller Handgriff, ohne handgreiflich zu sein, ich bin ein Feigling. Der Duschregen zog die Mücke hinab, ohne weiteres Zutun. Unten drehte sie eine Runde, dann rutschte sie in den Abfluss. Die ganzen zehn Sekunden lang guckte ich nur zu.
C. kommt zur Tür hinein, sagt Hallo, aber nicht, wo sie gewesen ist. Geiles Wetter heute, der Himmel ist blau, warst du schon im Wasser? Ich weiß nicht, wie sie das macht, so beiläufig zu tun. Mir fällt nur Rippströmung ein. Ihre Schlagfertigkeit. Wenn ich nachts eine Sirene höre, stelle ich mir manchmal vor, sie würde mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren nach irgendeinem Unglück – einem versuchten Gegenargument. Ich bin blauäugig, aber nicht blöd. Ihrem Vater teilt sie jeden Monat eine Neue zu; Prokura erteilt er ihr. Sie bezahlt das Hotel, sie hat den geilen Job, Geschäftsessen in den Metropolen. Im Restaurant gibt sie zwanzig Euro Trinkgeld, schnippt verächtlich den blauen Schein hin. Hat sie auswärts geschlafen, es sich hart besorgen lassen, lässt sie mich den ganzen Tag nicht.
Ich bin allein mit meinen blauen Ängsten.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | FatimaDjamila
Brandenburg
(Ein weites Feld)
Durchsetzt von Steinen und Saatgut
Rehe am Waldesrand
Ist Furcht die Einzahl von Furchen
Ein Fuchs schleicht über den Sand
Wie Sargdeckel knarren die Bäume
Wohltönend stirbt er
Der Wald
Überall Manufakturen
Und der Ostwind
Weht dieses Jahr kalt
Heimat
Glaziale Serie
Wildverbiss
Zu wenig Geld
Müdigkeit küsst sanft die Sehnsucht
Es ist wohl ein weites Feld
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at