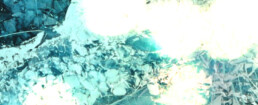8 | Alina Lindermuth
Vom Kleinsein
„Der Berg fordert gar nichts von uns. Nicht unsere Hingabe und auch nicht unseren Tod.“ [1]
Schneebedeckte Gipfel im Morgenrot, Blumenwiesen vor Kuhglocken-Orchestern, zerstäubende Wasserfälle im Zeitraffer.
Ich klappe den Laptop zu, schalte das Licht aus. Im Dunkeln sehe ich noch immer scharfkantig die Umrisse von Gebirgsketten an der Leinwand meiner geschlossenen Augenlider. Rieche taunasse Bergwiesen und spüre das Kratzen von heißem, trockenem Heu auf meiner Haut.
Am nächsten Morgen die übliche Intensität. Der Wecker zu schrill und zu laut, aber eigentlich nur zu früh. Eine Bluse aus dem Schrank ziehen und in die Business-Hose von gestern schlüpfen. Strümpfe nicht vergessen. Der Kaffee verbrennt meine Lippen und seine Bitterkeit trägt wenig zu Stimmung bei. Ich hätte früher schlafen gehen, die Dokumentation nicht bis zum Ende ansehen sollen.
Dazu schmiere ich mir ein Honigbrot wie jeden Morgen. Aber heute ist die Butter aus. Und ihre Abwesenheit nimmt dem Frühstück seine ganze Seele. Egal, die Zeit läuft, das erste Meeting ist für acht Uhr angesetzt und ich bin noch immer dabei, die Honigreste mit trockener Zunge von meinen Fingerspitzen zu lecken. Im Bad ziehe ich mir die Augen nach und am Weg zur die Tür hinaus den Blazer über die Schultern. Es ist Zeit!
Die Stimmen des Ö1-Morgenjournal vermischen sich mit dem U-Bahngemurmel. Ein weiteres innenpolitisches Fiasko zum Fremdschämen jagt ebenso pausenlose weltpolitische Unruhen zum Kopfschütteln. Aber: Grünes Licht zur Einführung einer globalen Mindeststeuer für Großkonzerne. Und vor allem: Es wurde eine neue Paradies-Vogelart entdeckt.
Im Büro herrscht die typische, erwartungsvolle Spannung. Fast so, als würde heute, morgen oder spätestens nächsten Mittwoch wieder etwas ganz GROßES passieren. Oder erreicht werden. Oder eher: Erreicht werden müssen.
Am hochgestellten Schreibtisch beim Fenster, wahlweise mit Blick auf Stephansdom oder Kahlenberg, verbinde ich meinen Laptop mit den Bildschirmen und stelle mich breitbeinig und gut geerdet hin. Mein Postfach ist schon hochaktiv und lässt die neuen E-Mails herein. Erst eins, zwei, drei… dann immer mehr. Wie kleine unbeabsichtigt losgetretene Steinchen, die sich zusammenschließen und als große Masse ins Tal rauschen. Aber ich stehe geerdet wie ein Murenbrecher vor dem Tisch und konsolidiere das Tal der Gesamtsituation mit schneller Reaktion. Das ist übrigens Teil der Job Description. Nur ohne Muren-Metapher.
Der erste Schwall von E-Mails ist nun zumindest kategorisiert, es ist acht Uhr und Zeit für das Meeting. Zwei Kollegen sitzen schon im Glasraum. Wir holen Kaffee und starten ein gemeinsames Brainstorming für den neuen Kunden, der eine Strategie für die Zeit nach Corona braucht. Eventuell auch ohne Corona gebraucht hätte.
Wir diskutieren, recherchieren und skizzieren Ideen am Whiteboard. Es prickelt unter der Kopfhaut und in den Fingerspitzen. Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit, Ergebnisse zu liefern: Bis zum Abend muss ein Konzept stehen. Und beim ersten Blick auf die Uhr ist es schon weit nach Mittag.
Später stehe ich wieder am Schreibtisch und spüre, dass die Spannung steigt wie der Luftdruck in einem am Herd vergessenen Kelomat. Sie korreliert exakt mit dem Vergehen der Zeit. Aber: Wir schaffen das schon. Wir können das schließlich. Wir sind ja auch hier, weil wir das können. Und darum: Müssen wir das schaffen. Eine Alternative ist nicht angedacht.
Nach zwei anderen Meetings, einem weiteren Kaffee und Stunden sitzend und stehend am Schreibtisch ist das Konzeptpapier fertig. Es ist nicht schlecht, aber auch noch nicht so gut, dass ich es der Chefin schicken könnte. Die meisten anderen sind entweder schon zu Hause oder still an ihren Arbeitsplätzen. Draußen stockfinster, beim Blick hinaus gibt es um diese Uhrzeit keine Auswahl mehr.
Irgendwann übersteigt die Müdigkeit den Drang nach Perfektion und ich sende den ersten Entwurf ab. Dann bin ich schon draußen in der Nacht und warte auf die U-Bahn, drei Minuten bis der nächste Zug kommt. Ich schließe die Augen und öffne sie gleich wieder, denn an den Augenliderleinwänden sehe ich ein wildes Gewitter aus Zahlen, Wörtern, Diagrammen. Und ich fühle mich dabei wie im Hochgebirge. Mit Business-Outfit. Ohne Biwak. Gefährlich weit oben.
Zu Hause durchlaufe ich die gleichen Schritte wie am Morgen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Blazer ablegen. Kleidung abstreifen. Ins Bad. Beim Essen piept mein Handy mit einer Erinnerung: „Morgen, Samstag, Abfahrt um 7:32“
Das Bergfest! Morgen? Nein, erst nächsten Samstag! Morgen? Ich durchforste meine Mails, die Nachrichtenverläufe in der WhatsApp-Gruppe, meinen Kalender. Und tatsächlich. Ich habe mich in der Woche geirrt. Dabei brauche ich den Vormittag für das Konzept. Schnell packe ich einen Rucksack und überlege dabei, wie viel Zeit mir im Zug noch bleiben wird. Im Bett schlafe ich augenblicklich ein, endlich ist die Leinwand finster.
Still gleitet Österreich an mir vorüber. Zuerst noch Stadt. Dann Vorstadt. Dann endlich Land. So ruhig ist es im Zug um diese Uhrzeit. Hügel. Fluss. Dorf. Kleinstadt. Hügel. Ausläufer von etwas Großem.
Eine gute Atmosphäre, um zu Arbeiten. Wie erwartet hat mir die Chefin ihre Kommentare geschickt. Wann sie das gemacht hat, bleibt fraglich. Ich arbeite konzentriert, es bereichert, wenn man beim Überlegen weit in die vorüberziehende Ferne schauen kann.
Kurz vor der Ankunft blinkt das Akkusymbol am Laptop auf. Beim Griff in den Rucksack finde ich kein Kabel. Zehn Minuten später ist der Bildschirm schwarz aber das Konzept unfertig zurückgeschickt. Und draußen der Himmel tiefblau.
Ich fahre weiter mit dem Bus. Dann werde ich abgeholt. Von alten Freunden. Wie jedes Jahr. Noch vor dem Umarmen ist alles wieder so wie in der Volksschulzeit. Die meisten von ihnen sind hier geblieben. Wir sehen uns wenig. Aber eben mindestens einmal im Jahr.
Die letzten paar Hundert Meter steigen wir zu Fuß auf. In den Händen Taschen voll Essen und Kisten voll Bier. Und dann sind wir oben, die Hütte ist schon eingeheizt, ein paar sind vorausgegangen und haben alles aufgebaut.
Ich schmeiße meinen Rucksack ins Bettenlager und schaue auf mein Firmenhandy. Keine neuen Nachrichten. Die anderen verdrehen die Augen, ich schalte das Handy schnell aus und schiebe es zum Laptop ganz unten in den Rucksack.
Und dann sprudelt der Nachmittag über mich hinweg, erfrischend wie eine klare Bergquelle. Nasses Gras unter den Fußsohlen, ein Glas Bier in der Hand, vertraute Stimmen im Ohr. Und all die alten Geschichten im Kopf, die wir uns jedes Jahr wieder erzählen, ausgeschmückt oder verkürzt, je nachdem, von wem sie gerade erzählt werden. Einer spielt Gitarre und die meisten singen mit, obwohl niemand wirklich singen kann. Die Hitze der Sonne brennt auf der Haut. Ich helfe beim Grillen und wende das Fleisch vom Bauern aus unserem Dorf.
Beim Schälen der Erdäpfel sitzen wir in kleinerer Runde und sprechen über das, was uns zur Zeit bewegt. Und als ich erzähle, habe ich das Gefühl, es bleiben mit jedem Satz mehr Fragezeichen zwischen den Erdäpfel-Schalen liegen. Die „Wies“ zu beantworten ist noch am leichtesten, die „Warums“ schon wesentlich schwerer. Und bei den „Wozus“ gehen mir schließlich die Antworten aus.
Aber dann plätschert der Tag weiter und der Erdäpfelsalat muss nur noch durchziehen. Wir sitzen zusammen und klauben mit den Zehenspitzen Alpenblumen von der abschüssigen Wiese. Ich lasse mich treiben, durch diesen Nachmittag, durchwegs vor der Kulisse meiner Berge.
Frühmorgens erwache ich im Bettenlager, um mich herum schlafende alte Freunde, schwaches Dämmerlicht fällt durch das winzige Fenster unter dem Giebel. Obwohl ich so müde bin, als hätte ich Wochen nicht geschlafen, steige ich aus den warmen Decken und schleiche auf leise knarrenden Brettern zur Tür. Alles noch ruhig, keiner ist aufgewacht.
Ich nehme eine fremde Jacke, finde meine Schuhe und trete vor die Hütte hinaus. Noch keine Sonnenstrahlen über der Welt. Rund um die Hütte ein paar Flaschen, ein paar Teller, das meiste schon ordentlich zusammengeräumt. Dazwischen einige von der Bergnacht nasse Seiten Papier, auf denen ausgedruckte Liedertexte verrinnen.
Ich gehe um die Hütte und steige langsam den schmalen Pfad dahinter hinauf. Müde. Schritt für Schritt. Und schwer. Aber dann komme ich auf den kleinen Platz unter den steil aufragenden Felswänden, mit einem phänomenalen Blick über das Tal.
Ich setze mich auf einen Stein und warte mit meinen Augen am Horizont auf die Sonne. Ich lege den Kopf in den Nacken und blicke die senkrechte Wand hinauf. Spüre den kleinen kalten Stein unter mir, der wohl vor langer Zeit Teil dieser Wand gewesen ist.
Rundherum so viel Weite. Keine neue Weite. Ich kenne sie seit Kindertagen. Und trotzdem: Sie fühlt sich jedes Mal wieder an wie eine neue Perspektive.
Und plötzlich bin ich bin so unglaublich klein. So klein.
In Anbetracht dessen, was um mich ist.
Und dann, mein Blick noch immer am Horizont, fällt der erste Sonnenstrahl auf diesen Tag, fällt über das Tal, über die Gipfel und über die Felsen. Fällt auf mein Gesicht, meine Pupillen, fällt durch mich hindurch bis auf die Netzhaut. Ich schließe die Augen und sehe das, was wirklich ist, durch meine Augenliederleinwände hindurch. Nämlich das, was wirklich GROß ist.
[1] aus der Dokumentation „Mountain“ von Jennifer Peedom, 2017.
.
Alina Lindermuth
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: