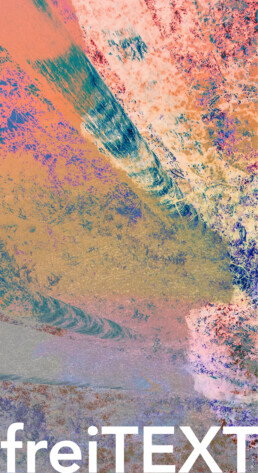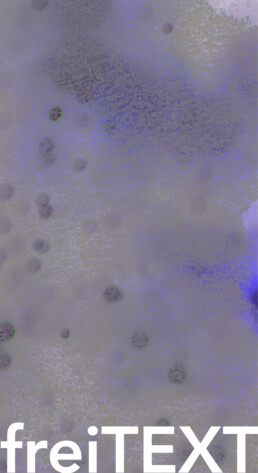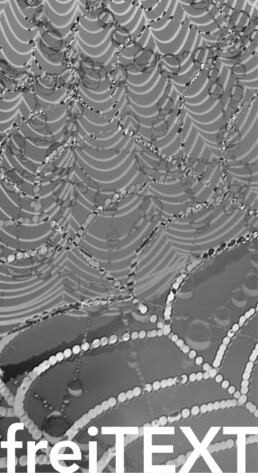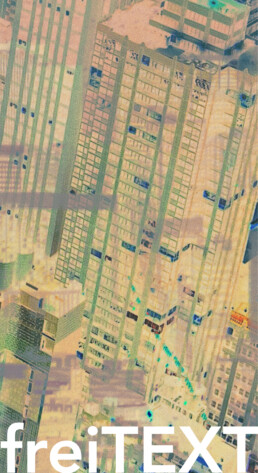freiTEXT | Stefan Volkmann
Grünspan
Der 16jährige Ich-Erzähler und zwei Freunde sind nach Stuttgart gefahren, um ein Konzert zu sehen. Das Konzert wird kurzfristig abgesagt, sie sind mindestens drei Stunden früher als gedacht wieder zurück in Wörth am Rhein zuhause.
Wir gingen zum Golf, stiegen ein. Uwe hielt an der Tankstelle, kaufte eine Tüte Chips und ein Sixpack. Wir glitten über die Autobahn.
„War besser als Zuhausebleiben.“
„Looking on the street, better than tv.“
Uwe parkte vorm Jugendzentrum.
„Wir sagen allen, 's war 'n Superkonzert. Hate Convoi ham zwei Stunden gespielt, die Vorband Spätzlekiller is 'n Geheimtip.“
„Ja, so geheim, dass sie nich mal aufgetreten is.“
Olli drehte einen Joint, kurbelte das Beifahrerfenster runter, zündete ihn an und lachte. Ich hoffte, Lene sei bei mir und wollte aussteigen.
„Ich brauch unbedingt die neue Spätzlekiller-Platte.“
„Ich geh nach Hause.“
„Er will zu seiner Kleinen.“
„Mittwoch, Spitz ins Loch.“
„Heut is Donnerstag.“
„Wenn du verliebt bist, is jeder Tag Mittwoch.“
„Ich bin gefahrn und steh nich auf.“
„Ich häng am Joint und kann nich aufstehn.“
Uwe seufzte, stieg aus und klappte den Sitz vor. Ich kletterte von der Rückbank, aber der Asphalt wankte wie ein Schiff bei leichtem Seegang.
„Komm gut nach Hause.“
„Grüß die Kleine.“
„Mach ich.“
Ich ging am Spielplatz, den Schrebergärten und Tennisplätzen vorbei, dachte, wenn die Sportanlagen unter den Flutlichtern fertig seien, lägen beim Freibad oben größere Tennisplätze als die alten hier unten. Würden hier neue Schrebergärten angelegt oder Wohnblöcke hoch gezogen? Ich lief durchs Einkaufszentrum, kam am Kleinstadtwol- kenkratzer vorbei und suchte Nadines Fenster. Es war dunkel, sie schlief. Ich kam an der Bücherei vorbei, ging über die Fußgängerbrücke und schaute zu unserer Wohnung, alle Fenster waren dunkel, Lene nicht da. Ich lief zum Wohnblock, ging das Treppenhaus hoch und schloss die Tür auf, schaltete Licht an, zog meine Converse aus und stand in der Küche. Lenes Jacke hing über einem Stuhl, ihre Tasche lag auf der Eckbank. Ich dachte, sie schlafe, schaltete Flur- oder Küchenlicht aus und schlich in mein Zimmer. Mein Bett war leer, ich hörte Geräusche, ging zu Jens' Zimmer und öffnete seine Tür. Die Schreibtischlampe mit dem grünen Schirm tauchte sein Bett in morsches Licht. Er lag auf seinem Rücken, sie saß auf ihm, ihre Schenkel waren gespreizt, er streckte seine Arme aus, legte die Hände auf ihre Brüste, aber seine Basketballerhände schienen zu groß oder ihre Brüste zu klein. Jens streichelte sie sanft, wie ein Schmetterling, der mit seinen Flügeln schlägt. Sein Unterwäschewerbewaschbrettbauch spannte und entspannte sich in kürzer werdenden Abstän-den. Ich spürte Schleier vor meinen Augen, als regnete Sand unter meinen Lidern.
„Jens sieht aus wie Apollo oder Amor“, hatte Tamara mal gesagt.
„Ja sicher“, hatte ich gelacht, „ne Mischung aus Adonis und Alain Delon, von Rodin gemeißelt.“
Er lag mit dem Kopf zur Tür, hätte mich nicht sehen können, blonde Haare fielen über ihre Brüste, bedeckten seine Hände und Unterarme. Lene öffnete zeitlupenlangsam ihre Augen, starrte mich an, aber schloß die Augen wieder. Ihr Hüftrhythmus geriet ins Stocken wie eine Maschine, die stottert, aber reibungslos weiter schnurrt. Ich dachte, ich sei auf der Rückbank im Golf eingeschlafen, stolperte rückwärts, wankte in mein Zimmer und fühlte mich, als wären Jahrzehnte vergangen. Aus ihren Mündern rieselte Sand, ihr Keuchen, Stöhnen und Atmen wehte Körner in mein Zimmer. Feuchte Dünen bedeckten meine Knie und türmten sich um meine Hüften. Ich kämpfte mich hoch, wankte in die Küche und warf ihre Tasche vor seine Tür, schloß mein Zimmer ab, barg meinen Kopf unterm Kissen und weinte. Dampflokomotiven stürzten auf meinen Körper, Eisen verdichtete sich zu Dunkelheit, die nicht schwarz genug war, darin zu verschwinden. Ich schaute in den Flur, ihre Tasche lag nicht mehr vor seinem Zimmer, und ging in die Küche, ihre Jacke hing noch überm Stuhl. Schlich zu Jens' Zimmer, drückte die Klinke und schob seine Tür auf. Er lag auf dem Rücken, atmete wie ein Baby, sie auf ihrem Bauch, aber hatte ihr Gesicht in seiner Achselhöhle vergraben. Seine Boxershort hing über einem Stuhl, ihr Slip lag am Fußende des Bettes auf dem Teppich. Jens war dunkel und trainiert, Lene schmal und hell, ein schönes, vom Liebemachen oder von Liebe erschöpftes Paar. Ich sah die Schere auf dem Tisch, nahm sie und schlich ans Bett, schnürte ihre Haare zum Zopf, setzte die Schere an und drückte beide Griffe. Lene lag so ruhig, als schliefe sie, aber lächelte, als empfinge sie eine Strafe, die sie für gerechtfertigt hielte und die sie erlöste.
„Kennst du Lene?“
„Ja, die mit den langen blonden Haaren.“
Ich stolperte in mein Zimmer, der Zopf schleifte über den Teppich, glaubte, sie weinen zu hören, aber sie hätte Tränen unterdrückt, bis ich im Flur war. Falls ich sie weinen hörte, war es ein Traum, weil ich hoffte, sie sei traurig. Ich ging in die Küche, öffnete den Abfalleimer und warf ihren Zopf in den Müll, war halb aus der Küche draußen, drehte mich wieder um und öffnete den Abfalleimer, zog eine blonde Strähne raus, rollte sie in meiner rechten Hand zu einer Schlinge und ging in mein Zimmer. Steckte die Schlinge – ihre Strähne – in einen Briefumschlag, legte ihn in die unterste Nachttischschublade und zog mich an, brachte den Müll zur Tonne, holte Brötchen und wartete auf ein Gefühl, was in Ordnung gebracht zu haben, aber es kam nicht, nichts kam, niemand.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ben Rinosch
Der Sturz – Ein MRT-Bericht
Bin ich ein auf dem Rücken liegender, blau schimmernder Tintenkäfer? Oder bin ich ein auf dem Rücken liegender, kleiner Vogel, ein Zaunkönig vielleicht? War ich bisher nur ein Zaungast, der den Menschen dabei zusah, wie sie sich amüsierten, wie sie miteinander sprachen, lachten und stritten?
Ich sehe durch ein kleines Fenster hindurch auf das weite Meer hinaus. Das stetige Hämmern und Klopfen ist beunruhigend. Ich erinnere mich an nicht enden wollende Nächte, in denen ich frühmorgens in dunklen und kalten Technobunkern strandete. Völlig besoffen.
Menschen in Reih und Glied stampfen nach elektronischer Musik und auch dort ein stetiges Hämmern und Klopfen. Das Herz rast davon, als würde es sich in den frühen Morgenstunden nach einer langen Nacht weiter am Leben abarbeiten. Und ein Discjockey oben auf der Bühne, ummantelt mit Aluminium, steht vor seinem Cockpit. Er drückt Knöpfe und fährt Schalter rauf und runter. Ab und zu jault er auf und dreht sich im Kreis.
Ich liege in einer Metallkapsel flach auf dem Rücken.
Die Metallkapsel ist Teil eines Raumschiffes. Schon bald wird es die Erde verlassen. Ich umklammere meine Kopfhörer, in der Hoffnung sie würden die Störgeräusche abschirmen. Ich frage mich, warum die Menschen andauernd produktiv sein müssen. Und dann wird andauernd gebaut und dabei Lärm erzeugt. Grobe Materialien, die mit schweren Maschinen bearbeitet werden. Überall Maschinen. In den Wohnungen. In den Gärten. Auf den Gewässern. In den Händen der Bauarbeiter:innen und Handwerker:innen. Fahrende Maschinen auf den Straßen und auf den Gewässern und in der Luft fliegende Maschinen, Milliarden von Maschinen, die wir in unseren Händen halten...
Denke an das Meer, sage ich mir. Schau genau hin. Dort wirst du vergessen.
Vorgestern hatte ich noch in einem Bio-Supermarkt gearbeitet, war auf nassen Fliesen ausgerutscht, die kurz zuvor gereinigt wurden. War also kurz in der Luft. Dann der Aufprall. Warum hatte ich danach weiter gearbeitet, als wäre nichts gewesen? Und wie kam ich auf die bescheuerte Idee in einem Supermarkt zu arbeiten? Weil ich als Buchhändler ein mieses Taschengeld bekam und ich bei gleicher Arbeitszeit im Supermarkt 500 Euro mehr im Monat bekomme? Aber so langsam geht mir ein Licht auf: Obwohl die Kolleg:innen im Bio-Supermarkt zueinander freundlich sind und trotz harter Arbeit andauernd lächeln, weiß ich noch nicht, ob ich das jemals erreichen kann. Und ob ich das überhaupt will. Schon am ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass ich das nicht lange durchhalten werde.
Ich liege in einer Metallkapsel, flach auf dem Rücken, immer noch. Das dunkle Blau des Wassers und das helle Blau des Himmels fließen weich ineinander. Ein kleines Fenster lächelt mir zu. Lässt mich ruhig und tief atmen.
Von sechs bis zehn Uhr am Morgen zwölf riesige Kühlschränke nach Mindesthaltbarkeitsdaten durchgehen, die Produkte, die am selben Tag auslaufen, mit
25%-Aufklebern und die Produkte, die am folgenden Tag auslaufen, mit 15%-Aufklebern versehen. Die Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdaten gestern abgelaufen sind, aus dem Warenbestand herausnehmen, löschen und in eine grüne Tonne werfen. Den Restewagen aus einer Kühlkammer holen und die Molkereiprodukte, die gestern nicht mehr in einen Kühlschrank gepasst hatten, in die Kühlschränke füllen. Immer darauf achten, dass die Produkte vorne im Regal ein kürzeres Mindesthaltbarkeitsdatum haben, als die Produkte weiter hinten in der Reihe. Dann die Bestellung für den nächsten Tag. Mit einer Bestellvorschlagsliste arbeiten. Die zwölf Kühlschränke nacheinander durchgehen. Welcher Artikel wie oft? Gibt es Fehlbestände? Wenn ja, dann müssen die später korrigiert werden. Die vorgenommene Bestellung speichern. Dann ins Büro flitzen und die gespeicherten Daten am Computer sichten. Die Bestellung öffnen, prüfen und freigeben. Ausloggen.
In der Nacht nach dem Sturz war mir sehr übel gewesen. Es war für mich unmöglich auf dem Rücken zu liegen. Um 04:05 Uhr war ich aufgestanden und hatte mir überlegt, trotz des Sturzes zur Arbeit zu gehen. Kurze Zeit später hatte ich im Bio-Supermarkt angerufen und mich krankgemeldet. Der behandelnde Arzt hatte mir wenige Stunden später einen Überweisungsschein für die Radiologie mitgegeben.
Die Störgeräusche sind immens, das kleine Fenster meine Rettung. Ich muss immer wieder an die Arbeit denken und ich komme auf den Gedanken, dass der Verkaufsjob im Bio-Supermarkt so etwas wie eine Ameisenbeschäftigung ist. Wie kann es sein, dass ich in meiner Freizeit andauernd an die Arbeit denken muss! Alles ist so leidenschaftslos durchorganisiert und was sich vielleicht von einem Ameisendasein unterscheidet, ist, dass meine Kolleg:innen Humor haben und dass immer mal wieder gelacht wird. Obwohl ich den Humor nicht schön finde. Ich weiß schon, was drunter liegt: Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit.
Ich will den Sturz als eine Art von Protest begreifen. Der Sturz ist meine Rettung und ich will dem Reinigungsmann danken, dass er zu viel Seifenlösung in das Putzwasser getan hatte. So falle ich für ein paar Tage aus. Und vielleicht wird mir schon in ein paar Tagen ein Licht aufgehen: Ich arbeite für ein Bio-Supermarkt-Imperium und da bringt es mir auch nichts ein, dass sich alle duzen und übertrieben freundlich miteinander sind. Ich kann nicht schreiben. Ich kann mich nach der Arbeit nicht konzentrieren. Ich will weiterschreiben, mir neue Stoffe ausdenken, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss damit Schluss machen.
Ausloggen. Wieder raus auf die Fläche und schnell die gelieferte Ware reinziehen. Handschuhe an, hunderte von Kartons aufreißen und die Ware verräumen.
Dann an die Kasse und hunderte von Produkten in den restlichen ein bis zwei Stunden über den Kassenscanner ziehen. Ich bemühe mich freundlich zu sein. Ich denke mir, dass ich ein schleimiger Verkäufer bin. Ich hasse es, während meiner Arbeit freundlich sein zu müssen.
Mir ist es ein Rätsel, wie man über Jahre hinweg so hart arbeiten kann. Werden mir nach ein paar Wochen Maulwurfhände wachsen?
Ich liege auf dem Rücken in einer Metallkapsel. Durch meinen Kopf gehen magnetische Strahlen. Störgeräusche. Über mir ein kleiner Sehschlitz. Strand. Runzel-Rosen, Strandhafer und Krähenbeeren. Nordseewellen. Eine Idee davon, dass alles einem stetigen Wandel unterliegt und die Angst davor zu verschwinden.
Aber erst einmal werde ich kündigen. Und dann werde ich weiter schreiben, immer weiter.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Alice Grünfelder
Stadt am Meer
Zikaden
im Ohr, im Kopf, im Denken, als längst kein Wald mehr und kein Gesträuch, die Stadt schon hetzt, aber noch immer Zikaden im Ohr.
Wellen
donnern, rollen, schlagen ein auf das Meer, denn im
Sturm
zerrt schon an den Palmen auf der Promenade, schon wird vor ihm gewarnt, die Menschen hier bleiben gelassen, warten ab, denken, er geht vorüber, dieses Mal geht er uns nichts an.
Luft
darin der Geruch von Klärschlamm, dreht sich träge in runden Becken, zwischen Büschen und Mangroven eine Müllhalde mit Blick aufs Meer, ein blaues Förderband hängt schlaff zwischen Erde und Himmel, wo einst Fels aus den Bergen, Stein zu Kies zu Sand zerrieben wurde, aus einem Turm mit aufgemaltem Wal fallen Betonklötze, unter Planen kauern Menschen mit Gesichtern so grau wie ihre Mäntel, reichen sich Knöchelchen, Geißen ducken sich hinter Brettern vor der Hitze, dem Regen, auf einer asphaltierten Straße hoppelt eine hinunter zum Strand.
Schatten
kann nicht ohne Licht, entlarvt das Dunkel, das Helle.
Taifun
wird erklärt, eine Nachricht ploppt auf, eine Freundin warnt, die Angestellte im Gästehaus spricht bloß von Starkregen, noch ist alles ruhig.
Gedichte
übersetzen – bis der Regen kommt.
Warten
und Wolken nachsehen, ob sie nun langsam oder schneller ziehen, den Gewächsen auf Dächern, ob sie nun stärker schwanken als zuvor, die Fußgänger von oben betrachten, ob sie Regenschirme aufspannen, den Straßenbelag, ob er glitzert im Regen – warten auf den Taifun.
Löcher
sind die Fenster im Haus gegenüber am späten Nachmittag, Löcher so dunkel, als lebte kein Mensch darin, nur in den beiden oberen Etagen flackert ein Licht.
Küstenwachen
stehen in orangefarbenen Hosen, Schwimmwesten, mit Fernglas, Flaschen, Stöcken, Trillerpfeifen, Taschenlampen, seit Wochen schon, stehen da mit dem Rücken zum Meer, andere mit dem Rücken zur Stadt, in Erwartung jedenfalls, schauen, wie der Regen Nägel treibt ins Meer, ob der Sturm kommt oder was anderes, über den Fahrradwegen hängen Ketten, daran gelbe Wimpel mit Wörtern, nicht zu entziffern, so heftig flattern sie im Wind, die Wege hinunter zum Strand versperrt mit rot-weißen Plastikbändern, der Sturm, der Regen, angekündigt für den Nachmittag, kommt nicht, Stunden später nieselt es, als es düster ist und das Meer, der Wind sich beruhigt, fällt der Regen stärker, trommelt gegen das letzte Fenster im Haus, das noch nicht zerbrochen ist von den Regenstürmen zuvor, ein dunkelblaues Auto mit Warnlicht fährt langsam auf dem Damm hin und her, Regen stürzt nun aus Wolken, ein Bagger schaufelt einen schmalen Zugang frei, zugeweht vom Sand über Wochen, Monate, Jahre, damit das Wasser wieder zurückfließen kann ins Meer.
Spiegelung
eine TV-Reporterin in transparentem Regenmantel spricht, auf dem Weg zum Mikrophon gehen die Worte unter in der brüllenden Brandung, der Boden hinter ihr bricht weg, unter einer Fußgängerbrücke hocken zwei Männer, vor ihnen eine Pfütze, ihre Finger gehen hinein, dann zu den Lippen, sie schippen etwas in zwei Becher, Wolken schieben sich über Berge, dass sie darin verschwinden, dorthin geht schon lange keiner mehr.
Regen
splattert heftig an die Scheiben, auf den Asphalt, eine Radfahrerin stemmt sich gegen die Regenwand, die der Wind vor sich hertreibt – bis schließlich jeglicher Verkehr eingestellt wird, weil Felsen den Hang hinunterrutschen, die Berge auseinanderfallen, die Erde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leon Zechmann
Wir drei
Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass du auf die gleiche Schule gehst wie ich früher und schon vor dir deine Schwester. Ich kenne die Räume und Flure zu gut und kann darin verloren gehen. Mondlicht ändert sich nicht in dreißig Jahren, auf den Tafeln lag der Staub nur dichter. Am Fenster deines Klassenzimmers hört man die Geräusche aus der Sporthalle am anderen Ende des Pausenhofs. Davor steht das neue Auto, direkt neben der Plane auf dem Roller deiner Schwester. Ich weiß nicht, wie ich fragen soll, ob wir danach noch in den Drive-in fahren und unter dickem Schnee auf dem Autodach, mit den Fingern in den Nikolaus-Häusern an den beschlagenen Fensterscheiben, nachts uns noch satt essen. Du hast seit gestern Abend nicht mit mir geredet und ich weiß nicht, ob es etwas ändern würde, wäre ich jetzt bei euch. Stattdessen verstecke ich mich im vierten Stock. Der Wind trägt dumpfe Musik nach oben und sie perlt an der dicken Jacke ab. Wenn du dran bist, werde ich es hören können, aber nicht zuordnen.
Ich stand bei allem immer draußen zum Rauchen, um deine Oma sauer zu machen. Du traust dich, heute aufzutreten, ohne Musikstunden. Mich nervt die Asche am Fensterbrett, ich puste sie fünfzehn Meter zu Boden. Ich hätte mich nicht getraut. Deswegen stehe ich, obwohl ich früher aus der Arbeit rausgekommen und hergefahren bin, hier oben. Zwischen jedem Act kommt kurzes Geplänkel, eine moderierende Person mit extrem hoher Stimme duelliert sich mit den Ausschreitungsklängen der nie ausgetauschten Lautsprecher. Ich heule hauptsächlich und wische mir mit langen Bewegungen immer wieder die heißen Tränen nach außen und oben. Ich habe Angst, dich zu verpassen und ich habe Angst, dich zu sehen.
Ich nehme Angst in Kauf, Schuhe zwischen den Fingern über den Boden schlittern, rennend. Das Treppenhaus hinunter, in dem ich mir beim Fangenspielen den Fuß verstaucht hatte, durch den Keller mit dem Werkraum, in dem ich mir mit der Nadel durch den Finger gestochen hatte. Der Korkboden vor dem Turnhalleninnenleben reibt über meine fallende Sockenferse und mein Knie kracht in die Heizung. Die Tür lässt sich schwer öffnen und dahinter stehen die anderen Eltern. Ich ziehe den Kopf ein, unterdrücke Scham und Schmerz mit jedem Atem und lehne mich neben sie an die Wand. Erst nach ein paar Minuten bin ich da, davor war alles schwarz. Regungslos suche ich den Raum nach deiner Schwester ab. Sie sitzt in der dritten Reihe auf einem Schulstuhl und hält das Handy in der Hand. Sie hält es hoch. Auf der Bühne stehst du, wie das kleinste Ei der Welt im Scheinwerfer und die Welt schaut dir zu. Ehe ich nachdenken kann, stehe ich an der hintersten Stuhlreihe, beinahe in jemandes Nacken. Ich spüre, wie wir uns drehen. Ich will, dass du mich siehst. Du singst, wie Siebtklässlerinnen singen, nur besser. „Ich will später mal Tickets für deine Konzerte haben“, würde ich sagen, wäre es nicht albern. Albern war es nicht, als wir in dem einen Campingurlaub unseres Lebens auf den alten Klappstühlen in der frisch feuchten Erde saßen und du die Karten zum Spielen auf deine Schwester geworfen und die Lieder aus dem Kindergarten über den Platz geträllert hast.
Du hörst auf und ich klatsche, bis die Wunden an meinen Fingern unter dem angestauten Schweiß der Sporthalle brennen. Endlich siehst du auf und dein Blick fällt zuallererst in die dritte Reihe. Bitte guck mich an. Ich bin doch hier. Und dann guckst du. Dein stolzer Blick schweift in winzigen Rucken durch den Raum. Und bleibt hängen. An mir. Bitte, sei nicht sauer auf mich. Es tut mir leid. Du reißt Kopf und Daumen in die Höhe wie die Königin der Welt, hebst das eine Bein an und setzt es dumpf und doll neben dich auf und ich glaube, du zwinkerst wie ein Dussel. Wie ein winziger Frosch stolzierst du über die Bühne und irgendetwas in meinen Lungen fängt beim dir „Zugabe“ Rufen an, sich zu lockern. Du stehst da wie beim allerersten Fahrradfahren, Laufenlernen, Schwimmen, auf weiter Flur in freier Welt, während ich ganz abseits im Licht deiner Augenwinkel hänge, die ganz genauso aussehen wie meine.
Ihr fahrt nach Hause, weil ihr keine Lust habt auf Drive-in und nachts im stickigen Auto auf dem Parkplatz stehen. Ich fahre hin und hole alles. Ich sehe euch durchs Fenster, als ich heimkomme, und die Lichter auf dem Brett funkeln euch wie wild durch die vom Wind zerzausten und von Mützen verschwitzten Haare. Mitten im Schnee, die Essenstüten mich wärmend am Bein, nehme ich den Moment auf ewig in mich auf. In meinen Blutbahnen bauen kabellose Wärmedecken Schutz vor dem eisigen Geschmackston der Winternacht. Der Tisch ist gedeckt, als ich schlüsselklimpernd hereinkomme, und so funktioniert das in einer Familie. Man geht zur Schule und zur Arbeit und abends isst man am Tisch und vergibt sich gegenseitig. Du hast, die Beine auf der Küchenbank verknotet, noch immer dein fasriges Kleid vom Auftritt an, und deine Schwester isst sofort, halb in der dicken Mopedjacke, die das Futter verliert, aus zerrissenem Papier wie ein Schwein.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Christian Hornstein
weg
Du stehst in deiner Vier-Quadratmeter-Küche und bläst den Rauch aus dem Fenster. Er schmeckt abgestanden, nach einem Versprechen, das nie eingelöst wurde. Durch den Grauschleier des anbrechenden Tages werfen die Straßenlaternen immer noch mit elektrischer Sturheit ihre grellen Lichtinseln auf die Straße. Du hörst das Rauschen der Benzinkarren auf der Autobahn, unablässig, ihr gleichgültiges Rasen, das dich begleitet, seit du existierst. Und das Kreischen der endlosen Züge, die ständig irgendwelche Waren durch die Nacht schaffen, für die unersättliche Menschheit, die mit Gesichtern aus Stein im fahlen Kunstlicht ihrer Armaturen ebenso unaufhörlich in ihren Fahrzeugen durch die Dunkelheit rollt.
Du schaust auf den Küchenboden, die kaputten Fliesen, in die Ecke hinten, zur Baumwollmatte neben dem Fressnapf, wo sich schon seit einem Jahr kein Leben mehr regt und nur noch leere Bierflaschen liegen. Du spürst das Kneifen in der Brust, dieses trockene Weinen. Da ist er wieder, dieser kalte eiserne Rahmen, in dem kein Bild mehr steckt.
Noch ein Tag, denkst du, noch eine Zigarette. Noch einmal durch den Türrahmen schlurfen, aus der Küche raus ins andere Zimmer und zurück. Noch ein paar weitere Stunden dem Getriebe der Stadtmaschine lauschen, fernen Stimmen nachhorchen, die kaum noch wirklich sind. Noch ein Blick auf das zersplitterte Display deines Handys, das sich wie ein Spinnennetz über kryptische Lichtschemen legt, die du schon lange nicht mehr entziffern kannst. Und noch ein Blick durch die Schlieren auf dem Fensterglas, hinauf zum bleichen Himmelsdeckel.
Und plötzlich weißt du, es geht nicht mehr.
Es ist wie ein Stück Unrat, das du ausspucken willst. Du gehst in das andere Zimmer deiner Wohnung, dort, wo du alles andere machst außer kochen und rauchen, ziehst dir mechanisch den Jogginganzug an und gehst raus. Du schließt nicht ab. Du nimmst auch nichts mit. Nicht einmal deine Schlüssel.
Du gehst die Stufen im Treppenhaus runter, vorbei an den kaputten Wänden, den zerkratzten Türen; du gehst auf die Straße, unter die grellen Leuchten, wie auf eine verdammte Bühne; beschleunigst deine Schritte, rennst weiter, dorthin, wo das Licht der Scheinwerfer vergeht, wo die Straße ins Zwielicht führt.
Und du wunderst dich, wie einfach es ist, wie glatt und frei der Weg vor dir liegt. Nichts und niemand hält dich auf. Keinen schert es. Bald hörst du das Bullern, das Rauschen. Du gehst über die Landzunge, steigst über die Steine, bis es nicht mehr weiter geht, und dann, zum ersten Mal, schaust du auf und nimmst den Fluss wahr, wie er sich machtvoll über alles hinweg wälzt, und du ahnst, wozu er fähig ist. Es macht dir Angst ... und zieht dich an. Ihm widersetzt man sich nicht. Er duldet kein Zögern. Du merkst, dass du an den Richtigen geraten bist. Hier wird es ernst. Du lauschst dem Rauschen des Wassers, dem gleichgültigen Strom, der seit Urzeiten an dieser Stelle sein Bett auswalzt. Du riechst die Kloake aus zersetzten Algen und Müll.
Dann steigst du runter. Du merkst, wie das kalte Nass in deine Joggingschuhe dringt. Fast wärst du ausgerutscht auf dem glitschigen Gestein. Du gehst weiter. Nun klebt die Hose an deinen Unterschenkeln und die Kälte umfasst deine Körpermitte. Noch nie warst du dem Fluss so nah. Du merkst, wie er beginnt an dir zu zerren, wie eine Macht nach dir greift, der du nichts entgegensetzen kannst. Noch einmal bäumt sich deine Angst auf, im Angesicht der Endgültigkeit, dann breitest du die Arme aus und lässt dich nach vorne fallen.
Du lässt dich tragen, ins Reich der gedämpften Töne. Du weißt nicht, wohin der Strom dich schiebt und dreht, aber er kümmert sich schon. Mit jedem Moment, das weißt du, entfernst du dich von den Lebendigen, von der Last, von allem. Ein Zurück gibt es irgendwann nicht mehr. Du hörst das Gluckern, das Rauschen, vielleicht ein fernes Rumpeln, ein Wimmern oder Klagen. Die Seelen der im Fluss Ertrunkenen? Ein Schauer greift dir in den Nacken. Die Klagen werden immer lauter, oder sind es Rufe? In deinem Brustkorb wird es eng. Jetzt gilt es. Das Wasser verlangt Einlass. Du öffnest die Augen. Nebel aus Schlamm. Wie tief bist du abgesunken? Wo ist oben und wo unten? Da sind sie wieder, diese Rufe, nun lauter. Du öffnest den Mund. Kälte breitet sich in deinem Hals aus, bis weit hinunter in deine Brust, wie bei einem tiefen Atemzug an einem eisigen Wintermorgen, nur erfrischt es dich nicht. Da packt dich etwas, zieht dich fort ... und du tauchst auf.
Eine Stimme, Keuchen, Gezerre an deinem Körper. Du wehrst dich nicht. Du hast dich losgelassen, gehörst dir nicht mehr. Etwas anderes hat dich übernommen. Jemand anderes. Da ist diese Stimme. Sie ruft nach jemandem, ohne ihn beim Namen zu nennen, einem, der ihr fremd ist. Sie bebt, presst Worte hervor, fleht. Dann ein Stoß, fast schmerzhaft, noch einer. Dein Körper krümmt sich hart und du erbrichst, krampfhaft. Die Schwere dieser Welt drückt plötzlich wieder in deinem Rücken, auch wenn sich deine Lungen noch weigern, Sauerstoff aufzunehmen.
Vor deinen Augen, der grellgraue Himmel eines Morgens, den du nicht mehr erwartet hast. Und das zarte Gesicht eines Jungen an der Schwelle zum Mann. Er spricht zu dir, atmet schwer. Ob es dir gut geht. Du schweigst, bist noch unter denen, die nicht mehr sprechen. Ob du verletzt bist, will er wissen. Was du dir dabei gedacht hast, fragt er, was hast du dir nur dabei gedacht? Lange sieht er dich an, dann weint er. Da bricht etwas in dir auf und auf deinen nasskalten Wangen spürst die Wärme deiner eigenen Tränen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | blumenleere
cut
[…] mangue manguea manguea manguea
manguea mangue manguea manguea man-
guea manguea respira respira respira respi-
ra […] mangrove; moor mother
exerziere oder exorziere stellungen eingewoben
am glaskasten kribbelst durch diesen ameisenbau
du krabbelst du reachin‘ for infinite urbanisation
models ueber aufschlaemmungen grauer kadaver
krass versponnene netzwerkallueren anticipating
the moment when our words become dead meat
hinterm zenit transhumanistischer weisen lauern
klingen knirschen die uhren voll gedaechtnissand
have their holes been plugged with sad memories
entgleiten dir die bewegungen gen imaginationen
virtual spaces fernab der etymologie des zimmers
glitched deine haptik unter provokanten aktionen
wider texturen deren zweck hoechstens aeuszerst
vage an grenzen abstecken & pretending to create
nice ambiences visuelle sphaerenklaenge erinnert
total synaesthesis as a curse of bold determination
laws baustellen die in topologien uns ueberlappen
induce the need to synchronize to feel acceptance
to obey in order to fit in immerhin noch ein raum
den du einnehmen darfst auch wenn du dich dann
verformen zerreiszen neuorganisieren musst dort
wo einige andere ihre beduerfnisse stillen quellen
lippen aus subordinierten ritzen & u sing to urself
what morbid methods but maybe it‘s all about sex
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Camilla Lindner
Plastikhandschuhe
Wie zwei genutzte Plastikhandschuhe liegen sie da, die Hände meines Vaters. Liegen da auf dem weißen Tuch und sind ungewöhnlich hell. Ich nehme meine Hände und lege seine Hand in meine. Sie sind kalt. Dann beuge ich mich mit dem Kopf über sie, sie scheinen durchsichtig – kann ich durch sie hindurchschauen? Meine eigenen Hände werden feucht, mit dem Daumen schiebe ich die Feuchtigkeit Richtung Finger. Es ist wie Schnee vom Gehweg räumen, verbunden mit der Hoffnung, darunter etwas Neues zu entdecken und dann die Erkenntnis, wieder einmal auf Asphalt zu schauen. Ich beuge mich noch tiefer, drücke meine Augen auf die Hand meines Vaters.
Ich sehe ihn, die Hände umgreifen einen grünen Schwamm. Das Grün bewegt sich über braune Fliesen, es wischt hin und her und hin und her und hin. Grün und braun vermengen sich. Die Bewegung hat etwas Spielerisches, meine Augen folgen dem Grün und irgendwann werfe ich mich auf es, sage „ich habs“ und mein Vater zieht langsam seine Arme unter meinem Körper hervor. Er legt das Grün in einen Eimer voll Wasser, taucht das Grün hinein, wringt es aus und legt es wieder auf den brauen Boden. Hin und her und her und hin. Es kratzt leise, weiße Schaumbläschen bilden sich an der Seite des Schwamms und meine Augen folgen den Blasen.
Ich puste in meine Hände, sie sind wieder feucht geworden. Ich puste und puste und beobachte dabei die Bläschen. Mein Vater bewegt seine Hände, jetzt strömt mein Atem auf den Boden, dahin wo die Hände sich bewegen und der Atem wickelt sich um das Grün. Ein paar Bläschen lösen sich, fliegen in der Höhe. Dann lösen sie sich auf.
Ich drücke die Hände meines Vaters, lege meine Hände in seine Handfläche. Fahre die bläulichen Adern mit meinen Fingern entlang, die Adern sind endlos und verzweigt. Ich lege meinen Kopf an die Adern und höre es plätschern und rauschen. Der Eimer fällt um und das Wasser verteilt sich auf dem braunen Boden. Wir ziehen Gummistiefel an und ich bringe das Wasser zum Spritzen. Es riecht nach Chlor. Mein Vater nimmt von der Wand einen Besen, hängt darüber einen grauen Lappen und fährt mit dem Besen über die nasse Fläche.
„Schau, Papa“, sage ich und lege mich mit dem Körper auf den nassen Boden, bewege Arme und Beine vor und zurück, so wie beim Schwimmen, „schau“ rufe ich und paddle immer schneller. Die Hände meines Vaters umgreifen mich am Bauch und auf einmal ist es, als ob ich fliege, aber ich schwimme weiter und mein Vater hält mich in der Luft mit den Plastikhandschuhen und den Gummistiefeln und bald bin ich außer Puste.
Er setzt mich auf einen Holzhocker an der Wand und bewegt wieder den Besen über die brauen Fläche. Ich bleibe auf dem Hocker sitzen, wie am Schwimmbeckenrand sitze ich da, die Hände umschlingen die Beine. Ich habe Hunger.
Mein Vater stellt den Besen in den kleinen Schrank neben der Wand mit weißen Fliesen. Er zieht die Handschuhe von seinen Fingern und legt sie über den Seitenrand des Eimers. Die Handschuhfinger schauen auf den Boden. Zwei Tropfen fallen von den Spitzen.
Mein Vater geht zum Waschbecken, über dem ein Metallregal hängt und auf dem Blechschüsseln stehen. Er nimmt sich ein Seifenstück und seift die Hände ein, mehrere Minuten lang. Dann lässt er Wasser darüber laufen und es bilden sich Bläschen an der Stelle, an der das Wasser auf Haut trifft. Er nimmt das weiße Leinhandtuch zwischen die Hände und tupft sie langsam trocken, fährt mit dem Stück Stoff über Handflächen, zwischen die Finger, dann über seine Fingernägel. Er legt das Handtuch ab, zögert, dreht den Wasserhahn nochmals auf, seift die Hände wieder ein, diesmal auch die Unterarme, wäscht sie wieder ab, schüttelt das Wasser von den Fingern, trocknet die Hände. Er zeigt auf das Waschbecken, auch ich wasche mir die Hände, zweimal hintereinander, dann nimmt er meine rechte Hand in seine linke, zieht mit der rechten Hand die Türe zu. Draußen an der Türschwelle greift er in seine Manteltasche und gibt mir ein großes, weißes, rundes Brötchen. Es ist so hell wie seine Haut und ich stecke es in meinen Mund, beiße mit den Zähnen hindurch.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Max Rauser
Unserzwei
I
Okay, aber was ist wirklich passiert? Die Nacht fiel vom Himmel, schlug auf dem Boden auf und sprang gleich wieder einige Meter zurück in die Luft. Um 23 Uhr ein Kaltgetränk, es verbesserte die Stimmung tatsächlich. Das Wissen um alte Brunnen als Goldquellen brachte sie um Schlaf und Verstand. Sie tanzten einen Ringelreihn, sprangen dann ins Auto und fuhren Richtung Obsoleszenz in die Zukunft, wo sie in eine U- oder S-Bahn umstiegen und sich endlich als Elektronen im großen Strom fühlen konnten. Später betäubten sie sich mit Bier und Cannabis und gingen unter dem Betriebslämpchen eines riesenhaften Mixers schlafen. Das war das Wochenende.
II
Unserzwei
machen eine Rolle vorwärts
Richtung Spiel, und verreisen
nach Diktat.
Unserzwei
schlagen der Nähe
zwischen Liebenden
ein Schnippchen, begraben
vorm Zubettgehen den Hund
und vergessen, wo er liegt.
Unserzwei
leben ihre Viten,
bis es ihnen lange genug gefallen hat,
dann wechseln sie hinter einer Kurve die Pferde
und rangieren im Rückwärtsgang davon.
Unserzwei
sind schon wieder zuhause,
waren so schnell, dass
man sie aus einem Zug, der
in Gegenrichtung unterwegs ist,
noch auf der Straße laufen sehen kann.
III
Unserzwei
gehen spazieren
in leichtem Regen.
Unserzwei
vergessen
sich anzurufen.
Unserzwei
senden einander
beflissene SpraNas.
Unserzwei
fotografieren ab und
zu ihr Essen.
Unserzwei
fahren Monat
um Monat Zug.
Unserzwei
versuchen sich
an spitzen Namen.
Unserzwei
bieten gerne
noch mehr Essen an.
Unserzwei
ziehen unzufrieden
die Decke über sich.
Unserzwei
sagen einander
strenge „Schlaf jetzt“.
Unserzwei
haben voneinander
wenig Ahnung und fragen verzweifelt
„Worüber sprechen wir morgen?“
Unserzwei
lassen sich
zugedeckt anderthalb Minuten
einer Ewigkeit gehen
und weinen nur wenig,
wenn man sie weckt.
IV
Als die Ringe getauscht,
die Wohnung gemietet,
der Van ausgebaut,
der Landstrich befriedet,
die Tickets gekauft
und die Kinder auf dem Weg zu ihnen waren,
trennten sie sich.
Einer zog auf die andere Straßenseite
und seitdem trägt der Hund,
von dem sie beide nicht lassen können,
ihre bitteren Briefe hin und her,
möge doch der Laster ihn endlich erwischen.
V
Okay, aber was ist wirklich passiert? Der Anfang war angemessen glorreich, aber als sie beide nicht mehr wussten, wer sie eigentlich waren, hatte das Spiel an Witz verloren, und die Zweisamkeit war leere Form geworden. Das Wörterbuch gab den Gefühlen den Ausdruck und das gegnerische Gesicht wurde blinde Wand. Sie töteten einander zuerst in effigie, dann faktisch, dann postfaktisch, dann wurden sie gute Freunde. Als sie zurück auf den Markt kamen, waren sieben verflixte Jahre vergangen. Die Nacht fiel vom Himmel, schlug auf dem Boden auf, und nach einigen samtigen Stunden trat an beide ein neuer Morgen heran.
Das war ihre Jugend gewesen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Marc Späni
Der Klang der Stille
Stille könnte die Lösung sein, absolute Stille. Wenn nur nicht in der Stille, gerade in der absoluten Stille erst diese Androhung von Lärm steckte, in der Stille wächst sogar die Vorstellung eines Geräuschs ins Unerträgliche, zu einem Grad, der denjenigen des realen Geräuschs um ein Vielfaches übersteigt. Das Einschalten der Kaffeemaschine etwa, diese Kakophonie von Schaben, Klicken, Mahlen, Reiben, Zischen: Jede Komponente für sich genommen ein kleiner Stich, zusammen schon richtig schmerzhaft, in der Vorstellung aber die reinste Folter. Das Hoch- und Niederfahren der Sonnenstoren, der Geschirrspüler, unregelmäßige Schritte auf der Treppe, das Öffnen und Schließen der Zimmertüren. Am schlimmsten: menschliche Laute in all ihren Facetten. Wäre es gleichmäßig, permanent, ginge es vielleicht noch an, aber es ist eine chaotische Abfolge der unterschiedlichsten Teilgeräusche – Tausende, Hunderttausende, wahrscheinlich mehr – und jedes reißt mich von Neuem aus der konzentrierten Arbeit. Ich bin an der Buchführung, an einem Bericht, an einer Statistik, da schreit das Baby, meine Frau murmelt beruhigende Worte, extra leise, aber dadurch erst recht störend, es folgen Schritte, das Schließen von Schranktüren, Geschirrklappern, der Wasserhahn. Und selbst wenn es tatsächlich einmal ganz leise ist, warte ich nur auf das nächste Räuspern, Klirren, Rauschen, Klicken oder Scheppern, und wenn sie mir diesen Wahnsinn ersparen und mich in meinem Home Office oben in Ruhe lassen will, dringt zuerst das Rascheln der Jacken und Mäntel zu mir hoch, das Klimpern von Kleiderbügeln an der Garderobenstange, das Zuschlagen von Schranktüren, die Geräusche des Schlüssels im Türschloss, dann Schritte auf dem Kies, Autotüren, das Anlassen des Motors, aber auch dann, wenn ich ängstlich in die Stille lausche, dauert es nicht lange und fremde Kinder lärmen auf dem Trottoir, der Bus rauscht vorbei, ein Auto hupt oder die Müllabfuhr fährt mit unerträglichem Krach vor.
Dabei muss ich funktionieren, muss meinen Job machen, ich brauche Konzentration, muss eins werden mit meinen Zahlen, meinen Abrechnungen, den Konten und Bilanzen. Absolute Stille wäre nur die angstvolle Erwartung der nächsten Störung, außerdem völlig illusorisch. Nein, die Lösung liegt darin, die unregelmäßigen, unkontrollierbaren Geräusche durch gleichmäßige, kontrollierbare zu überlagern, um aus dieser zermürbenden Erwartung neuer Störungen zu kommen. Radio zum Beispiel geht anfänglich ganz gut, dieser immergleiche Strom von inhaltslosem Schwatzen und anspruchsloser Musik. Alle paar Monate optimiere ich die Senderwahl, stoße auf Radio Swiss Jazz, bei diesem Geplänkel dauern immerhin die Stücke länger, aber irgendwann ist jedes Stück fertig, und schon zuvor warte ich verkrampft darauf, dass nach den letzten Tönen die unkontrollierbaren Geräusche in die kurze Leere platzen, dass unten die Tür geht, ein Kind von der Schule kommt, mit Freunden telefoniert, Videospiele spielt. Ich bin zu Hörbüchern übergegangen, dann zu längeren Hörspielen, die haben weniger Leerräume, nach weiteren Jahren zu Opern, zuerst wahllos, Berlioz, Verdi, Mozart, wie sie alle heißen, dann entdecke ich Wagner. Es ist zwar scheußlich pathetisch, und überhaupt mag ich keine klassische Musik, aber eine Wagneroper hält mich fünf Stunden an der Arbeit, die Berichte und Auswertungen fließen nur so aus mir heraus, ja letzten Endes hat bei der ersten Restrukturierung Richard Wagner wohl meinen Arbeitsplatz gerettet.
Die Chefs oben sind nämlich zufrieden mit meiner Leistung, aber ich weiß, das reicht nicht, ich muss noch produktiver sein, die nächste Restrukturierung kommt, ich muss mehr tun als ich müsste, darf mich nicht ablenken lassen, gar nicht, nie. Nun ist es nicht so, dass die Wirkung eines einmal gewählte Klanghintergrunds über Monate andauert, nein, sie nutzt sich ab, mit der Zeit weiß man intuitiv, wo die Pausen sind, und schon wartet man ängstlich darauf, dass gerade dann eines der Kinder mit dem Wagen vorfährt, mit Partner und Kleinkindern unten Lärm macht, dass die Frau Freundinnen bewirtet, der Postbote klingelt. Immer müssen neue Lösungen her. Ich gehe kaum mehr nach unten, ich kann mir diese Auszeiten nicht mehr leisten, dafür bin ich mit den Jahren aber auch immer besser geworden, meine Berichte lassen keine Beanstandung zu, die zweite und dritte Entlassungswelle schwappt über mich hinweg, viele werden entlassen, ich bleibe. Entdecke irgendwann Youtube-Videos, auf denen stundenlang ein bestimmtes Musikgenre abgespielt wird, Hintergrundmusik für Hörspiele oder Filme: 10 Stunden Horrormusik, 15 Stunden Flamenco-Gitarre, ohne Unterbruch, das ist herrlich, ich steigere meine Effizienz gleich nochmals, werde mit über fünfzig sogar befördert, habe dadurch noch mehr zu erledigen, muss noch mehr Zeit für die Geräuschbewältigung investieren. Denn mit den Videos ist es nicht etwa einfacher geworden: Man muss sie zuerst finden, probehören, herunterladen, die Internetverbindung könnte ja mal abbrechen und man wäre dann dem ganzen Klangdschungel schutzlos ausgeliefert. Außerdem gibt es immer noch Steigerungspotenzial: Von den musikalischen Klangteppichen bin ich auf Geräusche gekommen: 15 Stunden Brandung, Wellen und Möwen, 12 Stunden Alpen mit Kuhglocken und dem Wind in den Tannen, Waldgeräusche in Endlosschlaufe, 10 Stunden fahrendes Auto, 12 Stunden das gleichmäßige Geräusch einer Waschmaschine. Ich nähere mich der Perfektion, auch wenn ich nur noch wenige Jahre arbeiten muss.
Dabei ist es mittlerweile im Haus selbst immer still. Seit die Kinder studieren oder selbst schon zu wichtigen Rädchen in der Maschinerie der Berufswelt geworden sind, seit sich auch meine Frau für ein neues Leben entschieden hat, könnte ich grundsätzlich wieder nach unten gehen, ich könnte sogar unten arbeiten, aber wenn der Ort einmal durch jahrzehntelangen Lärm infiziert ist, bleibt die Erinnerung und die Stille ist nur die Androhung weiteren Lärms und damit weit zerstörerischer als der Lärm selbst.
Wenige Tage vor meiner Pensionierung stoße ich auf ein neues Video: 10 Stunden Alltagsgeräusche eines Haushalts mit Kindern. Damit mache ich weiter, sobald ich offiziell im Ruhestand bin, man kann ja ohnehin nicht einfach aufhören.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | all caps
lauthals
ich trau mich nicht die töpfe zu säubern, die gläser die gabeln die löffel die tupper die dosen deinen letzten speichel wegzumachen, deine wimpern wegpusten zum staub, deine durchsichtigen fußabdrücke mit dem besen zu kehren, obwohl die straße längst darin übrig ist, zwischen die fliesen gekullert. deinen letzten speichel, den ich so lange vermisst und jetzt wieder misse, mein herz, worüber beugt sich meins, liebling deiner neurone wenn du dir müde den schlaf aus den augen wischst und deine haare zerzaust, wenn du mit müden füßen und durchlüfteten lungen abends durch deine wohnungstür eine sprachnachricht aufnimmst und summst
ich hab den schlaf gesammelt, den du dir aus den augen gewischt hast, hab alle wimpern geschluckt, die du weggepustet hast von meiner zunge in meine luft röhren reiniger kaufe ich nicht brauche ich nicht, weil ich bei jedem halskratzen deine wünsche schmeck en noch nach gelben gummistiefeln zwei paar an verandatreppen runtersteppen in den garten, ich trau mich nicht schon wieder auf etwas zu warten was in der spülmaschine bricht.
ich traue mir zu, dass ich mich an irgendwelchen scherben schneide, deshalb spül ich nicht ab, spür ich nicht hin, schreib ich dir nicht
liebesbriefe
weißt du hab ich oft genug und vorgetragen und immer hör ich dann münder sagen ich dich nicht
ich trau mich nicht mein handy auf laut zu machen, weil was wenn wer anruft und was wenn es bingt und was wenn es du bist und was wenn es klingt, als würde es dir egal sein als wäre das was, was du dich einfach traust
ich trau mich jetzt wieder auf die straßen, diese stadt gehört auch mir meine haut, die
lass ich mir nicht nehmen (nur auf den busbahnhof trau ich mich immer noch nicht ganz)
traue mich (nicht) zu weinen, wenn er bricht, es kullert rückwärts, weil ich außen sonst nicht ernst genommen sonst emotional bin, als wäre das was schlechtes, rückwärts der dammbruch meiner wirbelsäule, wenn alte wunden feuern in alle richtungen und ich decken für die feuer suche, stick dicht im rauch dicht es mir aus den augen quillt statt tropft, rückwärts läuft es meine kehle runter und tropft auf
die zeit zurück, in der wir
im dunkeln flüstern
wir nicht mehr wie tagsüber, weil nur noch wir uns hören können und wenn nur du mich hörst, kann ich gar nichts falsches sagen, wenn nur du mich hören kannst verrate ich dir lauthals, dass ich meine stimme hasse, aber wenn nur du mich hörst, bleibt das unter uns und vielleicht können wir tauschen?
zusammen tragen wir uns durch die stadt, wir trauen uns in jede straße, in jede dunkle gasse, die wir alleine nicht betreten würden, zusammen mit dir traue ich mich zurückzuschreien, wenn uns jemand f**tze aus dem autofenster zubrüllt, du zückst deine mittelfinger und ich traue mich das jetzt auch
das habe ich von dir gelernt und meine zunge, die habe ich dir zu verdanken und meine zähne, die auch. beißen haben wir zusammen gelernt und spucken mit energie, dass es vom pflaster zurückspritzt, winkel berechnet, in die richtige richtung
direkt auf die windschutzscheibe und es wird lauter gebrüllt und der motor aufgeheult und wir flüchten auf den fahrrädern durch die nacht aber hauptsache zurückgebrüllt, hauptsache zusammen
trauen wir uns in jede nacht in jede noch so dunkle ecke
das hab ich von dir gelernt, das nicht schlafen gehen müssen und dass es nachts genug gründe gibt wach zu bleiben und meine schlafstörungen, die hab ich dir zu verdanken
ich trauere nicht mehr um dich.
wir standen in meiner küche, als du gesagt hast, du findest das mit uns ist mehr so freundschaftlich und ich habe genickt, damit mein hals aufgeht und die tränenflüssigkeit sich auf meiner netzhaut gleichmäßig verteilt und bloß keine kleinen kügelchen bildet
ich traue meiner zunge nicht, wieso zitterst du, wieso verrätst du mich
ich traue meiner zunge nicht, weil sie manchmal so high pitched spricht, obwohl ich doch so masc obwohl ich doch so lässig wieso zitterst du wieso sprichst du nicht mich wieso brichst du das bild an solchen tagen trau ich mich nichts sagen dann mach ich mich sprachlos
an supermarktkassen, weil meine stimmbänder sich nach alten regeln anschlagen
alle regeln zerschlagen
das hab ich von dir gelernt
und meine zunge zeigen hab ich dir zu verdanken.
heute hab ich keinen empfang, ich schreib dir briefe aus lesbos, versprochen, ich trau mich jetzt
fang! hechte voraus und sag mir, ist es das, wo wir hergekommen sind
ich trau mich denn der blick zurück sagt vorne liegt mehr der blick zurück sagt zieh los mach dich auf
und ich trau mich das jetzt
irgendwann.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at