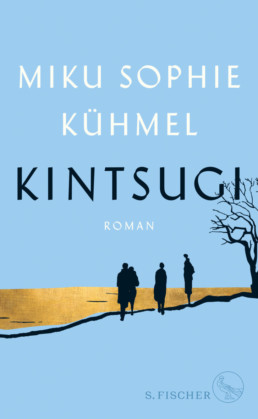freiTEXT | Franziska Wotzinger
derAndere
Gestern hab ich ihn gesehen, diesen Anderen. Er stand in einer Gruppe, mit ganz vielen. Viele Andere, hab ich noch gedacht. Was die wohl sagen, hab ich noch gedacht. Diese Anderen. Wie Zaunlatten standen sie da und zwischen den großen, runden Kaubewegungen meines Kiefers, pfiff ich leise Luft durch diese Latten. Als einer leicht zu schwanken begann und die anderen Anderen misstrauisch zu mir hinübersahen, hörte ich auf. Ich weiß noch ich habe mir gedacht, diese Anderen sind doch nicht so stabil, wie man gemeinhin denkt. So habe ich gedacht und meinen Apfel gegessen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Florian Kranz
spekulationsblase
am anfang warst da du, und
ich war wohl auch irgendwo.
unsere gemeinsamen pläne waren bald schon zerplatzt wie
zu große seifenblasen, die durch die gegend wabern als
schwabblige, triefende luft und
derer es dieser tage ohnehin zu viele gibt.
wenn du unten lagst, half ich dir auf, was trotz einiger
anstrengung auf dem glitschigen
boden nicht immer so ganz gelang und man
muss ja auch aufpassen: ich hätte mich fast verhoben.
dann habe ich die fischstäbchen in den kühlschrank gelegt,
die ringelblumen noch einmal gegossen,
meine schuhe angezogen,
den seifenblasenring fachgerecht entsorgt und dann
warst da du. doch wo war
ich?
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anja Christ
Flughafen CDG
Ich stehe im Ankunftsbereich von Gate 2F. Ich habe noch nie jemanden vom Flughafen abgeholt. Mir kommen Filmszenen in den Sinn. Love actually. Ja, das war’s eigentlich, mir kommen nur Szenen aus diesem Film in den Sinn. Hat das automatisch eine romantische Konnotation, jemanden vom Flughafen abzuholen, am Gate auf ihn zu warten? Vielleicht hätte ich dann Blumen mitbringen sollen. Besser Kaffee. Mit zwei Papp-to go-Bechern in der Hand warten, das hat Filmcharakter. So ein Quatsch, ich will ja gerade vermeiden, dass es romantisch wirkt. Und ich bin gegen Einwegbecher. Also stecke ich die Hände in die Manteltasche und warte. Er schrieb, er stehe gerade bei der Sicherheitskontrolle an und dann müsse er noch auf sein Gepäck warten. Mich wundert die Sicherheitskontrolle, schließlich ist das ein innereuropäischer Flug. Ich denke an das Wort „Schengen“ und daran, dass ich seinen Klang lustig finde.
Hier sind viele Leute, die warten. Sie haben diese typischen Schilder dabei, wo ein Name oder eine Institution drauf steht, Abholserviceschilder. Sowas hätte ich basteln und mitbringen können. Natürlich nur aus Spaß, denn wir kennen uns und werden uns wiedererkennen, selbst wenn unser letztes Treffen schon etwa drei Jahre her ist. Ich bemerke, dass Papierschilder out sind. Die Meisten haben ein Tablet dabei und halten das hoch. Zuerst lache ich darüber und finde das ein bisschen bescheuert. Andererseits spart man so das Papier, das man für den nächsten to go-Becher aus Pappe verwenden kann. Hat also durchaus auch seine Vorteile.
Es macht ziemlichen Spaß, am Gate zu stehen, dort ankommende und wartende Menschen zu beobachten. Vielleicht komme ich nächste Woche mit einem Schild wieder (aber eins aus Papier) und da schreibe ich irgendeinen Namen drauf und stelle mich ans Ankunftsgate und warte. Und ich würde den ganzen Tag warten und niemand käme, aber ich hätte eine wunderbare Rechtfertigung, wieso ich da stehe: Ich warte auf die Person auf dem Schild, aber sie ist noch nicht angekommen. Ein anderer Wartender würde mich ansprechen: „Sie warten auch schon ganz schön lange, hat der Flug Verspätung?“ „Ich fürchte, ja.“ Und wir würden ein paar Minuten plaudern, solange bis seine Person ankommen und er mit ihr gehen würde. Irgendwann am späten Abend würde ich resigniert mein Schild einpacken und mich auf den Nachhauseweg machen. Der Flughafenangestellte (ich wüsste nicht genau, was sein Job ist, deshalb wäre er einfach „der Flughafenangestellte“) würde mich fragen: „Niemand gekommen?“ Und ich würde antworten: „Nein, ich fürchte ich wurde versetzt.“
Ich finde, man kann zwei Typen von Ankommenden unterscheiden: einerseits die Träumer, andererseits die Realisten. Die Träumer kommen durch die sich automatisch öffnenden Türen und schauen sich um, nehmen aber die Wartenden gar nicht richtig wahr, außer sie wissen, sie werden abgeholt. Ansonsten sehen sie leicht verpeilt aus, verschlafen, verstrubbelt, etwas neben sich stehend (das sind vielleicht die von den Langstreckenflügen mit Zeitverschiebung) und nun gucken sie in die Flughafenhalle, stolpern durchs Gate in sie hinein, sind aber im Kopf noch nicht ganz da. Die Realisten andererseits, die sind sich sehr bewusst, wo sie sind. Sie blicken die Wartenden entweder direkt an, oder sie schauen mit Absicht nicht hin, weil sie sich angestarrt fühlen und ihnen das unangenehm ist. Genauso wenn der automatische Türöffnenmechanismus nicht richtig funktioniert und ihnen die Tür, kurz bevor sie hindurchgehen wollen, wieder vor der Nase zuklappt. Wenn die Tür dann doch wieder aufgeht, nachdem sie abrupt abgebremst haben, verdrehen sie genervt die Augen und gehen hindurch. Es ist ihnen peinlich, dass sie fast gegen die Tür gelaufen wären und die Wartenden das gesehen haben. Die Realisten schauen sich auch ein wenig um, aber viel flüchtiger, denn sie wollen möglichst schnell weg, um nicht weiter angestarrt zu werden. Zugegeben, diese Einteilung ist etwas grob, aber im Großen und Ganzen tragfähig. Sie trifft aber nur auf Alleinreisende zu, die von niemandem abgeholt werden.
Gerade kommt ein Pärchen an und die beiden tragen das gleiche Shirt, rot und dunkelblau gestreift. Ich hasse sowas. Aber eigentlich ist es mir egal, ich sage nur deshalb, dass ich das hasse, weil ich gelernt habe, dass das cool ist, Pärchen nicht ausstehen zu können. Ich frage mich, ob die beiden häufiger dasselbe Outfit tragen und ob sie noch mehr gleiche Sachen haben. Zahnbürsten in derselben Farbe zum Beispiel.
Ich stehe nun schon fünfzehn Minuten hier und ein gleichmäßiger Singsang hat sich in mein Hirn gegraben. Jetzt höre ich zum ersten Mal aufmerksam hin: „Taxi officiel sortie 11.“ (Ja, wir sind in Frankreich. Und obwohl ich es für prätentiös halte, Dinge in Texten unübersetzt zu lassen, nur um die Folklore nachzuzeichnen und am besten noch damit anzugeben, dass man diverse Fremdsprachen spricht, lasse ich das so stehen.) „Taksiofisiel sortiõz.“ Ich drehe den Kopf und sehe den Flughafenangestellten. Er hat eine kleine Weste an und verweist alle Neuankommenden auf den offiziellen Taxistand bei Ausgang elf. Wie lange am Stück muss er das machen? Muss man bei solch repetitiven Aufgaben häufiger Schichtwechsel machen, um nicht aggressiv zu werden? Ich lache über meine eigene plötzliche Idee: wie lustig wäre das, sich ebenfalls eine kleine offizielle Weste anzuziehen und sich direkt neben ihn zu stellen. Und immer wenn neue Reisende ankommen und er sagt: „Taksiofisiel sortiõz“, würde man direkt hinterher sagen: „Taksiofisiel sortinöf“. Taxi officiel sortie 9. Fraglich wäre, ob man zuerst von dem Angestellten aufs Maul kriegen, oder vom Sicherheitspersonal entfernt werden würde. Ich muss diese zwei Ideen kurz aufschreiben, bevor er ankommt: „Schild hochhalten“ und „Taxi-prank“.
Wie schnell bekommt man Hausverbot am Flughafen? Würde es jemandem auffallen, wenn ich von nun an mehrmals die Woche hier wäre und am Gate Menschen beobachten würde? Wäre das verdächtiges Verhalten und sie würden mich anhalten und verhören? Fällt so etwas zuerst dem Wachpersonal, das durch den Flughafen patrouilliert, auf, oder der Person, die regelmäßig die Überwachungsvideos checkt? Gibt es eine Person, die regelmäßig die Überwachungsvideos checkt? Ich habe wieder Filmszenen im Kopf. Dieses Mal aber keine bestimmten, sondern mehr so generell als Topos. Der Typ, der vor dem Computer sitzt, in einem Raum ohne Tageslicht. Das bläuliche Licht des Bildschirms spiegelt sich in seinen Brillengläsern, deshalb sieht man seine Augen nicht richtig und ich weiß nicht genau, welcher Film es ist.
Nun müsst er eigentlich jeden Augenblick durch die Türen kommen, die Anzeigetafel sagt, dass die Gepäckausgabe seines Fluges beendet ist. Jedes Mal, wenn die automatischen Türen aufgehen und jemand herauskommt, bin ich für eine Sekunde lang aufgeregt. Um das klar zu stellen: Ich habe wirklich keine romantischen Gefühle für ihn und das hier ist auch keine Geschichte darüber, wie ich mir meine romantischen Gefühle für ihn zuerst nicht eingestehen will, sie am Ende aber doch ganz deutlich sehe. Es ist tatsächlich die Flughafenatmosphäre, die für diese Aufregung sorgt. Vielleicht passiert das nicht, wenn man das dauernd macht. Der Mann im Anzug neben mir, der mit einer Hand sein Tablet hochhält, in der anderen sein Handy hat und mit dem Daumen durch seinen Facebook-Feed scrollt, sieht nicht besonders aufgeregt aus. Geht das auf Dauer nicht ins Handgelenk, wenn er das Tablet nur mit einer Hand hochhält? Vielleicht ist es ultraleicht.
Ein kleines Mädchen kommt mit ihrer Mutter durch die Türen, sieht ihren wartenden Vater und rennt auf ihn zu, ruft freudig „Papa!“ und springt ihm in die Arme. Hat sie das auch in Love actually gesehen, oder hat sie das bei ihren Eltern gesehen, die es in Love actually gesehen haben? Oder ist das eine zutiefst menschliche Verhaltensweise?
In einer Ecke steht ein knutschendes Paar. Er hat seine riesige Reisetasche zwei Meter neben sich abgeworfen. Glückselig unterbrechen sie ihre Küsse immer wieder für lange Umarmungen. Ich habe leider seine Ankunft verpasst und frage mich, ob sie sich zuerst geküsst, oder zuerst umarmt haben. Nun starre ich auf seine Reisetasche. Schon etwas riskant, die achtlos zwei Meter neben sich liegen zu lassen. Ich würde sie gerne näher an seine Füße heranschieben, aber das würde die beiden eventuell irritieren. Der Mann unterbricht die Umarmung und bückt sich nach seiner Reisetasche. Ich kann beruhigt den Blick abwenden.
Wenn ich zu viel durch die Gegend schaue, verpasse ich den Moment, in dem er durch die automatischen Türen kommt. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich ein breites Grinsen auf mein Gesicht legt, sobald ich ihn sehe. Schließlich ist das so eine Situation mit dem Warten und der Aufregung und wahrscheinlich ist ein besonders großes Lächeln dann eine physiologische Reaktion, um Stress abzubauen. (Ich habe keine Ahnung von biochemischen Körperprozessen.) Gleichzeitig warte ich aber seit einer halben Stunde genau darauf, dass er durch diese Tür kommt. Ich kann also gar nicht umhin zu hoffen, dass ich den Moment nicht verpasse. Ihn nicht durch die Tür kommen zu sehen, wäre unbefriedigend. Ich fixiere also die Türen, abwechselnd, denn es gibt vier davon. Es wundert mich, dass nicht tatsächlich regelmäßig Menschen dagegen knallen, denn dass sie kurz bevor jemand hindurch will wieder zu gehen, kommt relativ häufig vor. Wenn er gegen eine der Türen knallen und sich dabei die Nase brechen würde, dann müssten wir erstmal ins Krankhaus fahren. Das würde garantiert jegliche unerwünschte romantische Stimmung ersticken. Ah, ich sehe ihn, da ist er. Ich muss Stift und Papier wegpacken und ihn begrüßen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Werner Weimar-Mazuhr
teheran
für Granaz Moussavi
eine wegwarte legten sie mir in den mund
die sich verlief
im schatten des waldes
fragte sie einen ziehenden wolf nach dem weg
über den glucksenden fluss sprang das tier mit mir
als sie mich fanden
später
im niemandsland
wunderte sich niemand über das büschel haare unter dem fingernagel
und den fetzen fell in der hand
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sebastian Schmidt
Am Hackelklotz vom Meisenast
Immer wenn draußen das Hupen losgeht fühle ich mich gemeint und renne zum Fenster.
In den meisten Fällen fahren die Autos vorbei als sei nichts gewesen.
Have you had your brain whipped, too?, tippe ich, zurück. Vielleicht mache ich das anstatt Sauna oder Hanteln heben. Tippen und zum Fenster rennen wenn es hupt. Wenn mir unter der Dusche etwas einfällt tippe ich manchmal sehr lange nackig.
Vor wenigen Tagen habe ich betrunken versucht, mit einem Radiergummie die Nachrichten von meinem Rechner zu radieren. Natürich war das Show und es sollte witzig sein und ich wollte damit meinen Kumpel Älex beeindrucken, weil der vielleicht bald wieder nach England muss. Den Brexit rubbern, lachten wir. Aber der Bildschirm ist nun kaputt. Mein Laptop ist erst vier Jahre alt. Idiet, hatte Älex gesagt.
Da bin ich 33. In meinem Gehirn steckt ein Stock, deshalb vielleicht die Frage mit der Peitsche. Vielleicht ist aber auch der Bademantel schuld, der unten im Hof immer wieder mit erbarmungsloser Härte auf den Betonboden eindrischt. Ich bin gespannt, wer das länger aushält.
Do you mean 'Have you had your brain wiped, too?' steht auf dem Monitor des anderen Computers, der im Nachbarzimmer steht, an einem improvisierten Schreibtisch. Der Weg zum Fenster ist nun länger, jedenfalls der Weg zum Fenster, durch das man sehen muss, um auf die Straße zu sehen. Ich bin zu bequem um den Computer in das andere Zimmer zu bauen. Ein richtiger Tower, tausend Kabel. Jedenfalls kann man in dem Zimmer jetzt besser aus dem Fenster rauchen wenn man will. Man sieht direkt in die Natur. Es ist eine andere Ecke des Hauses. Ich rauche nicht mehr.
When will your kids be back?, fragt Älex später am Telefon.
About six. We could meet in the park at half past?, sage ich.
Sounds okish mate. Would you bring your …?, fragt Älex.
'Course., sage ich.
Diesmal bin ich wirklich gemeint als es hupt. Ein schwarzer SUV hält direkt vor der Haustür. Ich setzte/schmeiße mein Basecap auf den Kopf über die Schmalzfrisur. Als ich unten ankomme winkt mir eine blonde Frau vom Fahrersitz aus zu, wirklich adrett, aber im Jogginganzug. Dann setzt sich das imposant große Auto in Bewegung. Meine Kinder begrüßen mich mäßig. Beim Hochlaufen kann ich durch das Fenster im Treppenhaus den Hackelklotz im Hof sehen, der sich hinter dem tiefhängenden Meisenast versteckt. Meisenast, weil da immer so viele Meisen draufsitzen. Fast immer zwischen zwei und vier. Kohlmeisen, wissen sogar schon die Kinder. Zwei Hippies sitzen auch im Hof, direkt neben dem Hackelklotz, und versuchen mit zwei Ästen Feuer zu machen. Indem sie die Äste aneinander reiben. Ein Stock höher läuft Hip Hop.
Wir treffen uns gleich mit Älex im Park., sage ich.
Jaaa!, sagt Jojo.
Friderike muss jetzt Abendessen, deshalb sind wir schon zurück, sagt Attan.
Ich weiß, sage ich. Wir essen etwas im Park. Älex bringt etwas mit., verspreche ich.
Ich packe heimlich Zigaretten ein. Eine schöne Decke. Außerdem ... . Zwei Biere. Am Fenster hupt es wieder aber diesmal ist nichts zu sehen. Karotten für die Kinder.
I mean whipped in the sense of torturing, in a masochistic way., tippe ich schnell, bevor es losgeht.
Älex hat nun einen dicken Bart. Er ist sehr weiß, der Älex, deshalb gibt ihm der Bart wirklich Farbe und er sieht gesünder aus als sonst. Er ist aber immer noch sehr dünn. Wir sind schon eine sehr lange Zeit Freunde, Älex und ich. Unsere Freundschaft ist älter als meine Kinder.
Wie gekt ez oiche, Kinder?, fragt Älex dann Jojo und Attan.
Es wird gelacht, vor allem weil Älex immer noch schlecht Deutsch redet. Wir spielen Federball und Fußball bis Attan nicht mehr will. Und essen zu Abend bis Jojo und Attan satt sind. Es ist ein kindischer Abend, weil es warm und sonnig ist. Älex macht Tier-Choreographien und springt über den Rasen. Es sieht scheiße und peinlich aus, aber wir lachen uns tot. Später lesen Älex und ich etwas auf der Decke vor und trinken Bier. Aus den Lautsprechern an den Bäumen verklingen die letzten Vögel und es dunkelt vor sich hin. Auch die Autos sind nicht mehr zu hören, schon eine ganze Weile nicht mehr.
Happy birthday mate, flüsterte Älex, und gibt mir einen Kuss auf die Wange.
And thin ice, why?, fragt er flüsternd, da waren die Kinder schon auf der Decke eingeschlafen. What did you mean with 'in between'?
Maybe because of the Hackelklotz and the SUV, flüstere ich. Sie sind alles Hackelklötze.
Da musste Älex lachen und prustete etwas Bier auf Jojos Bein.
Nice German word, but i don't understand., flüstert Älex als er sich erholt hatte. So du hazt wunsche für dein geburtztach? As a present?
Ich wünsche mir ein Signature T-Shirt von Clemens Setz, mit einer Figur drauf, oder ein Hemd, das von Christian Kracht designt wurde., sage ich, lache. Aber Älex versteht das nicht.
So bleibt es eine ganze Weile still in der wir Bier nippen und ich meine Zigaretten heraushole und mir eine anstecke. Älex biete ich auch eine an.
Oh, you brought some. How nice., sagt Älex.
Siehst du, was für eine Scheiße. It's a shit, a shame, sage ich.
Älex und ich lachen unanständig viel, denn es ging immerhin ums Rauchen. Mir fällt zum letzten Mal an diesem Tag der Hackelklotz in unserem Hof ein und die Hippies und als ich hinter den Busch gehe finde ich eine Stelle mit einem abgesägten Baumstumpf und ich stelle mir vor wie ich auf den Hackelklotz uriniere, während ich auf den Baumstumpf uriniere.
Heute trage ich Hemd obwohl ich nur zu Hause damit rumrenne, aber das ist gut so. Wenn ich ein Hemd trage kann ich mich besser konzentrieren, bilde ich mir ein. Natürlich ist das ein riesen Schwachsinn, aber es funktioniert. Gleich nach dem Duschen kleide ich mich an. Zum einen, weil ich unbedingt ein Hemd anziehen möchte, aber auch weil ich unter Dusche keinen Einfall hatte, der es Wert war nackt niedergeschrieben zu werden. Das ist kein gutes Zeichen, denke ich, aber ich habe ja das Hemd. Mit dem Hemd wird die Übersetzung fertig, wenn sie fertig werden muss, da bin ich mir sicher. Und alle werden zufrieden sein.
Ich öffne das Fenster und rauche frei mit Blick aufs Grüne. Als ein Auto hupt, lege ich die brennende Zigarette auf den Fenstersims und renne zum Fenster im Nebenraum. Es ist Anna, die mit beiden Händen wedelt. Ich wedele zurück. Anna wollte mir nur etwas in den Biefkasten werfen, das weiß ich. Das macht Anna oft so. Dann hupt sie, um mir Bescheid zu geben, dass sie etwas in den Briefkasten geworfen hat, so wie jetzt.
Ich muss weiter tippen!, rufe ich herunter zu Anna und lache dabei.
Dann fährt Anna weiter und ich gehe zurück. Meine Zigarette wurde vom Sims in die Natur geweht, was ich sehr bedauere. Jetzt liegt sie neben einer Baumwurzel und glimmt vor sich hin. Ich hoffe, dass sie einer der Hippies findet und fertig raucht. Aber sie verlassen ihren Platz so gut wie nie.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Die Wahrheit ist ein vages Ding und schwer zu greifen
Die Wahrheit ist ein vages Ding und schwer zu greifen
Rezension
Kintsugi ist eine japanische Keramikbearbeitungsmethode, in der Brüche oder kaputte Stellen vergoldet, statt versteckt werden. Das soll die die Wertschätzung des Fehlerhaften, die Schönheit im Defekten ausdrücken. Fehlerhaft und defekt sind auch die vier Protagonist*innen in Miku Sophie Kühmels gleichnamigen Debüt, das im August bei S. Fischer erschienenen ist. Aber auch ihnen wird viel Wertschätzung entgegengebracht: Als Vexierspiel angelegt und von Dramoletten durchwachsen, die die Handlung zwischen den einzelnen Kapiteln vorantreiben, führt uns die Autorin durch wechselnde Erzählperspektiven
Kintsugi beginnt etwas schwer und konstruiert, wird aber noch im ersten Viertel ruhiger und entwickelt gleichzeitig eine irre Sogwirkung. Kühmels Figuren sind gleichsam liebenswert und verabscheuungswürdig, süß und unsympathisch – ein Emotionscocktail, dem man sich als Leser*in schwer entziehen kann. Vier Menschen, drei Männer und eine Frau, verbringen ein Winterwochenende gemeinsam am See.
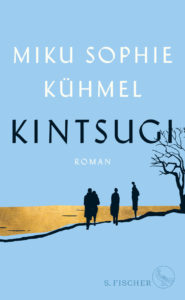 Max und Reif sind seit zwanzig Jahren ein Paar, nehmen sich in ihrem Ferienhaus regelmäßig Auszeiten von ihren Leben als Künstler und Universitätsprofessor für Archäologie – manchmal auch von ihrer Beziehung. Und das, obwohl sie von allen beneidet werden: Für ihre Liebe, die schon so lange hält, und die Harmonie, obwohl oder gerade weil sie nicht verheiratet sind. An diesem Wochenende begleiten sie ihr langjähriger Freund Tonio und dessen studierende Tochter Pega, die für Max und Reif wie ein eigenes Kind ist. Pega sieht das mittlerweile anders und überhaupt ist keine der Beziehungen so, wie sie auf den ersten Blick scheint. Da geht es viel um Liebe: Zwischen Mann und Mann, Mann und Frau, Vater und Tochter, Kumpel und Kumpel.Es fließen Tränen, brechen Teetassen und Herzen. Manches kann man kitten, anderes nicht. Oft verschwimmen Vergangenheit und Gegenwart. Da geht’s um Abhängigkeitsverhältnisse, finanziell, gefühlsmäßig. Um Schuld, um Versäumnisse – aber auch, wie man am besten betrunken von einem zugeschneiten Hochstand im Wald herunterkommt, ohne sich etwas zu brechen. Es entwickeln sich Dynamiken: Konflikte brechen aus, manche neu, manche seit Jahrzehnten am heimlichen Brodeln. Miku S. Kühmel kann bodenständig und authentisch ohne Kitsch – aber mit schönem Pathos – über Liebe schreiben. Die Beziehung zwischen Reif und Max kann stellvertretend für alle Beziehungen gelesen werden, so klar sind die Bilder, die die Autorin darstellt, so kunstvoll verpackt sie Romantik und Tragik im Alltäglichen:
Max und Reif sind seit zwanzig Jahren ein Paar, nehmen sich in ihrem Ferienhaus regelmäßig Auszeiten von ihren Leben als Künstler und Universitätsprofessor für Archäologie – manchmal auch von ihrer Beziehung. Und das, obwohl sie von allen beneidet werden: Für ihre Liebe, die schon so lange hält, und die Harmonie, obwohl oder gerade weil sie nicht verheiratet sind. An diesem Wochenende begleiten sie ihr langjähriger Freund Tonio und dessen studierende Tochter Pega, die für Max und Reif wie ein eigenes Kind ist. Pega sieht das mittlerweile anders und überhaupt ist keine der Beziehungen so, wie sie auf den ersten Blick scheint. Da geht es viel um Liebe: Zwischen Mann und Mann, Mann und Frau, Vater und Tochter, Kumpel und Kumpel.Es fließen Tränen, brechen Teetassen und Herzen. Manches kann man kitten, anderes nicht. Oft verschwimmen Vergangenheit und Gegenwart. Da geht’s um Abhängigkeitsverhältnisse, finanziell, gefühlsmäßig. Um Schuld, um Versäumnisse – aber auch, wie man am besten betrunken von einem zugeschneiten Hochstand im Wald herunterkommt, ohne sich etwas zu brechen. Es entwickeln sich Dynamiken: Konflikte brechen aus, manche neu, manche seit Jahrzehnten am heimlichen Brodeln. Miku S. Kühmel kann bodenständig und authentisch ohne Kitsch – aber mit schönem Pathos – über Liebe schreiben. Die Beziehung zwischen Reif und Max kann stellvertretend für alle Beziehungen gelesen werden, so klar sind die Bilder, die die Autorin darstellt, so kunstvoll verpackt sie Romantik und Tragik im Alltäglichen:
„Es beeinflusst meine Wahrnehmung vielleicht nicht mehr so sehr, die Proportionalitäten ändern sich, und spätestens, wenn wir zu zweit im Auto sitzen und auf unseren Schenkeln trommeln und laut Roxane singen, weiß ich, dass Reif das alles nicht missen oder eintauschen wollen würde.“ (S. 54)

Ebenso bemerkenswert stimmig ist der Stil, die Sprache in Kintsugi: Konsequent und realistisch lesen sich alle vier Protagonist*innen. Als 1992 geborene Autorin drei Männern Ende Vierzig eine glaubhafte Stimme zu verleihen, ist eine literarische Herausforderung, der sich Miku S. Kühmel nicht nur gestellt hat, sondern in der sie brilliert. Kritisieren kann man die gelegentlich zu bildungsbürgerlichen Formulierungen
„Ich gluckse, als sie mich an diesen alten Namen erinnert, den sie im Kindergarten oktroyiert bekommen hat und mit dem wir sie ewig getriezt haben“ (S. 116)
und die teils sehr abrupten Übergänge zwischen Rückschau und Realität. Aber das sind Bagatellen, denn hier liegt ein ausgezeichneter Roman vor. Unaufgeregt, ohne banal zu werden, mit einer Liebe zur Sprache und großem handwerklichen Geschick erschaffen. Mit Inhalten, in denen man sich als Leser*in sofort wiederfindet, ohne jemals gelangweilt zu werden. Mit Details, die in Erinnerung bleiben. Ein Buch, das schnell gelesen, aber keinesfalls schnell vergessen ist.
Miku Sophie Kühmel: Kintsugi, S. Fischer Verlag 2019, 304 S.
mehr von Miku lesen: freiTEXT: Gehwegplatte
Scroll-free August
Eine britische Gesundheitsorganisation rief 2018 den „Scroll-free September“ ins Leben: Einen Monat lang soll auf Social Media verzichtet werden. Die dadurch „gewonnene“ Zeit könne man für Dinge nutzen, für die man anscheinend keine Zeit (mehr) hat(te). Nach den guten Erfahrungen letztes Jahr, tauchen wir auch 2019 wieder für einen Monat unter.
Für alle, die nicht „Cold Turkey“ gehen wollen, bietet die Royal Society for Public Health unterschiedlichste Strategien für einen partiellen Verzicht auf Social Media und das Smartphone: RSPH.org.uk
Wir haben uns diese Initiative zum Anlass genommen und werden im August auf Social Media verzichten. Schon lange gibt es bei uns im Team in unterschiedlichen Intensitäten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten immer wieder Diskussionen über den Einsatz von Social Media. Wir stehen der Rolle, die Soziale Medien in unserem Leben spielen und die Vorgangsweise der dahinterstehenden Unternehmen (nicht nur aber insbesondere auch im Hinblick auf Datenschutz) durchaus kritisch gegenüber, wenngleich wir die Vorzüge oft nicht leugnen können.
Darum wird es im August keine Inhalte auf den Social Media-Kanälen des mosaik geben. Keine Posts auf Facebook, keine Bilder auf Instagram oder Flickr, keine neuen Uploads auf Issuu oder Youtube, keine Aussendungen via WhatsApp. Und voraussichtlich auch keine Interaktion – keine Likes, keine Shares, keine beantworteten Anfragen.
Wir werden privat unterschiedliche Strategien des Scroll-free September bereits im August anwenden (oder anwenden versuchen) und diese nach Möglichkeit auch auf das mosaik umlegen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns von der Welt abschließen und eremitisch leben werden. Wir sind weiterhin erreichbar. Per Mail zum Beispiel. Eure Einsendungen erreichen uns, eure Fragen werden beantwortet werden.
Gleichzeitig erlaubt uns diese Initiative aber auch, uns wieder mal unserer Arbeit bewusst zu werden - und der Rolle unterschiedlicher Kommunikationswege. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen zu unserer Kommunikation, zu einzelnen Kanälen oder anderen Themen habt, freuen wir uns ebenso darüber, wie über eure eigenen Erfahrungen mit Social Media. Gleich hier als Kommentar oder direkt: schreib@mosaikzeitschrift.at
Macht es uns gern nach: Lest mal wieder ein Buch, ohne vom neuesten Statusupdate unterbrochen zu werden. Trefft euch mit Freund*innen und lasst das Smartphone zuhause. Blickt wieder mal über den Touchscreen-Rand hinaus und entdeckt die Welt.
Genießt den Sommer.
euer mosaik
freiTEXT | Katharina Körting
Smalltalk, bebildert
Ergrauen
Verlernt man
Jedes Haar hält
Was es nicht verspricht
Fallweise

HIER FEHLT EIN FOTO, DAS ICH NICHT MACHEN KONNTE: Vater und Sohn in der Tram. Der jüngere, den Kopf entspannt auf der Schulter des Älteren, liest in einem dicken Buch aus Papier, Der Ältere hält ein Tablet vor sich wie ein Buch, kramt dann seinen Telefoncomputer hervor, sagt etwas zu dem Jungen, das ich nicht höre. Der Junge taucht unwillig auf: Das brauche ich nicht, sagt er, das habe ich mir schon abgeschrieben. Wahrscheinlich etwas für die Schule. Der eigene Sohn mag auch lieber Formulare mit der Hand ausfüllen als im Rechner. Vielleicht ist die Zukunft gar nicht so eindimensional wie wir uns manchmal glauben machen.

Zugehör
Immer wieder dieses halbe Zugehören, diese Unfähigkeit, voll dabei zu sein, zum Beispiel beim Handballspiel des Sohnes, bei dem mir eine Mutter einen Krachmacher in die Hand drückt, und ich weiß, ich werde ihn nicht verwenden, werde nur zaghaft klatschen, wenn ein Tor fällt, zwischendurch viel zu viel nachdenken, beobachten, dieses unablässige Beobachten, bei dem mir das meiste entgeht, weil ich zu tief grabe in meiner Seele. Oder bei der Arbeit, sogar bei meiner Ehe gehörte ich, bis sie zerbrach, nur halb zu mir, zu uns, zu ihm. Unsicher, ob es sicher ist.
Ich sitze mit der Kapuze in meinem Café und schreibe in meinem Buch. Die ganze Zeit bin ich, schreibe ich, auf der Suche nach Zugehörigkeit, finde sie in den Zwischenspielen, die die Zeit bietet, die ich mir erkämpfe, manchmal erzwinge, in temporären Gruppen, im Nützlichsein, das durch Tun erfolgt: Zugehörigkeit gibt es für mich nur im Nützlichsein. Zugehörigkeit ist Tun. Deshalb kann ich nie stille sein, nicht ruhen, außer bei Gott, wo ich fraglos zugehörig bin, wenn ich das glaube.
Angst fließt in Wellen, wie warme Luft aus U-Bahnschächten, Klimaanlagenfurze, wallt mich an, von der Seite, von hinten, von vorn, hinterlässt im Verschwinden ihre Spur in meiner zusammengepressten Hand (keine Faust, nur die Idee einer Faust), in meinem mahlenden Kiefer, den ich nicht locker kriege, egal, was ich versuche, Achten machen, wie der Physiotherapeut riet, oder gucken wie eine Kuh. Fehlende Zugehörigkeit verursacht diesen leichten Schwindel, als zöge jemand, den ich nicht kenne (nur zu kennen meine) am Stuhl unter mir, lässt dann davon ab, bevor ich fallen kann.
Schreiben ist Notwehr.
Es gibt diese Sinnlosigkeit. Sie ist unleugbar (und lässt sich leicht behaupten, wenn man den Magen voll und ein warmes Schlafzimmer hat). Diese Sinnlosigkeit meines Strebens, des Strebens meiner Kinder. Was wollen wir damit? Was erhoffe ich mir von all meinen Gedankensprüngen? Heute leben wir und morgen sterben wir. „Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne?“, fragt der Prediger, „alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt, und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.“ Diese Verse lassen sich lesen als Mahnung, als deprimierende Zusammenfassung, als Trost, weil es immer schon so war und so sein wird – oder als Augenzwinkern, denn wenn alles sinnlos ist, ist auch nichts sinnlos. Wenn nichts Bedeutung hat, hat alles Bedeutung. Auch mein nichtiges Sehnen, mein haltloses Versuchen und Suchen, so vergeblich, da ich mich nicht geben kann, ohne mich zu verlassen.
Es gibt eine beständige, besänftigende, oder irre machende Wiederholung. Essen, schlafen, arbeiten, wieder schlafen, aufräumen, traurig sein, müde sein, vergeblich sein oder nicht in der Versuchung, Dieses Eine Wichtige nur noch nicht gefunden oder erkannt zu haben. Und die Ahnung, die zur Gewissheit wird: Das Eine Wichtige existiert nur als Qual, als Nichtvorhandenes, als Wunsch. Eine Schimäre, die ablenkt von den wirklich wichtigeren Dingen, wobei dieses „wirklich“ unzulässige Behauptung und Propaganda ist.
Meine Müdigkeit macht mir zu schaffen, meine luxuriöse Müdigkeit, die an Erschöpfung grenzt und sich wünscht, irgendwie, Erschöpfung zu sein, oder zu werden, eine Rechtfertigung für eine Pause in diesem unleugbar sinnlosen Strebenleben, das Sinn nur aus sich selbst schöpfen kann:
Aus dem Heben des Kopfes, wenn jemand mit lauten Schritten vorbeigeht.
Aus dem Streichen über das Haar eines bald erwachsenen Kindes.
Aus der dummen Gewissheit, dass es egal ist, wenn es egal ist, solange du dein Bestes tust und gibst und bist und denkst und schreibst, auch wenn du keine Ahnung hast, oder höchstens eine Ahnung, was dieses „dein Bestes“ sein könnte.
Menschen sprechen in mein Gehirn, blockieren die Sehnsucht, dass jemand seinen Arm um mich legt, jemand, dem ich angehöre. Wer könnte das sein? Wer könnte ich sein?
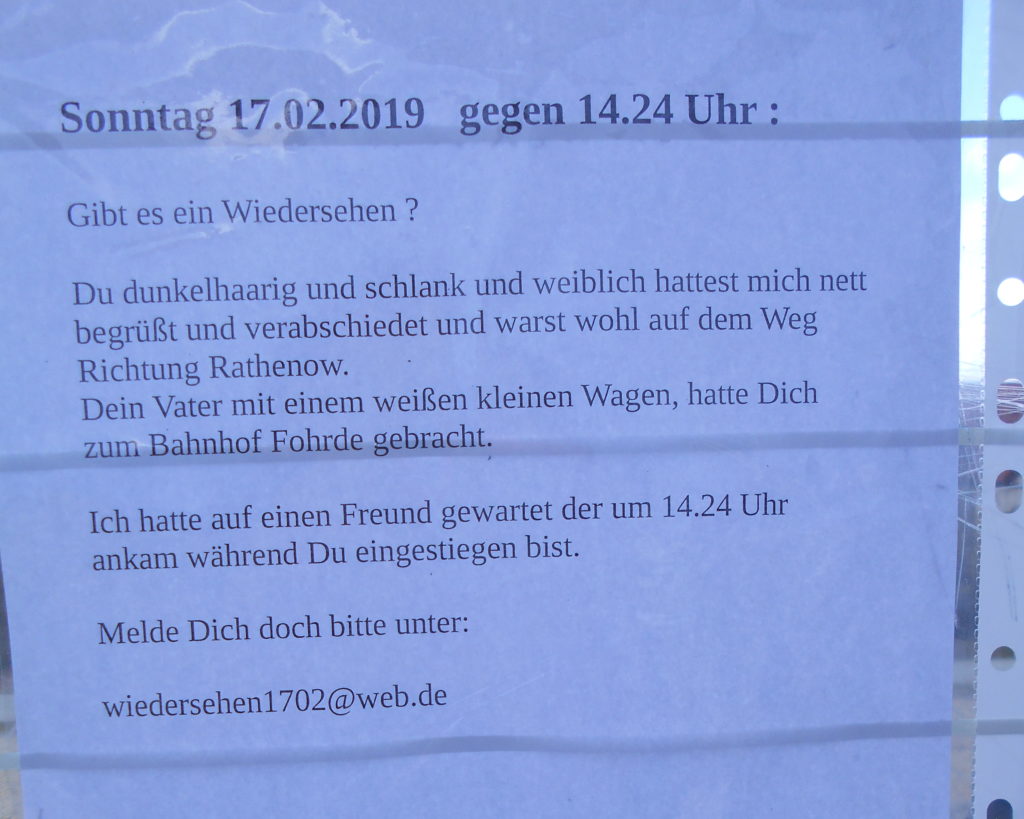
Ich putze mir die Nase, lasse die Kapuze wie einen Schutzwall auf meinem anstößigen Kopf und wehre den Kommentar eines Bekannten ab. „Sieht gut aus“, oder Ähnliches sagt er, als müsse er mich bewerten, als müsse er mir Mut zusprechen, als müsse er behaupten, dass ich dazu gehöre, zu irgendetwas, und sei es zu denen, die sich von ihm bewerten lassen. Er meint es nicht böse. Er meint es nicht gut. Er meint gar nicht mich, doch ich mag ihn im Moment nicht sehen, mag nicht gesehen werden, mag nicht reden, mag nur nicht allein sein in dieser kurzen Zeit meiner Demütigung, meines Hochmuts.
Niemand hält, was er verspricht, auch ich nicht. Aber wenn da jemand wäre, der auf die richtige Weise in der richtigen Zeit seinen Arm um mich legt, wäre mir mehr geholfen, als ich verweigern kann. (Und all dies schreibe ich nur, um es wieder zu lesen, später, morgen, unverständliches Zeug, um mich zu vergewissern, dass ich ein Herz habe, das schlägt, auch wenn ich nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt, wenn mir jemand den Arm um die Schulter legt und tatsächlich mich meint, und sich. (Schreiben ist vergebliche Kommunikation mit dem Nichtschreiben.) Das aushalten. Aushalten, dass ich das aushalte.

Existenz
Früher hatte man dieses altmodische Wort Betrachtung, das meint: genau hinschauen und lange hinschauen. Immer durch dieselben Straßen gehen und warten, bis man etwas entdeckt. (...) Zu Beginn mag es langweilig sein, weil man es nicht beherrscht. Später kann man erfahren, daß Geist in der Welt ist. Immer die gleiche kleine Menge. (Ilse Aichinger)[1]
Im Café. Eine runde junge Frau, schwarze Jacke, schwarzer abgenutzter Rucksack mit eddingweißen Peace-Zeichen, schwarze Jogginghose, helle Turnschuhe, dunkle Haare, dicke Brille spricht mich mit heftigem Lispeln an: Ob ich eine ihrer Postkarten haben möchte? Ich frage nach dem Preis. Drei Euro. Kitschige Motive, zu denen mir keine Verwendung einfällt. „Alles Liebe“ in erhöhten goldenen Buchstaben mit einer erhabenen lila Blume. „Herzlichen Glückwunsch“ mit Glitzerglanz. Ihr Schweißgeruch ist stark, aber nicht unangenehm. Im Moment brauche ich keine Postkarte, sage ich. Sie wünscht mir einen schönen Tag und drängt sich weiter. Ich sehe, wie sie Absagen kassiert, freundlich aber bestimmt sagt ein Gast nach dem andern Nein, schüttelt den Kopf, schaut sich ihre Werke nicht an. Meine Augen füllen sich mit diesen Tränen eines Berührtseins, das ich nicht immer vermeiden, nicht töten kann, denn es ist da, lauert auf meine Unaufmerksamkeit, damit ich ihm nachgebe.
Ich winke sie zurück. Sie freut sich, quetscht sich zu meinem Tisch, streift dabei einen Zeitungsverkäufer in dem engen Raum, gibt mir ihre Karten zur Ansicht. Sie erklärt, wie sie sie herstellt. Sie mache alles selbst außer der Schrift – die schneide sie aus und klebe sie drauf. Ihre Offenheit besiegt mich. Nun kramt sie auch die schon überholten Valentinstags-Motive aus ihrem Rucksack. Rote Herzen und lächelnde Gesichter. Sie macht den Eindruck, dass sie gern über ihre Arbeit spricht. Und dass sie glücklich ist. Zuversichtlich. Als wäre alles in Ordnung und das Leben okay. Die drei Euro pro Karte scheinen weniger wichtig zu sein als die Informationen zum Werk - der Austausch. Ich schaue nur flüchtig und wähle die lila Blume mit „Alles Liebe“. Sie wechselt flink bei der Kellnerin den Zehn-Euro-Schein. Ich weiß nicht, ob ich mich beim Kauf ihrer Postkarte, die ich nicht leiden kann, gut fühle oder schlecht oder beides. Ob ich überheblich bin, weil ich etwas aus einem vagen Mitgefühl heraus erwerbe, damit sie nicht abgewiesen das Café verlässt. Ob meine Unehrlichkeit gerechtfertigt ist. Sie verabschiedet sich, schenkt der Kellnerin zwei Karten. Auch ich verlasse bald nach ihr das Café, sehe den großen, alten, stinkenden Mann mit dem verschlissenen Tarnfarbenmantel, dem weißen Bart, den schweren Plastiktaschen, die seine Arme zu Boden ziehen. Neulich stand er an der S-Bahntreppe und wirkte, als würde er gleich starten, oder sterben. Er stand lange und schaute, und ich drängte mich an ihm vorbei, wollte schnell weg, mein schlechtes Gewissen drückte, oder die Neugier, ich drehte mich nach ihm um, aber wollte mich nicht hineinziehen lassen in meine Phantasien von Unglück und verschloss mein Herz und existierte nicht. Jetzt steht er an der Straße wie eingefroren, obwohl kein Auto kommt, und scheint zu überlegen, was er da soll. Wie es weiter geht. Ich überlege, ihm zwei Euro zuzustecken, aber vielleicht will er das gar nicht. Vielleicht bettelt er nicht. Ich zögere von ferne. Da kommt er in Bewegung, überquert die Straße mit festen Schritten, biegt zielstrebig in eine Straße ein. Vielleicht wohnt er unter der S-Bahn-Brücke, denke ich ziellos, lasse von ihm ab und fahre nach Hause, "Alles Liebe" in lila in der Tasche.

Nein
Sage ich nur vorläufig
Um das Ja hinauszuzögern
(Manchmal klappt das)
Auf der Bahnhofstreppe trifft mich ein Schwindel
direkt ins Mark, sendet sekundenbrüchige Kaskaden
von Folgen und Ursachen (was wird aus mir?)
„Hast du das auch gespürt?“, fragt die Touristin ihre Begleitung.
„Die Stufen zittern! Merkt das sonst keiner?“
Das Kopfschütteln, das ich im Rücken spüre, bringt mich in Versuchung:
„Doch ich!“, will ich rufen. „Ich auch!“
Meine schwitzige Seele beruhigt sich, verwundert:
Entwarnung kann seltsam enttäuschend sein

Sommererinnerung
„Das ist immer das Schlimmste Mann
Wenn du außen nass bist und innen
Ich hasse das Mann ich hasse es“
Ich kann kein smalltalk
Ich kann kein smallwork
Ich kann kein smalllove
Ich kann kein smalllife
[1] Im Interview mit Iris Radisch in der ZEIT, 1.11.1996 Link
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Ernad Osmic
Rahmet oder Wie Gleichmut geht
wenn du entschließt zu sterben
vergiss nicht den Herd auszumachen
und den Kühlschrank und das Bügeleisen
und den Fernseher aus der Steckdose
und schalte alle Lichter aus
oder noch besser
nimm die gesamten Sicherungen raus
schraub alle Glühbirnen raus
(die im Kinderzimmer
hast du ja lange schon herausgeschraubt)
zahle die Rechnungen
zahle die Kreditrate
zahle alle Schulden
versöhne dich mit Feinden
vergib ihnen, falls nötig
geh zum Grab deiner Mutter
geh zum Grab deines Vaters
geh zu allen Gräbern
zu denen du gehen solltest
küss dein Kind
küss auch das andere
küss deine Enkelinnen
streiche die Wohnung
fege vor der Tür
putz dein Badezimmer
wasch das Geschirr
putz deine Zähne
ziehe saubere Unterhosen an
ziehe ein sauberes Unterhemd an
damit die im Leichenschauhaus nicht lachen
bring den Müll raus
(denn, nur weil du entschlossen hast zu sterben,
bedeutet das ja nicht, dass morgen nicht Diensttag ist)
guck dir die Elbe an
geh runter und berühre sie
schau dir die Lichter in ihr an
zähle sie
guck nach oben
du siehst Sterne
zähle sie nicht
einatmen
ausatmen
schließe deinen Mund
hörst du in dir
etwas klopft
Hufen von Pferden
etwas schwellt und quietscht
Kinderschritte im Schnee
etwas brummt
der Regen als du geliebt hast
atme ein
atme aus
sie Rufen dich
du kennst seinen Namen
atme ein
fühlst du sie?
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Janine Adomeit
Keine Spatzen
Agata, das bedeute ja „die Gute“, hatte Herr Pfeiffer gleich am Bahnhof gesagt und ihr mit dem Zeigefinger auf die Schulter getippt.
Ob sie das gewusst habe?
Agata hatte nicht, obwohl zuhause in Kruszki jede Dritte oder Vierte so hieß.
„Ach so“, hatte Herr Pfeiffer gesagt, „ein ganzes Dorf voller guter Frauen!“ Sein grauer Schnurrbart zitterte.
„Na dann, Agata. Pass gut auf uns auf, ja?“
Sie nickte, etwas anderes als Nicken kam ihr unpassend vor.
Herr Pfeiffer nahm ihren Koffer. Sie müssten nur fünf Minuten gehen, sie wohnten sehr zentral. Es klang stolz, wie er das sagte. Agata sah ihn in die Dunkelheit vorausgehen mit ihrem Gepäck, das ihr in der fremden Hand eine ängstliche Sekunde lang nicht mehr wie ihr eigenes vorkam. Sie folgte Herrn Pfeiffer. Das Haus, vor dem sie stehenblieben, war groß, aber freundlich. Sie müssten jetzt leise sein, sagte Herr Pfeiffer, seine Mutter schliefe schon. Er steckte den Schlüssel ins Schloss.
Herr Pfeiffers Mutter wohnte im Erdgeschoss, in dem Zimmer das neben Agatas lag. In der Nacht hörte Agata sie zum ersten Mal klopfen, das Geräusch bohrte sich tief in ihren Traum. Sie stand benommen auf, dicke milchige Wärme hinter der Stirn, Schlaf, dachte Agata, Schlafen – und dann: Jakub. Aber als sie die Tür zum Flur öffnete, stand da nicht Jakub, sondern Herr Pfeiffer in seinem hellblauen Bademantel und hatte schon das Licht eingeschaltet.
„Sie klopft“, sagte er, „das ist das Zeichen.“
Er steckte den Kopf in das Zimmer seiner Mutter, seine Lippen bewegten sich lautlos und er gestikulierte in Richtung Agata, dann ging er zurück in sein Schlafzimmer im ersten Stock. Er trug keine Socken und hatte sehr weiße, sehr hässliche Beine. Er tat Agata leid.
Frau Pfeiffer musste zur Toilette. Agata versuchte, nicht an den Bandscheibenvorfall vom letzten Winter zu denken, als sie ihr aus dem Bett half. Woran sie stattdessen zu denken versuchte, waren die kaputten Rohre in ihrem Haus und Jakubs Studium in Lublin, waren die tausend Euro, die sie schon nächsten Monat schicken könnte. Tausend, dachte Agata. Vierundzwanzig Stunden, ein halbes Jahr lang jeden Tag, dann könnte sie zurück für drei Wochen. Sommer in Kruzski. Ein Korbstuhl; Wind im Laub der Weißbuchen und Wind über dem See; Kormorangefieder, das im Sonnenlicht schimmert wie flüssiges Metall. Tausend.
Agata und Frau Pfeiffer, geteilte Verlegenheit zwischen sich, gingen den Flur entlang zum Badezimmer. Die alte Frau machte die winzigsten aller Schritte, wie ein aus dem Nest gefallener Vogel. Sie sprach erst, als sie sich, auf Agata gestützt, zum Pinkeln setzte, und Agata ihr das Nachthemd über die Oberschenkel zog.
Entschuldigung. Das sei ja nicht die feine Art, einander kennen zu lernen.
Doch, sagte Agata, Frau Pfeiffer sei sehr fein angezogen.
Sie schwiegen eine Weile und lauschten dem Geräusch von Frau Pfeiffers Urinstrahl, wie er auf das Wasser in der Toilettenschüssel traf.
„Der Erwin hat erzählt, du bist Krankenschwester in Polen.“
„Krankenschwester“, wiederholte Agata, „ja, Krankenschwester. In Polen.“
„Und du hast auch einen Sohn?“
„Ja“, sagte Agata und sah zu, wie die alte Frau sie beim Abrollen des Klopapiers beobachtete.
Sie hätten auch schon deutsche Schwestern gehabt, sagte Frau Pfeiffer: „Aber die wollten nichts tun für ihr Geld!“
Dazu fiel Agata nichts ein. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft zuckte sie mit den Schultern.
Sie konnte nicht gleich wieder einschlafen, nachdem sie zurück ins Bett geklettert war. Sie hörte auf die Züge mit ihren rumpelnden Waggons, die drüben im Bahnhof einfuhren, und sie dachte an die alte Frau im Zimmer nebenan. Sie streckte die Beine aus.
Agatas waren gute Beine. Nicht schön, sondern gut. Sie hatte mit ihnen fast alle Weitsprungwettbewerbe zwischen der vierten und der achten Klasse gewonnen. Wie viele Jahre würden die Beine noch zu gebrauchen sein? Wann würde sie das erste feine Reißen in den Knien spüren, in den Fingern, im Hüftgelenk? Der Rücken ließ sie ja jetzt schon im Stich. Zweifellos, Agata löste sich auf, sie wurde alt. Noch zwanzig Jahre Verfall, dann hätte sie auch das geschafft. In zwanzig Jahren wäre sie nur noch alt.
Ihr Kopf schmerzte. Erst nach einigen Minuten fiel ihr auf, dass sie Hunger hatte. Sie öffnete ihre Handtasche und fand die in Papierservietten eingewickelten Waffeln, die sie gestern Abend mit Jakub gebacken hatte. Sie hatte auf einmal das Gefühl, dass sie bei den Waffeln anfangen müssen würde, wenn sie jemals hier ankommen wollte. Sie nahm eine, biss ab, kaute, schluckte. Der süße warme Brei auf der Zunge, zwischen den Zähnen, war tröstlich. Sie nahm die nächste Waffel. Sie sah nicht auf die Uhr. Irgendwann waren keine Waffeln mehr da. Sie legte sich schlafen.
Herrn Pfeiffer sah Agata erst am nächsten Abend wieder. Er betrachtete die belegten Brote auf dem Küchentisch, legte sich schließlich eins auf den Teller und aß es mit Messer und Gabel, dazu zwei kleingeschnittene saure Gurken. Dann lehnte er sich zurück und sagte: „Tja.“ Agata kannte das Wort nicht, doch es klang wie „Ja“, deshalb wurde sie mutig und schob mehr von dem Brot über den Tisch, mehr von der rosa Fleischwurst, der Butter. Aber Herr Pfeiffer schüttelte den Kopf.
Agata habe das selbstverständlich nicht wissen können, aber wenn er abends vom Geschäft nach Hause kam, hatte er gerne etwas Warmes. Sie sei doch hoffentlich gewohnt, frisch zu kochen?
Frisch. Agata verstand: Schnell, und nickte heftig. Schnell kochen konnte sie, zur Not auch für viele. Herr Pfeiffer machte eine Handbewegung, so als risse er an etwas, und sagte: „Nicht so!“ Dann tat er, als rühre er mit einem Löffel in einem Kochtopf: „Sondern so!“
Seit dem zweiten Tag kochte Agata frisch. Sie probierte es mit den Gerichten, die Jakub gern aß, bei denen er sagte: Schmeckt gut und macht satt. Sie hatte dabei Herrn Pfeiffers großen Bauch vor Augen, wie er den Bauch mit einer geschickten Handbewegung angehoben und bequem unter der Tischkante platziert hatte. Sie ahnte, das Essen musste stark sein und viel. Aber er mochte den Eintopf nicht, wie Agata ihn machte, und er mochte keine Kutteln. Spätzle, sagte er. Sie solle sich von seiner Mutter das Rezept geben lassen.
Die alte Frau Pfeiffer hörte das und bekam aufgeregte Flecken im Gesicht.
„Mein Erwin“, sagte sie, als Agata ihr später im Bett die Haare bürstete. Seit Jahren habe niemand mehr für ihn gekocht, alles habe er selbst machen müssen. Ein guter Koch, ihr Erwin. Aber das wolle er jetzt nicht mehr, jetzt sei Agata da.
Frau Pfeiffer ließ sich am nächsten Morgen nach dem Frühstück die Lesebrille bringen, den Notizblock, den Bleistift, und steckte die Bleistiftspitze lange in den Mund und saugte daran.
„Dann schreibt er besser“, sagte sie.
Agata sah ihr über die Schulter. Spätzle, schrieb Frau Pfeiffer und zog eine schwache Linie darunter. Agata presste die Schneidezähne auf die Unterlippe. Sie ließ Frau Pfeiffer allein, ging in ihr eigenes Zimmer und nahm das Wörterbuch aus der Nachttischschublade. Es dauerte lange, bis sie glaubte, fündig geworden zu sein. Spatzen. Agata strich das Wort mit ihrem gelben Textmarker an und starrte auf das pergamentdünne Papier, das kühl und abweisend unter ihren Fingern knisterte. Sie wusste, es verbarg etwas vor ihr.
Erst am Nachmittag war Frau Pfeiffer fertig. Ihr Gesicht leuchtete vor Zufriedenheit.
„Ja, Spätzle“, sagte sie, als sie das Rezept auf den Küchentisch legte, „das ist was Gutes. Der Erwin hat abends gern was Gutes. Er arbeitet doch so schwer.“
Agata wusste nichts von Herrn Pfeiffers Arbeit, sie hatte auch nicht gefragt. Sie wusste nur, dass er Jeans und Hemd trug, wenn er morgens das Haus verließ, und kam er später zurück, war alles noch so sauber wie einige Stunden zuvor. Im Treppenhaus waren ihr gerahmte Fotos von ihm aufgefallen, fünf oder sechs versetzt nebeneinander, und auf jedem stand er neben einem anderen Auto, eine Hand auf der geöffneten Wagentür, die andere in die Hüfte gestützt. Vielleicht war das schwerer, als es aussah.
Agata setzte sich an den Küchentisch. Sie faltete den Bogen Papier auseinander und strich ihn glatt. Sie starrte darauf. Sie blinzelte.
„Ja“, sagte Frau Pfeiffer in ihrem Rücken. „Das ist Sütterlin. Kennst du Sütterlin?“
Agata antwortete nicht. Sie lächelte schief. Sie begleitete die alte Frau ins Wohnzimmer und schaltete ihr den Fernseher ein. Zurück in der Küche öffnete Agata den Kühlschrank. In Kruszki öffnete sie immer den Kühlschrank oder ging in die Speisekammer, wenn sie nachdenken musste. Verdammtes Spatzenessen. Sie legte den Kopf zurück und schloss die Augen, damit die Tränenflüssigkeit dahin zurücklaufen konnte, wo sie hergekommen war. Kälte kroch ihr übers Gesicht. Agata schlug die Kühlschranktür zu. Sie nahm das Rezept vom Tisch, faltete es klein und steckte es in die Hosentasche. Sie ging in den Flur und warf einen Blick ins Wohnzimmer, wo Frau Pfeiffer schief im Sessel saß, das Kinn auf der Brust, die Atemzüge geräuschvoll, gleichmäßig. Agata nahm Jacke, Schlüssel, das Portemonnaie – ihr eigenes Portemonnaie mit den an der Grenze eingetauschten Scheinen, nicht das mit dem Haushaltsgeld. Die Haustür zog sie so leise wie möglich hinter sich zu.
In dem Supermarkt, den ihr Herr Pfeiffer am ersten Tag gezeigt hatte, ging sie entlang der Tiefkühltruhen, die Eiskruste darin glitzerte diamantschön im Licht der Neonröhren. Klamm und mutlos betrachtete Agata das abgepackte Fleisch unter dem Truhendeckel, die gefrorenen Erbsen, den Apfelstrudel. Endlich sah sie eine Frau in einem rot-weiß-gelben Kittel und reichte ihr das Stück Papier aus ihrer Hosentasche. Ihr Herz klopfte.
Sie wolle kaufen, sagte Agata. Zögerlich fügte sie hinzu: „Spatzen?“
Die Frau runzelte die Stirn und nahm ihr den Zettel aus der Hand. Las. Gab ihr den Zettel zurück.
„Das kann ja kein Mensch entziffern. Machen Sie es sich nicht so schwer. Im Kühler gibt es Spätzle, ganz frisch, sind im Angebot.“
„Spatzen“, wiederholte Agata.
„Spatzen, Spätzle, die einen sagen so, die anderen so. Warten Sie, ich zeige es Ihnen.“
Agata folgte der Frau durch den Supermarkt. Die Frau blieb vor einem Kühlregal stehen. Sie griff nach einem rechteckigen Paket. Gelbe Teigstreifen drückten sich von unten gegen die Folie. Nicht einmal auf der Verpackung war ein Spatz abgebildet. Nudeln.
„Danke“, sagte Agata.
Sie drehte die Spätzle um, suchte nach den kleinen Flaggensymbolen, fand die weiß-rote. Zwölf bis vierzehn Minuten in kochendes Salzwasser geben. Agata stellte sich an der Kasse an.
Frau Pfeiffer war wach, als sie gegen Vier nach Hause kam.
„Du musst einen Zettel schreiben, wenn du gehst, Agata“, sagte sie.
Agata lächelte der alten Frau zu, hielt das Paket mit einer Hand hinter dem Rücken und sperrte sich in der Küche ein. Sie ließ das Lächeln aus ihrem Gesicht fallen. Noch zwei Stunden, bis Herr Pfeiffer von der Arbeit kommen würde. Agata öffnete die Schränke. Eine Handvoll Mehl, zwei Eier, Salz. Das Handrührgerät. Sie schlug eine geringe Menge Teig, einen Teigrest nur. Sie verteilte das Mehl auf der Arbeitsplatte und dem Fußboden, sie bestäubte ihre Hände damit und fuhr sich durchs Haar. Um zehn vor Sechs ließ sie Wasser aufkochen auf dem Herd. Um zwei vor Sechs öffnete sie die Packung Spätzle und schüttete die Nudeln in das Wasser. Sie setzte sich an den Küchentisch und wartete.
Die saubere, glänzende Spüle. Die karierten Handtücher. Das weiße Ziffernblatt der Uhr über dem Kühlschrank. Und Agata dachte an das gestickte Madonnenbild, das an derselben Stelle hing in Kruszki.
bereits erschienen in: entwürfe 74 (2013)
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at