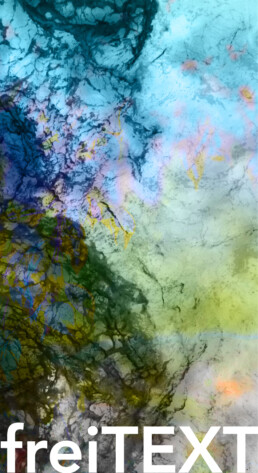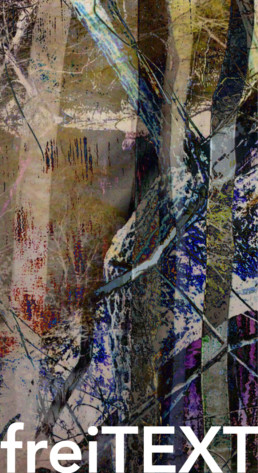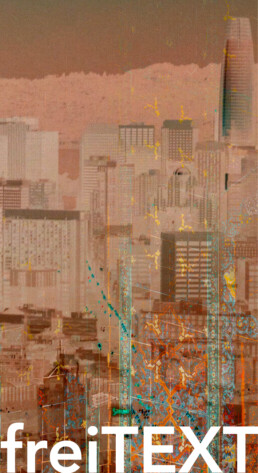freiVERS | Crispin Scholz
du hast auf der Parkbank gesessen
und gesagt, dass du mich interessant findest
und ich habe mich verliebt
zumindest schreibe ich das
wenn jemand fragt
meistens frage ich
kann ich vorbeikommen?
seitdem schreibe ich kongruente Gedichte
wo lyrisches Ich und Autor
beinahe
gleichzusetzen sind
ich zum Beispiel
finde Menschen die auf Lehnen von Parkbänken sitzen attraktiv
weil sie ein bisschen freier sind als ich
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Eugen Fuchs
Das deutsche Butterbrot
Einem deutschen Butterbrot begegnete ich zuerst in der Grundschule beim gemeinsamen Frühstück. Die Eltern meiner Mitschüler waren da und belegten fleißig Brote. Egal ob mit Käse oder Wurst – zuerst kam immer die Schicht Butter. Bei uns zuhause war das anders – da kam die Wurst direkt aufs Brot.
Das nächste entscheidende Ereignis, das mich davon überzeugen ließ, dass auf einem deutschen Brot Butter zu sein hat, folgte in der Orientierungsstufe. Da machte meine Mutter mir noch das Pausenfrühstück: Geröstetes Toastbrot und immer zwei Scheiben Aufschnitt, meist Mortadella, sonst nichts. So wie wir da in der ersten großen Pause auf dem Hof standen und unsere Schnitten verzehrten, hatte einer meiner Mitschüler oft was an meinen Broten zu bemängeln. Es war ein sehr großer, dicker Junge, bereits mit zwölf hatte er am Kinn einen blonden Flaum von Bart. Seine Mutter war alleinerziehend und man wusste, dass sie wenig Geld hatte. Er schüttelte oft seinen Kopf über meine Brote.
„Zwei Scheiben Aufschnitt“, sagte er, „Wenn man Butter nehmen würde, würde auch eine reichen und besser schmecken würde es auch!“
Ich wollte aber keine Butter auf meinem Brot, ich wollte eine zweite Scheibe Wurst.
Eines Morgens, meine Eltern und ich waren zu Besuch bei Freunden, beobachtete ich am Frühstückstisch, wie unsere Gastgeber, ebenfalls Spätaussiedler wie wir, sich Butter auf ihre Brote schmierten, bevor – und da staunte ich wirklich gar nicht schlecht – sie dann auf die Butter Nutella schmierten. Meine Schlussfolgerung war, dass diese Leute unglaublich integriert sein mussten, ja, kurz vor der Assimilation standen!
Auch auf dem Gymnasium sah ich meine Mitschüler solche deutschen Brote aus ihren Tupperdosen hervorholen. Wenn man sich in der Cafeteria ein belegtes Brötchen kaufte, kam das mit Butter.
So ging ich in meine erste Beziehung mit einer sehr genauen Vorstellung vom deutschen Essverhalten.
Zuerst sah ich meine Freundin nur am Wochenende, doch bald besuchte ich sie auch unter der Woche und irgendwann verbrachte ich jeden Nachmittag und Abend bei ihr. Da man ja auch etwas essen musste, setzten wir uns schließlich zum Abendbrot mit an den Esstisch. Zuhause aßen wir zu Abend meist Reste vom Mittagessen, mal ein Tiefkühlgericht oder machten uns auch schon mal ein Brot, doch wir nannten es Abendessen. Bei meiner Freundin gab es abends in der Woche immer Brot und Tee. Schon allein der Ausdruck „Abendbrot“ sagte mir, hier wird Brot ernst genommen.
So saßen wir also das erste Mal gemeinsam am Tisch. Es war eine lange Tafel, die wir gerade mal so zur Hälfte besetzten. Am Kopfende immer der Vater, neben mir meine Freundin, ihr gegenüber die Mutter, mir gegenüber der Bruder. Die Platte reichlich gedeckt mit weißen Brötchen und Vollkornbrot, Hähnchenbrustaufschnit, Schinkenwurst, Salami, Leberwurst, einem Stück Käse, daneben ein Käsehobel, Marmelade, Nutella, Frischkäse, einer Kanne schwarzen Tee, Milch, Zucker, doch Moment mal – wo war die Butter? Auf dem Tisch stand weder Butter noch Margarine. Das erste gemeinsame Essen mit der Familie meiner Freundin löste schon genug Nervosität in mir aus, nun drohte aber mein Weltbild ins Wanken zu kommen. Alle anderen waren schon längst beim Essen und ich saß da und glotzte den Tisch an. Um so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung, griff ich zum Frischkäse und bestrich eine Brötchenhälfte damit, legte eine Scheibe Schinkenwurst darüber und biss hinein. Es schmeckte scheußlich. Ich würgte es herunter und schmierte mir noch eins. So machte ich es dann jeden Abend, Woche für Woche saß ich nervös am Tisch, sagte gar nichts, fühlte mich beobachtet und aß diese furchtbaren Brote.
Eines Abends, wir hatten gerade wieder gemeinsam gegessen, kuschelten meine Freundin und ich im Bett. Da fragte sie mich, ob ich bei ihnen auch satt werden würde und ob es auf dem Tisch an irgendetwas mangelte, das ich gern hätte.
„Weißt du“, sagte sie, „viele vermissen die Butter bei uns.“
Ich tat unbeeindruckt.
„Wir tun die Sachen so drauf“, sagte sie, „aber wenn du gerne Butter haben möchtest, Mama kann beim nächsten Einkauf gerne welche mitbringen.“
Erst jetzt wurde mir klar, dass ich nie, wirklich nie darauf geachtet hatte, was die anderen gegessen hatten. Ich war so mit mir selbst beschäftigt gewesen, hatte solche Angst gehabt, anders zu sein, dass ich völlig blind geworden war.
„Aber du tust dir ja immer Frischkäse drauf“, sagte sie, „schmeckt das denn?“
„Oh ja, ich mag das gerne!“
Viele Jahre sind seitdem vergangen. Nie wieder habe ich ein Frischkäse-Schinkenwurst-Brot gegessen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Georg Großmann
Aubezki
(AUssenBEZirksKInd)
ich bin ein gemälztes Kind
ich bin ein in
Pappelschnee gewälztes Kind
ich bin ein Kind der Weiher
und Regenfälle
des regengewürzten
Betons
des sommerblüten-
verschmierten Betons
des straßenmalkreide-
geschminkten Betons
des straßenleuchthonig-
getönten Betons
ein Kind der bunten Betonburg
nahe Neu-
Florida
—
ich bin ein Faltenbalgkind
ein Algenkind
ein Fußball-unterm-Arm-Kind
ein Räuber-und-Gendarm-Kind
ein Kind der Flächen
und Schnittstellen
der Aufzugkabinen und
Stiegenhäuser
Kind der frisch gemähten Wiesenstücke
Kind des sonnenwarmen Rindenmulchs
ich bin ein Ekazentkind
ein Wohnhausanlagen-
ein Sportplatzanlagen-
ein Sprenkleranlagen-
ein Gegensprechanlagen-
Ge Ge Nsch ppprrrrrrrrrrrr *ech*-
Anlagen-
Kind
ein "Ich komm runter", "Na, ich darf nicht", "Ist Mustafa zuhause?"-
Kind
ein Neun Monate, Oaschfetzn, Ausrede-
Kind
ein "Stange rettet", "Schweineleben"-
"Zweimal berührt"-
Kind
ein "Mach ma Match?", "Ich spiel Verein" "unser Ball is besser"-
Kind
ein "Ich muss heim, sagt meine Mama"-Schlüssel-
um-den-Hals-
Kind
ein Kind der Pyramiden
Pappeln
—
ich bin ein Wasserwaldkind
ein Feuchtwiesenkind
ein Kind der Auen
Kind des Dschungels
der hohen rauschenden
Blätterfassaden
Kind der duftenden
Wolkenbrüche
ich bin ein Donaumastenkind
ein Windschutzstreifenkind
(ein Kind der Flächen)
Kind der Felder und geraden
Straßen
Kind der sich auflösenden Stadt
ich bin ein Tretbootkind
ein Freibadkind
Freifahrtkind
Zweiradkind
Kind der stridulierenden
Fahrradspeichen
Kind des Immer-Geradeaus
Kind des In-Alle-Richtungen-Laufens
Kind der empfundenen Freiheit
ich bin ein Kind des Komprimierten;
der Minigolfplätze und
Kleingartenvereine
bin ein Kind der Ausdehnung;
ein Kind der Satellitenstädte
ein Kind der Industriegeschwüre
der brennenden Backsteinburgen
der von Rohren umschlungenen Schlösser
der speihenden Schlote und
stählernen Stelzenhäuser
ich bin ein Kind der begehbaren Nacht
bin ein Außen-
Kind, ein
Zirkuskind
Bezirkskind
Außenbezirks-
kind
Au-
Bez-
Ki
Kind
der Peripherie
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jakob Klein
Die Wunde
Ich löste die Spalten einzeln vom Fruchtkörper der Orange, sodass der Saft durch die Zwischenräume der Finger bis über das Handgelenk rann. Ein Tropfen floss über die Kuppe meines rechten Zeigefingers in die Wunde, die ich mir vor kurzem zugezogen hatte. Es war nur ein schmaler Streifen Hornhaut am Nagelrand gewesen, an dem ich gedankenlos gezogen hatte. Jetzt, da der Orangensaft in die Öffnung trat, spürte ich sie deutlich. So deutlich, dass ich die halbe Nacht nicht schlafen konnte.
Als ich die Wunde am nächsten Morgen immer noch spürte, begann ich mir Sorgen zu machen. Ich begutachtete die Stelle. Die Wunde war noch offen, die Haut rundherum war leicht gerötet und sie spannte ein bisschen. Ich verteilte etwas Zinkpaste darauf und umwickelte die Fingerkuppe mit einem Pflaster. Darunter spürte ich es pochen. Auf der Straße meinte ich, jeder müsste dieses Pochen hören.
Außer dass ich auf Zitrusfrüchte verzichtete, änderte sich zunächst an meinen äußeren Lebensumständen wenig. Ich turnte nach dem Aufstehen am Balkon, trank koffeinfreien Instantkaffee, nahm den Bus wie jeder andere auch. Bei der Arbeit baumelte ich im Bürostuhl und abends datete ich Tinder-Bekanntschaften. Weil ich aus Bequemlichkeit den Suchradius auf zwei Kilometer um meine Wohnung gesetzt hatte, kam es oft zu der unangenehmen Situation, dass wir im Gespräch gemeinsame Bekannte entdeckten. Meistens endeten diese Abende über einer Schüssel Wasabi-Nüsse beim Beobachten der Karaoke-Sänger. Ich musste dabei ungemein aufpassen, nicht meinen rechten Zeigefinger zu benutzen.
Trotz alledem gelang es mir, das kleine Ungemach, das mir die Wunde bereitete, zu vergessen. Eines Tages holte ich am Heimweg aus der Packstation eine Osmoseanlage ab. Ich wusste nicht, dass es so etwas überhaupt gab, geschweige denn, dass ich es bestellt hatte. Ich beschloss ab da nur noch gefiltertes Wasser zu trinken. Wieder einmal fragte ich mich, wie ich bisher überhaupt gelebt hatte. Sogar ins Restaurant nahm ich – in einem Flachmann in der Innentasche meines Parkas versteckt – eine geringe Menge davon mit. Zu dieser Zeit traf ich Marlies. Marlies war die erste Person mit Zöpfen, die ich kannte, die es schaffte, erwachsen auszusehen. Auch sie besaß eine Osmoseanlage. Als ich das herausfand, dachte ich wirklich, es könnte etwas werden. Was ich noch über sie herausfand: dass sie jeden Morgen eine Krill-Öl-Kapsel nahm. Dass sie aus Laibach kam. Dass sie in einer Bio-Schöpferei arbeitete.
„Büttenpapier bekommst du halt beim Tedi nicht.“ Marlies ließ ein Sashimistück zwischen ihren violetten Lippen verschwinden. Ich saß zu weit weg, aber ich stellte mir vor, dass sie nach Kleister roch.
„Was hast du da?“ Marlies deutete mit den Stäbchen auf meinen rechten Zeigefinger. Zunächst wusste ich nicht, was sie meinte. Da war es auch schon zu spät. Sie hielt den Finger in ihren Schöpferinnenhänden. Ruckartig zog ich ihn zurück. Marlies sah mich an. Ich hatte plötzlich Durst und griff nach dem Flachmann. Ein Japaner mit glänzender Stirn keifte mich an. Die Wunde pochte.
„Alles ok?“ Ich nickte, konnte mich aber kaum rühren. Ich entschuldigte mich und verschwand im WC. Ich nahm das Pflaster ab und entdeckte, dass sich unterhalb der Wunde ein neuer Hautstreifen gebildet hatte. Ich zupfte daran. Mit einiger Mühe ließ er sich abziehen, wodurch sich die Wunde jedoch vergrößerte. Sie brannte; ich hatte Sojasauce an den Händen gehabt. Vor Schmerz zitternd hielt ich sie unter kaltes Wasser. Jemand kam. Hastig packte ich den Finger in Einwegtücher und ging nach Hause.
Zuhause kauerte ich mich dann mit einer Tube Zinkpaste auf mein Bett. Ich dachte daran, wie wir jetzt in Marlies‘ Küche sitzen und Wasser filtern könnten. Ich holte mein Handy heraus, setzte eine Nachricht auf, verwarf sie wieder. Auf der Website der Schöpferei bestellte ich einen Stoß Büttenpapier. In die Spalte „Spezielle Wünsche“ schrieb ich: Bitte verzeih mir. Dann wechselte ich das Pflaster. Beim Abspülen der Zinkpaste machte ich eine Entdeckung: Schorf. Ich versuchte ihn wegzukratzen. Es tat weh. Ich ließ es.
Dass ich morgen wieder arbeiten sollte, erschien mir absurd. Trotzdem kam es so.
Beim Tippen vermied ich die Tasten J, U und N. Leider war es nicht mehr Mai. Marlies schrieb nicht. Die Fingerkuppe war geschwollen. So ging es die nächsten drei Tage. Dann kam das Büttenpapier. Der Finger wurde größer. Ich ging zu meinem Hausarzt. Er nahm das Pflaster ab, spülte die Wunde und verband sie wieder. Danach schickte er mich nach Hause.
Unterdessen bereitete ich mich auf meinen Termin beim Dermatologen vor. Schon am Telefon hatte ich der Ordinationsassistentin klargemacht, dass es um Existentielles ging. In der Arbeit druckte ich – anstatt zu arbeiten – die Fotos der Wunde mit dem frischen Schorf aus. Ich vergrößerte sie und erhöhte den Kontrast, damit es unnatürlicher aussah. Ich heftete die Druckbögen zusammen, ordnete sie in eine Mappe ein und beschriftete sie mit Datum und Uhrzeit der Aufnahmen. Ich legte eine ganze Kartei solcher Mappen an. Noch nie hatte mir die Arbeit dermaßen Spaß gemacht.
Das Pflaster wechselte ich von nun an fünf Mal am Tag. Ich erinnerte die Ordinationsassistentin mir sofort Bescheid zu geben, falls jemand ausfiel. Marlies reagierte nicht auf meine Nachrichten. Stattdessen wurden nun die Träume häufiger. In einem erklärte mir mein Hausarzt die Funktionsweise eines Beils, als wäre es eine neuartige medizinische Methode. In einem anderen rannte ich mit einem verletzten Vogel in der Innentasche meines Parkas durch eine Straße voller Schnellrestaurants. Immer wieder trat ein Japaner aus der Ladentüre hervor und keifte etwas, was den Vogel in Aufruhr versetzte. Es waren wirklich harte Nächte.
Am Morgen des Termins stand ich auf wie immer. Ich turnte, trank Instantkaffee und filterte das Wasser für den Tag. Beim ersten Wechseln des Pflasters hielt ich inne. Etwas war anders. Ich konnte zuerst nicht sagen was, also verteilte ich gewohnheitsmäßig ein wenig Zinkpaste und schnitt ein neues Pflaster zurecht. Doch etwas daran irritierte mich. Ich traf auf keine Unebenheiten auf der Oberfläche der Haut. Nach dem Abwaschen der Zinkpaste dann die Gewissheit: Die Wunde hatte sich über Nacht geschlossen…
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Melissa Tara Nielsen
Portugal
Hast du gelächelt
als ich mein Shirt ausgezogen habe
Sonne auf meinen Brüsten
Musik aus der Küche
Wein auf deiner Zunge
Qualm aus deinem Mund
Hattest du das
Universum im Blick
Sind meine Sommersprossen
auf dich heruntergefallen und
in deinen Bauchnabel getropft
Hattest du Haare
auf deiner Brust
meine oder deine
Hattest du deinen Gürtel noch an
deine Jeans
Wie lange
Wellen von der Küste
Hattest du
Schweiß auf deinen Lippen
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Henni-Lisette Busch
Untersuchung des Drogenvokabulars auf sein poetisches Potenzial:
Nur das kann ich, denn ich saß am See, als sie hinter mir tanzten, oder am Feuer saßen auf der befleckten Matratze, oder im Auto auf den zurückgelehnten Vordersitzen mit Ketamin im Gehirn und tauben Synapsen. Du existierst dann nicht mehr, sagte mir einer von ihnen, nicht du, als wir auf der Matratze am Lagerfeuer saßen und du, nicht er, dich im Rausch auf meinen Schoß legtest. Du bist einfach nicht mehr da oder nur noch ein ganz kleines bisschen und das ist manchmal sehr erleichternd, sagte er. Ich legte meine Flasche Billigwein in den Rasen und kraulte deinen nicht vorhandenen Kopf. Du löst dich auf und bist an einem Ort, wo sich deine Nicht-Existenz anfühlt wie Apfelmus mit Vanillesoße und du lachtest in meinen Schoß.
Meine Hand eckte nach unten, stieß den Finger zwischen kleine, kalte Halme und kratzte in den Boden; das Stroboskop zuckte blau und weiß und grün und warf mit kantigen Schatten. Ich hielt ihm stand mit weiten Pupillen, die pulsierten wie die Bässe in der Luft aus Regen und die Musik jagte das Licht und ich saß am Feuer auf der Matratze, kopfloser Schoß.
Warum ich da war?
Kein ich, kein wir, nur atmen in Baumkronen und selbst gefühlte Unwichtigkeit. Letztendlich ist es egal, ob ich unter Schwarzlichtlampen oder in Hörsälen sitze, es ist auch egal, wie Apfelmus mit Vanillesoße schmeckt und das ist gar nicht pessimistisch gemeint, sagte ich dir in meinem Schoß, ob du existieren willst oder nicht, ist egal. Irgendwas passiert zwischen Kreißsaal und Krematorium, da hätten wir sie wieder, die Wörter mit K. Kaum kein Kind mehr, arbeitest du an deiner Karriere, bildest Kompetenzen aus, stichst Konkurrenten aus, wirst letztendlich von jeder KI übertrumpft, im Kapitalismus ist die Freizeit für Konsum und Kurzurlaube, dass Krieg herrscht und dass es sowas gibt wie Klimaerwärmung, musst du noch irgendwie deinen Kindern erklären und du musst weiterarbeiten an deiner Karriere, denn wenn du aufhörst, dich abzukämpfen, verlierst du den Anschluss, fällst erst durch Klausuren und dann auf deine Knie und zu viel Kaffee ist auch schlecht, Saufen bis zum Kotzen, Selbstzerstörung, dein Körper braucht zwar Kalorien, aber auch nicht zu viele, jemand in deiner Familie stirbt an Krebs und mit der Zeit werden deine Knochen porös und deine Kraft schwindet…
Das ist gar nicht pessimistisch gemeint und im Prinzip ist das auch nichts Neues, aber trotzdem kochst du abends, und trotzdem kannst du tanzen, und trotzdem kämpfst du weiter, weil du ein Lebenskünstler bist.
Ich wäre gerne ein Gedicht – hermetisch abgeriegelt, gegen Ks zum Beispiel, doch ich saß da unter der Schwarzlichtlampe und nahm keine Drogen, in ein paar Stunden werde ich wieder im Hörsaal sitzen und keine Notizen machen.
Den Schotterweg zu uns entlang stach das Scheinwerferlicht und dienstmüde Augen schweiften über Gesichter, bitte nur noch mit 30 bis 40 Dezibel und neben dem Deck lag was Buntes und ein bisschen Gras. Nicht-Existenzen sind lauter, als das Lärmschutzgesetz erlaubt, aber man konsumiert leise. Die Scheinwerfer stocherten durch die Dunkelheit zurück und still saß ich wieder am Feuer und dort in der Baumkrone hing das Licht.
Willst du auch?
Weiße Linie auf schwarzem Display. Später ging einer kotzen – nur wer fliegt, kann abstürzen. Ich schwenkte meine Flasche Billigwein gegen Lichtgezucke, fast leer. Auch Alkohol betäubt Synapsen. Alkohol trinke ich kaum, sagtest du, nicht mehr in meinem Schoß, sondern halb liegend neben mir. Der letzte, nachtkalte Schluck rann meine Kehle hinab und ich wendete meinen Kopf halb zu dir: wann legst du eigentlich auf, dann suchte ich mit dem Handytaschenlampenlicht einen Ort zum Pinkeln.
Solche Musik imprägniert die Seele, ich weiß nicht, ob ich tanzte, ich bewegte meinen Körper, aber vielleicht bewegte mich die Musik, Arme eckten um meinen Rumpf und meine Beine stießen in den Boden und da schoss eine Ratte zwischen zehn bis zwölf Fußpaare hindurch, oder war das nur so ein gejagter Schatten?
Weißt du, und du lehntest dich zu mir rüber, ich wäre mit meiner Musik gern wie ein Pilz, der sein Netz im Untergrund entfaltet und mit seinen Sporen ein Umdenken bewirkt, wartetest kurz nur auf meine Reaktion und gingst dann rüber zum Deck und auf dem kurzen Weg dorthin verschlangen das Bild psilocybinbedingte Muster. Ich weiß nicht, was du sahst, aber genau das sah ich.
Den Stoff, aus dem Träume gemacht sind,
stellte ich mir selber her. Beim Tanzen zu deiner Musik meditierte ich, Visuals hatte ich nicht, aber ich visualisierte und stell dir vor, traumeigene Bilder mit DMT zu kombinieren… Weder romantisiere ich, noch verpflichte ich mich zur Moral und ich muss mich nicht erst zum Dessert bekennen, um die Möglichkeiten einer Nicht-Existenz in Klammern poetisch auszuschöpfen und nicht mal lyrisch muss ich sein, wenn Prosa bunt genug ist und irgendwo im Damals und Dort tanzte ich auf Träumen…
Und dann – sah ich – am Horizont – die Sonne.
Stell den Sturm auf stumm und unmute die Musik.
Es war nach sechs, das Lärmschutzgesetz schob die Regler hoch und mit der steigenden Sonne verblasste das Schwarzlampenlicht und Gold befleckte meine Wangen. Deine Hand lag kühl auf meiner Hüfte und ich war erleichtert, kein Gedicht zu sein. Meine selbstgemachten Visuals waberten hinter verschlossenen Augen noch auf den Wellen meines Unterbewusstseins, dann und wann ein Schaumkamm, Steilküste, Blick in die Ferne, ein Schritt und du fällst in die Sehnsucht. Warst du mit deiner Musik wie ein Pilz, fragte ich dich und entnahm deinem Schweigen eine Erinnerungslücke. Nur wer schreiben will, muss sich erinnern, also: hier sind deine Gedanken, ich schenke sie dir zurück.
Der Stoff, aus dem Träume gemacht sind,
glitzerte noch im Sonnenlicht. Meine imprägnierte Seele
atmete wieder und du lehntest dich zu mir rüber, einfach so, ohne was zu sagen, wartetest auf keine Reaktion und ich weiß nicht, was du sahst, aber ich sah dort hinten auf dem Feld im Nebel einen Kranich stehen.
Willst du auch
einen heißen Tee? Du holtest die Thermoskanne aus dem Auto, während ich sitzen blieb am See, hinter mir saßen sie an der Glut auf der befleckten Matratze und als du wiederkamst, waren wir hier und meine Existenz fühlte sich an, wie Apfelmus mit Vanillesoße. Meine Hand glitt durch kleine, kalte Halme und ich blickte der Sonne entgegen mit kleinen Pupillen.
Warum ich da war?
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Lise Reingruber
ein gestrandeter wal
meeresblau das wasser
in der badewanne
ein gleitender sockenfussel
gleich einem schwarzen vogel
um meinen körper
planlos schwebend
irgendwann dann
das badewasser ablassen
und liegen bleiben
mein körper schwer
immer schwerer — am ende
ein gestrandeter wal
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Felix Wünsche
Kind eines Vaters
Der Wind fuhr um die Hausecke, ein wenig kühl, spielte mit unseren Haaren. „Wir waren neulich bei Bekannten zum Geburtstag eingeladen. Da waren auch zwei Paare mit Kleinkindern und der eine Vater ist die ganze Zeit mit seinem Sprössling am Boden rumgekrochen. Hat sich echt zum Affen gemacht. Bubi hier, Bubi da. Rumgekeckert mit Babystimme. Immer schön auf den Knien rumgerutscht, weißte. So richtig peinlich. Und Applaus hat er auch noch dafür gekriegt von den Mamas. Schau mal, wie der sich kümmert, lächel, lächel. So ein Mist echt mal.“ Er zog an seiner Zigarette, die in der Herbstluft rot aufglomm, aschte ab. Sachte legten sich die feinen, verglühten Tabakteilchen auf meine Arbeitshose, auf die staubigen Schuhe. Roh und unverhohlen sauten mich seine Worte ein.
Was bleibt von mir, wenn ich mit sanfter Stimme gurre? Liebkose, mein Herz verliere? Bin ich verloren? Mir die ganze Kraft, die Welt zu stemmen, entrissen, Titanentod?
„Nicht meine Art, weißte. Man muss doch 'n bisschen Selbstrespekt haben. Das Leben ist auch einfach 'n Scheißdreck.“ Daran würgte er. Spuckte aus.
Zwei Jahre her. Der Dachstuhl war gerade fertig, Richtfest gefeiert. Vorm Winter würden die Dachpfannen drauf sein. Meine Arbeit war beendet. Mit ihm hatte ich öfter mal gequatscht in den Pausen, mal ein Bierchen getrunken. Wir lehnten an der rohen Betonwand. Seine Hand zerquetschte die aufgerauchte Zigarette, Ruß, schwarze Wut auf dem makellosen, gleichgültigen Grau.
In seinen Händen zeigt sich der Mensch, sie sind es, die liebkosen, erbauen, zerstören. Seine Hände waren muskelbepackt, nicht fähig, sich Konturen weich anzupassen, gewohnt, zuzupacken, zu schleppen, zu heben, Dinge zu bezwingen, zärtlich vielleicht zu aufsteigendem Mauerwerk.
Sein Junge war ein paar Mal auf der Baustelle gewesen. Wenn seine Mutter Dienst hatte samstags und die Oma zu Freunden oder Familie verreist war. Durfte eigentlich nicht auf die Baustelle, aber der Bauleiter drückte ein Auge zu, wenn er bei den Bauwagen blieb.
Strubbliges Haar, mattblond, Augen, die auszulaufen schienen. Aufgerissen, rote Augenlider, ein bleiches Gesicht, rotfleckig, die Mimik kämpfte gegen eine stille Erstarrung.
„Willst du 'ne Cola?“ Leises Nicken. „Komm.“ Ich musste ein Telefonat machen, eine Dienstplanänderung. Er stand an der Tür, den Kopf gesenkt, in der schmutzigen rechten Hand sein Handy. Ganz fest. Er hatte Muster mit den Fingern in den staubigen Sand vor den Wagen gezogen.
„Komm rein, setz dich.“ Ich holte eine Cola aus dem Kühlschrank, goss ihm einen Plastikbecher ein, den er zögerlich, ungeschickt mit der Linken griff. Trank mit niedergeschlagenen Augen, kleckerte sich Cola auf die Jacke, scheinbar ohne es zu merken. Klein war er. Sieben, hatte sein Vater mir erzählt. Robert. Seine Füße in den Gummistiefeln baumelten sachte in einem geheimen Rhythmus in der Luft.
Die Colaflasche noch in einer Hand, streckte ich spontan die andere aus, um ihm über die Haare zu fahren. Abrupt, heftig zuckte er zurück, ließ den Becher fallen, die Cola zeichnete dunkel einen Fleck auf den Boden, der sich langsam weiter in den Staub fraß. Steinern saß er da, unter den Wimpern quollen lautlos Tränen hervor, die Kiefer mahlten sie wegzubeißen.
„Alles okay. Alles gut, Robert. Ist nicht schlimm, hörst du? Tut mir ganz doll leid, dass ich dich erschreckt habe. Wir bringen das in Ordnung. Keine Angst. Ich wische das auf und du trinkst noch eine Cola auf den Schreck. Schau, ich stelle dir den Becher auf den Tisch hier. Du kannst ihn dir nehmen. Und ich mache den Fleck weg.“ Mir klumpte der Bauch. Weich redete ich auf ihn ein, wischte die Cola auf, sprach, ohne eine Antwort zu bekommen, über den Bagger, den ich ihn hatte bestaunen sehen und den gelben Baukran.
„Erzählst du nichts meinem Papa?“ Die Stimme war schmal. Das erste Mal blickte er mich an. Schüchtern, bereit, die Flucht zu ergreifen.
„Ich erzähle nichts. Versprochen. Großes Ehrenwort.“
„Meinst du, ich kann Baggerfahrer werden? Mein Papa sagt, nur gute Jungen können Baggerfahrer werden.“
„Ich bin ganz sicher, dass du Baggerfahrer werden kannst. Absolut. Du bist ein guter Junge. Das mit der Cola kann jedem passieren, wenn man sich erschreckt.“
Stumpfe Helligkeit warf Lichtstreifen in das Wageninnere. Durch das kleine, verschmutzte Fenster und den Spalt der halb offenen Tür stach sie herein, ließ seine grüne Jacke düster erscheinen. Die Cola hatte eine schmale Spur hinterlassen, vom Kragen hinab zur rechten Tasche.
„Wirklich?“
„Ja. Komm, ich wische dir die Cola ab. Dann muss ich mal telefonieren. Du kannst aber gerne hierbleiben.“ Ich wählte, drehte mich zum Dienstplan an der Rückwand und als ich aufgelegt hatte, mich umwand, war er weg.
Danach sah ich ihn nur noch einmal, als er mit seiner Mutter den Vater abholte. In der gleichen grünen Jacke stand er neben dem Wagen. Auf mein Winken reagierte er nicht. Hob nur kurz den Kopf, schaute mich an, als er einstieg, ein Blick, der mir blieb. Sein Vater hupte im Wegfahren. Eine lange Welle Verlassenheit schwappte mit vertrauter Wucht über mich hinweg.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Sebastian Sokołowski
der kern
ich habe mit meiner vermutung
recht behalten
die rückseite des mondes
birgt keine geheimnisse
keine zu erforschende prähistorie
die der mantel des vergessens deckt
die nackte kraterlandschaft
in unmittelbarer nähe
der endlosen leere
sagt niemandem was
wie die olympischen weltenlenker
die längst kein teufel mehr
fragt wer original
wer abbild ist
ich schreibe den ersten satz
niemals so dass
der leser unbedingt
den zweiten lesen will
es findet sich immer
jemand der das körnchen
wahrheit verzerrt
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sean Keibel
Meister des Heldentums
Wir bilden unsere Helden aus wie jede andere Zunft. Sie bekommen keine Sonderbehandlung, denn in Anbetracht der Bescheidenheit als höchste Tugend würde das nur ihren Charakter verderben. Ihre Berufsbekleidung, die sie auf ihrem Weg in den Betrieb meist schon am Leibe tragen, soll nicht nach Aufmerksamkeit lechzen. Hält man sie in den Straßen an, so ist ihr lächelndes Schweigen auf Anfrage – Sind Sie Held? – keine Koketterie. Ein jeder Bürger ist ausdrücklich angehalten, normal mit diesen Menschen umzugehen, auch wenn es schwerfällt, im Bruder, in der Schwester, im Onkel, in der Tante, im Schwiegervater, in der Schwiegermutter eben nicht mehr zu sehen als das; als Mitreisender im Zug muss man sich ihnen ja nicht zuwenden, aber wenn der Kontakt sich aufzwingt, darf man sich nicht blenden lassen vom strahlenden Heldentum, das einem ins Gesicht schlägt. Man darf nicht vergessen, dass sie ihre Heldenausbildung selbst gewählt haben; sich zu bewähren in der Not, sich gar aufzugeben, wenn es sein muss, und dabei ganz bescheiden zu bleiben und von sich aus niemandem von den eigenen Heldentaten zu erzählen, das bekommen sie ja im Berufsschulunterricht beigebracht, daraufhin werden sie trainiert, wie der Tischler in seinem Handwerk, wie der Maurer auch.
Wenn sie sich dann freigesprochen und frohen Mutes auf ihre Wanderschaft begeben, den Stock schwingend wie jeder andere Geselle und gehüllt in Tarnkleider, damit sie nicht auffallen, so sind sie nicht in Versuchung zu führen, keiner darf sie um Hilfe bitten, wenn Not am Mann ist, vielmehr müssen sie ihr Meisterstück von selbst erspähen und sich aus freien Stücken ohne Anleitung eines Anderen in die Aufgabe stürzen. Dies ist, offen gestanden, eine alte Sitte; später wird man ihnen genau sagen, wohin sie sich zu begeben haben und was sie dort tun sollen, was es ihnen, den Jüngeren, leichter macht Held zu sein; um die Älteren aber nicht zu brüskieren, deren Arbeitsalltag noch ganz anders war und ganz andere Qualitäten abverlangte – sie sitzen ja überdies in den Gremien, diese Älteren, und bestimmen mit über die Ausbildungsinhalte –, um sie also nicht zu brüskieren, belässt man einige der alten Sitten, damit die jungen Helden wissen, wie schwer es ihre Vorgänger einmal hatten und wie viel Respekt ihnen damit gebührt. Die Jungen nehmen es hin, sie nehmen es sogar auf und werden eines Tages vor den noch Jüngeren selbst darauf bestehen. Vorerst aber sind sie schließlich, nach sorgsam choreographierten Lehrjahren, Meister des Heldentums, die hoch gehandelt werden. Einige treten der Handelskammer bei und beteiligen sich an der Nachwuchsförderung.
Viele unserer Nachbarvölker neiden uns unsere Helden. Es sei ja alles viel zu durchorganisiert, blöken sie, eine Heldenreise könne nicht verordnet werden. In Wirklichkeit aber, da sind wir uns sicher, sind sie schon längst dabei, in aller Heimlichkeit ihre eigenen Helden zu produzieren. Freilich besorgt uns das nicht, denn wir haben den Vorsprung; was uns besorgt, betrifft unsere Bevölkerung, den einfachen Bürger, den es von allzu großer Verehrung, ja am besten jeglicher Verehrung unbedingt abzuhalten gilt, bevor er beginnt sich zu fragen: Wenn die Helden höher gehandelt werden als er selbst, weil sie sich für ihn, den Bürger, der also weniger wert ist, aufgeben würden – worin liegt ihr Wert dann eigentlich?
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>