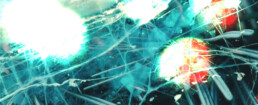4 | Christina König
Raststation
Ich war mitten auf einem Autobahnknoten, als mein Wagen den Geist aufgab. Die Asphaltstreifen kreuzten sich und liefen nach links und rechts, vorne und hinten, die Sonne knallte auf mein Armaturenbrett, das Auto hickste, es wurde langsamer und zwei oder drei Kontrollleuchten flammten auf. Am Pannenstreifen hielt ich an. Die Warnblinkanlage klickte wie ein Metronom, links rasten die Autos an mir vorbei und ich zog die Handbremse. In einer halben Stunde sollte ich bei meiner Schwester sein und ihr bei den Vorbereitungen für die Taufe meiner Nichte helfen.
„Was soll das heißen, du hast eine Panne?“ Die Stimme meiner Schwester stolperte. „Wir brauchen dich! Was ist mit den Salaten und der Deko und der Kerze? Und Tante Walli? Du bist die Taufpatin, ich schwör dir, wenn du nicht auftauchst…“
Der Schweiß stand auf meinen nackten Armen. Ich öffnete das Fenster und schloss es im Donnern der vorbeifahrenden Autos sofort wieder. Ich telefonierte mit meiner Mutter, die sagte, sie könnte mich unmöglich abholen, sie müsste noch Besorgungen für meinen Vater machen, dann mit meinem Cousin, der brummte, wenn es unbedingt sein müsste, dann könnte er jetzt losfahren und mich aufklauben, dann mit Tante Walli, der ich erklärte, dass ich sie nicht pünktlich abholen würde. Mitten in ihrer Schimpftirade tauchte der Abschleppwagen auf.
Während die Autos an mir vorbei ihren Zielen entgegenhetzten, balancierte ich am Pannenstreifen und beobachtete den Abschleppfahrer, wie er mein Auto auf seiner Ladefläche festschnallte und die Räder stabilisierte. Das kalt verschwitzte Taufkleid wehte im Luftsog der Autos um meine Beine und zerrte mich vorwärts, ich stemmte mich dagegen, stieg beim Abschleppwagen ein und er fuhr los und von der Autobahn ab; wir kurvten unter den vier Spuren durch und blieben an einer staubigen Raststation stehen. Hinter dem Tankstellenlogo ragte ein Burger King in den glühenden Himmelsdunst. Der Abschleppwagen verschwand, ich schulterte meine Taschen und schleppte zwei Nudelsalate, eine Taufkerze, ein aufblasbares Schwimmlama und meinen Übernachtungsrucksack durch die Glastüren, bestellte etwas Eiskaltes mit viel Zucker und warf mich in einen der harten Sitze. Popmusik dudelte aus den Lautsprechern. Eine Ladung übergewichtiger Männer existierte mit halb geschlossenen Augen in einer Ecke. Sonst war das Restaurant leer.
Mein Cousin antwortete mit einem genervten Daumen-hoch-Emoji, als ich ihm meinen Standort schickte. Mein Onkel schrieb mir eine Nachricht: hab ghört du hast a panne, vielleicht findst ja an feschen kerl der di mitnimmt haha. Meine Schwester fluchte. „Ja super, und ich mach das Buffet jetzt allein oder was? Wer schaut auf Sophia? Also du hast dir wirklich einen Scheißtag ausgesucht für deine Panne.“
Die Eiswürfel klickten in meinem Pappbecher, als ich mit dem Strohhalm umrührte. Hinter meinem Fenster preschten weiterhin die Autos vorbei. Die Glasscheiben verschluckten ihren Lärm. Inzwischen sollte ich bei meiner Schwester sein und die Nudelsalate in schöne Schüsseln füllen, die Markise ausrollen, Tomaten und Mozzarella schneiden, Saucen bereitstellen, Servietten falten, mit Sophia spielen, Anna in den Mittagsschlaf schaukeln und Luftballons aufblasen. Ich rollte den feuchten Becher an meiner Stirn hin und her und schloss die Augen. Hinter den Lidern jagten sich rastlos die Autos. Meine Mutter schrieb: Gibt es dort eine Apotheke, wo Du bist? Dein Vater braucht neue Warzenpflaster. Mama.
Die Resopalplatte meines Tisches war klebrig, wo die Menschen vor mir ihre Getränke verschüttet hatten. Die Angestellten drifteten hinter der Theke hin und her. Meine erhitzte Haut kühlte. Ich sah mich Polster auf die Bierbänke drapieren, Girlanden über Hecken werfen, Zitronensaft pressen, das Lama aufpumpen, Sonnenschirme herumschleppen, Grillkohle suchen, Sandspielzeug wegräumen und mich anmaulen lassen, weil die Taufkerze nicht schön genug war.
Wie Spinnfäden tropften die Minuten von der Decke auf mich herab. Ich fuhr mit den Autos auf ihren grauen Straßen in die Zukunft, zu Kindergebrüll und müden Sektkorken und brutzelnden Grillwürstchen und Tante Walli, die schrie, ihre Füße wären unruhig und jemand sollte ihr Tabletten bringen; Tortencreme klatschte auf hysterisch gemähten Rasen, Rotweinflecken landeten auf Annas Taufgewand, Fürze stahlen sich zwischen Fettschichten und Kleiderfalten durch und alles schmatzte und wieherte und witzelte. Meine Großmutter kniff mir in den Hintern. Der Graue Star meines Vaters starrte in den Pool. Meine Mutter klopfte die Brösel von seinem Schoß und goss pissgelbes Bier in sein Glas. Ich drückte die Handballen in die Augen und meine Schwester drückte mir Kinder und Teller und Windeln in die Arme, die Tischkärtchen platzierten mich neben Tante Walli, die sonst niemand ertrug, und die Rücken meiner Cousinen befragten meine Schwester zu den besten Stilleinlagen. Mein Großvater vergaß meinen Namen. Die Familie meines Schwagers redete mit mir, wenn sie Salz brauchte. Mein Onkel schaute auf meinen Busen und sagte: „So a Verschwendung.“ Die Autos stanken und hupten und fetzten hinter den Fenstern vorbei, sie heulten in meinen Ohren, fegten durch meine Adern, blitzten und blinkten und gleißten durch alle Synapsen und mein Handy vibrierte. Ich öffnete die Augen. Mein Cousin rief an. Eine Weile lang betrachtete ich die graue Kopfsilhouette auf dem Display. Dann schloss ich die Augen wieder.
.
Christina König
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Christina König
Geschmacklos
Der Tag, an dem das Essen seinen Geschmack verlor, war ein Dienstag. Wir saßen beim Abendessen, meine Frau hatte Krautfleckerl gemacht und ich griff zum zweiten Mal nach dem Salz, um ihnen Aroma zu entlocken. Meine Frau schaute mich pikiert an. Sie konnte nicht kochen und wollte es nicht wahrhaben.
„Es ist sicher gut, ich schmeck nur heute nichts.“
„Wie, du schmeckst nichts?“
Ich zuckte mit den Schultern. Das Salz glitzerte nutzlos wie Haarschuppen auf meinem Teller.
Nach dem Essen reichte mir meine Frau einen Corona-Test.
„Ernsthaft?“
„Man weiß ja nie.“
Der Test war negativ.
„Vielleicht geht es ja von allein wieder weg.“
Es ging nicht von allein wieder weg. Nach einer Woche schickte mich meine Frau zu ihrem Bruder, der Arzt war. Er kratzte sich am Kinn.
„Hast du Kopfverletzungen? Eine Erkältung? Einen trockenen Mund?“
„Nein.“
„Nimmst du irgendwelche Medikamente?“
„Was gegen Eisenmangel.“
„Könntest du schwanger sein?“
„Du weißt schon, dass ich mit deiner Schwester verheiratet bin.“
„Ich mein ja nur.“
Er führte ein paar Tests durch, aber als die Ergebnisse da waren, hob er nur die Achseln. „Eigentlich hast du nichts.“
„Und was machen wir jetzt?“
Wir machten weitere Tests, diesmal im Krankenhaus. Auch bei denen kam nichts raus. Ich wusste jetzt, dass meine Schilddrüse nichts hatte, ich nicht an einem Gehirntumor litt und aktuell keine Strahlentherapie machte. Grantig schaute ich meiner Frau dabei zu, wie sie Schokoladeneis löffelte.
„Ich kann aufhören, wenn du willst.“
Ich stapfte in die Küche, holte mir einen Löffel und grub ihn ebenfalls ins Eis. „Ich stell es mir jetzt einfach vor.“
Meine Frau sagte nichts. Die Brownie-Stücke aß sie selbst.
Ich pflanzte ein Kochbuch über gesunde Ernährung auf die Küchentheke. Es gab Rote-Beete-Salat, Linseneintopf und Walnuss-Apfel-Porridge zum Frühstück. Ich nahm fünf Kilo ab.
„Wenn ich schon nichts schmecke, kann es gesund auch gleich sein.“
„Recht hast du.“ Trübsinnig schaufelte meine Frau gedämpfte Brokkoli in sich hinein.
„Magst du’s nicht?“
„Es ist ein bisschen stark gewürzt.“
Ich kniff die Augen zusammen.
„Ich sag schon nichts mehr.“
Die Pizza schwitzte auf dem Teller vor sich hin. Meine Freundinnen gafften mich an. Ich schnitt ein Dreieck ab und führte es zum Mund. Niemand sagte etwas. Ich nahm einen Bissen und alles jubelte, kreischte und applaudierte wie bei der Mondlandung. Ich hasste Tomatensauce. Meine beste Freundin erzählte heute noch die Geschichte, wie ich mich bei den Kennenlerntagen im Gymnasium übergeben hatte, als die Lehrerin mich zum Pizzaessen gezwungen hatte. Eine Freundin schoss ein Foto. Ich hob den Daumen und grinste blöd.
Drei Wochen lang musste ich bei jedem Freundinnentreffen Pizza essen. Dann wurde es den anderen zu langweilig. Meine beste Freundin sagte: „Ich weiß nicht mehr, was ich den Leuten über dich erzählen soll, wenn ich nicht mehr sagen kann, dass du Pizza hasst.“ Meine Frau sagte: „So identitätsstiftend war das auch nicht.“ Meine beste Freundin sagte: „Na, es war schon ziemlich cool.“
Mein Neffe kicherte und gluckste und drängte mir eine furchtbare Essenskombination nach der anderen auf. Gurke mit Nutella. Ketchup auf Kaiserschmarrn. Cornflakes in Cola. Ich schlang alles gelangweilt herunter. Bisher hatte er mit mir nichts anfangen können, jetzt war ich seine Lieblingstante. So lange, bis er selbst nur noch Lasagne mit Gummibären essen wollte und seine Eltern mir verboten, ihn aufzustacheln. Dann mochte er wieder meine Schwester lieber.
Meine Arbeitskollegen redeten über die neue Kochshow auf Netflix, über die Vorteile von Granatapfeleis und über die besten Sommersalatrezepte. Ich zupfte an meinem Falafel-Wrap herum. Dann redeten sie über die Kollegin, die immer die besten Geburtstagskuchen backte, über die Teriyaki-Sauce beim Chinesen gegenüber und über kalorienarme Muffins. Ich zermalmte Kichererbsen und Datteltomaten zwischen den Zähnen. Dann schwärmten sie von den Erdbeeren aus eigenem Anbau.
„Hört ihr endlich auf mit dem Scheiß?“
Alle gafften mich an. Ich warf meinen Wrap in den Mülleimer und stopfte mir Dragee-Keksi vom Süßigkeitentisch in den Mund. Es krachte neurotisch.
Ich hing über dem Schnitzel, das meine Frau und ich bei Mjam bestellt hatten. (Es gab jetzt wieder Schnitzel.) Nebenbei lief eine Fernsehsendung, von der wir beide bestritten, dass wir sie jemals gesehen hatten.
„Du, ich glaub, ich schmeck was.“
„Hm?“
„Ich schmeck was.“
Sie löste den Blick vom Bildschirm. „Bist du sicher?“
„Ich glaub schon.“ Ich kaute, stoppte, kaute weiter. „Oder ich weiß nicht.“
Meine Frau stand auf, holte das Chiliöl aus der Küche und goss einen Schluck über mein Schnitzel. „Probier nochmal.“
Ich kostete. Dann zuckte ich mit den Schultern. Meine Frau schnitt ein durchtränktes Stück von meinem Schnitzel ab und aß es selbst. Ihre Augen tränten, sie wurde rot und spuckte das Stück in ihre Serviette. „Du schmeckst nichts.“
„Okay.“
Wir widmeten uns wieder unserer Fernsehsendung. Dasselbe Gespräch hatten wir schon fünfmal geführt.
Beim Geburtstag meines Bruders kam die ganze Familie zusammen. Jedes Jahr wünschte er sich Käsefondue. Dazu gab es Fleischbällchen, Prosciutto-Melonen-Spieße, Ofenkartoffeln und Maissalat. Ich brachte selbst gemachtes Knoblauchbrot mit. Mein Bruder fütterte meine Nichte, mein Neffe ließ sich flüssigen Käse übers Gesicht tropfen, meine Frau schnüffelte an den Ofenkartoffeln, mein Vater lachte mit vollem Mund und ich warf meinen Teller auf den Boden. Alles wurde ruhig.
Ich hörte auf zu essen. Ich nahm nur noch etwas zu mir, wenn mir der Kreislauf versagte. In der Arbeit konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, ich hatte dauernd Kopfschmerzen und lag am liebsten auf der Couch. Auf dem Weg zum Einkaufen wurde mir einmal schwindelig, ich fiel ein paar Stufen herunter und wachte im Krankenhaus wieder auf. Meine Frau saß auf dem Stuhl neben meinem Bett. „Wenn du so weitermachst, verlass ich dich.“ Die Schwester schob einen Wagen mit Lauchrisotto und Schokoladenpudding als Nachspeise herein. Ich griff zur Gabel.
Wir saßen gemeinsam am Frühstückstisch. Es gab Rühreier. Ich schaufelte meine Portion in mich hinein. Dann stockte ich. Ich öffnete den Mund.
„Du schmeckst nichts.“
Ich klappte ihn wieder zu. Wir aßen weiter.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
mosaik36 - Eine Wohnung mit Zukunft
mosaik36 - Eine Wohnung mit Zukunft
Winter 2022
.
INTRO
Wir wohnen seit zehn Jahren im bedruckten Papier.
Literaturzeitschrift.
Eine Zeitschrift mit Zukunft.
Hier wollen wir alt werden.
Man macht das eigentlich nicht, aber wir hoffen auf Milde aufgrund unseres Alters: Wir haben uns für diesen Einstieg einer Textstelle von Pia Schmikl (S. 20) bedient und an unsere Situation angepasst. Es ist nämlich so, dass wir dieser Tage das zehnjährige Jubiläum der mosaik1 feiern. Und es ist auch so, dass wir traditionell lieber nach vorne als zurück blicken. Vor zehn Jahren haben wir das nicht gemacht: Niemand hat sich überlegt, was wir dereinst beim 10-jährigen Jubiläum wohl machen sollen. Und so feiern wir unseren ersten runden Geburtstag etappenweise: In dieser Ausgabe findet ihr ein paar wenige, ausgewählte Texte, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Im Herbst werden wir mit euch allen gemeinsam ein mosaik-Fest feiern. Und dann fällt uns sicher noch weiterer Jubiläums-Schabernack in diesem Jahr ein.
Und gleichzeitig blicken wir weiter in die Zukunft – mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es warten spannende Projekte auf uns: Bücher, Kooperationen und neue Ideen! Aber gleichzeitig hat sich auch nach zehn Jahren wenig an der prekären Situation des Projektes mosaik geändert. Wir arbeiten gerne und nur von Idealismus getragen – hinterfragen diese Praxis aber immer öfter und fragen uns, wie es weitergehen kann.
Bevor wir jetzt aber selber zum Partycrasher oder zur Spaßbremse werden, wünschen wir euch viel Freude mit dem neuen Heft. Aber nicht vergessen: „Lesen ist eigentlich asozial.“ (Stefanie Stegmann, S. 82)
euer mosaik
.
.
Inhalt
Spezial: 10 Jahre mosaik
Stell dir vor, du kommst nach einer Lesung ins Gespräch: Was es bräuchte, wäre eine stärkere Förderung junger und neuer Autor*innen, am besten mittels einer Zeitschrift! Man beschließt die Gründung einer solchen. Gefühlt drei Tage später feiert man das 10-jährige Jubiläum.
Wir sind keine großen Freund*innen von Sentimentalitäten, aber wir erinnern uns in dieser Ausgabe sehr gern zurück, haben Wegbegleiter*innen des mosaik gefragt, an welche Texte sie sich erinnern, welche hängen geblieben sind – und präsentieren eine nicht repräsentative Auswahl auf den ersten Seiten. Nur original auf kariertem Papier (wie bei mosaik1). Viel Freude mit dem bisschen Nostalgie.
Wellengang oder Geflüster
Pia Schmikl – Ein Fisch kennt keine Angst vor dem Ertrinken
Georg Großmann – Altokumuli | Einige Pilzarten
Stefanie Nebenführ – Das Haus
Sigune Schnabel – Kindheit
Giovanna-Beatrice Carlesso – Der Hase rennt
dringende seelenstoffe
Elke Steiner – ich schenke dir mein natternhemd
Christina König – Gegenüber
Jimmy Brainless – Der Eiswürfel
Ronja Lobner – mein letzter rest
halb Wunschvorstellung
Leo Lemke – Der Wasserwandler
Signe Ibbeken – Kurz vor Glücksstadt
Hannah Beckmann – Dunkel, Linie, Dunkel
Vera Hohleiter – Fundstücke
Anja Bachl – Kaleidoskop
Kunststrecke von Ursula Wimmesberger
BABEL – Übersetzungen
Miklós Radnóti, geboren am 5. Mai 1909 in Budapest, war ungarischer Dichter jüdischer Abstammung. Sein Werk war beeinflusst von der tschechisch-ungarischen Avantgarde und dem französischen Expressionismus. Seine Tätigkeit als Handelskorrespondent im Unternehmen seines Onkels legte er 1930 nieder, um Ungarische
und Französische Philologie zu studieren. Im selben Jahr veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband ‚Pogány köszöntő – Heidnischer Willkommensgruß‘.
Der zweite Gedichtband wurde aufgrund des Vorwurfs der Obszönität verboten und brachte ihm beinahe eine Haftstrafe ein. In den frühen 1940er Jahren wurde er zur Zwangsarbeit eingezogen und schließlich nach Bor im heutigen Serbien deportiert. Bei einem Gewaltmarsch Anfang November 1944 kollabierte er nahe der österreichisch-ungarischen Grenze und wurde mit 21 anderen Mithäftlingen hingerichtet. Sein Leichnam konnte später in einem Massengrab identifiziert werden. Bei sich trug er ein Notizbuch mit seinen letzten Gedichten. Darunter den hier vorliegenden Zyklus ‚Razglednicák‘.
Miklós Radnóti – Homály / Dämmerlicht
– Két karodban / In deinen Armen
– Razglednicák / Razgledinicen
[foejәtõ]
Wo findet (denn eigentlich) Literatur statt? Im Kulturteil setzen sich diesmal gleich mehrere Texte mit möglichen, neuen und sinnstiftenden Orten der Literatur, von Lesungen, von Gesprächen über Kunst auseinander: Raoul Eisele bewandert den urbanen Raum, Hartmut Hombrecher und Martin Peichl beleuchten jeweils innovative Ideen und Umsetzungen von unabhängigen Lesereihen, Stefanie Stegmann berichtet im Interview von ihrer zwischen/miete – Lesungen in WGs!
Kreativraum mit Friedrich Rücker
.
.
>> Infos, Leseprobe und Bestellen
11 | Christina König
Finderlohn
hast du schon mal kaiserschmarrn mit eierlikör gegessen
hey es ist das beste
am weihnachtsmarkt gibts da so einen stand
da haben sie so was
ich könnt mich dort fett fressen
beim nächsten mal gehen wir da hin
ich bekehr dich schon
Schlumpfblaue Augen tanzen durch den Raum, vom pseudo-antiken Kronleuchter über Salz und Zucker bis zu mir. Überschminkte Sommersprossen sprenkeln ihre Stirn, drei Muttermale wandern über ihre Wangenknochen wie Orions Gürtel und unter ihr Ohr ist eine Taube tätowiert. Hinter den geschlossenen Fenstern präsentieren die Schneeflocken ihr russisches Ballett und sie streckt ihnen die Zunge heraus: Sie hasse den Winter, immer sei es so kalt, sie wolle endlich wieder Sommer; ich schiebe ihr meinen Cappuccino hin, sie trinkt dort, wo vorher meine Lippen die Tasse berührt haben, und draußen rauscht ein Rettungswagen mit Blaulicht vorbei. Hinter ihr schält sich die türkisblaue Tapete ab. Dunkle Wandfarbe mit seltsamen Mustern kommt darunter zum Vorschein.
und dann sagt der ernsthaft zu mir
na dann müssen sie halt länger bleiben
das kann ja wohl nicht das problem sein
hallo gehts noch
soll ich meiner tochter sagen sie soll im kindergarten übernachten oder was
und ihr papa
also mein ex
der ist so nutzlos
den brauch ich wegen abholen gar nicht fragen
das nervt mich alles schon so
Das Kunststück aus Schokolade, Creme und Erdbeeren landet auf dem Imitat eines japanischen Tellers neben ihrem Ellbogen. Ihre Gabel taucht hinein, gräbt die erste Erdbeere aus wie ein Bagger und fliegt zu ihrem Mund. Das zweite Stück überlässt sie mir, ein Klecks Creme bleibt an meiner Unterlippe hängen und sie tupft ihn mit dem Daumen ab, betrachtet die Fingerkuppe und leckt sie ab. Eine Zitronenscheibe sprudelt im Sodawasser, Blasen steigen an die Oberfläche und rosa Lippenstiftfasern hängen am Glasrand. Goldringe blitzen auf, sie dreht meine Handfläche nach oben und liest meine Zukunft heraus; sie bescheinigt mir zahlreiche Liebschaften und ich sage nichts. Manchmal berührt ihr Fuß mein Bein.
der letzte
o gott
der war eine katastrophe
na in einer beziehung sind wir doch nicht
warum ist das nicht wurscht wenn ich lieber pornos schau als dass ich mit dir schlaf
und wehe du verlangst dass ich mal nicht zu spät komm
emotionally unavailable
ich schwörs dir
Ihre Hand dreht die Schneewittchenhaare um die Finger wie eine Spindel, Kerzenlicht verfängt sich darin, der Kleeblatt-Anhänger an ihrer Halskette oxidiert und ich lächle. Sie weiß von nichts. Denkt immer noch, wir hätten uns zufällig kennengelernt. Als hätte ich einfach so ihre Geldtasche gefunden und zurückgegeben. Ihren Retter aus der Finanzkrise hat sie mich genannt, mir ein fast volles Säckchen Trüffelpralinen überreicht, das sie aus einer Büroschublade geklaut hat, und die Geschichte unter dem Hashtag #weihnachtswunder auf Instagram gepostet. Alle ihre Freundinnen haben kommentiert, wie viel Glück sie gehabt habe, sie redet von Schicksal und Karma, unsere Teller sind leer, die Rechnung flattert auf die Tischplatte und sie greift nach ihrer Tasche, Finderlohn, sagt sie, und ich lege meine Hand auf ihre; ich mach schon. Ihre Ringe und neongelben Nägel verschwinden unter meiner Hand, ich drücke kurz und sie lächelt. Ihre Stiefel klackern auf dem Marmorboden, ihre Hüfte streift mich und wir treten hinaus in den wirr verschneiten Winterabend.
.
Christina König
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: