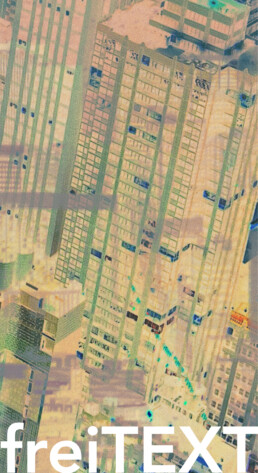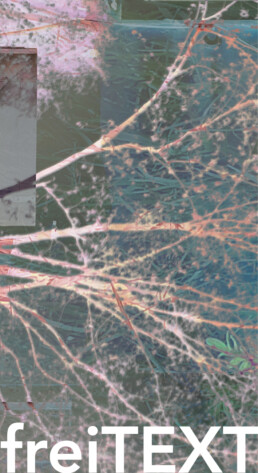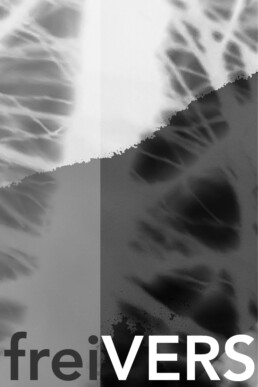freiVERS | Eline Menke
Auf der Autobahn
Im Fahrtenbuch meiner Sätze
fehlt Geschwindigkeit.
Kein Wort ist meinem Weg voraus.
Es ist laut. Du vertraust Geräuschen,
die sich gegenseitig zerfleischen,
leckst Leere von den Lippen,
sprichst von Verdunklungsgefahr
im Freigang der Gedanken.
Ich schweige die Landschaft an,
rausche in sie hinein.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | all caps
lauthals
ich trau mich nicht die töpfe zu säubern, die gläser die gabeln die löffel die tupper die dosen deinen letzten speichel wegzumachen, deine wimpern wegpusten zum staub, deine durchsichtigen fußabdrücke mit dem besen zu kehren, obwohl die straße längst darin übrig ist, zwischen die fliesen gekullert. deinen letzten speichel, den ich so lange vermisst und jetzt wieder misse, mein herz, worüber beugt sich meins, liebling deiner neurone wenn du dir müde den schlaf aus den augen wischst und deine haare zerzaust, wenn du mit müden füßen und durchlüfteten lungen abends durch deine wohnungstür eine sprachnachricht aufnimmst und summst
ich hab den schlaf gesammelt, den du dir aus den augen gewischt hast, hab alle wimpern geschluckt, die du weggepustet hast von meiner zunge in meine luft röhren reiniger kaufe ich nicht brauche ich nicht, weil ich bei jedem halskratzen deine wünsche schmeck en noch nach gelben gummistiefeln zwei paar an verandatreppen runtersteppen in den garten, ich trau mich nicht schon wieder auf etwas zu warten was in der spülmaschine bricht.
ich traue mir zu, dass ich mich an irgendwelchen scherben schneide, deshalb spül ich nicht ab, spür ich nicht hin, schreib ich dir nicht
liebesbriefe
weißt du hab ich oft genug und vorgetragen und immer hör ich dann münder sagen ich dich nicht
ich trau mich nicht mein handy auf laut zu machen, weil was wenn wer anruft und was wenn es bingt und was wenn es du bist und was wenn es klingt, als würde es dir egal sein als wäre das was, was du dich einfach traust
ich trau mich jetzt wieder auf die straßen, diese stadt gehört auch mir meine haut, die
lass ich mir nicht nehmen (nur auf den busbahnhof trau ich mich immer noch nicht ganz)
traue mich (nicht) zu weinen, wenn er bricht, es kullert rückwärts, weil ich außen sonst nicht ernst genommen sonst emotional bin, als wäre das was schlechtes, rückwärts der dammbruch meiner wirbelsäule, wenn alte wunden feuern in alle richtungen und ich decken für die feuer suche, stick dicht im rauch dicht es mir aus den augen quillt statt tropft, rückwärts läuft es meine kehle runter und tropft auf
die zeit zurück, in der wir
im dunkeln flüstern
wir nicht mehr wie tagsüber, weil nur noch wir uns hören können und wenn nur du mich hörst, kann ich gar nichts falsches sagen, wenn nur du mich hören kannst verrate ich dir lauthals, dass ich meine stimme hasse, aber wenn nur du mich hörst, bleibt das unter uns und vielleicht können wir tauschen?
zusammen tragen wir uns durch die stadt, wir trauen uns in jede straße, in jede dunkle gasse, die wir alleine nicht betreten würden, zusammen mit dir traue ich mich zurückzuschreien, wenn uns jemand f**tze aus dem autofenster zubrüllt, du zückst deine mittelfinger und ich traue mich das jetzt auch
das habe ich von dir gelernt und meine zunge, die habe ich dir zu verdanken und meine zähne, die auch. beißen haben wir zusammen gelernt und spucken mit energie, dass es vom pflaster zurückspritzt, winkel berechnet, in die richtige richtung
direkt auf die windschutzscheibe und es wird lauter gebrüllt und der motor aufgeheult und wir flüchten auf den fahrrädern durch die nacht aber hauptsache zurückgebrüllt, hauptsache zusammen
trauen wir uns in jede nacht in jede noch so dunkle ecke
das hab ich von dir gelernt, das nicht schlafen gehen müssen und dass es nachts genug gründe gibt wach zu bleiben und meine schlafstörungen, die hab ich dir zu verdanken
ich trauere nicht mehr um dich.
wir standen in meiner küche, als du gesagt hast, du findest das mit uns ist mehr so freundschaftlich und ich habe genickt, damit mein hals aufgeht und die tränenflüssigkeit sich auf meiner netzhaut gleichmäßig verteilt und bloß keine kleinen kügelchen bildet
ich traue meiner zunge nicht, wieso zitterst du, wieso verrätst du mich
ich traue meiner zunge nicht, weil sie manchmal so high pitched spricht, obwohl ich doch so masc obwohl ich doch so lässig wieso zitterst du wieso sprichst du nicht mich wieso brichst du das bild an solchen tagen trau ich mich nichts sagen dann mach ich mich sprachlos
an supermarktkassen, weil meine stimmbänder sich nach alten regeln anschlagen
alle regeln zerschlagen
das hab ich von dir gelernt
und meine zunge zeigen hab ich dir zu verdanken.
heute hab ich keinen empfang, ich schreib dir briefe aus lesbos, versprochen, ich trau mich jetzt
fang! hechte voraus und sag mir, ist es das, wo wir hergekommen sind
ich trau mich denn der blick zurück sagt vorne liegt mehr der blick zurück sagt zieh los mach dich auf
und ich trau mich das jetzt
irgendwann.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Elia Aubry
Wolken ist ein anderes Gefühl
Wann wirst du wiederkommen frage ich
wirst du wiederkommen?
Der Besuch er kommt zwischen die Zustände
ich meine Wirklichkeit
und meine Wirklichkeit
wo dich der Moment hin und her
wendet zuweilen auch Omeletten
wir fanden unter dem Laub eine Schar
Totentrompeten in Knoblauch geschwenkt
Dass ich denke (immer) wie
ich das gemacht habe mit den Vorstellungen
ich meine Luft unter den Flügeln
und der Wirklichkeit ich meine
Boden unter den Füssen
und der Lust ich meine
das Vergessen der Fallhöhe
wenn dir die Flügel bestellt
nämlich wie brachliegende Felder
im Hand-um-drehen
Der Besuch er linst aus dem Fenster so
als fahnde er dort nach dem Sinn des Lebens
den die Luft (wer weiss) als winzige Materie enthält
Ich meine die Geste des Hypnotiseurs die
dir die Augen in ihren Sockeln wegdreht
Ich flösse dem Besuch beruhigenden Tee ein
streiche ihm behutsam übers Haar und so
weiter halte ich seinen Kopf (Kugel) und richte ihn aus
auf die Einbildung die durch die Wirklichkeit pflügt
Der Horizont er kommt langsam ins Bild
und stellt Gegenwart her ein schmaler
Streifen Himmel erhellt sich
heller rot röter und so
weiter denke ich an einer Stelle so hell
dass es weh tut beim Hineinschauen es
ist 8 Uhr 34 und die Sonne wirft eine Zeichnung
an die Wand über dem Küchentisch
wir meinen die gleiche wie letztes Jahr
Wir führen Protokoll ein Inventar
vor einem Jahr
:in die Sanduhr
hinein
eine Oase denken
Der Besuch er sagt unsere Wörter sind wild
und scheu
nachts schleichen sie einsam durch die Gassen
und benehmen sich unangemessen
Es ist, letzten Endes, das gute
Recht der Wörter, die Dinge durcheinander
zu bringen und […] (G.B.)
Der Besuch er ist gegangen er kommt
und geht wie es ihm passt
er hinterlässt Sätze mit Augen
und Ohren gestohlen
ausgeschüttet am Küchentisch
:der Schreibende wobei
er sich darüber nicht (mehr) im Klaren ist
Ich schreibe: ich schreibe…
Ich schreibe: «ich schreibe…»
Ich schreibe, dass ich schreibe…(G.P.)
Ich schreibe:
wer sich aufs Schreiben einlässt
der tut es nicht um sein Leben zu retten
er tut es um sein Leben zu leben und
merke die Wörter sie hecheln nach Luft
die Möglichkeit ein Wort zu tauschen
die Möglichkeit ein Wort zu leihen
die Möglichkeit ein Wort weiterzuverleihen
ich habe das lange nicht verstanden
die Anatomie von
ich meine die Evolution eines Satzes
Gib mir eine Erinnerung sagt der Besuch
Einfach so eine zufällige?
Ja die erste die sich um 8.45 am Küchentisch einstellt
Die Unmöglichkeit ein Wort zu tauschen
Die Unmöglichkeit ein Wort zu leihen
Die Unmöglichkeit ein Wort weiterzuverleihen
fast hätte ich gesagt Sprachlosigkeit
oder wir legten Wörter in unsere Köpfe
wie etwas Zerbrechliches in etwas Zerbrechliches
Wie lange noch fragt der Besuch
wann werden wir
und eine Handvoll Wunder am Wegrand
Bilder machen um zu sehen
ob sie uns entsprechen
Der Besuch er sagt
ich werde ein Gefühl für dich
an dem du entlangleben kannst
Morgens liegen wir träumend in der Schwerelosigkeit
das Erwachen wie ein Wiedereintritt
wie Verrat an den Träumen
die Schwerkraft als Strafe
Und Träume solche die hinüber
wollen und kleben bleiben
fast hätte ich gesagt wie Scheisse
schlagen wir in den Wind
Bäume im Wind nie sind sie schöner
ich meine Gedanken in den Wind
nie schöner vielleicht
in den Wolken
Wolken ist ein anderes Gefühl
Literaturnachweis:
Georges Bataille, 2005, Kritisches Wörterbuch, Merve Verlag Leipzig
Georges Perec, 2013, Träume von Räumen, Diaphanes Verlag Zürich
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tillmann Lösch
Rauchmelder
Das Aufstehen ist
ein Problem.
Manchmal geht es einfach nicht.
Selbst dann nicht, wenn ich auf die Toilette muss.
Hüfte, Knie – morsches Holz.
Die Frau, die zweimal die Woche klingelt, die mir die Wäsche macht, die das Geschirr aus weißem Hartplastik von der AWO rausstellt, sie würde gerne mehr helfen,
sagt sie.
Aber so viel Zeit, wie es dafür bräuchte,
hat sie nicht.
Es riecht
unangenehm.
Nein, es stinkt.
Es stinkt nach Pisse. Der Gestank ist im Bad. Hält sich im Fernsehzimmer. Im Schlafzimmer. Ich kriege ihn nicht mehr raus.
Schämte mich,
als der Schornsteinfeger ins Haus musste, um etwas abzulesen.
Die Treppe nach unten bedeutet nichts
als Schmerzen.
Am Morgen herunter und später wieder rauf. Ein Mal am Tag mache ich das. Wenn es geht, setze ich mich und rutsche herab.
Eine Stufe,
eine Pause.
Im Erdgeschoss steht mein Rollator, oben lehnen die Stöcke. Damit komme ich zurück bis zum Sessel. Noch. Aber was,
wenn ich falle?
Irrsinn sagen die Kinder. Ich sage nichts.
Sie haben sich abgesprochen. Das merke ich
daran, wie sie mir gegenübersitzen. Wie sie sich die Bälle zuwerfen. Sie reden über mich, als wäre ich
gar nicht da.
Eine Situation nennen sie es. Eine Lösung muss gefunden werden, sagen sie. Eine, die finanziell machbar ist.
Ich sage,
dass sie sich zum Teufel scheren können, dass es mein Haus ist und ich sehe,
wie sie den Kopf schütteln.
Ein ganzes Leben. Siedlungsfeste, Kegelverein, Adler Osterfeld, Kumpels von der Zeche.
Wenn ich von hier weggehe,
komme ich nicht mehr wieder.
Ein Starren ins Nichts. Mandalas und Suppe. Sie spielen Mensch ärgere dich nicht, und wenn sie würfeln, pressen sie ihre faltigen Lippen aufeinander und dann freuen sie sich, wie kleine Kinder es tun. Man hat uns eingesperrt. Man sagt es nicht, aber
es ist so.
Je länger man so lebt, desto mehr vergeht man.
Der Tod
ist allgegenwärtig,
wartet geduldig
und legt denen, die im Gesellschaftsraum singen wie die Bekloppten, bereits seine Hand auf die Schulter.
Ich ertrage es
nicht.
Ich existiere nur mehr in einem Zimmer von zwölf Quadratmetern.
Ich löse Kreuzworträtsel.
Ich schlafe.
Ich sehe aus dem Fenster in den Garten.
Durch die Vorhänge der Wohnungen gegenüber beobachte ich, wie fremde Familien aufstehen, die Kinder morgens frühstücken, bevor sie in die Schule gehen, die Eltern abends von der Arbeit kommen,
essen,
streiten,
fernsehen.
Mein Enkel war bei mir und hat grüne Hanteln mitgebracht. Ein Kilogramm pro Stück. Für die Arme meint er. Wie es mir geht, hat er gefragt, als wir uns gegenübersaßen. Ob das Essen in Ordnung ist? Ob ich mich langweile? Das Zimmer findet er ganz schön. Ein bisschen klein vielleicht, aber ansonsten doch in Ordnung? Sogar mit Blick auf den Garten. Und schön hell, wenn die Sonne scheint. Eine Ausbildung will er machen.
Schweigen.
Verabschiedung.
Die Hanteln habe ich seither nicht benutzt.
Ich sitze am Fenster und öffne die Augen. Musik. Gelächter, Alkohol und Zigaretten. Viele Gäste waren früher bei uns. Auch ein guter Bekannter aus dem Kegelverein. Einmal beugte er sich vornüber und sagte etwas zu meiner Frau. Sie sah ihn erschrocken an. Dann sah sie zu mir. Ich sagte nichts. Obwohl ich es gehört hatte, hielt ich den Mund, trank weiter und lachte mit den anderen bis zum nächsten Morgen.
Danach sah sie mich anders an.
Ich halte den Hörer fest in der Hand. Wenn ich könnte,
ich würde ihn zerdrücken.
Doch ich kann nicht. Stattdessen höre ich, was man mir mitzuteilen hat.
Viel
gibt es nicht zu sagen. Ich notiere Datum und Uhrzeit, bedanke mich und lege auf.
Bin der letzte, der noch da ist.
Der junge Pfarrer behauptet, das Leben sei ein Fluss im ständigen Wandel. Eine hoffnungsvolle Bewegung hin zu einem großen Ganzen, einem ewigen Meer, sagt er.
Eisernes Schweigen
schlägt ihm aus den müden Gesichtern derjenigen entgegen, die zur Beerdigung gekommen sind und von denen ich niemanden kenne.
Ich möchte aufstehen.
Möchte rufen, dass nichts so ist, wie er behauptet.
Weder Fluss noch Meer habe ich vor Augen. Ein Trotzen. Eine ständige Rückschau. Erinnern, vergessen. Wut und Scham über Dinge, die geschehen sind und die nachhallen. Vor allem aber ein Warten. Da ist keine Hoffnung, da ist nur Angst am Ende alleine zu sein. Das alles möchte ich ihm zurufen,
möchte ihn packen und schütteln.
Doch ich sage nichts und später nicke ich ihm zu, als er an mir vorübergeht.
In meinem Zimmer hängt an der Decke ein Rauchmelder. Ich weiß, dass er funktioniert, denn er blinkt regelmäßig fünfmal pro Minute. Ich habe gezählt. Habe den Rauchmelder angesehen und an meinen Fingern mitgezählt. Während sie draußen auf den Fluren singen, sitze ich auf einem Stuhl am Fenster
und zähle noch mal.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Torsten Siche
andächtig
Vermoosung unter der Zunge
mehr als ein aufgestoßenes Gebet
zwischen den Seiten zittern
die Finger ein Lied herbei
ein Krächzen gespuckt statt Lobpreis
die Erinnerung splittert unter den Nägeln
schnell überwachsen die Spuren im Gras
noch knistert das Laub des letzten Jahres
unter den Schuhen erhebt sich der Gesang
wie fallen gelassen kurz nach der Geburt
Bruchstein unter Efeu vergessen
beim Näherknien bricht das Dickicht
unter der Stirn keine Melodie
kein Klageton
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Clara Dobbelstein
Kerstin
Eigentlich hatte Christina den Gartenteich für die Koi-Karpfenhaltung angelegt. Sumpfdotterblumen und Schwertlilien hatte sie gepflanzt, auch Pfeilkraut und Seerosen. Sie hatte eine Terrasse mitsamt einem schmalen Steg aus Douglasienholz anbauen lassen.
Nachts durchzogen bunt gescheckte Koi-Karpfenschwärme Christinas Träume. Sie konnte die Koibabys kaum mehr erwarten, so sehr sehnte sie sich danach, die kühle Karpfenhaut unter ihren Fingern vorübergleiten zu spüren.
Doch dann kam Kerstin. Eigentlich wollte Christina sie nur vorübergehend aufnehmen. Ihre Nachbarin hatte unter Tränen darum gebeten. Kerstin sei in letzter Zeit aggressiv geworden. Sie bräuchte zumindest für ein paar Tage ordentlich Auslauf und frische Luft.
Christina hatte sich erbarmt und die verwahrloste Kreatur aufgepäppelt. Erst bei der Übergabe war ihr erklärt worden, dass es sich um eine Schnappschildkröte handele. Schnappschildkröten könnten mit einem blitzschnellen Happs einen Finger abbeißen. Deswegen solle Christina ein bisschen aufpassen.
Anfangs warf sie Kerstin nur im Vorübergehen ihr Futter ins Wasser. Ständig hatte sie das Gefühl, Kerstin liege auf der Lauer, um plötzlich hervorzuschnellen und sich in ihrem durch den dünnen Boden des Flip-Flops kaum geschützten Zeh zu verbeißen. Es war fast so, als würde sie einen Tiger halten. Christina lebte mit einer immerwährenden Bedrohung an ihrer Seite, als Herrin über ein Wesen, vor dem andere Hals über Kopf die Flucht ergriffen hätten.
Von einem Tag auf den nächsten hatte Kerstin sie zu einem besonderen Menschen gemacht. Jemand, der sich von den anderen unterschied. Jemand, dessen stilles Wasser tief war und nicht nur Seerosenstängel barg.
Christina war ihr Leben lang mittelmäßig gewesen. Es fing mit ihrem Namen an. Es ging mit ihrem Äußeren weiter. Sie war weder schön noch hässlich, weder dick noch dünn, weder groß noch klein. Sie hatte erst Prinzessin und dann Tierärztin werden wollen, um schließlich eine Ausbildung zur Bankkauffrau zu machen. Sie hatte geheiratet, zwei Kinder bekommen und sich vor fünf Jahren geschieden. Sie lebte in einem Reihenhaus und fuhr in den Urlaub nach Norderney. Sie ging zweimal die Woche ins Gym und machte einmal die Woche Rücken-Fit, seit einem Bandscheibenvorfall während Corona.
Aber jetzt hatte sie etwas zu erzählen! Etwas, bei dem nicht alle sagen konnten: „Ich versteh voll, was du meinst“ oder „Irgendwoher kommt mir das bekannt vor“. Eine Schnappschildkröte namens Kerstin hatte nicht jeder. Bald wussten alle Freundinnen Bescheid. Christina adoptierte Kerstin.
Mit der Zeit wurde Christina waghalsiger. Sie blieb neben dem Teich stehen und beobachtete, wie Kerstin ihr Futter aus Mehlwürmern und Grillen verschlang. Irgendwann überwand sie sich sogar, Kerstin am hintersten Ende ihres Panzers zu kraulen. Ihr war, als legte sie ihre Hand in ein Tigermaul.
An einem Samstagnachmittag erhielt sie den Anruf. Torsten, der älteste Sohn ihrer besten Freundin, war am Telefon. Torsten sagte, er hätte von Christinas Schnappschildkröte gehört. Ob er sie mal besichtigen und ein kleines Video drehen dürfe?
Christina fühlte sich geschmeichelt. Torsten war ein liebes Kind gewesen, aber sie hatte ihn seit Jahren kaum zu Gesicht bekommen. Umso erstaunter war sie, als ein hoch aufgeschossener junger Mann vor ihrer Haustür stand und ihr selbstbewusst die Hand reichte: „Lange nicht gesehen.“
Voller Stolz führte sie Torsten nach einer ausführlichen Gefahrenbelehrung zum Gartenteich. Sofort zückte Torsten sein Handy und filmte die über den Steg watschelnde Schildkröte. Dann ließ er das Handy sinken. Ob er das Video mit ein paar Leuten teilen dürfe? „Klar doch“, sagte Christina begeistert von seinem Interesse. Er bat sie, ein oder zwei Sätze in die Kamera zu sprechen. Aufgeregt winkte sie und sagte: „Hallöchen! Das ist meine Schnappschildkröte Kerstin und ich bin die Christina.“
Kerstin kam noch ein Stück näher. Rasch zückte Christina ein großes Blatt Wassersalat und ließ es vor Kerstins Maul pendeln, bis sie gierig danach schnappte und es einsog. Torsten schwenkte das Handy wieder auf Christinas Gesicht. „Also dann, tschüssi!“, rief sie.
Auf einen Kaffee wollte Torsten nicht bleiben. Aus der Küche sah sie, wie er beim Weggehen die Hausfassade filmte.
Eine Woche später begannen die Leute auf der Straße, ihr Blicke zuzuwerfen. Anfangs hielt sie es für Zufall, dass die Menschen die Köpfe zusammensteckten, wenn sie an ihnen vorüberging. Aber dann fragte ein Mädchen, ob sie vielleicht ein Autogramm bekommen dürfe. Sie sei doch die mit der Schnappschildkröte. Woher sie denn das wisse. Naja, wegen dem Tiktokvideo.
Drei Tage später sprach man Christina erneut an. Und dann fast täglich. Ein paar Teenager wollten wissen, ob sie mal die Kerstin streicheln dürften. Sie würden auch dafür zahlen. Ein Junge rief ihr „Also dann, Tschüssi!“ hinterher und kicherte. Auf dem Heimweg hatte sie das Gefühl, dass man sie verfolgte, und als sie sich an der Haustür noch einmal umwandte, sah sie jemanden hinter dem Brombeergebüsch verschwinden.
Christina ging immer seltener nach draußen und wenn, dann trug sie Hut und Sonnenbrille. Doch sogar in diesem Outfit erkannte man sie oft. Sie war die mit der Kerstin. Die Zoowärterin eines Promis.
Eines Tages kniete sie auf dem Steg und betrachtete ihre in der Sonne rastende Schildkröte. Kerstin sah Christina aus ihren stumpfen Äuglein an. Christina starrte zurück. Abscheu stieg in ihr auf. Plötzlich merkte sie, wie sehr sie diese Kreatur hasste, die ihr Leben auf den Kopf gestellt und ihr den Grund unter den Füßen fortgerissen hatte. Sie war die Schuldige für Christinas kollektive Verfolgung. Sie hatte ihr früheres Leben aufgefressen und sich zum Gravitationszentrum gemacht, um das Christina nun täglich aufs Neue zu kreisen hatte. Ha, sie ließ sich doch nicht von einer Schildkröte an der Nase herumführen! Sie würde ausbrechen. Christina entschloss sich dazu, Kerstin für immer in das unterste Fach des Kellerkühlschranks zu verbannen.
Am nächsten Morgen wollte Christina zur Tat schreiten und Kerstin todesmutig beim Panzer packen. Doch als sie die Terrassentür öffnete, sah sie zwei vermummte Gestalten um die Ecke huschen. Keine Kerstin gähnte ihr mehr zahnlos aus der Tiefe des Gartenteichs entgegen, solange sie auch suchte und rief. Zweifellos: Man hatte ihr die Schildkröte entführt!
Christina schleuderte vor Freude die Flip-Flops von den Füßen und tanzte barfuß über den Steg, bis sie vor Erschöpfung einschlief.
Wieder durchzogen bunt gescheckte Koi-Karpfenschwärme ihre Träume. Kühle Karpfenhaut glitt unter ihren Fingern vorüber.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Lukas Leinweber
Der Wald und lauter Bäume
Die Überzeugung liegt falsch
und holt sich ein steifes Genick
Die Meinung macht sich breit
und bleibt im Türrahmen stecken
Das Gefühl schlägt Alarm
und trifft wen im Gesicht
Der Menschenverstand steht goldrichtig
und weicht den Argumenten aus
Der Glaube fliegt hoch hinaus
und drunter vergammeln Tatsachen
Die Erkenntnis geht fehl
und wird in der Sackgasse heimisch
Die Wahrheit tanzt im Kreis
und ihr wird schwindelig dabei
Die Kritik kommt zu spät
und dafür bestraft sie das Leben
Das Denken fährt fort
und erholt sich von sich selbst
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Dania D'Eramo
Davor. Danach
Später werden wir alles erfahren: den Ursprung von Erschütterungen und Dröhnen im tiefen Gestein, den genauen Zeitpunkt – 2 Uhr 33 Minuten 14 Sekunden.
Davor ist es eine Nacht im September, die Süße letzter Blüten noch in der Luft. Und wir haben noch ein paar Momente des unbemerkten Lebens. Ein Leben, das wir so nie wahrnehmen, bis es nicht mehr so ist, wie es war, das vor sich hin pulsiert – durch unsere Adern, unsere Lungen, ohne scheinbare Steuerung, als gehörte es nicht uns, als wäre es von uns getrennt.
Danach ist es die Nacht des Bebens.
Stimmen aus Fernsehen und Radio erklären uns, was wir erlebt haben. Es ist eine Vermessung des Schreckens in einzelnen Fakten, in der jeder dieser Fakten einen Namen und eine Zahl bekommt. Nicht aber unser plötzliches Aufwachen, nicht das unkontrollierte Erbeben der Körper, das Barfußhasten auf unsicherem Boden. Weder unsere Rufe noch das Grollen aus der Tiefe der Erde.
Als wir dieser Vermessung zuhören, sind wir schon lange in einer Welt aufgewacht, in der nichts mehr ist, wie es eine Sekunde oder auch nur Millisekunden davor war. Einer Welt, in der Dächer in die Häuser einbrechen, Klüfte Straßen spalten, Risse durch Wände laufen wie Wunden, aus denen das Innere dringt.
Es ist eine Welt, in der am Vormittag desselben Tages – oder, so die Vermessung, um 11 Uhr 40 Minuten 24 Sekunden – unter strahlender Sonne der Schrecken nochmals an unserer Tür rüttelt und wir nicht anders können, als ihn hereinzulassen. Und dann fällt Giottos Sternenhimmel wie eine falsche Prophezeiung herab. Nun ein Meer aus Steinpulver und Lapislazuli, begräbt er Menschen unter sich. Und da steht Großmutter vor ihrem Haus und sieht es schwanken, während Großvater im Olivenhain die Erschütterung unter seinen Füßen spürt. Mit den Händen die Augen beschattend, versucht er, von dort oben das Haus im Dorf zu finden, und hofft, hofft, es nicht unter die zusammengestürzten zählen zu müssen.
Zwölf Jahre später – Großvater ist inzwischen gestorben – darf Großmutter nach dem Wiederaufbau hinein, in ihr altes Haus, das nun ihr Witwensitz ist. Zu diesem Zeitpunkt haben wir fast schon vergessen, wie der Kamin im Esszimmer riecht, wie der Kirchturm, dessen Glockenschläge sich in die Träume meiner Kindheitssommer einschlichen, vor dem Küchenfenster aufragt; wir wissen nicht mehr, wie der Blick vom Balkon die Pappeln am Fluss umfasst und wie sich ihr Wispern zusammen mit dem Rauschen des Wassers an windigen Tagen anhört. Wir versuchen, uns an all das zu erinnern, und denken an Großvater, wie er am Kamin sitzt und seine Filterlosen raucht. Dass ich hier jetzt allein leben muss, sagt Großmutter und bleibt an der Türschwelle stehen.
Und ich denke an jene Momente zurück, als es noch eine Nacht im September ist und wir in unseren Betten schlafen, als ich noch ein, zwei, vielleicht drei Sekunden habe, bevor das grausame Wiegen mir eine Stimme gibt, die aus mir kommt wie ein eigenständiges Wesen, als wäre sie von mir getrennt. Bis ich zur Magnitude der Erschütterung ganz aufwache – zur Nacht des Bebens.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | I. J. Melodia
Es fehlt uns der Hunger
Wir schlafwandeln
durch die Langeweile
auf einem Weg aus Worten
die es nicht mehr gibt
Mir gingen die Synonyme aus
meine Metaphern verfehlten
blieben in der Kehle stecken
Unsere Tage streunen
durch den Regen
Wir pflücken Strandgut
aus der Stille
warum redest du von morgen
Verzeih mir
dass ich dich schon zuvor
geliebt habe
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Björn Potulski
Als ich diese Worte an dich las
Ihre Versuche, mich ins Wasser zu stoßen, scheiterten zumeist. Nicht jedoch immer. Mit Mühe haben sie es vor kurzem erst geschafft, mir zumindest meine neuen Schuhe zu verderben. Doch meistens schafften sie es nicht. Zu sorgfältig halte ich mich von allem fern, was Uferkanten hat, über die man stürzen könnte. Sie ärgern sich sehr über meine Vorsicht. Denn die Stadt hat Wasser! Beinahe überall. Sie hat drei Bäche, einen großen Teich im Park, zwei Flüsse und einen mittelgroßen Strom, mit dem alles dies in oberirdisch-offensichtlicher, oder wenigstens in untergründiger Verbindung steht. Also fehlte es ihnen nicht an Gelegenheiten, mich zum Wasser hinzustoßen. Und das versuchten sie, Tag für Tag. Immer, wenn ich rausging. Jetzt aber habe ich genug davon. Ich bleibe drinnen. Doch sie werden nicht von mir lassen. Immer wieder einmal schlage ich die Gardine ein Stück beiseite, gerade weit genug, damit mein Blick durch den Spalt nach draußen gehen kann: Unten stehen sie und warten. Ihre Beharrlichkeit im Warten ist dem Fluss des Wassers ebenbürtig.
Wo liegt nun meine Schuld? Liest man sie an meinen neuen Schuhen ab? – Aus braunem Leder sind sie, rundherum, die Sohlen auch, aus braunem Leder. Auch die Schnürsenkel sind braun, nicht aber aus Leder. Also gehört das nicht zur Schuld, denn die braunen Schnürsenkel sind aus Baumwolle. Baumwolle wird nass und trocknet. Auch das braune Leder trocknet. Doch es bleiben Wasserflecken.
Nach langer Zeit erst –. Nach langer Zeit erst hebt Vater seinen Blick von den Wasserflecken hoch. Und sticht mir damit in die Augen. – Nicht in die Augen, nein. Mehr in den Hals. Ja, in meinen Hals senkt Vater seinen Vorwurf ein, und das recht tief. Mir bleibt die Luft zum Atmen weg. Ist doch diese Luft seine Luft. Keine Luft, das ist wo die Schuld ist. Das ist, wo ich bin. Ich bin unter Wasser –. Flecken. Dabei – doch wollte ich es wagen, mich auch noch zu verteidigen?
Unaufhörlich dringt der Lärm der Stadt zu mir herein. Gefrorene Wasserbälle, die auf Blechdach krachen. So dringt der Lärm der Stadt zu mir herein und die Gedanken ihrer Bewohner. Ihre Selbstgespräche. Vorgehalten sind die Hände, zugezogen ist mein Fenstervorhang (und das Fenster dicht geschlossen!). – Mit der einen Hand halte ich die Gardine ein Stück offen, mit der anderen versuche ich festzuhalten, was ich draußen sehe, was ich höre. So kratzt die Feder über das Papier, das ich auf die Fensterbank lege, gehalten nur von einem rohen Stein.
Nun lässt sich nicht fortwährend hinter der Gardine stehen und zum Spalt hinaussehen. Niemand könnte das. Einige Verzagte mögen es versuchen, doch es sinkt der Arm, irgendwann, unweigerlich, es erschlafft die Hand, die den Spalt eröffnete. Zufallend werden sie gesondert, hinter dem zugehängten Fenster: sie drinnen, wo sie mit ihrer Schuld verharren, abgesondert von dem Draußen, wo man wartet, mit der Ausdauer, die das Wasser hat in seinem Fließen. Auch lässt sich nicht fortwährend schreiben, immer weiterschreiben, so sehr ich es versuche (immer, sogar dann, wenn ich nicht an der Gardine stehe). Sie, sie versuchen es nicht. Ich, ich versuche es. Und erlahme. Hebe die Feder von dem Blatt. Es stockt der Fluss der schwarzen Tinte. Und versiegt. Dann gibt es nur noch draußen sie und drinnen mich. Drinnen? –
Ich liege. Liege auf dem Grund; liege auf dem Rücken und es strömt über mich hinweg. Ein wenig nimmt es mich wohl auch in seine Richtung mit, das teilen mir die Brocken mit, die das Bett des Flusses kleiden. Mein Hinterkopf stößt an rohen Stein. Der Stein empfängt den Kopf mit dem äußersten an Sanftheit, zu dem der Stein die Möglichkeit besitzt. Das hintere meines Kopfes gleitet nicht darüber weg, solche Sanftheit liegt nicht darin – ich stoße immer wieder an, der Stoß hebt ihn ein wenig in die Höhe, bis das Hindernis überwunden ist und er wieder sinken kann, mein Kopf. Eben wollte ich mir – das Entsetzen war schon im Begriff, mich loszulassen – eben hatte ich beschlossen, mich in meiner Lage einzurichten, als ich schon wieder daraus hervor gerissen werde: Papiere treiben. In langer Kolonne treiben Sie über mich hinweg. Die Papiere überholen mich, treiben sie doch ungehindert von den Steinen und der Schwere an der Oberfläche hin, unter der ich liege. Auf dem Weißen erahne ich noch meine Hand in schwarzer Tinte. Auf den Wellen tanzt sie – für mich unerreichbar, so sehr ich mich auch danach Strecke. Und es würde auch nichts bleiben, um danach zu greifen – die Schrift beginnt schon, sich von dem Papier zu lösen. Sie geht ins Wasser über und was konnte ich da tun? Ich sog sie ein, durch meinen Mund, den ich jetzt weit aufriss. Die Schrift schmeckte scharf und bitter. Und ich sog sie durch die Nase ein – sie lässt mich husten, wie der Rauch in meinem Zimmer, den der Brand der Blätter macht, die ich beschrieben habe. Eines aber, eines sehe ich noch im Fließen, im Zerfließen, etwas kann ich wohl entziffern: „Nein“. – Und ich denke ganz bei mir, hier unten: so sehr du dich dagegen sträubst – sie greifen doch nach dir, sie kriegen dich zu fassen und sie packen dich mit ihrem festen Griff. Und sie zerren dich empor zu sich. Hinauf, an ihre Luft.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at