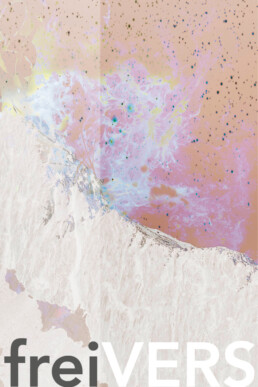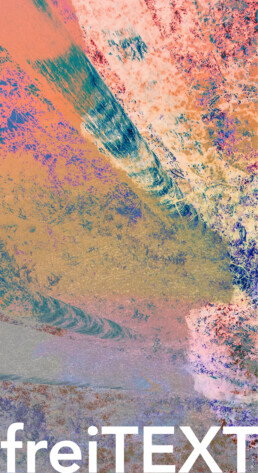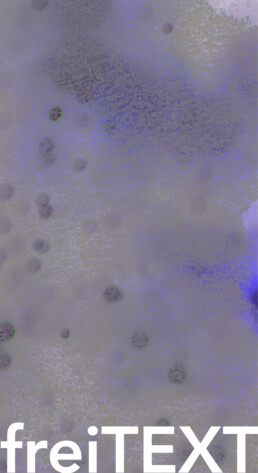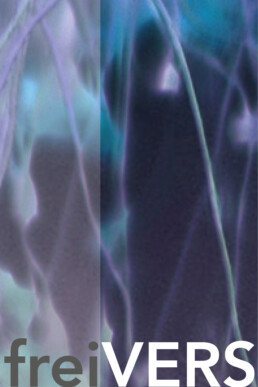freiVERS | Christine Johanna Seidensticker
Heimat
Die Zeit sickert in das Land, sickert mitten in die brüchigen
Knochen. Jetzt markieren Herzschrittmacher
die Territorien, beschwören mit ihren elektrischen Impulsen
den Takt des Landes, stimulieren
das zu langsame Herz.
Als Kind wusstest du die Namen aller Tiere, kanntest
ihre geheimen Wege, ihr Einfluggebiet. Manchmal
warfst du den Nachbarshühnern Mutters geköpfte Regenwürmer
über den Zaun, schautest nach dem aufgeregten
Gackern, ihrem Flügelschlag. Jetzt meinst du, ihn in deinem Herz
zu spüren, in deinen flatterhaften Augen
beim Niederschlag. Abgründe
tun sich dir auf beim Schmieren des Brots, beim Lösen
eines Kreuzworträtsels. Die Seiten verblassen in deinen Händen.
Die Stube scheint immerzu kühl, die vielen Stühle, Tassen und Teller
braucht es nicht mehr, sie sind nunmehr Requisiten
deiner Einsamkeit. Ein kleines Gerät hält Kontakt zum Herz.
Christine Johanna Seidensticker
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ann-Christin Kumm
pflanzen beneiden. schreiben gegen ohnmacht
ich nehme mir vor, mehr lyrik zu lesen, besonders morgens, es räumt mir den kopf auf. ich lese mary oliver. ich lese selma merbaum, regen als tränen.
selma merbaum wurde nur achtzehn jahre alt. von den nazis in ein zwangsarbeitslager verschleppt, starb sie 1942.
ich lese ihre biografie (marion tauschwitz: „selma merbaum. ich habe keine zeit gehabt zuende zu schreiben. biografie und gedichte.“) und erfahre, dass sie nach ihrem tod unter falschem namen erinnert wurde und wird, ihr wiki-eintrag führt den noch.
ich erfahre, dass sie sich um die kinder im lager kümmerte. sie ging mit ihnen muscheln suchen, steine und pflanzen. naturkundeunterricht am fluss. ein fluss, der am lager vorbeifloss, ein fluss, an dem sich die leichen zu stapeln begannen, die über die böschung geworfen wurden.
der schmale grat zwischen bewunderung und inspiration porn. zwischen aus der vergangenheit lernen und sich in den zeiten nicht mehr zurechtfinden.
merbaum schreibt:
„und wenn die gärten verlassen sind,
dann sind sie es nur für mich.“
ich lese katrin de vries, die ihren garten verwildern lässt („ein garten offenbart sich. erzählung von einem anderen leben“).
abgestorbene bäume werden von pilzen zersetzt. wilde stiefmütterchen wachsen unter dicken bohnen. ein rasen wird ungemäht zum wiesendickicht. ein prozess, durch den sie sowohl den garten als auch sich selbst zu verstehen beginnt. der mensch als eines von anderen tieren. sich selbst weniger wichtig nehmen. ich beneide de vries um das stück land, auf dem sie eine wiese wachsen lassen, auf dem sie sich in beobachtungen vertiefen kann ganz nach ihrem ermessen. niemand, die_der ihr da reinredet, weil grundbesitz. ich beneide sie, dabei – und ich blende jetzt materielle gründe aus, denn weder meine generation noch die nach mir kann sich mal eben häuser mit gärten leisten – finde ich eigenen grund und boden in diesen zeiten eine eher schlechte idee. ich möchte zumindest das gefühl haben, jederzeit gehen zu können, die zelte abbrechen, die brücken abbrennen. privilegien, all das. wenn ich gehen will, obwohl ich bleiben kann.
stichwort privileg: ich fahre ans meer, was ähnliche auswirkungen auf mich hat wie lyrik lesen am morgen. der kopf wird klarer, das gefühl, nichts ausrichten zu können und sinnlos vor mich hinzuvegetieren, wird kleiner.
es ist so ähnlich, wie unter dem sternenhimmel zu stehen und erleichtert zu sein über die eigene nichtigkeit, nur andersherum: in der natur komme ich mir weniger nichtig vor. eher wie teil von etwas großem. vielleicht ist das widersinnig.
meanwhile zu viele handlungsskizzen, zeilenanfänge und lose enden, ich weiß nicht wozu und wohin. welchen „ideenkeimen“ (patricia highsmith) mich zuwenden?
wenn ein text auf dem papier steht, aber nicht gelesen wird, ist er dann ein text?
ich rette einen silberfisch aus der badewanne. am nächsten tag sitzt they wieder darin, oder es ist ein anderer, der them extrem ähnlich sieht, was, sage ich, hoffst du in der badewanne zu finden. dabei weiß ich genau, dass es nicht die schuld der silberfische sein kann, wenn menschen silberfischtodesfallen in ihre badezimmer einbauen. ich bin mir nicht sicher, ob das schreiben über „zur urtümlichen insektenordnung der fischchen“ (wikipedia) gehörige mitbewohner_innen zu nature writing zählt. aber ich lerne nebenbei, dass sie auch zuckergast genannt werden. sie mögen kohlenhydrate. feel you, silberfischchen.
ich beneide sie, weil politische entwicklungen für sie keine rolle spielen. sollte es irgendwann keine küchen und badezimmer mehr geben, überleben sie auch unter steinen.
ich lese viel, aber anders als früher. ich lese zeitungen, onlineartikel und newsletter. ich lese bücher von hinten nach vorn oder nur in der mitte, um sie dann wegzulegen und ein anderes anzufangen. ich sammle wörter, denn winter is coming. ich lese thriller und essays und abhandlungen über toxische männlichkeitsbilder bei jane austen.
ich experimentiere mit genres und gattungen, lesend wie schreibend.
ich experimentiere mit textschnipseln auf bluesky. zu anfang vermisse ich instagram, das ich wegen METAs vorauseilenden gehorsams gegenüber trump verlassen habe. dann beginnt es mir besser zu gehen ohne instagram. ohne das beständige hin und her zwischen politischem und pseudo-apolitischem content – ich schreibe pseudo, weil auch das eine entscheidung und damit sehr politisch ist. ohne function follows bildästhetik. ohne hassinhalte, die mir der algorithmus ungewollt anbietet. ich fühle mich ein bisschen wie nach einer entgiftung.
eine freundin schreibt mir: für dich selbst zu sorgen ist ein akt der rebellion. ich schreibe ihr, dass ich in diesem jahr (stand märz) mehr nachrichten gelesen habe als in den jahren davor zusammengerechnet. aber meine informationsaufnahme ist gezielter geworden. bewusster. vieles lässt mich verzweifeln. manches macht mir hoffnung. ich fühle mich klein angesichts der weltlageTM. ich gehe auf eine solidarität-mit-der-ukraine-demo. ich überklebe naziaufkleber. ich reposte kritische kommentare von menschen, die mehr verstehen als ich. ich probiere bandenbildung. tropfen auf heiße steine.
dieser tage beneide ich nicht nur die zuckergäste und gartenbesitzerinnen, sondern auch die pflanzen, die sich immer wieder anpassen, die sich weiterentwickeln und dem klimawandel trotzen. über_lebenskunst. sie wachsen in lücken im mauerwerk, ihre resilienz ist unvergleichlich. ihre geduld auch: jahre und jahrzehnte verharren manche samenkörner im boden und warten. auf wärme. auf regen. auf bessere zeiten.
es tut mir gut, über pflanzen zu lesen. über pflanzen zu schreiben. fast so gut, wie die finger in die erde zu schieben und die wurzeln freizulegen zum vereinzeln in der pflanzenkinderstube.
eine pflanze braucht keine hoffnung, sie macht einfach weiter. das zumindest kann ich mir von ihr abschauen. weitermachen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Lisa Spoeri
diese tage
ich wache
einem schlaf nach
trauernd
tausendjähriger einsamer
von dem wir träumten
es war
ein-, zweimal
zwischen rauschen und
schäumen
den salzkronen
zwischen sand
und zehen
spitzen deine träume
vor vielen jahren
hier verunglückt
vor vielen jahren
ich war
ein-, zweimal
zwischen toben und donner und
du warst
eine
idee in meiner magengrube
faustgroß dort
wo ich den uterus
versehentlich verortete
du warst
zwei
sich entfernende beine
zwischen dem zischen und flüstern
der sandkörner
und eine weitere
in wellen
kommen und gehende gelegenheit
für eine
verpasste heimat
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stefan Volkmann
Grünspan
Der 16jährige Ich-Erzähler und zwei Freunde sind nach Stuttgart gefahren, um ein Konzert zu sehen. Das Konzert wird kurzfristig abgesagt, sie sind mindestens drei Stunden früher als gedacht wieder zurück in Wörth am Rhein zuhause.
Wir gingen zum Golf, stiegen ein. Uwe hielt an der Tankstelle, kaufte eine Tüte Chips und ein Sixpack. Wir glitten über die Autobahn.
„War besser als Zuhausebleiben.“
„Looking on the street, better than tv.“
Uwe parkte vorm Jugendzentrum.
„Wir sagen allen, 's war 'n Superkonzert. Hate Convoi ham zwei Stunden gespielt, die Vorband Spätzlekiller is 'n Geheimtip.“
„Ja, so geheim, dass sie nich mal aufgetreten is.“
Olli drehte einen Joint, kurbelte das Beifahrerfenster runter, zündete ihn an und lachte. Ich hoffte, Lene sei bei mir und wollte aussteigen.
„Ich brauch unbedingt die neue Spätzlekiller-Platte.“
„Ich geh nach Hause.“
„Er will zu seiner Kleinen.“
„Mittwoch, Spitz ins Loch.“
„Heut is Donnerstag.“
„Wenn du verliebt bist, is jeder Tag Mittwoch.“
„Ich bin gefahrn und steh nich auf.“
„Ich häng am Joint und kann nich aufstehn.“
Uwe seufzte, stieg aus und klappte den Sitz vor. Ich kletterte von der Rückbank, aber der Asphalt wankte wie ein Schiff bei leichtem Seegang.
„Komm gut nach Hause.“
„Grüß die Kleine.“
„Mach ich.“
Ich ging am Spielplatz, den Schrebergärten und Tennisplätzen vorbei, dachte, wenn die Sportanlagen unter den Flutlichtern fertig seien, lägen beim Freibad oben größere Tennisplätze als die alten hier unten. Würden hier neue Schrebergärten angelegt oder Wohnblöcke hoch gezogen? Ich lief durchs Einkaufszentrum, kam am Kleinstadtwol- kenkratzer vorbei und suchte Nadines Fenster. Es war dunkel, sie schlief. Ich kam an der Bücherei vorbei, ging über die Fußgängerbrücke und schaute zu unserer Wohnung, alle Fenster waren dunkel, Lene nicht da. Ich lief zum Wohnblock, ging das Treppenhaus hoch und schloss die Tür auf, schaltete Licht an, zog meine Converse aus und stand in der Küche. Lenes Jacke hing über einem Stuhl, ihre Tasche lag auf der Eckbank. Ich dachte, sie schlafe, schaltete Flur- oder Küchenlicht aus und schlich in mein Zimmer. Mein Bett war leer, ich hörte Geräusche, ging zu Jens' Zimmer und öffnete seine Tür. Die Schreibtischlampe mit dem grünen Schirm tauchte sein Bett in morsches Licht. Er lag auf seinem Rücken, sie saß auf ihm, ihre Schenkel waren gespreizt, er streckte seine Arme aus, legte die Hände auf ihre Brüste, aber seine Basketballerhände schienen zu groß oder ihre Brüste zu klein. Jens streichelte sie sanft, wie ein Schmetterling, der mit seinen Flügeln schlägt. Sein Unterwäschewerbewaschbrettbauch spannte und entspannte sich in kürzer werdenden Abstän-den. Ich spürte Schleier vor meinen Augen, als regnete Sand unter meinen Lidern.
„Jens sieht aus wie Apollo oder Amor“, hatte Tamara mal gesagt.
„Ja sicher“, hatte ich gelacht, „ne Mischung aus Adonis und Alain Delon, von Rodin gemeißelt.“
Er lag mit dem Kopf zur Tür, hätte mich nicht sehen können, blonde Haare fielen über ihre Brüste, bedeckten seine Hände und Unterarme. Lene öffnete zeitlupenlangsam ihre Augen, starrte mich an, aber schloß die Augen wieder. Ihr Hüftrhythmus geriet ins Stocken wie eine Maschine, die stottert, aber reibungslos weiter schnurrt. Ich dachte, ich sei auf der Rückbank im Golf eingeschlafen, stolperte rückwärts, wankte in mein Zimmer und fühlte mich, als wären Jahrzehnte vergangen. Aus ihren Mündern rieselte Sand, ihr Keuchen, Stöhnen und Atmen wehte Körner in mein Zimmer. Feuchte Dünen bedeckten meine Knie und türmten sich um meine Hüften. Ich kämpfte mich hoch, wankte in die Küche und warf ihre Tasche vor seine Tür, schloß mein Zimmer ab, barg meinen Kopf unterm Kissen und weinte. Dampflokomotiven stürzten auf meinen Körper, Eisen verdichtete sich zu Dunkelheit, die nicht schwarz genug war, darin zu verschwinden. Ich schaute in den Flur, ihre Tasche lag nicht mehr vor seinem Zimmer, und ging in die Küche, ihre Jacke hing noch überm Stuhl. Schlich zu Jens' Zimmer, drückte die Klinke und schob seine Tür auf. Er lag auf dem Rücken, atmete wie ein Baby, sie auf ihrem Bauch, aber hatte ihr Gesicht in seiner Achselhöhle vergraben. Seine Boxershort hing über einem Stuhl, ihr Slip lag am Fußende des Bettes auf dem Teppich. Jens war dunkel und trainiert, Lene schmal und hell, ein schönes, vom Liebemachen oder von Liebe erschöpftes Paar. Ich sah die Schere auf dem Tisch, nahm sie und schlich ans Bett, schnürte ihre Haare zum Zopf, setzte die Schere an und drückte beide Griffe. Lene lag so ruhig, als schliefe sie, aber lächelte, als empfinge sie eine Strafe, die sie für gerechtfertigt hielte und die sie erlöste.
„Kennst du Lene?“
„Ja, die mit den langen blonden Haaren.“
Ich stolperte in mein Zimmer, der Zopf schleifte über den Teppich, glaubte, sie weinen zu hören, aber sie hätte Tränen unterdrückt, bis ich im Flur war. Falls ich sie weinen hörte, war es ein Traum, weil ich hoffte, sie sei traurig. Ich ging in die Küche, öffnete den Abfalleimer und warf ihren Zopf in den Müll, war halb aus der Küche draußen, drehte mich wieder um und öffnete den Abfalleimer, zog eine blonde Strähne raus, rollte sie in meiner rechten Hand zu einer Schlinge und ging in mein Zimmer. Steckte die Schlinge – ihre Strähne – in einen Briefumschlag, legte ihn in die unterste Nachttischschublade und zog mich an, brachte den Müll zur Tonne, holte Brötchen und wartete auf ein Gefühl, was in Ordnung gebracht zu haben, aber es kam nicht, nichts kam, niemand.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Nicole Prosser
Stundenlose Tage
Dein taunasser Blick:
die Pupille umzingelt
von Weltmeeren
Deine blinden Hände
übersehen das Eigentliche
ertasten die Leere
die entsteht
morgens neben dem Theatercafé
stolperst du rücklings –
Und die Möwen –
Der Sommer an der Drau
glänzt noch
in deinen Augen
während du
das Herbstlaub stapelst
wie ein Kind, das
die Stunden nicht zählt
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ben Rinosch
Der Sturz – Ein MRT-Bericht
Bin ich ein auf dem Rücken liegender, blau schimmernder Tintenkäfer? Oder bin ich ein auf dem Rücken liegender, kleiner Vogel, ein Zaunkönig vielleicht? War ich bisher nur ein Zaungast, der den Menschen dabei zusah, wie sie sich amüsierten, wie sie miteinander sprachen, lachten und stritten?
Ich sehe durch ein kleines Fenster hindurch auf das weite Meer hinaus. Das stetige Hämmern und Klopfen ist beunruhigend. Ich erinnere mich an nicht enden wollende Nächte, in denen ich frühmorgens in dunklen und kalten Technobunkern strandete. Völlig besoffen.
Menschen in Reih und Glied stampfen nach elektronischer Musik und auch dort ein stetiges Hämmern und Klopfen. Das Herz rast davon, als würde es sich in den frühen Morgenstunden nach einer langen Nacht weiter am Leben abarbeiten. Und ein Discjockey oben auf der Bühne, ummantelt mit Aluminium, steht vor seinem Cockpit. Er drückt Knöpfe und fährt Schalter rauf und runter. Ab und zu jault er auf und dreht sich im Kreis.
Ich liege in einer Metallkapsel flach auf dem Rücken.
Die Metallkapsel ist Teil eines Raumschiffes. Schon bald wird es die Erde verlassen. Ich umklammere meine Kopfhörer, in der Hoffnung sie würden die Störgeräusche abschirmen. Ich frage mich, warum die Menschen andauernd produktiv sein müssen. Und dann wird andauernd gebaut und dabei Lärm erzeugt. Grobe Materialien, die mit schweren Maschinen bearbeitet werden. Überall Maschinen. In den Wohnungen. In den Gärten. Auf den Gewässern. In den Händen der Bauarbeiter:innen und Handwerker:innen. Fahrende Maschinen auf den Straßen und auf den Gewässern und in der Luft fliegende Maschinen, Milliarden von Maschinen, die wir in unseren Händen halten...
Denke an das Meer, sage ich mir. Schau genau hin. Dort wirst du vergessen.
Vorgestern hatte ich noch in einem Bio-Supermarkt gearbeitet, war auf nassen Fliesen ausgerutscht, die kurz zuvor gereinigt wurden. War also kurz in der Luft. Dann der Aufprall. Warum hatte ich danach weiter gearbeitet, als wäre nichts gewesen? Und wie kam ich auf die bescheuerte Idee in einem Supermarkt zu arbeiten? Weil ich als Buchhändler ein mieses Taschengeld bekam und ich bei gleicher Arbeitszeit im Supermarkt 500 Euro mehr im Monat bekomme? Aber so langsam geht mir ein Licht auf: Obwohl die Kolleg:innen im Bio-Supermarkt zueinander freundlich sind und trotz harter Arbeit andauernd lächeln, weiß ich noch nicht, ob ich das jemals erreichen kann. Und ob ich das überhaupt will. Schon am ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass ich das nicht lange durchhalten werde.
Ich liege in einer Metallkapsel, flach auf dem Rücken, immer noch. Das dunkle Blau des Wassers und das helle Blau des Himmels fließen weich ineinander. Ein kleines Fenster lächelt mir zu. Lässt mich ruhig und tief atmen.
Von sechs bis zehn Uhr am Morgen zwölf riesige Kühlschränke nach Mindesthaltbarkeitsdaten durchgehen, die Produkte, die am selben Tag auslaufen, mit
25%-Aufklebern und die Produkte, die am folgenden Tag auslaufen, mit 15%-Aufklebern versehen. Die Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdaten gestern abgelaufen sind, aus dem Warenbestand herausnehmen, löschen und in eine grüne Tonne werfen. Den Restewagen aus einer Kühlkammer holen und die Molkereiprodukte, die gestern nicht mehr in einen Kühlschrank gepasst hatten, in die Kühlschränke füllen. Immer darauf achten, dass die Produkte vorne im Regal ein kürzeres Mindesthaltbarkeitsdatum haben, als die Produkte weiter hinten in der Reihe. Dann die Bestellung für den nächsten Tag. Mit einer Bestellvorschlagsliste arbeiten. Die zwölf Kühlschränke nacheinander durchgehen. Welcher Artikel wie oft? Gibt es Fehlbestände? Wenn ja, dann müssen die später korrigiert werden. Die vorgenommene Bestellung speichern. Dann ins Büro flitzen und die gespeicherten Daten am Computer sichten. Die Bestellung öffnen, prüfen und freigeben. Ausloggen.
In der Nacht nach dem Sturz war mir sehr übel gewesen. Es war für mich unmöglich auf dem Rücken zu liegen. Um 04:05 Uhr war ich aufgestanden und hatte mir überlegt, trotz des Sturzes zur Arbeit zu gehen. Kurze Zeit später hatte ich im Bio-Supermarkt angerufen und mich krankgemeldet. Der behandelnde Arzt hatte mir wenige Stunden später einen Überweisungsschein für die Radiologie mitgegeben.
Die Störgeräusche sind immens, das kleine Fenster meine Rettung. Ich muss immer wieder an die Arbeit denken und ich komme auf den Gedanken, dass der Verkaufsjob im Bio-Supermarkt so etwas wie eine Ameisenbeschäftigung ist. Wie kann es sein, dass ich in meiner Freizeit andauernd an die Arbeit denken muss! Alles ist so leidenschaftslos durchorganisiert und was sich vielleicht von einem Ameisendasein unterscheidet, ist, dass meine Kolleg:innen Humor haben und dass immer mal wieder gelacht wird. Obwohl ich den Humor nicht schön finde. Ich weiß schon, was drunter liegt: Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit.
Ich will den Sturz als eine Art von Protest begreifen. Der Sturz ist meine Rettung und ich will dem Reinigungsmann danken, dass er zu viel Seifenlösung in das Putzwasser getan hatte. So falle ich für ein paar Tage aus. Und vielleicht wird mir schon in ein paar Tagen ein Licht aufgehen: Ich arbeite für ein Bio-Supermarkt-Imperium und da bringt es mir auch nichts ein, dass sich alle duzen und übertrieben freundlich miteinander sind. Ich kann nicht schreiben. Ich kann mich nach der Arbeit nicht konzentrieren. Ich will weiterschreiben, mir neue Stoffe ausdenken, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss damit Schluss machen.
Ausloggen. Wieder raus auf die Fläche und schnell die gelieferte Ware reinziehen. Handschuhe an, hunderte von Kartons aufreißen und die Ware verräumen.
Dann an die Kasse und hunderte von Produkten in den restlichen ein bis zwei Stunden über den Kassenscanner ziehen. Ich bemühe mich freundlich zu sein. Ich denke mir, dass ich ein schleimiger Verkäufer bin. Ich hasse es, während meiner Arbeit freundlich sein zu müssen.
Mir ist es ein Rätsel, wie man über Jahre hinweg so hart arbeiten kann. Werden mir nach ein paar Wochen Maulwurfhände wachsen?
Ich liege auf dem Rücken in einer Metallkapsel. Durch meinen Kopf gehen magnetische Strahlen. Störgeräusche. Über mir ein kleiner Sehschlitz. Strand. Runzel-Rosen, Strandhafer und Krähenbeeren. Nordseewellen. Eine Idee davon, dass alles einem stetigen Wandel unterliegt und die Angst davor zu verschwinden.
Aber erst einmal werde ich kündigen. Und dann werde ich weiter schreiben, immer weiter.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Sigune Schnabel
Geordnete Rechtecke sind die Zimmer
Ich stutze Gedanken
auf die gesellschaftsübliche Länge.
Herumtreiber bin ich
gewesen, an Träume gelehnt
bei Dunkelheit.
Gierig gieße ich Nachtworte ein
bis zum Mond
und leere sie leise.
Ich nehme mich zurück.
Wem habe ich mich gegeben.
Nebenan höre ich es:
das gekachelte Leben.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Alice Grünfelder
Stadt am Meer
Zikaden
im Ohr, im Kopf, im Denken, als längst kein Wald mehr und kein Gesträuch, die Stadt schon hetzt, aber noch immer Zikaden im Ohr.
Wellen
donnern, rollen, schlagen ein auf das Meer, denn im
Sturm
zerrt schon an den Palmen auf der Promenade, schon wird vor ihm gewarnt, die Menschen hier bleiben gelassen, warten ab, denken, er geht vorüber, dieses Mal geht er uns nichts an.
Luft
darin der Geruch von Klärschlamm, dreht sich träge in runden Becken, zwischen Büschen und Mangroven eine Müllhalde mit Blick aufs Meer, ein blaues Förderband hängt schlaff zwischen Erde und Himmel, wo einst Fels aus den Bergen, Stein zu Kies zu Sand zerrieben wurde, aus einem Turm mit aufgemaltem Wal fallen Betonklötze, unter Planen kauern Menschen mit Gesichtern so grau wie ihre Mäntel, reichen sich Knöchelchen, Geißen ducken sich hinter Brettern vor der Hitze, dem Regen, auf einer asphaltierten Straße hoppelt eine hinunter zum Strand.
Schatten
kann nicht ohne Licht, entlarvt das Dunkel, das Helle.
Taifun
wird erklärt, eine Nachricht ploppt auf, eine Freundin warnt, die Angestellte im Gästehaus spricht bloß von Starkregen, noch ist alles ruhig.
Gedichte
übersetzen – bis der Regen kommt.
Warten
und Wolken nachsehen, ob sie nun langsam oder schneller ziehen, den Gewächsen auf Dächern, ob sie nun stärker schwanken als zuvor, die Fußgänger von oben betrachten, ob sie Regenschirme aufspannen, den Straßenbelag, ob er glitzert im Regen – warten auf den Taifun.
Löcher
sind die Fenster im Haus gegenüber am späten Nachmittag, Löcher so dunkel, als lebte kein Mensch darin, nur in den beiden oberen Etagen flackert ein Licht.
Küstenwachen
stehen in orangefarbenen Hosen, Schwimmwesten, mit Fernglas, Flaschen, Stöcken, Trillerpfeifen, Taschenlampen, seit Wochen schon, stehen da mit dem Rücken zum Meer, andere mit dem Rücken zur Stadt, in Erwartung jedenfalls, schauen, wie der Regen Nägel treibt ins Meer, ob der Sturm kommt oder was anderes, über den Fahrradwegen hängen Ketten, daran gelbe Wimpel mit Wörtern, nicht zu entziffern, so heftig flattern sie im Wind, die Wege hinunter zum Strand versperrt mit rot-weißen Plastikbändern, der Sturm, der Regen, angekündigt für den Nachmittag, kommt nicht, Stunden später nieselt es, als es düster ist und das Meer, der Wind sich beruhigt, fällt der Regen stärker, trommelt gegen das letzte Fenster im Haus, das noch nicht zerbrochen ist von den Regenstürmen zuvor, ein dunkelblaues Auto mit Warnlicht fährt langsam auf dem Damm hin und her, Regen stürzt nun aus Wolken, ein Bagger schaufelt einen schmalen Zugang frei, zugeweht vom Sand über Wochen, Monate, Jahre, damit das Wasser wieder zurückfließen kann ins Meer.
Spiegelung
eine TV-Reporterin in transparentem Regenmantel spricht, auf dem Weg zum Mikrophon gehen die Worte unter in der brüllenden Brandung, der Boden hinter ihr bricht weg, unter einer Fußgängerbrücke hocken zwei Männer, vor ihnen eine Pfütze, ihre Finger gehen hinein, dann zu den Lippen, sie schippen etwas in zwei Becher, Wolken schieben sich über Berge, dass sie darin verschwinden, dorthin geht schon lange keiner mehr.
Regen
splattert heftig an die Scheiben, auf den Asphalt, eine Radfahrerin stemmt sich gegen die Regenwand, die der Wind vor sich hertreibt – bis schließlich jeglicher Verkehr eingestellt wird, weil Felsen den Hang hinunterrutschen, die Berge auseinanderfallen, die Erde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Susanne Gurschler
Ein Abend
Für Iryna
Deine Worte bauen Brücken zu einem Kontinent
geschrumpft auf einen Streifen
Sätze fallen in meine Hände federleicht
verflüssigen sie sich wie Pinselstriche im Wasser
kritzle Wörter auf weiße Stellen
schnell krakelig
tags darauf kaum zu entziffern
wortlos eingeschrieben
Erinnerungen an einen lauen Abend
an klingende Gläser an Babycalamari
die Holzperlenkette zwischen deinen Fingern
das Lachen
trotz allem
von einem Punkt aus neue Felder erforschen
wäre ein Anfang
sagst du
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leon Zechmann
Wir drei
Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass du auf die gleiche Schule gehst wie ich früher und schon vor dir deine Schwester. Ich kenne die Räume und Flure zu gut und kann darin verloren gehen. Mondlicht ändert sich nicht in dreißig Jahren, auf den Tafeln lag der Staub nur dichter. Am Fenster deines Klassenzimmers hört man die Geräusche aus der Sporthalle am anderen Ende des Pausenhofs. Davor steht das neue Auto, direkt neben der Plane auf dem Roller deiner Schwester. Ich weiß nicht, wie ich fragen soll, ob wir danach noch in den Drive-in fahren und unter dickem Schnee auf dem Autodach, mit den Fingern in den Nikolaus-Häusern an den beschlagenen Fensterscheiben, nachts uns noch satt essen. Du hast seit gestern Abend nicht mit mir geredet und ich weiß nicht, ob es etwas ändern würde, wäre ich jetzt bei euch. Stattdessen verstecke ich mich im vierten Stock. Der Wind trägt dumpfe Musik nach oben und sie perlt an der dicken Jacke ab. Wenn du dran bist, werde ich es hören können, aber nicht zuordnen.
Ich stand bei allem immer draußen zum Rauchen, um deine Oma sauer zu machen. Du traust dich, heute aufzutreten, ohne Musikstunden. Mich nervt die Asche am Fensterbrett, ich puste sie fünfzehn Meter zu Boden. Ich hätte mich nicht getraut. Deswegen stehe ich, obwohl ich früher aus der Arbeit rausgekommen und hergefahren bin, hier oben. Zwischen jedem Act kommt kurzes Geplänkel, eine moderierende Person mit extrem hoher Stimme duelliert sich mit den Ausschreitungsklängen der nie ausgetauschten Lautsprecher. Ich heule hauptsächlich und wische mir mit langen Bewegungen immer wieder die heißen Tränen nach außen und oben. Ich habe Angst, dich zu verpassen und ich habe Angst, dich zu sehen.
Ich nehme Angst in Kauf, Schuhe zwischen den Fingern über den Boden schlittern, rennend. Das Treppenhaus hinunter, in dem ich mir beim Fangenspielen den Fuß verstaucht hatte, durch den Keller mit dem Werkraum, in dem ich mir mit der Nadel durch den Finger gestochen hatte. Der Korkboden vor dem Turnhalleninnenleben reibt über meine fallende Sockenferse und mein Knie kracht in die Heizung. Die Tür lässt sich schwer öffnen und dahinter stehen die anderen Eltern. Ich ziehe den Kopf ein, unterdrücke Scham und Schmerz mit jedem Atem und lehne mich neben sie an die Wand. Erst nach ein paar Minuten bin ich da, davor war alles schwarz. Regungslos suche ich den Raum nach deiner Schwester ab. Sie sitzt in der dritten Reihe auf einem Schulstuhl und hält das Handy in der Hand. Sie hält es hoch. Auf der Bühne stehst du, wie das kleinste Ei der Welt im Scheinwerfer und die Welt schaut dir zu. Ehe ich nachdenken kann, stehe ich an der hintersten Stuhlreihe, beinahe in jemandes Nacken. Ich spüre, wie wir uns drehen. Ich will, dass du mich siehst. Du singst, wie Siebtklässlerinnen singen, nur besser. „Ich will später mal Tickets für deine Konzerte haben“, würde ich sagen, wäre es nicht albern. Albern war es nicht, als wir in dem einen Campingurlaub unseres Lebens auf den alten Klappstühlen in der frisch feuchten Erde saßen und du die Karten zum Spielen auf deine Schwester geworfen und die Lieder aus dem Kindergarten über den Platz geträllert hast.
Du hörst auf und ich klatsche, bis die Wunden an meinen Fingern unter dem angestauten Schweiß der Sporthalle brennen. Endlich siehst du auf und dein Blick fällt zuallererst in die dritte Reihe. Bitte guck mich an. Ich bin doch hier. Und dann guckst du. Dein stolzer Blick schweift in winzigen Rucken durch den Raum. Und bleibt hängen. An mir. Bitte, sei nicht sauer auf mich. Es tut mir leid. Du reißt Kopf und Daumen in die Höhe wie die Königin der Welt, hebst das eine Bein an und setzt es dumpf und doll neben dich auf und ich glaube, du zwinkerst wie ein Dussel. Wie ein winziger Frosch stolzierst du über die Bühne und irgendetwas in meinen Lungen fängt beim dir „Zugabe“ Rufen an, sich zu lockern. Du stehst da wie beim allerersten Fahrradfahren, Laufenlernen, Schwimmen, auf weiter Flur in freier Welt, während ich ganz abseits im Licht deiner Augenwinkel hänge, die ganz genauso aussehen wie meine.
Ihr fahrt nach Hause, weil ihr keine Lust habt auf Drive-in und nachts im stickigen Auto auf dem Parkplatz stehen. Ich fahre hin und hole alles. Ich sehe euch durchs Fenster, als ich heimkomme, und die Lichter auf dem Brett funkeln euch wie wild durch die vom Wind zerzausten und von Mützen verschwitzten Haare. Mitten im Schnee, die Essenstüten mich wärmend am Bein, nehme ich den Moment auf ewig in mich auf. In meinen Blutbahnen bauen kabellose Wärmedecken Schutz vor dem eisigen Geschmackston der Winternacht. Der Tisch ist gedeckt, als ich schlüsselklimpernd hereinkomme, und so funktioniert das in einer Familie. Man geht zur Schule und zur Arbeit und abends isst man am Tisch und vergibt sich gegenseitig. Du hast, die Beine auf der Küchenbank verknotet, noch immer dein fasriges Kleid vom Auftritt an, und deine Schwester isst sofort, halb in der dicken Mopedjacke, die das Futter verliert, aus zerrissenem Papier wie ein Schwein.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at