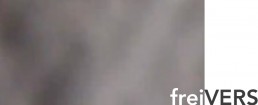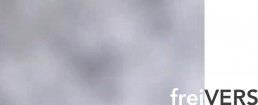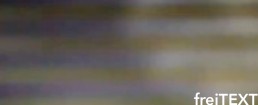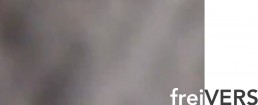freiVERS | SAID
fische von jenseits des meeres
sie sammeln sich und sind bestrebt, nicht aufzufallen. die hand halten sie vor den mund, als könnte sie das stottern verdecken.
man munkelt von einem virus; er wird unter flüchtenden verbreitet und verursacht stottern.
hier treffen sie sich und schweigen. sie warten auf olleg, den mann mit dem weißen hut. dem vernehmen nach hat er selbst auf der flucht seinen hut aufbehalten.
nach einbruch der dunkelheit zahlen sie eintrittsgelder und gehen gemeinsam in den park. dort hängen die fische in den bäumen und spenden gerüche.
hinter gazeschleiern beten sie dann. die fische schnappen nach luft, als wollten sie sich bedanken für die gebete.
beim abendessen bleibt ein platz leer. der des zurückgewanderten zwischenrufers –
der einzige, der die sprache der fische verstand.
sie sitzen im restaurant, dessen lichter sich im meer spiegeln.
ihre hände verscheuchen das licht – doch das licht ist stärker als die flüchtlinge. diese sind erregt, sehen die ankommenden schiffe und warten auf neue nachrichten.
jemand schüttelt eine kleine glocke. dann erzählt olleg von dem anderen land, von der langsamen zeit –
die anwesenden beginnen zu schluchzen.
olleg gestikuliert und beschwört sie auf einheit:
„jede berührung mit den reisenden wäre verrat.“
er deutet an, daß die fische dann nie mehr zu ihrer sprache zurückfinden würden.
„die von jenseits des meeres kommen, bringen neuigkeiten mit sich und einen geruch“,
dann warnt er vor diesem geruch und seiner wirkung.
vom gemäßigten schweigen ausgehend, fragen einige der anwesenden, warum sie längere zeiten brauchen für eine neue farbe.
„wir müssen an die fische denken. seit der zwischenrufer zurückgekehrt ist, schweigen sie“,
er räuspert sich und spricht weiter:
„wer weiß, was alles unter den reisenden ist, hörgeschädigte, spitzel, künftige verbrecher. sie alle haben aussagen unterschreiben müssen, damit sie ausreisen durften. ihr erkennt sie an dem trübe gewordenen blick.“
schließlich warnt er:
„wer glaubt, eine berührung mit den reisenden, heilt das stottern, irrt sich.“
olleg kennt die furcht der flüchtenden. für gewöhnlich überwinden sie sie mit dem wort, mit dem rufen.
doch jetzt, angesichts der ankommenden schiffe, brauchen sie einen halt. olleg weiß das:
„ihr müßt lernen, unbequem zu leben in der fremde –
sonst zerstört sie euch.“
SAID
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Markus Prem
Zaungast
Endlich
die Ankunft
in diesem
Land
so schmerzlich
fremd
wie ein
verbogener
Stachel
im Fleisch.
Markus Prem
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | blume (michael johann bauer)
Das Meer
Scheppernd wellen sich wabernde Wolken, der Himmel kreischt, nachtschwarze Herrlichkeit glüht zerfurcht in blitzendem Sekundenbrand und unter dem bedingt zuverlässigen Schutzdach einer semipermeablen Blätterhaube drängen sich zwei Ratlose aneinander, befühlen, vielleicht nervös, die konkrete Hysterie ihrer rasenden Herzen durch klebrig feuchten Stoff, und taumeln schweigend – stehend, lauernd – über lechzend züngelnde Abgründe einer traumatisierenden Flut unverhofft greller Eindrücke, hier, in der relativen Verlassenheit eines schroff gezeichneten, felsenüberwuchernden Waldes, fernab von ihrem Zuhause, dem sie entflohen sind, gierend nach Freiheit, nach Glück. Furchtsam wispern abgewetzte Stimmen wie geborstenes Glas, unnatürlich das Trommelfell scheuernd, ätzende und ätherisch flüchtige Spuren trauernder Tropfen kondensierender Schwallwellen in den sensiblen Gehörgängen der in unmittelbarer Reichweite Lauschenden – welche im Prinzip auf die direkt Involvierten reduzierbar sind – hinterlassend und vergehen, letztendlich, nachdem der jeweils angesprochene Rezipient die, in ihren Modulationen ruhenden Botschaften dechiffriert hat, im kühlen Nirgendwo einer wüst plätschernden Regenhöhle. „Wir haben das Richtige getan.“ „Wir hatten keine Wahl.“ „Die Unerträglichkeit des Alltags hat unsere Flucht unvermeidlich gemacht.“ „Wir dürfen keinen einzigen Schritt bereuen, nachdem der Weg zurück einem waghalsig idiotischen Sturz in ein Meer aus dornigen Augen gleichzusetzen ist.“ „Unsere Lungen keuchen in Atemnot, doch ist der Preis nicht hoch genug, um auch nur eine zaghafte Melodie tosender Reue durch das Gerippe unserer Entscheidungen galoppieren zu lassen, während wir, stumm betend, die Endlosigkeit lebendiger Schmerzen inhalieren.“ „Was ist schon die Bürde sengender Angst verglichen mit dem berauschenden Jubel lustig würgender Selbstständigkeit in den gewaltig pulsierenden Armen einer archaisch anmutenden Natur!“
Der Vorhang lüftet sich und eine sympathisch wärmende Morgensonne induziert, fröhlich strahlend, golden gelassen Zuversicht, beendet die Notwendigkeit, eine Maske verbaler Stärke über einen bitter stachelnden Kern aus sinnlos explodierenden Selbstzweifeln zu ziehen, beleuchtet das pittoreske Panorama einer bergig unterlegten, bildgewordenen Symphonie chronischer Veränderung und die beiden verharren, staunend, im köstlich lieblichen Widerhall eines heilig scheinenden Augenblicks. Erleichterung zaubert mit weit ausgebreitetem Gefieder schillernde Regenbogen sinnlicher Ekstase auf die jugendlich frischen Gesichter der sich angenehm Entspannenden, sodass schließlich, klirrend die finalen Ketten apathischen Erduldens zerspringen und sie sich, engumschlungen die Harmonie ihrer Zärtlichkeiten großzügig und gerne nicht bloß miteinander teilend, mit ungestümem Lächeln und seligem Lachen auf den magisch unschuldigen Lippen, aufmachen, die ihnen noch würzig fremde Schönheit einer sich tänzelnd vor ihnen entfaltenden Sommerlandschaft für sich zu gewinnen und diese, kunstfertig transformiert in einen süßlich flirrenden Reigen luftig schwebender Gemälde, in die empfänglichen Schalen ihrer zukünftigen Erinnerungen zu träufeln. Ausgelassenes Vogelgezwitscher und ein aus der geheimnisvollen Verborgenheit der mit Laub gefütterten Behausungen obskurer kleiner Tiere dringendes Rascheln begleitet den sanften Fluss ihrer Bewegungen akustisch, indes sie sich unaufhaltsam, ohne sich dieser verhältnismäßigen Tatsache bewusst zu sein, dem nahezu vollkommen von wild gedeihenden Ranken bedeckten Eingang eines teilweise verfallenen Steingartens, in dessen Zentrum eine einzigartige Herausforderung ihre baldige Ankunft erwartet, nähern.
Einst, als die Essenz absoluter Einheit alle Dinge durchdrang – eine fundamentale Gegebenheit, die, selbstverständlich, eine unveränderliche, jenseits von Raum und Zeit bestehende Konstante darstellt – und auch der Mensch, an sich, ihre sogar an der Oberfläche und in den verwinkeltsten Ausläufern der Materie erkennbare Omnipräsenz – mithilfe geistiger Leere – noch zu erfassen in der Lage war, lebte hier das erleuchtete Volk der Täler, welches keinen speziellen Namen für sich in Anspruch nehmen musste – kein Klammern an den Wahn einer von wirren Vorstellungen determinierten Identität –, um, ohne es wissen zu müssen, zu wissen, wer es war. Was aus ihm geworden ist, ist ohne Bedeutung, lediglich wenige sporadische, vom Lauf unzähliger Jahre entstellte Relikte eines gelegentlich erschaffenden Daseins bezeugen vage seinen Ruhm auf dem Gebiet bescheidener Weisheit ohne Zweck und ohne Ziel. Der Ort nimmt hierbei die Rolle einer beliebigen Hilfestellung ein, er ist unwesentlich, eine simple Zugangsoption, ein durch das Zusammentreffen gewisser gegenständlicher Umstände – Transkriptionen von Wahrheit in ein diskret anthropogenes Vokabular – zündender Funke, das vermeintlich erloschene Flammenmeer im Inneren der eigenen Verästelungen erneut zu entfachen – das Feuer vollendeter Klarheit spürbar zu machen –, das zu entdecken, was, immer und überall, ist.
Und schon ist sie überschritten, jene imaginäre Grenze, die sich, trotzig, zusammensetzt aus Glaube und Phantasie – und plötzlich ist alles – wie – verwandelt – in der verblendeten Welt der Perzeption. Ein filigran geschuppter Reptilienboden saugt lüstern an den nackten Füßen der sich in ihrer spontan einsetzenden Orientierungslosigkeit verwirrt Ergänzenden, wölbt sich manisch auf, erbricht dunkle Stöße panisch exkrementöser Lava exzentrisch fragwürdiger Konsistenz, höhnisch die Beine der zu wehrlosen Opfern Auserkorenen mit der dumpfen Widerwärtigkeit seines abstoßenden Auswurfs besudelnd – und steht still, ganz so, als wäre nichts geschehen, überlässt die Zwei, in ihrer Vereinigung, dem frivol verzerrten Labyrinth makabrer Assoziationen, eine dämonisch blinzelnde Furcht, die – einen lächerlich stupiden Vergleich aufs Papier schleudernd – weitaus tiefer sitzt als das, in manchen Situationen, schier übermächtige Beben fleischlicher Lust, aus dem eiskalten Refugium ihrer Epilepsie lockend. Zitterndes, hilflos winselndes Elend – kaum haben sie sich von der zynisch durch die heimlichsten Nischen ihrer Psyche echoenden Erschütterung des ersten Schocks erholt, zur Linderung die honiggleiche Idylle des anbrechenden Tages auf ihren zerrüttet gereizten Synapsen verteilt, zerfetzt der gnadenlose Dolch unvorhergesehener Ereignisse die trügerisch behagliche Leinwand harmlosen Schlenderns durch eine milchig satte Köstlichkeit friedlich summender Momente und reißt die empfindlichen Gemüter unserer leidlich unerfahrenen Protagonisten ins blechern schallende Verderben giftig schäumender Poren ominöser Unbeständigkeit. Ehe es ihnen gelingt, auch nur tendenziell zur Ruhe zu kommen und die unangenehm knisternden, ihre zarten Leiber grob malträtierenden Wogen schrecklich intensiver Stimulanzien zu verdauen, sind sie bereits angelangt, im Reich des mystischen Jaguars, der, wie ein behutsam funkelnder Opal, grollend flüsternd, zu ihnen spricht. „Der Pfad der Mysterien ähnelt einer blutroten Orchidee – verziert mit der opulenten Erhabenheit flüssigen Rubins geleitet er die Suchenden hinab in eine Schatzkammer bizarr flatternder Euphorie! Betörende Düfte verbreitend, erblüht ein Mosaik aus adoleszenten Rosen über den kristallenen Kelchen taubenetzter Schläfen! Hinter dem Schleier der Wahrnehmung, jedoch, in der stoisch prahlenden Kluft fremdartiger Unerreichbarkeit, stagniert spröde das Wort, wartet flehend darauf, vernichtet zu werden, den Marmor, den es zornig durchwurzelt hat, zu zersprengen, um in amorpher Vergänglichkeit seine Bestimmung zu erfüllen – und wir, wir lesen, gebannt, im Buch seiner ewigen Manifestationen, aufgewühlt erahnend, dass alles längst ist. Düster, wie Zimt, tobt ein eitriger Scharlachsturm durch die Nichtigkeit unserer Existenz und gebiert wundervoll obszöne Anomalien – möge das Ritual der Trennung und Melange beginnen!“ Nichts. Kein verträumt splitternder Laut tönt fruchtbar hinein in die klebrig exzessiven Ergüsse fanatisch zirkulierender Obsessionen, keine exorbitant wallende, phänomenal farbenprächtige, von aufrichtig stolzen Initiierten flott inszenierte Zeremonie befleckt die keusche Jungfräulichkeit des ins Aberwitzige abgleitenden Szenarios mit dem geradezu göttlichen Ejakulat einer alle Anwesenden aufheiternden Offenbarung - nein, ganz und gar nicht – stattdessen martert eine subtil quälende Atmosphäre schwül erdrückender Erwartung, die, langsam aber sicher, in peinigende Ungeduld umschlägt, die blank liegenden Nerven der partiell unfreiwillig Beteiligten, bis sich, zu guter Letzt, sichtlich verlegen, der Jaguar, wieder, zu Wort meldet. „Eventuell ...“ „Schluss mit dem Rechtfertigungsgejammer, wir gehen jetzt ans Meer!“ Gesagt, getan!
blume (michael johann bauer)
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Karin Posth
vatersprache. mutterland
sage: sprache. sage: mutter, vater.
und nun setze die wörter zusammen. du sagst:
muttersprache. vatersprache gibt es nicht.
obwohl dein vater alleinerziehend ist?
wie sollen kinder sagen, die eltern aus
zwei ländern haben?
und flüchtlingskinder,
geflohen aus dem heimatland, in dem sie längst
keine heimat mehr haben.
sage: land. sage: mutter, vater.
und nun setze die wörter zusammen. du sagst:
vaterland. mutterland gibt es nicht.
weißt du nicht, dass der engländer von
motherland spricht?
sollten wir nicht lieber mutterland
sagen, um nicht noch einmal zu beklagen,
dass der mensch durch nichts
so leicht, so schnell
zum mörder wird
wie durch sein vaterland.
Karin Posth
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Claudia Wallner
Verschiedene Welten
Es war warm in der Stube. Die Mutter hatte ihre gepunktete Kochschürze umgebunden und fing langsam an das Abendmahl auf dem Gasherd zuzubereiten. Vater war draußen, um Holz zu hacken, während unser Hund „Schorsch“ vergnügt den Hühnern nachjagte und bellte. Ich war gerade mit Hausübungen beschäftigt, als meine Schwester mit einem Geschenk vor mir stand: „Alles Gute mein lieber Bruder! Ich weiß du hast erst morgen deinen Ehrentag, aber ich möchte dich heute schon beschenken!“ Ich war sehr erstaunt und öffnete das Päckchen neugierig. Es war ein Schlüssel. Meine große Schwester Anna hatte mir also ihr Moped vermacht! Ich war selig vor Freude. Endlich konnte ich überall in der Stadt hinfahren, welch‘ neu gewonnene Freiheit! Ich war glücklich und genoss die Atmosphäre der warmen Stube, eingehüllt von köstlichem Essensgeruch. Ich fühlte mich so wohl im Kreise meiner Lieben und lächelte zufrieden.
Abdul schlug das Buch zu. Um sich sah er nur Zerstörung, Armut und Tod. Er war hungrig und allein. Mithilfe des Lesens flüchtete er sich regelmäßig in Fantasiewelten, die ihn wenigstens kurzzeitig von diesem Elend ablenkten. Ein ausländischer Soldat hatte ihm dieses Buch geschenkt. Es gefiel ihm, aber komisch fand er nur, dass es auf einem anderen Planeten spielte.
Claudia Wallner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Simone Scharbert
aufräumen I, 10:05
(eine schneise schlagen, zögernd)
abgewischte leere auf tischen und bänken haftet
ein übergang eingefasster räume von a bis b wenig
distanz nur ein paar schritte über den schulhof und
wieder zurück zwischen mauern auf betonierten
metern in quadraten mit kleinen kindern auf
rädern später einfach so eine schneise schlagen in
diesen moment in diesen tag oder den zaun die
wenigen stunden bis mittag und zur nächsten reihe
vor biertischen und warmhalteplatten die eigene
anwesenheit spüren
(Die Flucht ins Chaos. Auf der Balkanroute sind derzeit so viele Menschen unterwegs wie nie zuvor. Wegen der »massiven Überlastung« stoppt Österreich den Zugverkehr zwischen Wien und Budapest. SZ, 11.9.15)
Simone Scharbert
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Gregor Eistert
Das Kunstprojekt
Auf einmal stand er da, der Container. Mitten auf dem Stadtplatz. Im Laufe des Vormittags hatte sich dann schon eine beträchtliche Menschentraube gebildet aber obwohl viel geredet wurde, wusste keiner so recht, was hier eigentlich geschah. Der Container war kein normaler Baucontainer. Also an drei Seiten schon: Dieses in hellem Grau gestrichene Metall, dass zur Sicherung der Stabilität leicht gewellt war. Die der Kirche abgewandte Seite war jedoch aus Glas. Das ließ dann wieder an einen Zoo, vielleicht an ein Affenhaus denken. Diejenigen, die sich näher herangewagt hatten, sahen, dass der Container keinesfalls leer war. Auf dem Boden lagen einige alte Decken, die allesamt so aussahen, als wären sie von einem Laster auf der A8 abgeworfen und einigen Wochen später von irgendwem wieder eingesammelt worden. An einer der Metallseiten hatte der Container auch einen kleinen Anbau, in den man aber auch von der Glasseite aus nicht hineinschauen konnte, da er mit einem fetzenartigen Vorhang vom Rest des Raumes abgetrennt war. Der Container stand auf mehreren Holzpaletten, so dass sich der Boden des Innenraumes ziemlich genau auf Kniehöhe eines durchschnittlich großen Mannes befand.
Während sich bis zur Mittagszeit immer mehr Menschen am Stadtplatz versammelten, zerstreute sich die Menge während des Nachmittags wieder. Einige Neugierige kamen zwar noch vorbei um sich den Container aus der Nähe anzusehen, aber da sich davor weder ein Schild, noch irgendetwas besonderes darin befand, ließ das Interesse der Passanten bald nach.
Das änderte sich am nächsten Morgen.
„Ist ja unerhört!“ „Das ist wieder irgend so ein moderner Kunst Schaß, den sie von unseren Steuergeldern finanzieren. Wie damals der Hubschrauber.“ „Eine Frechheit ist das!“ „Das geht ja nicht. Das kann man ja nicht machen. Irgendwer muss da was dagegen tun.“ „Ist das überhaupt erlaubt?“
Im Container befand sich jetzt eine syrische Flüchtlingsfamilie.
Das stand jedenfalls auf dem Schild, das jetzt an einer der Außenwände befestigt war. Das Schild war klar und strukturiert designet und gab Informationen über den Inhalt des Containers, über die Herkunft der sich darin befindenden, ihre durchschnittliche Lebenserwartung, die Zahl der Kinder, die sie durchschnittlich zur Welt bringen und ihre größte, natürliche Bedrohung: Der Mensch.
Doch das Schild interessierte die meisten anfangs nicht besonders. Aller Augen waren auf das Kleinkind gerichtet, dass gerade weinend auf die Glaswand zu gekrabbelt kam und mit seinen speichelverschmierten Händen tollpatschig dagegen schlug. Eine dunkelhäutige Frau mit Kopftuch, offensichtlich die Mutter des Kindes, hob es vom Boden auf, wischte das Glas so gut es ging mit dem Ärmel ihres Gewandes sauber und sah sich dann verzweifelt im Container um. Das Kind wurde währenddessen immer unruhiger. Heftige Weinkrämpfe brachen aus ihm heraus. Schließlich ließ sich die Mutter mit dem Rücken zur Glasfront nieder und begann ihr Kind zu stillen. Das war ihr sichtlich unangenehm. Immer wieder warf sie einen verschämten Blick über die Schulter während die Leute draußen ihre Nasen gegen die Scheiben drückten.
Im Container befand sich auch ein Mann, der bis dahin auf dem Haufen dreckiger Decken geschlafen hatte. Jetzt stand er allerdings auf, nahm eine der Decken und versuchte sie schützend vor seine Frau zu halten. Augenblicklich ertönte ein lautes, schrilles Hupen im Container und an der Decke angebrachte Sprinkler ließen es regnen. Verzweifelt versuchte der Mann, seine Frau, das Kind und sich selbst mit der Decke zu schützen, doch der künstliche Regen wurde immer stärker. Erst als er den Stofffetzen entmutigt sinken lies, hörten die Sprinkler auf Wasser zu vergießen. Das versammelte Publikum, das ob des plötzlichen Wolkenbruchs kurz zurückgeschreckt war, drückte jetzt wieder seine Gesichter gegen die Scheiben und versuchten nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, was drinnen vor sich ging. Geräusche drangen nämlich keine aus dem Inneren.
Am frühen Abend, wahrscheinlich so, dass es sich eben für die Nachrichten noch ausgehen würde, war dann auch das Fernsehen zur Stelle.
Kunst. Der Container samt Flüchtlingsfamilie war eine Installation irgendeines belgisch-afghanischen Künstlerpaares. Damit war der Sachverhalt für die Zivilbevölkerung geklärt: Moderne Kunst muss man nicht verstehen. Moderne Kunst ist einfach. Man muss sie nicht mögen oder schönfinden und man muss sie vor allem nicht mit der Realität in Beziehung setzen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Weil finanziert wird das ganze ja sowieso immer von Menschen, die einfach zu viel Geld haben oder, noch besser, vom Staat, der zwar kein Geld hat aber zumindest so tut als ob. Nein, leid tun, müssen einem die Gestalten in diesem Container jetzt nicht mehr, letztendlich haben sie sich ihre Situation selbst ausgesucht. Genauso wie Millionen syrischer Flüchtlinge. Hätten ja nicht herkommen müssen. Keiner hat sie darum gebeten. Sollen sich jetzt nicht aufregen, weil sie in Zelten schlafen müssen.
In irgend einer Late-Night-Talk-Show, so spät, dass sowieso fast keiner mehr zusah, gab dann das belgisch-afghanische Künstlerpaar ein Statement zu seiner Installation ab: „Wir tun uns manchmal sehr leicht damit, etwas so sehr zu abstrahieren, dass wir den Menschen dahinter vergessen. Wenn Menschen fliehen, ist das nicht wie Lotto spielen. Man steht nicht aus seinem bequemen Wohnzimmersessel auf, kauft ein Ticket und hofft das große Los zu erwischen. Menschen fliehen, weil sie müssen. Weil, wenn sich wer zwischen dem sicheren Tod in der Heimat und dem wahrscheinlichen Tod auf einem Schlepperschiff entscheiden muss, wählt er zumeist doch diese klitzekleine Chance, diesen Lichtblick den ihm Europa bietet“.
Gregor Eistert
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT & freiVERS - Special
 In den letzten Monaten haben uns unzählige gute und wichtige Texte erreicht. Wir tun unser Bestes, eine ausgewogene Auswahl in den mosaik-Ausgaben zu präsentieren. So ergab sich in mosaik16 zum Beispiel ein Flucht-Schwerpunkt. Scheinbar hat euch dieses Thema aber weiterhin bewegt, weswegen wir im Jänner auf mosaikzeitschrift.at einen Migrations-Schwerpunkt setzen wollen. Wir tun dies in den gewohnten freiTEXTen ab Freitag, 15. Jänner - und in einer neuen Reihe:
In den letzten Monaten haben uns unzählige gute und wichtige Texte erreicht. Wir tun unser Bestes, eine ausgewogene Auswahl in den mosaik-Ausgaben zu präsentieren. So ergab sich in mosaik16 zum Beispiel ein Flucht-Schwerpunkt. Scheinbar hat euch dieses Thema aber weiterhin bewegt, weswegen wir im Jänner auf mosaikzeitschrift.at einen Migrations-Schwerpunkt setzen wollen. Wir tun dies in den gewohnten freiTEXTen ab Freitag, 15. Jänner - und in einer neuen Reihe:
freiVERS
freiVERS ergänzt die freiTEXT-Reihe: Jeden Sonntag gibt es aktuelle Lyrik aller Art, wie immer kostenlos und unkompliziert auf blog.mosaikzeitschrift.at
Nochmal zum mitschreiben:
Freitags: freiTEXT
Sonntags: freiVERS
Jänner: Migration & Flucht
Du hast einen freiVERS (oder einen freiTEXT) für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at