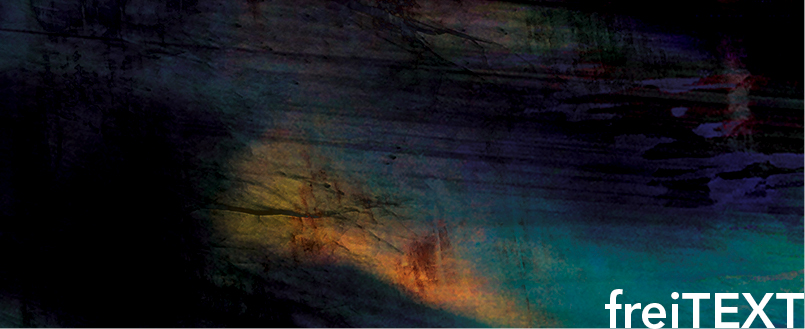freiTEXT 100
Alt ist er geworden, unser digitales Kind. Mit dieser Veröffentlichung wird er 100. Genau soviele freiTEXTe wurden seit September 2014 veröffentlicht, unterbrochen nur vom Advent-mosaik, manchmal - wie am Tag der Arbeit - ausgebaut.
Nach der ersten Saison haben wir die Texte in einem eBook versammelt. Seit heuer wird er durch den freiVERS ergänzt. Alles zusammen kommen wir auf knapp 150 literarische Veröffentlichungen pro Jahr auf mosaikzeitschrift.at - doch alles fing mit dem freiTEXT an.
Für heute haben wir aufgerufen, uns Texte zu schicken, die eben diese Hundert thematisieren sollen. Dieser Spezial-freiTEXT ist damit ein ganz besonderes mosaik - ergänzt mit Grafiken aus 26 Monaten von Sarah Oswald. So wie dieser hier, die den ersten freiTEXT von Thomas Mulitzer illustrierte:

-
100ml
Sie wollten sichergehen, dass es keinen Sinn machen würde es zu bereuen. Sie tranken gleichzeitig, sahen sich dabei in die Augen. „Alles wird gut werden“, sagte sie. Es schmeckte etwas bitter, als es seine Kehle hinunterlief. Ein wenig wie das Kokain, welches sie vor ein paar Jahren mitbrachte. Es würde nur ein paar Minuten dauern bis die Wirkung spürbar wäre. Er sah auf die Uhr, 1:40 Uhr. Es begann. Sein Blick fiel auf den Plattenspieler, der nicht weit von ihm auf dem Boden stand und Musik spielte, die er noch nie gehört hatte. Sie nahm seine Hand und legte sie in ihre, sagte: „Alles wird gut.“ Ihre Hand fühlte sich sanft an als würde sie einen Handschuh aus Watte tragen. Ein stärker werdendes Kribbeln zog sich von seinen Zehen hinauf über Beine und Torso und endete in seinen Haarspitzen, die er deutlich fühlen konnte. Er fasste sich an den Kopf, zog sich an den Haaren um es los zu werden. „Leg dich hin“, sagte sie, „kämpfe nicht dagegen an“. Alles wurde pelzig, seine Augen schlossen sich von alleine, nichts war mehr spürbar. Nur seine Gedanken waren bedrohlich klar. Er hörte den Regen, die Tropfen, die auf das Fenstersims schlugen und an der Scheibe kleben blieben. Der Klang der Musik legte sich über seinen Körper wie ein Leichentuch. Einzelne Töne strichen ihm durchs Haar, wie seine Mutter es immer getan hatte, wenn er krank gewesen war und fielen auf den Boden. Das Mondlicht quoll durch die Rippen der Jalousien und malte seinen Schatten an die Wand. Ein Stechen durchdrang seinen Brustkorb und beendete die Stille.
Fabian Lenthe
Verdampfen

Sie hat vor, noch bevor sie zu Hause ankommen, anzusprechen, dass sein Verhalten seit ein paar Tagen schwer auszuhalten ist. Er kann nichts davon wissen, weil er die meiste Zeit damit beschäftigt ist, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Es können nur zwei dafür ausgewählt werden, gemeinsam das Wasser, das sie eigentlich zum Überleben brauchen würden und das gerade noch fallen kann, bevor es verdampft...
Sie lässt sich gern beim Kochen über die Schulter schauen, nur beim Zerkleinern will sie sehen was die ersten Bläschen unten am Boden… Er trauert der Zeit nach, in der sie noch gemeinsam, was noch nicht von ihnen verlangt worden ist... Sie lässt sich nicht ungern Runterdrücken, aber der Spielleiter verlangt von ihnen, es zumindest für die Dauer dieser Szene zu vergessen. Sie bittet ihn um Hilfe, aber meistens gibt er den Teebeutel schon vor dem Abkühlen hinein.
Stehen sie zusammen, wo es so heiß werden kann, dass… Dazwischen ist es möglich zu trinken, aber lassen sie sich zu weit fallen, kippt die Stimmung. Wer als Erster mit einem Bein aus dem eigentlich zum Schutz angelegten Graben, für den Effekt, der bei der Annäherung nicht mehr vergessen werden kann… Er kann ihnen dabei zuschauen, wie sie noch vor dem Verdampfen an den Punkt kommen, an dem das Wasser, in dem sie stehen verdampft.
Es wird selten jemand älter als Hundert, aber so lange es dauert, wissen sie, dass auch während der unangenehmen Minuten… Das Auskochen der Instrumente beschleunigt das Gefühl, das wie gewünscht genau an dem Punkt aufkommt, wenn die Synchronklappe, noch bevor jemand etwas zu ihnen sagt… Die Lampe steht ihnen im Weg, wird aber dafür gebraucht ihre Gesichter glaubwürdig aussehen zu lassen.
.neutro
Nach Ball
Mit dem Zug fuhr ich nach Zürich, mit dem Zug, über die Berge, durch die Wälder, Holzfäller hätte ich werden wollen, Holzfäller, was kann es wahrhaftigeres geben als durch den Wald zu gehen, Tag ein, Tag aus, Holzfäller, die Säge, das Beil auf der Schulter, doch ich saß im Zug nach Zürich, wollte nicht zum Menschen-schlachten an die Front, Franz war so begeistert, Holzfäller hätte ich werden sollen, in einem Bergwald, Ahorn, Fichte, nur die schönsten Tonhölzer, ich klopfte so gerne an die Stämme, das Ohr rieb an der Rinde, für Geigen, für Cellis, Ball hatte mich eingeladen nach Zürich, er sprach von einem Text, er wollte dort etwas vortragen, ich fuhr gerne in die Schweiz, nach Zürich, viel lieber als nach Frankreich, dort lagen sie in den Gräben, die Feinde, die Deutschen, die Franzosen, krochen sich in die Eingeweide. Lieber nach Zürich, dankbar war ich Ball für die Einladung, er sprach von einem Gedicht, er wollte ein Gedicht vortragen. Schlecht hatte ich ihn verstanden, die Leitung war ständig unterbrochen worden, Cabaret Voltaire, dort wollte er sein, lesen, der Zug durchfuhr immer wieder die Bergwälder, mein Ohr wollte an die Bäume, Holzfäller hätte ich werden wollen, nach Cremona hätte ich mein Holz geliefert, auch nach Mittenwald, nach Paris, mein Vater hat es nicht gewollt, zu schwach sei mein Herz, meine Hände zu zart für die Axt, gerne hätt´ich Säge und Axt geschultert. Ball kannte ich kaum, wir waren uns in Berlin begegnet, ihm gefielen meine Bilder, ein Gedicht wollt er vortragen, er sei neugierig auf mein Urteil, die Texte, die er mir am Telefon vorlas, klangen sonderbar. Fremd. Wie von einem Tier. Unheimlich. Franz Josef ist letzte Woche gestorben. Droben in Verdun fressen sie die Eingeweide. Lieber unheimliche Gedichte. Wie sonderbar friedlich es hier im Zug ist. Immer durch die Wälder. Tannen, Fichten, hier und da sieht man Ahorn. Für den Boden ist Ahorn gut. Die Decke muss unbedingt aus Fichte sein. Gleichmässig gewachsen. Keine Artillerie zu hören hier. Keine Salven aus Maschinengewehren. Will nicht fürs Vaterland sterben. Lieber nach Zürich, zu Ball, die Somme ist ein schöner Fluss, lieber zum verrückten Ball, mir gefallen seine Gedichte eigentlich gar nicht, einfach verrückt, der ganze Ball, einfach verrückt, aber der Stahlhelm passt mir nicht, lieber zum verrückten Ball, nach Zürich, Cabaret Voltaire, will keine Gasmaske tragen im Graben, die Handgranaten reißen einem die Arme und Beine weg, dann lieber nach Zürich, immer noch seh ich Bäume, Franz wollte unbedingt in den Krieg, ich hab ihn nicht verstanden, er ist immer auf dem Pferd geritten, zerfetzt hat es ihn, in Stücke gerissen, Meldereiter war er, ist schon ein paar Monate her, ich hab seine Bilder geliebt, aber er wollte unbedingt in den Krieg, der Ball ist nicht mein Freund, eigentlich hasse ich ihn, viel zu arrogant, vollkommen verrückt sind seine Gedichte. Aber er hat mich eingeladen. Ich bin froh. In Verdun werfen sie Gas aufeinander. Verbrennen sich. Durchlöchern sich. Lieber Ball. Seine verrückten Gedichte. Lieber Ball. Bäume hab ich schon länger keine mehr gesehen. Wir müssen gleich da sein, Ball wollte mich abholen, die Räder kreischen schon, die Bremsen, nur die Bremsen, keine Granaten, keine Soldaten, schrill dringt der Ton in meine Ohren, lieber wäre ich Holzfäller geworden. Ich hab den Franz geliebt. Ich seh schon Ball, er steh am Gleis, wie eitel, als wäre er ein Dichter. Pah, dass ich nicht lache.
Stefan Heyer
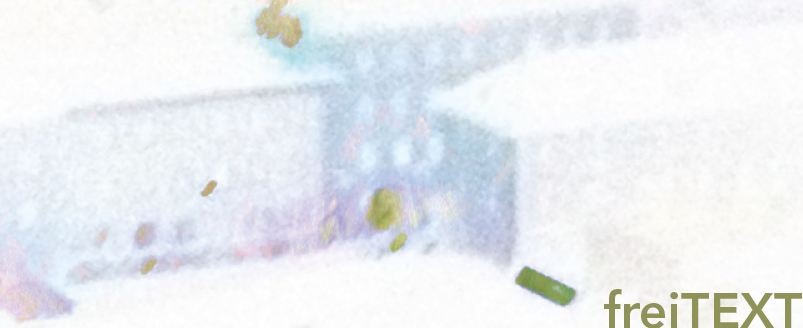
-
Illusion
Er schlief auf der Parkbank ein. Die feuchte Kälte drang in seinen Kragen und fühlte sich gehässig lachend an. Er spürte es nicht mehr.
Heute war ein guter Tag gewesen, sein Freund Franz hatte einen äußerst spendablen Passanten erwischt, von dessen Geldgabe sie sich eine Flasche Rum holen konnten. So etwas passierte meist nur in der Vorweinachtszeit.
Am nächsten Morgen wachte er auf, die Sonne schien. Es war selten, dass sich gute Tage wiederholten. Gute Tage waren eine Illusion, die kaum wahr wurde. Er hatte sich gestern in weiser Voraussicht ein bisschen vom Rum in den Flachmann gegossen, bevor sie auf die unglaubliche Spende und ihr damit verbundenes Rauschglück angestoßen hatten. So war zumindest schon einmal der Morgen gerettet.
Er streckte sich und blinzelte in die Sonne. Gottseidank kein Regen mehr. Er spürte, wie die Sonne seinen feuchten Parka trocknete, bald würde ihm nicht mehr kalt sein. Nachdem er seinen Rucksack gepackt und seine Schlafutensilien hinter dem Strauch versteckt hatte, machte er sich auf den Weg zu Mitzi.
Mitzi war eine gute Seele. Sie führte eine Imbissbude und schenkte den Obdachlosen in der Gegend morgens Kaffee. Eine dünne Filterkaffeebrühe, die er über alles liebte. Den Rest vom Rum würde er sich in den Kaffee leeren. Was für ein Freudentag.
Als er so dahinschlich, durch die hektisch ins Büro eilenden Menschen, entdeckte er etwas am Boden. Eines haben sie nämlich den anderen voraus, die Sandler: Den Blick auf die Dinge, die am Abgrund liegen. Manch achtlos Weggeworfenes, manchmal Verlorenes, was für uns nur Müll ist, ist ein goldleuchtender Schatz in ihrer Wahrnehmung. Heute fand Ferdl allerdings etwas, dass wirklich jemand verloren haben musste.
An Hunderter.
Er staunte. Es gab lange keine Wiederholungen mehr. Schnell blickte er um sich, und in einer sicheren Sekunde steckte er den Geldschein in seine Jackentasche. Er ging zu Mitzi, trank seinen Kaffee mit Rum und plauderte heiter mit ihr über das Wetter, insgeheim wissend, dass es für ihn in naher Zukunft wirklich gut laufen könnte.
„Heit bist owa guad drauf, wos ned de Sun ois ausmocht“ sagte sie erstaunt.
Er bedankte sich für den Kaffee und ging zurück zu seiner Bank. Er sah sich um, niemand kam des Weges. Zeit, um seinen Schatz genauer zu betrachten. Es war tatsächlich ein Hundert-Euro-Schein. Was sollte er damit machen?
Er könnte endlich seinem Enkel etwas kaufen, eine Carrera Bahn vielleicht! Auch wenn sie ihm die Türe nicht öffneten, er könnte sie davor legen und vielleicht würde er einen Blick durchs Fenster erhaschen, wenn der Kleine sie zum ersten Mal sah.
Oder er könnte mit Franz eine ordentliche Sauftour machen, und das sogar in einem Lokal! Dazu würden sie sich ein Vier-Gänge-Menü gönnen. Dann bräuchte er aber vorher noch neues Gewand. Ein neuer Parka, das wäre auch was! Oder ein neuer Schlafsack, das wäre wohl das sinnvollste. Ja, das ist vernünftig, nun, wo es doch immer kälter werden würde. Er wird zur Feier des Tages eine Flasche Rum für sich und Franz kaufen und dann geht er sich einen neuen Schlafsack holen, vielleicht sogar so einen wasserfesten.
„Fronz kim, i lod di auf a Flascherl ei, du wirst ned glaum, wos ma heit passiert is…
Sie gingen lachen in den Supermarkt und suchten sich voller Vorfreude eine gute, mittelteure Flasche Rum aus.
„I ruaf iaz de Polizei, der is gföscht.“
Kälte. Regen. Kaffee ohne Rum.
Doris Leeb

-
unendliches²
es geht ums laufen, um den grund und den weg dorthin. den weg, der bislang gelaufen ist. zwischen gefalteten gleichungen, die einen nicht weiterbringen, weil man sie erst entfalten muss, und einen zum stehenbleiben zwingen, wo stehenzubleiben keine option ist, wo der weg das ziel ist und nicht ins ziel. wo man sich wohlfühlen soll, obwohl es kein wohlfühlen gibt.
wenn ich an die tage denke, wo mir der lauf sinnlos erschien, weil die trägheit einem glauben machen will, es sei der richtige weg, auf dem liegen und gehen gleich sind, wo man am rücken liegend vorwärtsgeht, statt aufwärts oder eben gar nicht vorankommt.
stand ich da, kreuzungsgleich, in der mitte liegend, mit ausgestreckten armen und rannte, ohne zu steigen. da war ich. und da war sie.
in der seitenstraße, durch einen hochhäuserblock getrennt, aneinander denkend, wo der gedanke doch vorbeigeht. lagen wir gen himmel gerichtet, ohne jemals gemeinsam in den siebten zu gelangen, rannten wir gemeinsam fort, um uns im laufe zu verlieren, weil die ziellinie erreicht war, noch bevor wir dem ziel auf den grund gegangen waren.
wollte ich auf-grund, dessen faltete ich wolken zu steinstraßen, um neue wege zu gehen. gen himmel, richtung ab-grund.
doch ich rannte nicht, ich flog, im fliegenden fall: gravitation!, um wieder am anfang zu landen, wo es ent-stand. ent-stehend gegangen bin, weil ich immer am suchen war, doch nie an dieser stelle fündig wurde. war sie immer noch da, auf der straße zwischen „für immer“ und „verfluchten neuanfängen“ von „kann es nicht für immer so sein“ zu „jeder moment vergeht“.
kamen wir zum letzten, wo man sich zuwinkt und umarmt, wo man wieder gemeinsam zum stehen kommt, wo gehen erst danach sinn macht, weil der letzte moment in einer zeitschleife steht, um immer gleich zu verlaufen. waren wir für hunderte momente gefangen, um danach von einander getrennte wege zu gehen.
wo nur einer einen lauf hat. wo man sich fragt, ob laufen sinnvoll ist, oder der sinn im stehen liegt, wo man weiterläuft, auch wenn es nicht läuft, um wieder zum erliegen zu kommen, an der kreuzung, mit den ausgestreckten armen und dem blick gen himmel, zweier gedanken aneinander, die wieder vergehen. wo man wieder laufen will, weil stehenbleiben keine option ist, obwohl man einen stand hat. geht man weiter, geht man und läuft auf grund, auf dem weg ins ungewisse zwischen entfalteten gleichungen und ziellinien, über die man fliegt, weil man steigt, um wieder zu fallen, denn angekommen - ist man erst am grund.
Raoul Eisele
-
1100100
Da sitze ich hier und picke die Erbsen und Linsen auseinander. Die Erbsen nach links und die Linsen nach rechts. Oder andersherum. Dazwischen ein Haufen Dreck. Die Erbsen sind gut, die Linsen auch. Aber nicht alle. Was mache ich mit den halben Erbsen?
Wenn ich meine Arbeit schnell mache, dann ist es leicht: Linsen und Erbsen hier, und den Dreck dorthin. Die Guten ins Töpfchen, und die schlechten … Wenn ich nur ganz flüchtig schaue, kann ich leicht entscheiden, welche gut sind und welche schlecht.
Zum Schluß liegen viele halbe Erbsen und viele Linsenkrümel im Abfallhaufen. Vielleicht nehme ich die größeren davon und lege sie auf einen vierten Haufen. Muß ich noch einmal zwischen Linsen und Erbsen unterscheiden? Die Weizenkörner im Dreckhaufen habe ich vorher ignoriert, weil ich nur Linsen und Erbsen sortieren sollte. Leinsamen sind auch dabei, und Mohn. Wieviele Haufen benötige ich, und wird sich die Arbeit lohnen – oder sollte ich alles den Tauben zum Fraß vorwerfen …
Annett Groh

-
Scheinwelt
Es heißt, ich sei ichbezogen. Dabei existiert kein Ich. Ich bin Einhundert, ich bin viele.
Zugegeben, die Welt dreht sich um mich. Von alldem bekomme ich aber nichts mit, ich bleibe im Dunkel. Mit anderen Scheinen bin ich gebündelt in Tresoren, gestapelt in Registrierkassen und gequetscht in Brieftaschen.
„Geben und geben lassen“, gab mir die Maschine, die mich gedruckt hat, mit auf meinen Gebensweg. Ich bringe mich immer voll ein, ich kann nicht anders. Ich bin Einhundert. Nicht mehr, nicht weniger. Aber das eigentliche Ausgeben, das wahre Hingeben und das tatsächliche Vergeben, das übernehmen helfende Hände. Erneut holen mich Finger aus meiner Verwahrung. Von den eingecremten Hautrillen bleiben ölige Abdrücke und eine Duftnote an mir haften. Die jungen Finger legen mich in eine zerfurchte Handfläche, die mich sogleich zwischen die Flügel einer Geburtstagskarte gleiten lässt. Ich soll nicht zerknittern, wieder einmal bin ich ein Geschenk.
Die Zeit vergeht. Schließlich öffnen flinke Finger die Karte, eine schlichte Melodie ertönt. Ich bin ein Preis, der im kleinen Rahmen verliehen und gierig angenommen wird. Dabei sind Geburtstage pervers. Ich bin Einhundert, wir sind viele. Wir sind da, um Leistung zu feiern. Auf der Welt zu sein, ist keine Leistung. Ich kann nur eine Gefahrenzulage sein, ein Jahr überlebt zu haben. Der Lohn ist das Leben an sich.
Die kleine Hand schiebt mich in eine Geldbörse aus Polyester. Auf ihr sind Superhelden abgebildet, darunter der Befehl „Assemble“. Den Gefallen kann ich dem Kind nicht tun, denn lange bleibe ich nicht. Der Klettverschluss der Börse wird aufgerissen, spitze Finger mit Dreck unter den Nägeln zerren mich in den orangen Laternenschein der Nacht. Die Pranke schleudert die Superhelden ins Nichts. Unsymmetrisch zusammengefaltet lande ich in einer Hosentasche. Fasern reiben sich an mir. Ich kriege Falten. Das Dasein als Beute ist hart, aber nicht ohne seine Reize. Um mich zu bekommen, hat sich jemand angestrengt, hat Hand- und Schlagqualität bewiesen. So dreht sich die Welt.
Ein stahlharter Griff zieht mich aus der Jeans hervor. Eingeklemmt in der Faust färbt Schmutz auf mich ab. Das ist die Geldklammer des Kleinkriminellen. Ich sehe eine andere Hand auf mich zukommen: Zuerst denke ich an eine Begrüßung, doch ich erkenne– es ist ein Geiselaustausch. In einem nahtlosen Übergang wechsle ich den Besitzer. Ein Säckchen, gefüllt mit graubraunem Pulver, schiebt sich an mir vorbei.
Ich werde zu anderen Einhundertern transportiert, alle zusammengerollt und von einem Gummiband umwunden. Ich geselle mich zu ihnen. Ich bin Einhundert von Hundert. Aber ich bin nicht naiv: Wir sind kein Baum, der mit jedem neuen Schein Ring um Ring organisch wächst. Wir sind ein Bündel schmieriger Wäsche, das in die Reinigung muss. So kommen wir in einen strahlenden Salon. Die grünen Teppiche sehen aus, als wären die Böden mit fälschungssicheren Mustern von Geldscheinen ausgelegt worden - Ornamente aus sich überlappenden und ineinander verwickelten Linienzügen. Auf den Waschautomaten blinken die Worte „Glück“ und „Gold“. Wir werden durch einen goldenen Bogen gereicht und gegen Jetons eingetauscht. Nur sie haben in diesem Glitzer-Wunderland einen Wert, während wir in der Welt draußen alles zählen. Irgendwo ist doch jeder von uns in seiner Zahlungsfunktion behindert.
Mein Spielgeld-Zwilling kehrt zurück, er wird gegen kleinere und saubere Scheine eingetauscht. Es dauert, bis ich ausgezahlt werde – in eine Hand, die vor Aufregung zittert. Ich sehe den grünen Boden unter mir, mit den ungleichmäßigen, geschlossenen Ellipsen darauf. Die Hand trägt mich mehrere Stockwerke höher. Angekommen in einem Zimmer werde ich weitergereicht. Finger mit grellrot lackierten Nägeln stecken mich ein. Zuerst denke ich, in eine Brieftasche geschoben zu werden. Doch spüre ich auf der einen Seite Leder und auf der anderen Seite Haut. Diese Körperstelle ist mir fremd. Ich kenne nur Hände. All die Bakterien, die von dort kommen und sich im Laufe der Zeit auf mir angesammelt haben, lernen so endlich Neuland kennen. Der Untergrund beginnt zu beben. Tropfen um Tropfen bildet sich ein Fluss aus Schweiß, auf dem die Bakterien besser übersetzen können. Die Feuchtigkeit optimiert aber auch die Überlebensbedingungen auf mir. Es ist ein Milieu, in dem Keime sich wohlfühlen.
Das Naturschauspiel dauert nicht lange. Meine Weiterreise ist eine altbekannte: Ich gelange erneut zur goldenen Durchreiche, an der ich wieder gegen falsches Geld gewechselt werde. Alles wiederholt sich: Zuerst warte ich, dann zahlt man mich aus, ich werde verjubelt, komme an den Ursprung zurück und warte wieder. Ich drehe mich wie in der Trommel einer Waschmaschine. Doch jeder Waschgang hat ein Ende.
Schließlich werde ich vom Tauschposten mit anderen Scheinen in einen Tresor-Raum verbracht und zusammengepackt. Wir sind lebendig eingeschweißt in Sarkophage aus Plastik. Ich bin Einhundert von Eintausend. Das Massengrab ist voll. Dann fallen die Grabräuber ein. Alles an ihnen ist schwarz: Die Skimasken, aus deren Schlitzen ihre Augen starren. Die Handschuhe, mit denen sie unsere Stapel greifen. Die Taschen, in welche sie uns werfen. Der Transport ist holprig. Wir werden hin- und hergeworfen. Zuerst kracht es in der Ferne – es sind Schüsse, die näher kommen. Unsere Tasche wird getroffen. Ich und andere werden ins Freie geschleudert, hinauf bis in die Himmelswolken, die sich aus dem Rauch von abgefeuerten Waffen gebildet haben. Brennend und zerfetzt rotiere ich durch die Luft. Unter mir ein Feuerwerk, das zu unseren Ehren veranstaltet wird. Ich schwebe gegen den Boden hin und setze auf einer roten Landebahn auf. Ich sauge mich voll mit Blut.
Ich bin verkrüppelte Einhundert. Die Finger, die mich einsammeln, sind von künstlicher Haut überzogen. Sie tüten mich ein – wie in Quarantäne, so als hätte ich mich mit einer Krankheit infiziert. Ich werde weggebracht und auf einem Regal abgelegt - gemeinsam mit den Waffen und den Masken. Eines Tages werde ich geholt und als einzelner Schein in einem Koffer verstaut. Alleine in einem Geldkoffer zu sein, ist ein seltsames Gefühl. Eine Hand nimmt mich heraus und hält mich in dramatischer Weise vor viele Gesichter. Von Beweiskraft ist die Rede. Wenn ich ein Beweis sein sollte, dann weiß ich nicht, wofür: Was der Mensch mit Geld macht, oder, was Geld mit dem Menschen macht. Vielleicht bin ich auch selbst Angeklagter. Ich bin ein zerstörter Geldschein. Damit bin ich meinen Wert los.
Nach dem Theater komme ich zurück in das Regal. Gelegentlich flackern Leuchtstoffröhren auf. Um mich herum werden alle geholt. Sie haben noch einen Nutzen, die Waffen und die Masken können eingesetzt werden. Im Gegensatz zu mir, einem Stück bedruckter Baumwolle, das nur noch vernichtet werden kann, damit ein neuer Schein mit meinem Wert ausgegeben wird. Tatsächlich holen sie auch mich und legen mich auf eine durchsichtige Platte. Ich warte auf die Säure als meine Todesstrafe. Sie kommt nicht. Ich warte auf das Feuer, weil mir die Schuld an allem gegeben wird. Statt Flammen legt sich eine zweite Kunststoffplatte über mich. Zwischen den Platten eingeschlossen werde ich auf ein Podest gehoben, welches in einer Vitrine verschlossen wird. Zeigefinger kommen nahe an die Vitrine und Hände pressen sich gegen meine Zellenwand: Es ist wieder ein Gefängnis, aber ein transparentes. Draußen erkenne ich ein Banner: „Geldmuseum - Ausstellungseröffnung“. In Dauerwiederholung beginnt ein Lautsprecher unter meiner Vitrine einen Song zu spielen - ein Rap mit dem Titel „Scheinwelt“.
Die Begeisterung der Museumsbesucher begreife ich zuerst nicht. Ich sehe mich in der Spiegelung der Vitrine - löchrig, verbrannt und verkrustet von Blut. Wirtschaftlich bin ich nur noch ein reiner Schein. Ich war Einhundert. Doch ich verstehe, dass Geld immer zwei Seiten hat, die wirtschaftliche und die magische. Denn durch meinen Gebensweg bin ich nun mehr wert als Einhundert. Die Hände, die mir nahekommen, wollen mich an sich nehmen, doch ich bin unerschwinglich geworden. Die leeren Hände können nur eines tun. Also klatschen sie.
Markus Grundtner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Ausschreibung: freiTEXT x 100
Der freiTEXT wird 100!
Am 11. November veröffentlichen wir den hundertsten freiTEXT. Seit wir vor etwas mehr als zwei Jahren damit begonnen haben, verorgten wir euch fast wöchentlich mit neuester Prosa von über 90 verschiedenen Autor*innen.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag und schon ist der hundertste freiTEXT da. Wir suchen Texte zum Thema
- hundert
- C
- 1100100
- 2²x5²
- Summe der ersten neun Primzahlen
- Bereich zwischen 99 und 101
- Fermium
- ...
Und wir suchen diese Texte bis zum So, 6.11. 12:00
Einsendungen von Prosatexten an: schreib@mosaikzeitschrift.at
Alles klar? Wenn nicht: >> FAQ << oder Mail
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.