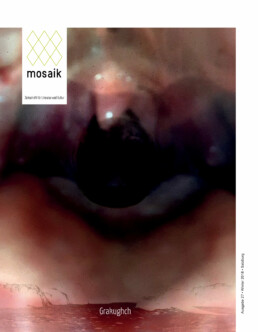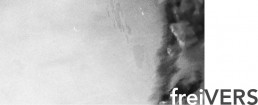freiTEXT | Katja Johanna Eichler
Schlamm und Schimmel
Sie trank inzwischen täglich Schlamm. Sie rührte sich jeden Morgen einen Teelöffel der Vulkanmineralien in ein Glas mit etwas Wasser, bis dies zu einer grauen Masse wurde und trank es. Jeden Morgen schaute er zu, wie die Masse in einem schmalen Rinnsal schwerfällig vom Glasboden in Richtung Rand rutschte und dann zwischen ihren beiden kirschroten Lippen verschwand. Jeden Morgen fand er, dass sie über Nacht wieder an Farbe verloren hatte, dass ihre Haut unterschiedliche Grautöne ausprobierte. Nach zwei Wochen fand er, dass ihre Haut auch die Grautöne verloren hatte und weiß, fast durchsichtig wurde. Im Folgenden fand er sogar, dass die Haut feine Risse bekam, so wie alter, weißer Marmor. Er dachte an antike Statuen in griechischen Tempeln, er dachte dann an Rom und an Pompej, an den Vesuv, der noch immer halb wach vor sich hin dämmerte und er dachte vor allem an Asche, die alle Häuser bedeckte und heiß in menschliche Lungen gesogen wurde. Inzwischen regnete es in jedem seiner Nachtträume Asche. Meist fiel sie in leisem Sinkflug auf eine zarte, fast durchsichtige Statue mit feinen Bruchstellen an Knien und Ellbogen. Bei näherem Hinsehen erkannte er Lola, obwohl ihr Statuen-Gesicht verzerrt aussah, die Stirn faltig, die Augen zusammen gepresst, der Mund eine schmale Linie. Es waren keine göttlichen Gesichtszüge, es waren schmerzverzerrte Linien. Eine Kore mit weltlich belastetem Antlitz.
Wenn er morgens aufwachte, lag sie nie mehr neben ihm. Vergeblich ließ er seine Hand Morgen für Morgen auf die andere Seite des großen Bettes wandern, das sie sich kurz vor Weihnachten zusammen gekauft hatten, nachdem sie diese Dachgeschosswohnung in der Innenstadt gemeinsam bezogen hatten. „Liebesnest”, hatte er sie damals liebevoll genannt. Jetzt war es „die Wohnung”. Eine Wohnung, in der zwei Menschen ein und ausgingen, um ihr Tagesgeschäft zu verrichten. Für Lola bedeutete das, früh aufzustehen, zur Uni zu gehen, danach die Unterlagen zu lesen, die wichtigen Stellen mit einem neongelben Marker anzustreichen und sie dann an der einzig richtigen Stelle in ihrem Universum von gereihten Ringordnern unterzubringen. „Die Wohnung” war zu einem Ort der Reihen geworden: Der Schuhreihen im Flur, der Bücherreihen im Wohnzimmer, der Reihen von Gewürz- und Müsligläsern in der Küche, von aufgereihten Kissen auf dem Sofa und Reihen von Duschgel- und Shampootuben im Bad.
In „Liebesnestern”, wie er sie meinte, gab es keine Reihen. Dort waren die Betten unordentlich, die Bettbezüge rochen nach Liebe und wiesen mehrdeutige Flecken auf. In „Liebesnestern” standen unbeachtet benutzte Weingläser herum, auf dem Küchentisch und neben dem Sofa, auf dem in wohliger Vertrautheit Kissen herum lümmelten. Espressokannen standen bereit, in denen jederzeit schwarzes italienisches Espressopulver aufgekocht werden konnte. Es gab Trauben im Kühlschrank und aufgebrochene Knoblauchzwiebeln, die achtlos neben großen Flaschen von frisch abgefülltem Olivenöl lagen. Es kam vor, dass Reste von Avocado, Schinken und roter Beete auf bunt befleckten Holzbrettern zu Zeugen eines gemeinsamen Kochens in leichter Bekleidung wurden, die einzig mögliche Schlussfolgerung nach einem Tag im Bett, der die Hautporen erfüllt hatte, aber nicht die Mägen. In „der Wohnung” fand sich von all dem nichts.
Als er Lola das erste Mal begegnet war, war sie weit davon entfernt gewesen, dem Abbild einer Göttin zu ähneln. Damals war sie eine Göttin. Sie unterschied sich von den anderen Erstsemesterinnen, die die Tischreihen des Hörsaals mit ihrer raschelnden und raunenden Profanität füllten, indem sie mit ihren Popos in viel zu engen Hosen die Klappstühle herunter drückten und nervös an ihren Haaren, dem billigen Modeschmuck und ihren Telefonen herum fingerten. Sie war ihm so anders als die anderen erschienen, dass ihr Anblick ihn geschmerzt hatte. An jenem Tag hatte er die Vorlesung dazu genutzt, sie genau zu studieren, ihr kantiges Profil mit dem starken Mund und der langen geraden Nase und ihre simplen glatten rötlichen Haare, die vorgaukelten, niemals irgendeiner Behandlung ausgesetzt gewesen zu sein. Als sie den Saal betreten hatte, schmucklos und schlicht gekleidet, hatten ihre Augen blitzschnell die Sitzreihen überflogen und zielbewusst seine selektiert. Er wusste, er hatte diese Wirkung, er war es gewohnt, dass ihm viele Blicke zukamen, doch damals war es anders gewesen. Nach der Vorlesung hatte sie hinter der weit geöffneten Flügeltür des Hörsaals auf ihn gewartet und er war auf sie zugegangen, als wäre dieser Augenblick alleine dafür bestimmt gewesen. Sie hatte ihm die Hand gereicht, sich ihm vorgestellt und er hatte ihre Hand mehrer Augenblicke in seiner gehalten. Nur drei Monate später waren sie zusammen gezogen. Er hatte sich glücklich gefühlt, bis das mit dem Schlamm begann.
Das mit dem Schlamm veränderte nicht nur seine Träume, sondern auch sein Geschmacksempfinden. Es fing damit an, dass er eines Morgens dachte, die Marmelade sei schimmelig. Oder das Toastbrot. Er nahm die Toastscheiben aus der Tüte, klappte sie auseinander und studierte sie sorgfältig. Aber er konnte keine Schimmelspuren entdecken. Er roch am verschmierten Deckel der Marmelade, stob mit der Messerspitze durch die rote Masse und quirlte die dunkelroten Punkte auf. Er konnte auch hier keine Schimmelschlieren entdecken. Irgendwann stellt er fest, dass sich der Schimmelgeschmack nicht nur auf das Frühstück beschränkte. Er zog sich durch alle seine Mahlzeiten. Er stellte auch fest, dass der Geschmack nicht pilzig, sondern steinig war. Er fragte sich, wie lange das mit dem Schlamm und dem Schimmel noch so weiter gehen konnte.
Es regnete, als er die Wohnung betrat, genau acht Wochen nachdem sie angefangen hatte, Schlamm zu trinken. Genau zwölf Wochen nachdem sie gemeinsam in ihr Liebesnest gezogen waren, das niemals eines werden sollte. Er zog seine Stiefel aus und stellte sie zu den anderen Schuhen, die sich im Flur an der Wand zwischen Eingangstür und WC-Tür aufreihten. Er zog seine durchnässte Jacke aus und hing sie an einen Haken aus der Reihe von Haken, die über die Schuhe wachte. Er ging in die Küche und sank erschöpft auf einen Stuhl. Es ließ das Licht aus, obwohl es draußen dämmerte und schaute abwechselnd zum Fenster hinaus und zu den Konturen der Trinkglas-Reihe auf dem Wandboard und der Müsligläser auf der Anrichte. Neben den großen Vorratsgläsern konnte er den weißen Kunststoffbehälter erkennen, der das puderige Pulver enthielt, das jeden Morgen als schmale Schlammlawine durch den Kirschmund rann. Er wusste, was auf dem Etikett stand, er wusste es auswendig, so oft hatte er es gelesen: Zeolith, Detox-Pulver, der Schadstoffbinder. Es würde alles absorbieren und hinaus transportieren, neue Energie geben, ja es half sogar gegen explodierte Atomreaktoren. Er hatte es selbst einmal probiert und er wusste, es machte Bauchschmerzen und einen grünlichen Stuhlgang, aber hey, alles nur leichte und völlig erträgliche Nebenwirkungen für einen maximal sauberen Darmtrakt. Plötzlich stand sie im Türrahmen, er erschrak und fragte sich, ob er die letzten Worte still gedacht oder laut gesagt hatte. Er hatte sie nicht kommen hören oder war sie die ganze Zeit da gewesen? Lief sie überhaupt noch oder schwebte sie bereits? Was hatte das Zeug schon alles absorbiert? Die letzten weltlichen Mikrospuren von Alkohol, Koffein und Schokolade? Oder bereits Nähr- und Mineralstoffe, gar erste Zellen? Höhlte es ihren Körper von innen aus? War sie nur noch die Hülle von Lola? Eine schwebende Kore in einem geordneten Imperium aus Reihen? Er sah ihr ins Gesicht. Es war nicht das verzerrte Antlitz aus seinen Träumen. Ihr Gesicht war klar und eben. Sie kam auf ihn zu, setzte sich auf seinen Schoß und legte ihre Arme um seinen Hals. Er konnte sie kaum spüren, aber er roch sie. Sie roch nicht nach Ascheregen. Sie roch nach Regenregen. Sie roch so anders als all die anderen. Sie roch so göttlich, dass es ihn schmerzte.
Katja Johanna Eichler
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Miriam V. Lesch
Spontandichtung
#59
Ausgehöhlt
ich existiere noch
an den
Rändern
jeder will mich
unbedingt
füllen nur
womit
so viel Gleichzeitigkeit
kann nichts
Sein.
#58
Du lässt warten
das ist nicht neu und
fancy
diese Jacke so
was konnt ich schon mit
fünfzehn
nicht
cool sein hab
Schnaps gekippt ja
richtig
es fehlt mir
wie beim ersten Mal
an Geduld
für deinen Lifestyle
das du
mich magst
Glaub’s doch selber.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Daniel Klaus
Kaugummis
An die Langsamkeit muss ich mich erst gewöhnen. Das ist nicht einfach. Die Minuten verrinnen mir nicht mehr zwischen den Fingern, sondern sie knoten sich aneinander, ineinander, und manchmal bleibt die Zeit für einige Momente einfach stehen, ohne sich von der Stelle zu rühren.
Aber die Krücken sind ein Fortschritt. Die ersten Tage durfte ich nur im Bett oder auf der Couch liegen, mit drei Kissen unter dem Fuß und einer Packung Eis darauf. Ich bin beim Basketballspielen umgeknickt. „Schwere Bänderdehnung“, sagte der Arzt, als er sich das Röntgenbild ansah. „Das braucht seine Zeit.“ Und mit dieser Diagnose hat er leider Recht gehabt. Ich bin froh, dass ich jetzt diese Krücken habe und mit ihnen die Wohnung verlassen kann. Endlich. Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet.
Es ist gar nicht so einfach, und es dauert eine ganze Weile, bis ich vom fünften Stock unten bin. Ich achte auf jeden Schritt, den ich mit meinem rechten Fuß und den beiden Krücken mache, und nach einer Weile merke ich, dass das Laufen für die Arme anstrengender ist als für das eine Bein. Eine seltsame Erfahrung. Schließlich öffne ich die Haustür und trete nach draußen.
Es ist halb ein Uhr mittags. In Berlin leben ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen. Vielleicht 800.000 davon halten gerade Mittagsschlaf. Es ist sehr ruhig auf der Straße. Vielleicht hängt die Stille aber auch mit der Hitze zusammen.
Ich gehe ein paar Schritte durch diese mittagsmüde Großstadtstille. Vor dem Esmarcheck bleibe ich stehen. Ich lege den Kopf in den Nacken und betrachte die gegenüberliegende Hausfassade wie ein Tourist. Ich lasse meinen Blick wie einen Aufzug vom obersten Stockwerk bis zum Erdgeschoss hinuntergleiten und steige dort mit meinen Augen aus. In der Zeitgalerie ist es dunkel. In der Zeitgalerie ist immer Winter, denke ich, selbst im Sommer. Merkwürdigerweise scheint gerade an diesem Ort die Zeit spurlos vorbeizugehen, während sich der Rest der Straße in ständiger Veränderung befindet.
Mitten in diesen Überlegungen läuft der schüchterne Nachbar aus dem Hinterhaus an mir vorbei. Mit gesenktem Kopf. Er ist der erste Mensch, den ich heute sehe. Er trägt Segeltuchschuhe und bewegt sich lautlos über den Bürgersteig. Ich blicke ihm hinterher. Kurz vor der Apotheke bleibt er stehen. Er betrachtet irgendetwas an der Wand. Ich gehe ein paar Schritte weiter, weil ich neugierig bin, und jetzt kann ich es erkennen: Es ist ein Kaugummiautomat. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Wie lange er wohl schon an dieser Wand hängt? Mein Nachbar kramt in seinen Taschen, holt eine Münze heraus und steckt sie in den Kaugummiautomaten. Mit einer andächtigen, fast feierlichen Bewegung, dreht er den Griff herum und hört auf das Klacken im Ausgabefach. Er wartet einen Moment, bevor er das Ausgabefach öffnet und die Kaugummis in seine Hand und von dort in ein Leinensäckchen rollen lässt, das er aus der Tasche gezogen hat. Ein Teil von ihm, sein Gesichtsausdruck und seine Körperhaltung, erinnern an den kleinen Jungen, der er einmal war, und den ich nie kennen gelernt habe. Dann wiederholt er das Ganze.
Und wieder.
Und wieder.
Seine Bewegungen werden schneller und sicherer.
Es ist noch immer sehr ruhig in der Esmarchstraße. Wir sind die einzigen Menschen. Nur ein Radfahrer mit losem Schutzblech fährt in der Liselotte-Herrmann-Straße über das Kopfsteinpflaster. Mein Nachbar scheint tatsächlich den kompletten Kaugummiautomaten leeren zu wollen. Er steht nun vor ihm wie ein erfahrener Panzerknacker oder Juwelendieb und wirft ein Geldstück nach dem anderen hinein. Ruhig und systematisch räumt er den Kaugummiautomaten wie einen Geldsafe aus.
Mein Herz pocht. Es ist Blödsinn, aber ich komme mir vor wie sein Komplize, der Schmiere steht. Es ist niemand zu sehen. Er hat freie Bahn.
Und dann scheint er fertig zu sein.
Ich humpele mit meinen beiden Krücken zu ihm und werfe einen Blick auf den Kaugummiautomaten. Er ist leer. Ein perfekter, völlig legaler Raubzug.
„Hallo“, sage ich.
„Hallo“, sagt er und sieht mich an. Es ist das erste Mal, dass ich ihn reden höre. Er lächelt und hält mir seinen gefüllten Leinenbeutel hin: „Bitte“, sagt er. „Greifen Sie zu.“
Ich suche mir einen grünen, einen blauen und einen gelben aus. Auf einem Balkon im Haus gegenüber steht ein Windrad, das sich schläfrig im Wind bewegt. Ich stecke sie mir alle drei auf einmal in den Mund und beginne, die Farben abzulutschen.
„Die sind wirklich gut“, sage ich, die Ellbogen lässig auf die Krücken gelehnt.
„Davon träume ich seit ich elf bin“, sagt er. „Und heute, zwei Tage nach meinem 38. Geburtstag, habe ich es endlich gemacht.“
Wir stehen beide vor dem leergeräumten Automaten in der stillen Esmarchstraße. Ich gratuliere ihm nachträglich. Wir lächeln. Und zerkauen mit unseren Kaugummis die Zeit.
Daniel Klaus
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Ausschreibung Advent-mosaik 2018
24 Tage | 24 Türchen | 24 Autor*innen | 24 mal Literatur.
Dein perfekter Weg durch die Vorweihnachtszeit.
Heuer schon wieder keine Schokolade. Dafür zum siebten Mal gute Literatur, quer durch. Jeden Tag darfst du auf advent.mosaikzeitschrift.at ein neues „Türchen“ aufmachen, Punsch dazu trinken und Schokolade dazu essen.
Damit das funktioniert, brauchen wir aber auch Türchen-Material. Schick uns deine Texte aller Art:
schreib@mosaikzeitschrift.at | Einsendeschluss: 17. November 2018
Inspiration dafür kannst du dir z.B. bei den freiTEXTen, den freiVERSen oder beim letztjährigen Advent-mosaik holen.
Wir freuen uns auf deine Texte!
mosaik27 – Grakughch.
mosaik27 – Grakughch.
INTRO
Über das Gefallen zu schreiben ist ein schwieriges Unterfangen. Über das Gefallen in der Kunst zu schreiben ist ein unmögliches Unterfangen. 270 Wörter haben auf dieser Seite noch Platz – das geht sich aus!
„Sie betrachtet sich selbst, ihr Gesicht, das ihr irgendwie fremd vorkommt. Die Arme wirken künstlich platziert. Das muss sie das nächste Mal anders machen.“ – Bastian Kresser
Wir sehen uns schon mit Fragen nach der Schönheit des Covers dieser Ausgabe konfrontiert. Warum habt ihr so ein ekelerregendes Cover gewählt? Manchen wird es (trotzdem?) gefallen, andere werden sich damit zufriedengeben müssen: Weil.
Jetzt diskutieren wir aber vor jeder Ausgabe über hunderte literarische Kunstwerke und entscheiden uns für eine Handvoll davon. Persönliche Geschmäcker sollten bei dieser Auswahl außen vor gelassen werden, brechen selbstverständlich ständig durch. Es ist allerdings eine schwierige Gratwanderung zwischen gefallen und gefällig. Letzteres geht anscheinend in der Kunst gar nicht. Und so wählt man Texte aus, die nicht gefallen – und andere nicht, die es tun. Und zack! sind wir in der Diskussion, was Kunst leisten soll/ kann/darf/muss.
„Ab und zu mag ich es auch mal, Dinge nicht zu verstehen!“ – Peter.W.
Und gleichzeitig fühlt man sich ständig in einer Rechtfertigungsschuld: Warum dieser Text, aber nicht jener? Auf diese und ähnliche Fragen antworten wir mit für richtig empfundenen Argumenten. Doch manchmal wissen wir selbst nicht, warum wir Entscheidungen auf bestimmte Weisen treffen – in der Retrospektive wird das erschreckend deutlich. Vielleicht muss man sich eingestehen, dass die Kunst den Argumenten manchmal voraus ist: Was man mit Logik (noch) nicht in Worte fassen kann, das geht durch Kunst oft besser.
„Wonach Schatten schmecken? Er lacht. Nach Staub natürlich. Man müsse ihn verwandeln, darin liege die Kunst.“ – Marlene Gölz
Warum hier dieser Text steht und kein anderer? Weil.
Euer mosaik
Inhalt
Lichtwellenleiter
- Katharina Körber – Menschen
- Markus Grundtner – Da sucht einer sein Glück
- Natalia Breininger – Entropie
- Babet Mader – Suppengrün
- Jörg Kleemann – Aus dem Stand
Bodentreppen
- Mariusz Lata – nicht mehr sein
- Sigune Schnabel – Mein Leben trägt Bürokleidung
- Ann-Christin Kumm – Wird grün, wird gelb
- Marcel Pollex – Die Baustelle
- Johanna Müller – Das Leuchten der Hemdkrägen bei Nacht
- Andreas Hippert – Graureiher
Fernsehbilder
- Peter Paul Wiplinger – Du böses Kind
- Bastian Kresser – Fältchen aber keine Falten
- Wolfgang Wurm – Beschämt; drei, zwei, eins
- Markus Leitgeb – Keine Zugfahrt
- Marlene Gölz – Schattenschlucker
Kunststrecke von Molly May Lewis
BABEL – Übersetzungen
- Gatuduvan – Det blixtrar till ibland / Es blitzt manchmal auf – En stilla eftermiddag i september / Ein stiller Nachmittag im September
- Jelena Anðelevski – Panter zna da ste ga otrovali / Panther weiß, dass ihr ihn vergiftet habt
Kolumne
- Peter.W.: Hüte aus Fischhaut, Hanuschplatz #14
Essay
- Samer Schaat – Fragilität der Welt
Buchbesprechung
- Thomas Ballhausen: Obdach für Gespenster
Interview
- „Das muss man mal so knallhart sagen.“– Marko Dinic beim Halleschen Dichterkreis
Kreativraum mit Niklas L. Niskate
freiVERS | Thomas Ballhausen
Versuch über das Rauschen
„Veränderung durch Wörter ist Dichtung.“
Rolf Dieter Brinkmann: Westwärts 1&2
Das Rauschen kann in seinem Naturzustand nicht beobachtet oder beschrieben werden, die Sprache geht ihm voraus.
Für das Rauschen gibt es keine Erklärungen oder Gebrauchsanweisungen, bloß warnende Empfehlungen hinsichtlich Verhaltensweisen, Ausbreitungsgrad und Formen der Übertragung.
Im Rauschen findet sich etwa ein Hundertstel eines länger zurückliegenden sehr lauten Beginns.
Rauschen und Raum stehen in einer schwierigen Beziehung. Das Rauschen findet deshalb vor allem zwischen Zeilen und in Pausen statt.
Rauschen kennt keine Handlungen oder Absichten, es löst sie aber wie beiläufig aus.
Es ist nicht ratsam, das Rauschen zu verdünnen.
Das Rauschen hat keine Farbe. Gerüchten nach ist es vielleicht weiß.
Es gibt bislang keine vollständige Auflistung der im Rauschen enthaltenen Allergene. Das Rauschen kann Spuren von Nüssen, Spänen und Dornen enthalten.
Das Rauschen ist nicht geeignet, um Katzen zu trocknen.
Je nach Dosierung können alle Sinne vom Rauschen kurzfristig beeinträchtigt oder auch dauerhaft verändert werden.
Man kann natürlich versuchen das Rauschen zu imitieren, aber bestenfalls wird man es ein wenig nachahmen. Alle bislang unternommenen Versuche waren lächerlich.
Vom Rauschen muss man sich erfassen und eine Zeit lang tragen lassen.
Das Rauschen ist keine Entschuldigung für irgendetwas. Vielleicht gibt es hin und wieder eine schlechte Erklärung ab.
Das Rauschen kennt keine Wehmut für das Ende des vergangenen Jahrhunderts. Das Rauschen kennt nur Immer und Überall.
Das Rauschen ist Gegenwart und Wirklichkeit.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Manon Hopf
wir haben noch den Schwindel einer Reise in den Beinen als wir schon im Feld stehen, aus dem tiefen Wein Erinnerungen ziehen die noch nachts in unsren Hosen halten, wüste Klettenköpfe sind am Schienbein, in den Kniekehlen ein Ziehen, Beugenwollen, wir sind groß geworden auf den Wegen senken wir die Blicke, suchen unsre Erde, unsre Gräser zwischen Kieselsteinen, Schotter, die Augen, die den Händen näher waren, jetzt ein Kopfumblicken sind, ein Sehen ohne Hand und Fuß, die Landschaft einsortierend, Nutzen, Schönheit die ein Nutzen ist der malträtierten Seelen, sie lassen sich scheuchen vom einsilbigen Kirchturmläuten durch die dünnen Gassen wächst ein Holzgeruch, im Ofen liegt die Ruhe einer schwarzen Nacht, die mit uns in dicken Jacken auf der Dachterasse sitzt, sich nach dem weißen Rücken streckt des greisen Mont Ventoux
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Katie Grosser
Herbstgefühle
Die Regentropfen prasseln mit Wucht ans Fensterglas
Doch drinnen wohlig‘ Wärme beschützend mich umhüllt
Das Prasseln bringt Gefühle, die ich nur kurz vergaß
Gefühle, die mich tragen hinaus aufs weite Feld
Wo letzte Sonnenstrahlen mit ihrem golden Licht
Behutsam mich begleiten, voll stiller, sanfter Ruh‘
Und Vögel leise singen im Einklang mit der Welt
Gefühle, die der Winde gar rastlos rasend bringt
Er bunte Blätter wirbelt – ein farbenfrohes Fest –
Mit luftig weichen Fingern er zärtlich Wangen streicht
Und nussig pralle Düfte er trägt ins Land hinaus
Mein Herz, es pocht dann höher und freuderquickt es singt
Gefühle, die den Anfang vom End‘ versprechen mir
Denn nun am Jahresende ich kehre still hinein
An jedem langen Abend ich endlich habe Zeit
Für Dankbarkeit und Ruhe, bin voll von leisem Glück
Ein warmes Licht mich füllet ganz sanft von innen aus
Im Herbst ich kann genießen allein das Jetzt und Hier
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Sergej Tenjatnikow
Zebra
frisch erlegtes Zebra
liegt
auf dem Asphalt –
herrenlos.
(hier enden die Verse.)
wenn du darüber schreitest,
mach dich nicht schmutzig
mit seinem weißen Blut.
hinterlasse keine Spuren
den Fußgängerjägern.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Florian Neuner
Visions of Samuel, Teil 1
Beklemmung
Herr Samuel Lichtenbring litt seit einiger Zeit unter entsetzlichen Beklemmungszuständen und war daher nicht mehr Herr seiner selbst. Er konnte es sich nicht versagen, dauernd mit dem Fuß zu wippen, wenn er über einem trockenen Kolleg saß. Was der Mensch sei, war ihm undeutlich, und er hatte verlernt, es wissen zu wollen. In der Regel wollte er um diese Uhrzeit nur noch nach Hause.
Herr Samuel Lichtenbring versuchte es mit Laufen, er war aber bereits außer Atem, wenn er den Feldweg hinter seinem Haus erreichte. Dann setzte er sich ins Gras und seufzte, seufzte noch einmal, seufzte unzählige Male, als sei es eine Beschäftigung. Er saß da, als warte er auf jemanden oder auf Erlösung, er hörte ein paar Krähen, er zog seine Schuhe aus, gähnte, rieb sich die Augen, gähnte wieder, als ob ihn jemand erhören sollte ‒ der liebe Gott oder der Nachbar. Er ging dann nach Hause und duschte, bis die Haut rot war.
Herr Samuel Lichtenbring war kein Träumer. Er sah die Dinge in ihrer Einfachheit, die Dinge waren so, wie sie waren, mein Gott, warum sollten sie anders sein, warum sich Gedanken machen. Bis die nervösen Zustände begannen. Er hielt sich seitdem nachts wach, um algebraische Aufgaben zu lösen, er fütterte seinen Goldfisch, er las lateinische Abhandlungen über die Natur, er versuchte den Gesang der Vögel und die Stimmen der Menschen in Noten zu fassen. Herr Samuel Lichtenbring hatte an die Vollkommenheit seines Lebens geglaubt. Sein Leben war ein Kreis. In dem Kreis war alles. Keiner durfte in den Kreis. Herr Samuel Lichtenbring hätte eher seinem Goldfisch das Sprechen beigebracht ˗ wenn er nicht von der Idiotie dieses Unterfangens überzeugt gewesen wäre ˗ als sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Überzeugt nämlich war er von seinen Fähigkeiten. Bis eines morgens die nervösen Zustände einsetzten. Eigentlich fingen sie nachts an. Er sah nachts einen Film, und die Bilder gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Lesen wäre an sich eine gute Idee gewesen, aber plötzlich konnte er sich für kein Buch mehr entscheiden. So fing es an: dass er sich nicht mehr für ein Buch entscheiden konnte. In einer Kettenreaktion fielen ihm Entscheidungen fortan grundsätzlicher schwerer. Am nächsten Morgen überlegte er sich, ob er den Kaffee nicht ohne Zucker trinken sollte. Er bekam regelrecht Angst vor einer Zuckerkrankheit. Am Nachmittag wippte er bereits das erste Mal mit den Füßen. Das Kolleg sagte ihm gar nichts mehr. Er freute sich nicht mehr auf die Algebra, die lateinischen Abhandlungen, die Vogelstimmen. Das Essen schmeckte nicht mehr. Der Goldfisch schien plötzlich beim Durchziehen des Wasserglases deutliche Geräusche zu machen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen, er hatte einmal in der Bibliothek eine Erektion, nur weil ihn eine Frau angelächelt hatte. Das erste Mal, seitdem er hier arbeitete, erlaubte er sich vor Feierabend an die frische Luft zu gehen, er atmete durch, doch es war zu viel Luft und zu wenig Möglichkeiten. Er hatte auch auf einmal den Wunsch, fliegen zu können, und er kehrte an diesem Tag nicht in die Bibliothek zurück.
-
Lukrez
Mechanisch kaufte er seinerzeit den Band Lukrez. Er war einerseits beeindruckt von dessen Versuch, zu erklären, was die Welt im Innersten zusammenhielt (er erinnerte sich an den Anspruch eines Biolehrers, der sie zu Beginn jedes Schuljahrs mit diesem Faust-Zitat gequält hatte) und das noch dazu fast ausschließlich mit Hilfe der damaligen Naturwissenschaft, die seinerzeit noch enger mit der Philosophie verzahnt war. Andererseits vergötterte er bereits als Oberstufenschüler die lebenspraktische, unironische Lakonie: Erst als Professor allerdings sollte er den Tipp, das Bordell zu besuchen, um sich vor Liebeskummer zu schützen, erst tatsächlich zu schätzen lernen. An irgendeiner Buchhandlung kam er vorbei, ging, von einem unerklärlichen Gefühl geleitet, hinein, erinnerte sich an die Blume und an den Lateinunterricht an der Schule und an einen Nachmittag im Juli, als er mit Gretchen Weiler im Gras saß und sie über die Natur sprachen, ein bisschen auch über Philosophie, das erste und letzte Mal, dass Herr Samuel Lichtenbring mit einer Frau über Philosophie sprach. Im Gras neben ihnJen lag Lukrez. Sie kamen direkt aus der Lateinstunde an diesen Musenort, den er einmal beim Umherschlendern entdeckt hatte. Die kleine Dorfschule, die sie besuchten, lag an einem Bach, worin sie badeten. Den Lukrez, der hier im Gras lag, verlor er irgendwann; gleichsam leistete er also auf eine Art Abbitte, oder vielmehr hatte er das Gefühl, Abbitte zu leisten, als er an diesem Nachmittag, von einer unbestimmten Ahnung geleitet, den Lukrez wieder kaufte. Entflammt steckte er ihn in die Tasche.
Rosenflügel
In seiner Kindheit hatten die Rosen keine Flügel. Dabei war er davon überzeugt, dass sie keinesfalls nur trostlos nach unten fielen. Die Blätter konnten sich auch in die winzigen, kaum wahrnehmbaren Ösen der Luft einhaken. Wie in einer Windhose für Liliputaner schraubten sie sich dann noch oben und fügten sich ins Himmelmosaik ein. Lange sah er ihnen nach, bis seine Augen sonnenfleckig und wolkenmustrig waren. Ikarus fiel ihm dann ein und dass er weiterschreiben musste, wenn es ihm schon nicht gelang, die Vorlesungsmanuskripte fertigzustellen.
Ein Bettler mit einem Strich wie einem Mund, goss diese besonderen Rosen. Waren sie verwunschen? Er wünschte sich dann immer ein Prinz im Märchen zu sein und der andere sein mittelloses Gegenstück. Das erinnerte er noch. Der Bettler hatte kleine Augen, die sich fast in die Höhlen zurück verkrochen. Sonst sprach er nicht viel. Als Gärtner war er von meiner Eltern ganz unvermittelt eingestellt worden. In einer Fußgängerzone sah ihn mein Vater und offerierte ihm einen Job, weil er ihn wohl an einen Schulkameraden erinnerte, der im letzten oder vorletzten Krieg gefallen war. Vielleicht handelte es sich auch nur um einen Bischof, der sich zur Erde neigen wollte, um substanzielle Arbeit zu leisten. Das hatte Samuel vielleicht aber möglicherweise bloß in einem Film gesehen.
Die Zahnbürste
Er steht nach dem Aufschlag der Geschlechter vor dem Waschbecken. Er hat die Zahnbürste vergeblich gesucht. Hierfür hat er den ganzen Rucksack ausgeräumt und ihn wieder eingeräumt, um ihn nur zur Vergewisserung noch einmal auszuräumen. Die Bürste ist nirgends zu finden. In ihrem Hintern entdeckt er die kindliche Kaiserin. Tut diese irgendetwas? Zwinkert sie vielleicht? Es beschäftigt ihn sehr, so sehr, dass er darüber fast die Güte des Ineinandergreifens der Geschlechter vergisst. Ihr macht das tatsächlich ein bisschen Wut. Ihn verwundert das. Sie aber will eben die Güte des Ineinandergreifens nicht relativiert wissen und seine Gedanken an die Zahnbürste lassen sie glauben, dasselbe habe ihm vielleicht nicht gefallen. Warum muss er auch an diese dämliche Zahnbürste denken? Warum kann er die Dinge nicht einfach sein lassen, auf sich beruhen lassen, in sich beruhen lassen, so wie sie eben sind. Woher kommt die Sucht, alles erklären zu wollen? Ja, warum muss er, kaum dass die bei dem Aufschlag verlorene Kontrolle zurückgekehrt ist, diese sofort wieder im Zwischenmenschlichen, in der Kommunikation, in seinem Gehabe installieren? Warum nicht die angenehme Taubheit auf seinem Penis genießen und die Reste des Warmstrahls ihrer Vagina auf der Haut belassen, auf seiner Zunge die Salzigkeit ihrer Klitoris?
Während es ihr kommt, denkt er an das arschkalte Wasser der Ach oder war es die Urspring, so genau weiß er es trotz ihrer mehrfachen Erklärung, welcher Fluss nun welcher ist, nicht, in einen von diesen beiden jedenfalls ist sie nach einem ausgedehnt schnellen Lauf gesprungen. Das erstemal, dass das Gesez der Freiheit sich an uns äußert, erscheint es strafend. Es kam ihr vier Mal. Müssen in der Erinnerung schon wieder vergangen sprechen, der Fluch des Nachträglichen. Nicht hintereinander, sondern immer wieder, während er sie leckte, dann von hinten in sie eindrang, in einer unbeschreiblichen Verrenkung, einem eigentlich unmöglichen Winkel, gerade noch ihren Kitzler zu fassen bekam, was sie in dieser einmaligen Mischung und der unvermittelten Heftigkeit der doppelten Penetration, dem h‘schen Gesetz der Wechselwirkung zwischen Stoff und Geist, nochmal kommen ließ; während sie sich selbst an ihrer Hand rieb, ließ sie der Schreck, dass es ihr wieder kam, nochmal in die Ach springen. Übertritt der Grenzlinie: viermal. Zweimal hin, zweimal zurück. Er erinnerte seine Kindheit, wo er nach dem Seilspringen, im Gebüsch kauernd und lesend, die Kacke zurückhielt, sie fließen ließ, sie wieder zurückhielt. Ich möchte nicht mit dir über deine Zahnbürste reden. Nicht jetzt, sagte sie. Das verletzte ihn. Es war eine, wenn auch von ihm gewollte Auslegung der Sache: Die Auflehnung, die sich in ihrer Weigerung, über den Verlust seiner Zahnbürste zu sprechen, erwies. Er konnte es nicht fassen, dass die Welt sie so wenig anging. Seine Welt, die er doch nur aus Zufall mit ihr und all den anderen Menschen teilte. Manchmal wünschte er sich einen Privatzugang zur Welt, einen eigens für ihn angefertigten Schlüssel, der einzig und allein in die Hintertür passte. Die Hintertür, die vielleicht auch einzig für ihn angefertigt war, sodass der Doppelzugang wie die Penetration, der Ausgang zur Welt für sie, verdoppelt war. Er bedauerte, dass es ihm aufgrund seiner Anatomie nie so heftig kommen würde. Die seidige Taubheit auf seinem Geschlecht, wurde langsam aber sicher auch zum Schmerz. Und die Zahnbürste hatte er immer noch nicht gefunden. So sehr er sich auch anstrengte, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, mischten diese sich immer wieder ein. Er musste wohl heute Nacht ohne seine eigene Zahnbürste leben, notgedrungen eine von ihr nehmen. Warum war ihm das unangenehm?
Florian Neuner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>