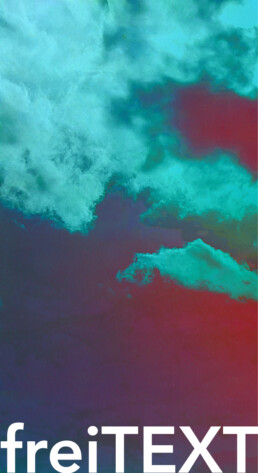freiTEXT | Simon Bethge
male fantasy, oder: alles kann, nussmix
steigt T. aus dem U-Bahn-Ausgang. In natura wirkt sie kleiner als auf den Fotos, geradezu petite, und wiegt sicher kaum mehr als der Rucksack, unter dem sie sich krümmt. Sie sieht sich um, sucht: mich. Und ich, ich müsste bloß die Sonnenbrille aufbehalten, ein paar Schritte zur und über die Straße machen, mir sagen, dass ich noch nicht bereit sei für jemanden nach IHR, das Match löschen, fertig. Doch T. hat mich entdeckt. Ob ich ihr den Rucksack abnehmen könne? Ja, der sei immer so schwer. Wer Medizin studiere, müsse sich ans Schleppen gewöhnen; Textbücher verschiedenster Auflage, Protokolle, Analysen – das Leben an sich stecke da drin.
„Meine Mutter hat mit unserem Pschyrembel immer Spinnen erschlagen“, sage ich, weil es fast dazu passt, „oder Blätter gepresst oder Möbel gestützt.“
Sie schmunzelt, ich schmunzele zurück, mein Füßling rutscht mit jedem Schritt weiter von der Ferse und knüllt sich vorne im Schuh zusammen. Alles ziept. Ob es noch weit sei, noch weit bis zu ihrem ‚Geheimtipp‘?
„Nicht besonders.“ Sie konsultiert Google Maps, dennoch laufen wir dieselbe Straße zweimal ab.
Im Café Bilodeau sind die Getränke klein und stark. Hunger scheint sie nicht zu haben, und einen Großteil des Dates verbringen wir schweigend, bis T. sich erinnert, dass wir ja beide Filme mögen.
„Welche hast du denn so gesehen?“, fragt sie.
„Alle außer den schlechten.“
Beim Lachen flattert ihr Hängelid. „Und, irgendwelche Empfehlungen?“
„Am besten sind die isländischen mit ungarischen Untertiteln.“
Ab da läuft’s. Auf den Kaffee folgen ein weiterer und ein Sandwich, dann ein Kurkuma Latte, den ich allem Umami zum Trotz drinnen behalte, während T. mir erklärt, warum Erdoğans Immobilienpolitik die medizinische Versorgung in den Innenstädten gefährdet. Zum Abschied umarmen wir einander. Zwei Tage später schreibt sie, dass sie sich zwar sehr wohlgefühlt habe mit mir, ‚uns‘ aber lieber
nicht nachlassen jetzt! A. hat sich in den letzten zehn Minuten meine beiden Läufer und einen Turm geschnappt, mit dem ich ihren linken Springer hatte schlagen wollen. Auch beim Astra führt sie 5:3. Den ganzen Abend schon trinken wir die Marke, als würden wir nichts Besseres kennen oder auf der Karte finden. Dabei hat A. vorhin noch gescherzt, dass ihr als Tschechin der Sinn für gutes Pils ja quasi mit der Muttermilch eingegeben worden sei, ebenso wie das Talent für Schach, schließlich sei sie die Ur-Urgroßnichte von Vera Menchik, ob ich von der, nein, natürlich nicht, Weltmeisterinnen hätten erfahrungsgemäß immer kleineren Anteil am kollektiven Gedächtnis als Weltmeister, ganz egal, wie lange sie die globalen Listen anführten, tja. Also Cheers – auf die von der Geschichte Verschluckten.
Seitdem läuft das Spiel: Ich ziehe, sie zieht. Ich überlege, sie nicht. Ich wage, sie gewinnt. Noch eine Runde?
Als ich mit zwei eiskalten Knollen von der Bar zurückkehre, hat A. die Figuren neu aufgestellt. Bevor wir beginnen, will sie wissen, worauf ich eigentlich aus sei – so ganz generell, aber vor allem bei ihr, vor allem auf lange Sicht. Und statt A. die Wahrheit zu sagen – dass, wäre nicht der Tod das Ende jedes Bewusstseins, ich ausschließlich den Weihnachtssalat meiner Eltern und IHRE Sillage vermissen würde, die der Fahrtwind einmal zu mir wehte, als ich auf dem Sozius saß –, behaupte ich bloß, dass es die bei mir nicht gebe, die lange Sicht, nicht im Moment.
Das scheint sie zu beruhigen, wenigstens nicht zu überraschen, denn sie fragt bloß: „So, can I use the white chessmen again or are you
dann wohl Simon, stimmt’s?“
B. ist wie jeder, damit auch wie ich. Der Tod des Hamsters als einziger bedeutender Verlust zwischen 11 und 20, irgendwann ein gebrochener Arm, ein Fahrradrennen und Capri Sun, die damals noch Sonne hieß, zum Abkühlen; Wildpinkeln, der erste Kuss. Souvenirs ohne DIN, die das Tagebuch hässlich ausdellen, wenn man sie hineinklebt. Trotzdem treffen wir uns.
„Nicht, dass ich was gegen Arthouse hätte – ich guck’s nur viel zu selten, um richtig Fan zu sein.“
Ich denke, dass ich vielleicht einfach nur jemanden suche, der mir die Eier krault, während ich an meiner IQOS sauge, Billie Eilish höre und vergesse, was wann wehtat.
„Magst du mir das Salz reichen?“
Ich denke, dass es da draußen vielleicht Menschen gibt, die sich fragen, warum ich nie zurückgerufen habe. Sie haben Katzen, Geschwister, immer genug Taboulé im Kühlschrank. Und wenn sie abends heimkommen, spucken sie in den Vorgarten, als wollten sie ein Revier markieren, das ihnen niemand streitig macht.
„Komm, ich lade dich ein. Kino ging ja immerhin auf dich.“
Ich denke, dass die Kastanie von gegenüber vielleicht jetzt, wo sie nur noch in meinem Kopf existiert, länger blüht; dass mir die Preise vielleicht mehr bedeuten, wenn ich wieder anfange, sie mit Werken der Liebe zu gewinnen.
„Ich würd' dich ja fragen, ob du mit hochkommen willst, aber mein Mitbewohner ist gerade erst aus Mumbai zurück und hat mega den Jet-lag, deshalb lass uns doch die
Nudes haben wir bereits hinter uns, als E. fragt, ob ich mir zutrauen würde, ihn zur Beerdigung seines Onkels zu begleiten; die finde am nächsten Wochenende statt, Sonntag, um genau zu sein, bei Lüchow im Wendischen, und eigentlich sei es ja nur logisch, nach dem Körper auch die Familie kennenzulernen. Ich willige ein, denn das Praktikum, das tags darauf hätte beginnen sollen, wurde mir zugunsten eines besser geeigneten Kandidaten – den ich insgeheim für eine Kandidatin halte – abgesagt.
E. will mich vor Ort abholen. Ich nehme den Regio bis Lüneburg, muss auf den Anschlusszug warten, versuche, währenddessen nicht an IHREN ersten Abschied auf der Ilmenaubrücke zu denken, an den zweiten im Hörsaal, weil wir’s nicht lassen konnten, und an den dritten, nach dem uns endlich nichts mehr einfiel. Dann kaufe ich im DB Store ein Magazin über moderne Männer.
E. hat ein hübsches Auto und gerade Zähne. Ich sehe ihn da, das sei erwähnt, zum ersten Mal richtig. Zum letzten auch, aber das weiß ich in dem Moment noch nicht. Und falls er es bereits weiß, lässt er es mich nicht spüren.
Während der Fahrt erzählt er aus dem Leben seines Onkels. Karriere bei der Post, als die noch staatlich war, Burnout, Frührente. Ein schwieriger Mensch sei er gewesen, nein, geworden, weil seine Eltern ihm nie beigebracht hätten, sich zu wehren. Aber geliebt habe E. ihn schon irgendwie.
Ich frage, warum er da jetzt nicht lieber allein durchwolle.
Ein Alibi, ganz simpel. Denn auf Familienfeiern, gerade jenen, auf denen es um jemand anderen gehen sollte, würden den Leuten naturgemäß irgendwann die Anekdoten ausgehen, und man fange an, sich stattdessen mit der nächsten Generation zu befassen – deren Jobs, Kinderpläne und Partner. Es genüge also, wenn die Verwandten ihn mit einer Begleitung sähen; die Kennenlernstory werde er ad hoc entwerfen, ich solle sie einfach abnicken. Deal?
Dann: Winterlicht in Sonnenbrillengläsern, Händeschütteln, „O Welt, ich muss dich lassen“, Suppe mit Eierstich, Peter Maffay Best Of, und zurück an die Bar, um
einzudösen ist mir zwar unheimlich peinlich, aber ich kann nichts dafür, besser: dagegen. Im Saal ist’s warm und dunkel, die 3D-Brille getönt, der Film entsättigt. Das ist das zweite Mal, dass ich ihn sehe, diesen Scheißstreifen mit seiner aufgesetzten Grandezza, aber was kann ich tun, wenn es der Einzige ist, der hier auf Englisch läuft, und A. mit Ausnahme von „Geschwindigkeitsbegrenzung“ kein Deutsch spricht.
Mit jedem Sekundenschlaf rutscht mein Kopf näher zu ihr. Und sie lässt es zu. Ihr Blick haftet an der Leinwand, kein Haar ragt über die Sessellehne, die uns trennt.
Es hatte wohl keiner von uns vor, den anderen wiederzusehen. Dass wir uns doch verabredet und die Verabredung auch durchgezogen haben, wird vor allem daran liegen, dass wir beide die Stadt zum Ende des Monats verlassen, um uns andere Karrieren zuzulegen, andere Makel; um uns tätowieren zu lassen oder Avocados auf dem Balkon zu ziehen. Wir werden Gewesenes neu formulieren, Gewordenes vergleichen, und am Ende
steigt T. aus dem U-Bahn-Ausgang ...
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Simon Bethge
Von dem Raum
Von dem Raum erzählt sie, klein und weiß, und vollkommen schattenfrei, sensorische Deprivation, ja, so nenne man das, wie in diesen Meditationstanks oder den Folterkellern des Guo’anbu, des chinesischen Geheimdienstes, und zwei Stühle standen in ebenjenem Raum, genauso weiß wie der Rest, schwach nach frischem Lack hätten sie geduftet, obwohl sie sich an keine Luftbewegung erinnere, die ihr den Geruch hätte zutragen können.
Sie nahm also Platz, spürte die Linie der Rückenlehne durch ihren Pullover, gerade bis zum Schulterblatt, und als man ihn ihr vorsetzte, den anderen Menschen, den Mann, der die gleichen dicken Kopfhörerschalen auf den Ohren hatte wie sie, weich und dämmend und nur das Rauschen ihres Blutes, den Puls im Ohr, zurückwerfend, ja, da hätte sie sich gefragt, ob das schon alles sei, ob da noch was komme, vielleicht mit den Wänden, die bisher nichts gewesen waren außer weiß, oder ob die Stühle sich vielleicht zu drehen beginnen würden, zu kippen, aber nichts passierte, nichts.
Der Mann habe, so weiter, das alles gleich zu Beginn viel ernster genommen als sie selbst, gibt sie zu, obwohl sie nicht genau festmachen könne, woran sie das erkannt habe, denn sein Blick, der ja den ihren traf und nichts anderes bis zuletzt, war ganz normal, fast gelangweilt, so, als habe er sich schon zig Mal in dieser Situation befunden.
Sie sagt, sie habe eine Weile gebraucht, um sich ans Licht, besser, an seine Allgegenwart, zu gewöhnen, und nachdem es ihr schließlich gelungen sei, sicher, die Helligkeit sei erstmal unangenehm gewesen, aber eben auch authentisch, habe sie die Hände in den Schoß gelegt und ihr Gegenüber einfach betrachtet, habe, wie er, einfach gesehen und, das stelle sie gern zur Diskussion, auch gewartet, dass etwas in ihr vorgehe.
Sich löse vielleicht und hinüberschwebe, das Lächeln hätte sie sich deshalb einige Male verkneifen müssen, derart surreal sei ihr das Ganze und der Gedanke vorgekommen, was sollte sich schon lösen außer den Flusen an ihrem Oberteil oder winzigen Hautpartikeln, die, wie allgemein bekannt, täglich zu Abermillionen vom Körper abgestoßen würden, so natürlich auch jetzt, und sie stellte sich, sagt sie, sie stellte sich vor, allmählich von den Hautschuppen eingeschneit, verdeckt zu werden, wie sie so zu beiden Seiten des Stuhls auf den Boden, im Übrigen sei der weiß gewesen, ob sie das schon, nein, aber das könne man sich ja denken bei der Sorgfalt, mit der der Raum gestaltet worden sei, jedenfalls war ihr Gedanke, ihre bildliche Vorstellung, die von zwei Haufen, vielleicht auch einem Kreis aus diesen Schuppen und Schüppchen, der sich um sie bilden würde, bis so viele hinuntergetaumelt wären, dass man sie ohne Probleme mit dem nackten Auge sehen könnte.
Der Mann, der, wie sie sagt, dasselbe oder zumindest Ähnliches in verwandten Worten gedacht habe, das nehme sie jetzt einfach mal an, worüber sollte man während des In-die-Augen-Schauens, des dauernden Schauens und Angeschautwerdens auch sonst, übrigens wolle sie an dieser Stelle ein Lob für ihr Gegenüber aussprechen, das nicht etwa, wie man ja hätte erwarten können, irgendwann von ihren Augen abließ, um ihren restlichen Körper, um ihre Nase oder die Wölbungen unter dem Pullover, ganz zu schweigen von dem, was ihre noch immer im Schoß gefalteten Hände verbargen, durch das Verbergen geradezu akzentuierten, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, nein, brav habe der Mann seine Augen dort gelassen, wo sie hin gehörten, und das habe wohl dazu beigetragen, dass sie sich während der ganzen Zeit höchstens für sich, hier legt sie eine Kunstpause ein, nicht wegen sich selbst schämte.
Ihre Disziplin sei dagegen allmählich verpufft, oder, nein, Verpuffung klinge zu plötzlich, aber relativiere man sie durch eine Allmählichkeit in ihrem Ablauf, nun, dann ließe sich das schon so sagen, und als ihre Selbstbeherrschung langsam schwand, was ja eigentlich gegen den Sinn der Übung verstoßen habe, da habe sie angefangen, sich den Mann etwas genauer anzuschauen, von oben beginnend, also dem Scheitel, tatsächlich seinem Scheitelpunkt aus, der ein bisschen nach rechts verlagert war von ihr aus gesehen, und wie ein Schützengraben seine Haare in Freund- und Feindesland teilte, ein für ihr Empfinden ungeschickter Vergleich, aber, das müsse man verstehen, durchaus zutreffend, außerdem beweisbar, hätte sie, der kleine Vorgriff sei gestattet, den Mann danach wiedergesehen und fotografiert.
Nun, die geteilten Haare waren wie gesagt schwarz und mittellang und hinter die Ohren gestrichen, ihr Schnitt habe sie an alte Poster der Backstreet Boys erinnert, diese zum Heraustrennen in Jugendmagazinen, oder, präziser, an Nick Carter, der ja blond gewesen sei und so ein, nein, schon ein Süßer nach damaligen Standards, zwar nicht ihr Lieblingsmitglied der Band, rein vom Aussehen her, aber, da stimme man ihr sicher zu, der Talentierteste der fünf.
Solche Haare habe der Mann vor ihr gehabt, und dort, wo sie nicht von den Kopfhörern, diesen dicken, alles verschluckenden und einbehaltenden Kopfhörern, verdeckt worden seien, da hätten sie geschimmert im Licht, das womöglich von oben kam oder von hinten, wer könne das jetzt noch sagen, ein sehr schöner Glanz sei darin gewesen, passend auch zum Glitzern, denn nun seien ihre Augen weitergewandert, zum Glitzern der Ohrringe, die er trug, zwei auf jeder Seite, ihre Ränder hätten unter den Rändern der Kopfhörer hervorgelugt, je einer im Ohrläppchen, silbern, und einer im Tragus, näher zum Gehörgang, golden, warum sie die nicht früher bemerkt habe, fragte sie sich und antwortete sofort, dass sie sie ja strenggenommen gar nicht hätte bemerken dürfen, weil sie nicht Teil der Situation waren, nicht wie die Augen des Mannes, die weiterhin, das habe sie gespürt und direkt erwidert, auf ihren eigenen oder eher darin geruht hätten.
Derart ermahnt, fährt sie fort, sei ihre Konzentration für eine Weile zurückgekehrt, sie habe angefangen, ihr Blinzeln, von dem es ja, vergeblich habe sie danach gesucht, keinen Plural gebe, jedenfalls keinen ihr bekannten, ihr Blinzeln also zu zählen und es bald anzuhalten, das sei dem Mann nicht entgangen, denn auch er habe aufgehört für die nächsten paar Sekunden, die zusammengenommen nicht mehr als anderthalb Minuten ergeben haben können, alles andere sei ja weltrekordverdächtig und nichts, was sie oder ihr Gegenüber ausgehalten hätten, denn obwohl die Luft, wie gesagt, von nichts Äußerem oder Innerem bewegt worden sei, hätte das Rieseln der Partikel ja nicht aufgehört, und insofern seien auch ein paar in ihre Augen geraten, deshalb hätte sie sie wieder schließen, den Versuch, den Kampf fast schon, aufgeben müssen.
Stattdessen habe sie versucht, auf die, grob geschätzt, zwei Meter Entfernung zwischen den Stühlen und also den Beteiligten, die Augenfarbe des Mannes auszumachen, ein gar nicht so leichtes Unterfangen, trotz des Lichts und ihrer, das habe der Arzt vor Kurzem noch lobend angemerkt, einwandfreien Sicht, die weitaus fernere Zahlen und Buchstaben korrekt identifizieren konnte.
Grün, ja, das sei, sagt sie, die Farbe gewesen, auf die sie sich letztlich festgelegt habe, nicht ohne einen gewissen Restzweifel, aber in Anbetracht der Umstände hätte wohl auch eine eindeutige Erkenntnis zu nichts, jedenfalls nichts Substantiellem, geführt, daher hätte sie sich damit begnügt, sich vorzustellen, dass die Augen des Mannes nun eben grün waren, grün wie, und damit habe sie, wie sie erklärt, eine ganze Reihe von Assoziationen losgetreten, Smaragde, der einfachste Vergleich, das Meer an besonders tiefen Stellen, ein weiterer simpler Sprung, auch grün wie die Tür ihrer ersten Wohnung, deren Dielen, speziell an der Grenze zwischen Flur und Küche, noch spätnachts zum Knarren neigten, sehr zum Missfallen der unteren Nachbarn, einem, ja, wie solle sie sagen, äußerst streitlustigen Ehepaar, das, so glaubte sie damals, wohl in diesen ihren vier Wänden sterben wollen würde, folglich die verbliebene Lebenszeit mit möglichst viel ungestörtem Schlaf zu verbringen gedächte.
Außerdem grün wie die Streifen in Italiens Flagge, in Kenias Flagge, was das anging, wenngleich sie natürlich wisse, dass für die beiden Flaggen erstens unterschiedliche Grüntöne verwendet worden seien und diesen zweitens unterschiedliche Symboliken zugrunde lägen, ersteres Grün etwa gehe auf eine fixe Idee der Jakobiner zurück, die, beeindruckt von der französischen Revolutions-Cockade, das italienische Volk vor die Wahl gestellt hätten, und das italienische Volk habe sich eben für Grün, das Naturrecht, Gleichheit, Hoffnung und Freiheit, entschieden, wohingegen Kenias Grün schlichtweg die savannische Vegetationsvielfalt repräsentiere.
Sie habe, gibt sie zu, nicht in Betracht gezogen, jedenfalls nicht in diesem Moment, höchstens, und nicht einmal da sei sie sicher, hinterher, dass ihr Gegenüber irgendetwas von Vexillologie, Flaggenkunde, verstehen würde, wohl aber, dass ihm der Besitz ebendieser Augen, für den, wenn überhaupt, nur seine Eltern etwas konnten, im Leben einiges erleichtert habe, das Davonkommen mit vergessenen Hausaufgaben zum Beispiel, die Schmierereien an der Turnhallenwand, an Herbstnachmittagen verbrochen und, weil er zu eitel war, um sein Kürzel nicht darunter zu setzen, ihm nächstentags vom Rektor halbernst zur Last gelegt, dann die Suche nach einer Partnerin in der Hochzeit jugendlicher Hormonflüge, kurz, das da im Schädel des Mannes seien Augen gewesen, nach denen sie, seufzt sie, früher und bisweilen noch heute oft gesucht, in die sie sich bereitwillig verliebt hätte, eigentlich noch immer verlieben könne und es zugegebenermaßen ein Stückweit getan habe in jener Situation, ohne Absicht und Angst sei sie in die Vorstellung abgeglitten, zurück, tatsächlich, in die grün betürte Wohnung auf die Couch im Wohnzimmer, nur diesmal eben nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Mann gegenüber, der, nach gut der Hälfte ihrer Zeit im weißen Raum, zwar ein wenig müde gewirkt hätte, die Spannung seiner Lider sei nachlässig geworden und die Fältchen im Winkel näher zusammengerückt, so, als sei er drauf und dran, bei einem Film, der ihn seit Längerem verloren habe, einzunicken, er den Impuls aber unterdrücke, um ihr, die den Film, den alten, zuvorderst ausgesucht hätte, mit Meryl Streep und Clint Eastwood, einem erstaunlich natürlichen Leinwandpaar, wenn man bedenke, dass die beiden gut zwanzig Jahre auseinander geboren wurden, dazu an entgegengesetzten Küsten Amerikas mit verschiedenen kulturellen Ausprägungen, und sie habe sich gefragt, wie lange der Andere, der gerade mit dem Einschlafen kämpfte, sein Kopf sank langsam, im Sinken näherte er sich ihrer Schulter, sich wohl noch mit der stillen Übelnahme begnügen würde, dass auch sie ein paar Jahre früher zur Welt, ergo auch länger in den Genuss ihrer Abgründe und Wunder gekommen sei, viel mehr Zeit gehabt habe als er, sich Koordinaten zuzulegen und in diesen einzurichten, denn manchmal, wenn sie von einem Abendessen mit Freunden nachhause spazierten, nicht selten, sie zumindest, beschwipst, da stellte sich so ein Ausdruck auf seinem Gesicht ein, der zu fragen schien, warum sie sich mit einem wie ihm überhaupt abgebe, ihm hingebe, schließlich war sie täglich von Menschen umgeben, deren Geschichten und Ansichten viel eher den ihren entsprachen, und mit denen sich zu unterhalten viel weniger Rücksichtnahme auf intellektuelle Leerstellen erforderte, ganz zu schweigen von seiner Einwärtskehrung, wenn das Gespräch einen bestimmten Punkt erreichte, überschritt, dieser Ausdruck, der, ja, war in manchen Nächten eine regelrechte Anklage, warum sie ihn nicht endlich anschreie, längst angeschrien habe, weil seine Versuche, mit ihr mitzuhalten, dermaßen armselig und durchschaubar waren, weil durch das ewige Vor und Zurück, vor zum Bessernwollen, zurück zu Selbstanklage und Verzicht, doch niemand etwas gewann, und zuletzt, weil sie ihm die Benennung niemals abnehmen konnte, so gerne sie es täte, das ging durch ihren Kopf, während jener des Mannes auf ihre Schulter, die jetzt ganz sanft berührt worden sei, und zwar von einer Hand, die keinem von ihnen gehört habe, sondern der Dame in Bluse und Uniform, sie habe sich zu ihr hinunter gebeugt und sie gebeten, die Kopfhörer abzunehmen, vom Stuhl aufzustehen, denn die Zeit, denn fünfundvierzig Minuten seien nun um, länger dürfe man in der Installation leider nicht, obwohl sie verstehe, wie intensiv das Erlebnis für einige werden könne, dürfe man leider nicht verbringen, da hinter der Tür schon die nächsten Besucher warten würden auf ihre Chance, einem Unbekannten in diesem Raum, weiß und klein, gegenüberzusitzen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at