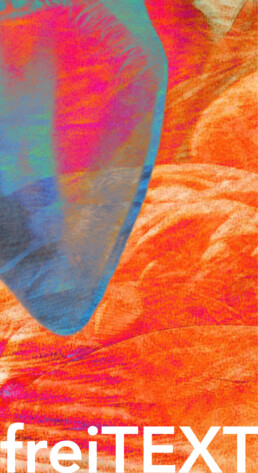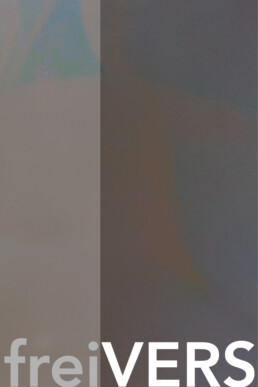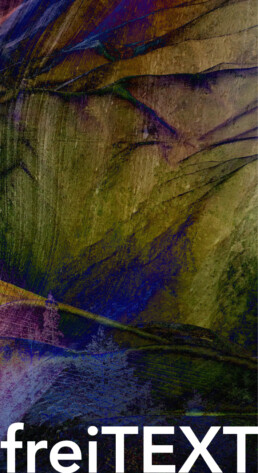freiVERS | Bettina Scherff
Allein
Im Labor alles nach Plan, ein Gefühl der Kontrolle
ein Teil von ihm ein Teil von mir
verschmelzen im Reagenzglas zu Einem
zu Eizellen in A-Qualität.
Verschmelzen wie er und ich verschmelzen
aus Zwei wird Eins
wir sind doch auch Eins.
Das Glucksen, wie ein zarter Schluckauf in meinem Unterleib,
als ich unser Kind aufnahm
zwischen meinen gespreizten Beinen ein Mann,
der da nicht hingehört
der mich anmault, weil ich zucke
als die Pipette in meinen Uterus sticht
der lacht, weil ich sage, ich habe das Glucksen gespürt,
was nicht sein kann, es ist doch noch zu klein, unser Kind.
In meinem Körper dann die wahre Katastrophe, die Zerstörung
dort bleibt nichts, dort wächst nichts.
Ich bin zerstörerisch, ich bin schuld.
Mein Bauch bleibt leer, meine Arme bleiben leer.
Ich bin allein.
Wollte unserem Kind die Welt schenken
der Welt unser Kind schenken
unserem Leben unser Kind schenken.
Wie soll ich bloß diese Lücke füllen?
Nichts kann diese Lücke füllen
ich werde verrückt bei dem Gedanken, kann ihn nicht zulassen
der Schmerz ist so groß, so tief.
Möchte mir die Sehnsucht herausschneiden
ich möchte operieren, ohne Betäubung
der Schmerz wäre lächerlich gegen das hier.
Ich muss die Lücke füllen.
Wie kann es sein, dass ich keine Mutter bin
es war doch in mir, unser Kind,
wie kann es sein, dass ich keine Mutter bin?
Ich bin doch jetzt Mutter, es fühlt sich so an
doch bin ich es nicht
bin mutterlos gleichzeitig, bin schutzlos und allein.
Wie kann ich denn jetzt mir selbst noch die Mutter sein?
Was ist das überhaupt, Mutter?
Sind wir nicht alle Frauen?
Aber Mütter sind besondere Frauen
das bin ich nicht, eine besondere Frau.
Ich zerstöre, ich bin schuld
das alles kann ich doch niemandem sagen
nicht mal ihm.
Ich muss doch stark sein für ihn und unsere Liebe,
dass ich ihn nicht verliere
uns nicht verliere
mich nicht verliere.
Ich brauche Kontrolle.
Letzte Nacht noch
haben wir uns die Lust zurückgeholt, ganz pur
ohne diesen Hintergedanken
haben uns gegenseitig getrunken.
Ich war voll von ihm in meinem Mund
bis ich ihn schmeckte
sein Speichel auf meinen Brüsten
die ich ihm gierig entgegenstreckte
seine Lippen auf meinem Bauch, seine Zunge
zwischen meinen Beinen das leise schmatzende Geräusch
bis ich vibrierte.
Am Morgen dann das nüchterne Erwachen
ein vergeudeter Eisprung ein verpasster Fick,
das ist mir herausgerutscht.
Meine Panik, dann seine Wut, unser Streit
laut und hemmungslos wie unsere Lust in der Nacht
aber die Dunkelheit ist eine andere.
Jetzt ist er weg
ist nicht mehr hier
auch uns zerstöre ich, bin schuld.
Ich bin allein.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Fynn Bastein
Frierende Epiphyten
Eine Störung unbekannter Größe
Die letzten Tage war es kalt geworden im Gebäude B8253 und Moos war sich unsicher, ob es nicht vielleicht schon immer so kalt war. Ob sich nicht einfach eine neue Sensibilität bei ihm gebildet hatte. Es war nichts Ungewöhnliches für Moos. In Abständen, die sich keinem Muster zu unterwerfen schienen, wurde sein Leben von neuen Sinnen verkompliziert – neue Verbindungen fanden sich in seinem Gehirn oder ihm wuchsen neue Geruchsorgane, die ihm auf eine absonderliche Art und Weise gut standen. Doch das Thermometer im Flur verriet ihm: nicht er, sondern die Umgebung war dieses Mal der Auslöser. Das Problem war nur, dass Moos keine Ahnung hatte, woher die Kälte kam. Bis jetzt war seine Erdgeschoßwohnung, die sich wie ein verschrecktes Tier halb unter dem Erdboden verbarg, immer kuschelig warm gewesen – und das obwohl er sich weigerte, die Heizung anzuschalten.
Das Gebäude war eines unter vielen gleichen, die sich nur in Gebäudenummer und Farbton unterschieden. Moos war schon vor einer Weile eingezogen, man konnte aber kaum von ‚wohnen‘ sprechen. Normalerweise kam er nur zum Schlafen nach Hause und genau dabei störte ihn die Kälte nun. Es war weniger eine klirrende als eher eine zugige Kälte, als wäre sein Bett strategisch auf einer Klippe platziert worden. Sie schien von allen Seiten zu kommen, was die Suche nach einem Auslöser als schwer bis unmöglich gestaltete. Geplagt, mehr von der Ausweglosigkeit der Situation als von der Kälte selbst, entschied sich Moos, noch ein bisschen zu arbeiten – eine Tätigkeit, die ihn meistens zur Ruhe brachte. Moos arbeitete bei der Verwaltung des Ortes in der Abteilung der kleinen Dinge. Moos war alleinig für die Kategorisierung der kleinen Störungen verantwortlich. Störungen können alles sein – physische, ästhetische, olfaktorische. Gerade erst hatte Moos eine neue Kategorie ins Leben gerufen – die der schlecht gesetzten Pflastersteine. So gab es welche, die schräg waren, welche die ein bisschen erhobener als die Steine um sie herum waren und welche die gar eine andere Farbe hatten. Seine Arbeit gliederte sich in einen suchenden Teil, bei dem er entweder selbst durch die Stadt streunte oder andere Bewohnende zu ihren Störungen befragte, und in einen kategorisierenden Teil, bei dem er in einem großen Hochhaus, seinem Wohnhaus nicht unähnlich, saß und die Störungen in verschiedene Kategorien einteilte. Vom Hochhaus aus konnte Moos fast die gesamte Stadt überblicken. So konnte er, wenn er über eine der Störungen las, in die Richtung blicken, in der sie sich befand und sich vorstellen, wie sie dort, auf eine Art widerlich und schön zugleich, das Stadtbild veränderte. In seiner Erdgeschoßwohnung war das schwer möglich und so hatte die Arbeit mit den Pflastersteinen von seinem Bett aus eine sehr viel weniger lebhafte Qualität. Als er dann so müde wurde, dass er bereit war zu schlafen, duckte er sich unter seine Decke. Nun ähnelte Moss einem verschreckten Tier, das vor dem kalten Wind flüchtete.
Entdeckung der Kälte
In der nächsten Nacht konnte Moos wieder nicht schlafen, seine Decke war kein ausreichender Schutz gegen die Kälte. Seine Ohren froren und er bildete sich ein, in seinen Haaren Eisklumpen spüren zu können. Da er nicht wusste, was er sonst tun sollte, beschloss Moos, sich auf die Suche nach dem Ursprung der Kälte zu machen. Er befeuchtete äußerst fachmännisch seinen Finger, um besser einschätzen zu können, woher die windige Kälte kam. Er stellte direkt fest, dass der Auslöser wohl keine undichten Fenster waren. Es kam durch die Tür aus dem Flur. Also trat er im Schlafanzug und mit erhobenem Zeigefinger hinaus. Moos hatte sich noch nie mit dem Rest des Hauses beschäftigt. Nicht mit seinen direkten Nachbarn und erst recht nicht mit den restlichen Stockwerken. Er wusste nicht mal, wie viele Stockwerke das Haus hatte. Die Kälte rührte aber von den oberen Stockwerken her, also musste er sich wohl oder übel nun damit auseinandersetzen. So folgte er der Kälte wie eine willenlose Marionette, ein Stockwerk hinauf und ein zweites und ein drittes. Nach dem 6. Stockwerk war die Frage nach der Anzahl der Stockwerke auf einmal dringlich. Nach dem 10. Stockwerk wurde sie durch die Frage abgelöst, ob das Gebäude überhaupt ein Ende hatte. Nach dem 13. Stockwerk bereute Moos, sich keine Flasche Wasser mitgenommen zu haben. Ab dem 15. Stockwerk fiel Moos auf, dass es merklich immer kälter und kälter wurde. Im 17. Stockwerk wurde die Kälte fast unerträglich. Nach dem 20. Stockwerk hörte das Gebäude endlich auf und dort befand sich nichts mehr. Die Treppe des 20. Stockwerks führte wortwörtlich ins Nichts und über Moos war nur noch der Sternenhimmel. Das erklärt die Kälte, murmelte Moos. Erschöpft von den Treppenstufen setzte sich Moos auf die vorletzte und betrachtete die Sterne. Erst nach einer Weile bemerkte er, dass direkt gegenüber auch ein Hochhaus war und dass dort ein Mann am Fenster saß. Er winkte ihm zu und Moos winkte zurück.
Er war ihm unheimlich unangenehm gesehen zu werden. Nicht weil er mitten in der Nacht im Schlafanzug die Sterne beobachtete, sondern einfach, weil ihn jemand wahrnahm, in einem Moment, in dem er selbst fast vergessen hatte, dass er existierte. Peinlich berührt machte er sich auf den Weg die Treppe hinunter, bemüht nicht noch einmal die Blicke des Mannes zu streifen. Der Weg nach unten kam ihm noch länger vor als der Weg hinauf. Als er in seinem Bett wieder ankam, kam es ihm im Vergleich zum Ende des Hochhauses unglaublich warm vor. Im Halbschlaf fragte er sich, ob es wohl eine Medizin für Situationen gäbe, in denen man aus dem Nicht-Existieren herausgerissen wurde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Petrus Akkordeon
ich wachte auf
und war der panamakanal
ich war auch die insel
und die see
und mein eis schmolz
mein gefühl flosz
wachte auf
versuchte ich
zu sein
aber blieb
der panamakanal
im laufe des tages
gewöhnte ich mich
an meine bedrohtheit
und wusch mir
zur nacht
die haare
und sorge
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Philipp Nowotny
Muse gesucht (m/w/d)
Ich lege meine ausgedruckten Texte um den Topf der Sukkulente. Dann setz ich mich aufs Sofa und schau zu. Die Sukkulente sagt, ich solle weggehen, das mache sie ganz nervös. Ich sage, ich würde gerne sehen, an welchen Stellen sie lache, aber die Sukkulente weigert sich zu lesen, solange ich da bin, also gehe ich auf den Balkon eine rauchen. Durchs Fenster beobachte ich die Sukkulente, aber von draußen ist es schwer, die Emotionen abzulesen, außerdem besitzt die Sukkulente sowieso kein Gesicht.
Ich frage meine Sukkulente, was sie nun zu meinen Texten sage. Sie sagt, sie freue sich, dass ich mich künstlerisch entfalten wolle. Ich sage meiner Sukkulente, sie könne ruhig sagen, wenn ihr meine Texte nicht gefielen. Sie sagt, es sei nicht so, dass ihr meine Texte nicht gefielen. Und es liege nicht an meiner Technik. Sie könne es nicht konkret benennen. Dann sagt sie, ich brauche vielleicht eine Muse. Wo ich denn jetzt eine Muse finden solle, frag ich. Meine Sukkulente schweigt vielsagend.
Geniale Texte bräuchten Musen, sagt meine Sukkulente. Ich frage mich, ob das notwendig ist. Es klingt nach zusätzlichem Aufwand. Ich möchte nur ein wenig Feedback bekommen, möglichst konkret, dann an den Texten feilen, damit ein Publikum finden, das ab und zu lacht, in den richtigen Momenten traurig wird, immer wieder den Kopf schüttelt, weil es jetzt doch wieder ganz schön seltsam wird, das nicht aufhören kann zu lesen und nach mehr verlangt. Meine Sukkulente sagt, dazu sei Team-Arbeit nötig.
Schreiben ist für mich das Gegenteil von Team-Arbeit. Du setzt dich hin. Du schreibst einen Satz. Du schreibst den nächsten Satz. Andererseits wiederum ist Schreiben nicht einmal Einzel-Arbeit. Du schreibst ja nicht selbst, nicht bewusst, deine Finger schreiben, du fütterst sie mit Impulsen, sie machen daraus Buchstaben und Wörter. Meine Sukkulente sagt, für genau solche Impulse brauche es eine Muse. Sie müsse mein Inneres besser kennen als ich selbst. Ob mir denn niemand solches einfalle?
Suche Muse, schreibe ich also, die mir helfen solle, ein paar seltsame Sachen aufzuschreiben, die passiert sind, von denen ich nicht ganz genau weiß, was Wirklichkeit und was Einbildung ist. Viel bin ich gewandert (ich nutze aber gerne auch fliegende Teppiche), viel habe ich zu erzählen. Sage mir, Muse, wie ich auf unterhaltsame Weise Ordnung schaffe in all den Abenteuern, die mich ereilten. Bisschen pathetisch, meint die Sukkulente. Ich füge hinzu: Budget gering, Mitarbeit ehrenamtlich.
Ich frage meine Sukkulente, wo ich den Musen-Aufruf veröffentlichen solle. Sie sagt, das wisse sie nicht, sie habe noch nie die Stelle einer Muse öffentlich ausgeschrieben, auch noch nie gehört, dass dies jemand getan hätte oder üblich sei. Ich weiß nicht, was sie hat, das mit der Muse war ja ihre Idee. Meine Sukkulente sagt, Musen seien oft dort, wo man sie nicht erwarte, manchmal direkt vor der eigenen Nase. Ich mache einen Social-Media-Post. Sofort ein paar Likes. Dann warten wir.
In den nächsten Tagen schau ich auch immer wieder in den Spam-Ordner, aber es meldet sich keine Muse. Meine Sukkulente sagt, alle Musen seien wohl beschäftigt. Vielleicht gebe es eine ganz naheliegende Lösung für die vakante Stelle, an die ich noch nicht gedacht habe. Ich suche im Internet nach Schulen für Musen, vielleicht könnten die Absolventen empfehlen, aber ich finde nichts, Schulen für Musen sind wohl sehr diskret, wahrscheinlich werden sie sonst mit Anfragen überschwemmt.
Ich lese mir die Ausschreibung für meine neue Muse noch einmal durch. Sie ist höflich formuliert, und die fehlende Bezahlung ist im Kultursektor die Regel. Ein paar Kriterien passe ich aber an. Teamfähigkeit und Manieren setze ich auf optional, ich komme ja auch mit meiner Sukkulente zurecht, und Office-Kenntnisse sind als Muse nicht nötig, die kommen ganz raus. Ich überlege, ob ich doch Demokratiefeindlichkeit ausschließen solle, will aber den Kreis der Bewerber nicht zu stark eingrenzen.
Dann habe ich eine Idee, warum sich bislang keine Muse auf meine Ausschreibung gemeldet hat. Ich habe keine Deadline gesetzt. Das kenne ich von mir selbst: Ohne Deadline geht gar nichts, und gerade eine Muse braucht sicher ordentlich Druck, woher sollte sonst die Inspiration kommen. Ich überlege, eine siebentägige Frist zu setzen, entscheide mich aber für eine harte Linie, es ist einen Versuch wert. Bewerbung nur noch möglich bis heute Nacht, 23:59 Uhr, schreibe ich, es gelte der Posteingang.
Ich aktualisiere die Ausschreibung. Dann warte ich. Alle paar Minuten synchronisiere ich meine Mails. Nichts, auch nicht über meine Social-Media-Kanäle. Ich warte. Und zum Glück fällt mir dann doch ein, was der Fehler ist: Ich habe komplett an der Zielgruppe vorbeigedacht – und um schriftliche Bewerbung gebeten. Eine Muse aber schreibt selbstverständlich gar nichts. Sie lässt schreiben. Also Anschrift und Telefonnummer rein, Email-Adresse raus. Um persönliche Bewerbung werde gebeten, fertig.
Ich bin nun überzeugt, die perfekte Ausschreibung für Musen aufgesetzt zu haben. Jetzt könne ich nur noch warten, sage ich mir. Ich beruhige mich damit, dass die meisten Bewerber sich immer erst kurz vor Fristende melden. Wobei ich zu dieser These keine statistischen Daten vorweisen kann, es ist lediglich anekdotisches Wissen, das auch nur auf meinem eigenen Deadline-Verhalten beruht. Ich spüre, dass die Sukkulente mich beobachtet. Sie findet meinen Perfektionismus albern, glaube ich.
Nichts tut sich. Ich sage meiner Sukkulente, ich habe ein Problem. Niemand wolle meine Muse sein. Wenn ich weiterhin schreibe, müsse ich dies wohl auch künftig uninspiriert tun. Die Sukkulente sagt, es sei zum Haareraufen (sie hat gar keine Haare!), ich denke ganz falsch und unterliege einem Irrtum, was eine Muse sei. Dabei sei es doch offensichtlich. Sie habe gehofft, ich komme selbst drauf. Sie schweigt. Ich sage, sie solle unbedingt fortfahren. Sie räuspert sich. Da klopft es an der Tür.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Jana Franke
in einer schachtel aus luft
unsichtbar,
wenn ich nicht atme.
beruhigt übersehen.
wenn ich nicht atme,
wachse ich unbehelligt
in einer schachtel
aus tischbeinecken
im spinnweb
mit holzdach zum ausziehn und
auf dem teppich geblieben.
wenn ich nicht atme durch
halbseidene tafeltücher
betrachte ich krampfadern,
notdürftig gestopfte strümpfe,
schwarze zehen, gelbe nägel
im sommer.
wenn ich nicht atme
vergessen sie mich
in der schachtel aus luft
zwischen den
beine derer, die reden.
über alles, auch mich.
aus mir wird dann: die.
dann atme ich nicht
mehr in meiner schachtel
unterm tisch, dann
verknüpfe ich schnürsenkel.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Flor
Erdbeerschokolade und „Löwenzahn“ – mein Medikamentenentzug
Ich trinke koffeinfreien Kaffee und esse seit Tagen Erdbeerschokolade, um mich bei Laune zu halten, außerdem habe ich drei Kilo abgenommen. Ich wäre gerne wieder normal. Ich berichte hier von meinem Medikamentenentzug. Heute ist Tag 19. Ich führe Strichliste. „Jede Stunde und jeder Tag, den Sie schaffen, bringt Sie weiter weg von dem Mittel.“ Dieser Satz hängt an meiner Wand. Und noch ein paar andere wichtige Sätze. „Es wird besser.“ Ich habe gerade einen guten Moment. Der ganze Tag ist schon ganz okay. Allerdings hochemotional. Ist es endlich bald soweit, dass ich wieder einen normalen Alltag führen kann? Eigentlich schmeckt mir die Schokolade gar nicht mehr. Mir schmeckt das nicht mehr. Brauche eine Ablenkung, weil ich sonst mein Projekt „Frei sein von Medikation“ nicht schaffe. Gestern war es hart. Ich knickte ein. Ich dachte, es sei vorbei. Heute ist ein neuer Tag. Jeder Tag ist anders.
Schon ein paar Tage vor Weihnachten 2024 dachte ich, dass ich nun auch den letzten Rest meines Neuroleptikums absetze. Ein Medikament, das einst Segen brachte und für viele Menschen immer noch Segen ist. Für mich ist es jetzt Fluch. Ich merke, meine Spannung steigt. Aber ich mache weiter, was soll ich sonst tun? Mit meinem Therapeuten habe ich besprochen, alles da sein zu lassen, kein Kampf gegen die Absetzsymptome. Annahme. An Weihnachten hatte ich den Versuch abgebrochen. Ich dachte ein wenig, es läge an Weihnachten. Nein, weit gefehlt.
Dann ein weiterer Versuch am Sonntag, den 2. Februar 2025. Ich merkte zunächst nichts. Habe scheinbar weit verdrängt, dass es schlimm werden könnte. Am Donnerstag, den 6. Februar ein totaler Absturz nach der Therapie. Ich habe da immer noch nicht an Absetzsymptome gedacht und das Medikament dann doch wieder genommen. Am nächsten Tag führte ich das Absetzen fort. An diesem Wochenende fiel dann noch die Heizung aus und ich saß da mit 17 Grad in der Wohnung. Ein paar Tage war alles noch machbar. Dann am Mittwoch extreme Durchlässigkeit. Wie erkläre ich, was das ist? Du kannst nichts mehr ertragen. Deine Themen schon mal gar nicht. Überhaupt keine Schutzschicht mehr. Der Körper steht ohne da. Es ist schlimm. Schlaflosigkeit setzte ein. Den folgenden Donnerstag wieder Therapie. Abends musste ich eine Veranstaltung verlassen. Ich ertrug nichts mehr. Noch nicht einmal Klavierklänge. So gut wie es ging, fuhr ich mit dem Bus nach Hause. Da ein totaler Absturz. Es setzten Hochspannungszustände ein. Panik. Ich wusste nicht, was mit mir geschieht. Im Sommer hatte ich auch Absetzsymptome. Da habe ich mit dem Absetzen begonnen. Im Sommer war es auch schwer, aber nicht so heftig. Telefonseelsorge nicht erreichbar. Überlastung. In der Psychiatrie angerufen. Laut der Stimme am anderen Ende der Leitung: „ein Notfall“. So wollte ich das nicht! Brauchte sofort Hilfe. Wusste nicht, wohin mit der Spannung. Am Telefon erhielt ich ein paar Ratschläge. Ich habe sofort ein paar Kraftübungen probiert, um die Spannung zu reduzieren. Im Kopf Tiernamen aufgezählt. Es war katastrophal. Es half auch nur bedingt. Die Spannung zu hoch. Ich ging draußen spazieren. Runde für Runde und überlegte. Ich wusste, ich halte es nicht mehr aus. Aber ich wollte das unbedingt schaffen! Ich drehe durch, insbesondere in der Wohnung. Telefonate. Meine Schwester holte mich ab. Ich war zwei Nächte bei ihr, dann eine Nacht bei meiner Mutter. Das alles ging nicht gut. Ich ertrug nichts. Die Mutter telefonisch nicht zu erreichen oder die Sirene in der Ortschaft brachte heftige Spannungsanstiege und Angst. Ich lief ständig umher, um gegen die Spannung vorzugehen. Einkaufen ging nicht. Ich hüpfte durch den Supermarkt, konnte vor Angst nicht warten. Keine Menschen ertragen. Keine Trigger. Das waren die härtesten Tage. Hochspannung Tag und Nacht. Ich konnte gar nicht mehr schlafen, vielleicht eine Stunde. Stattdessen musste ich meine Spannung in Griff bekommen. Nachts in Stützposition. Mitunter kalte Dusche. Trotz Husten. Später noch die Menstruation. Ich konnte es mit mir selbst nicht ertragen. Permanent in Angst, es könnten schwierige Gedanken in den Kopf kommen. Angst vor Gefühlen. Eine Angsthypnose, die ich in der Zeit hörte, kann ich jetzt
nicht mehr hören. Zu schlimm ist die Erinnerung an diese Tage. Ich nehme noch ein anderes Medikament bei Bedarf, in diesen Tagen so hoch dosiert, wie nur möglich. Es half kaum. Schnell weiter im Text!
Ich fuhr wieder nach Kiel. Und seitdem bin ich wieder in meiner Wohnung. Nur langsam verbessert sich der Zustand. Ich schlafe mittlerweile wieder vier bis fünf Stunden. Aber mein Kopf ist voller Angstgedanken. Mal mehr, mal weniger. Es kommen mehr Phasen der Ruhe. Die Hochspannung schlug sogar in extreme Entspannungszustände um, so sehr, dass mich das beunruhigte. Das Atmen fiel schwer. Gespräche kann ich immer noch nicht gut aushalten. Ich kann nur übers Wetter, Essen oder Ähnliches sprechen. Ich kann keine Filme zur Ablenkung schauen, außer Wissenssendungen für Kinder. Ich habe immer wieder Spannungszustände und auch Angstzustände. Gestern dachte ich, dass ich abbrechen muss. Aber nein, ich will es schaffen! Das kann ich nicht noch einmal durchmachen. Alle sagen, dass das vorbei geht. Es kann aber Wochen dauern. Am schlimmsten ist für mich das abendliche Alleinsein. Die Dunkelheit. Ich habe ein LED-Licht gekauft, damit ich mich im Bett sicherer fühle. Höre den ganzen Tag Radio. Ich weiß, dass ich stark bin. Ich ziehe das jetzt durch. Meine Spannung ist jetzt hoch, aber nicht extrem hoch. Und ich habe Angst. Muss mich diesen Gedanken aussetzen, weil sie sonst immer mehr Angst machen. Das Schlimmste ist vorbei, hoffe ich! Es ist immer noch schwer und ich arbeite an der Angstbewältigung. Mein Therapeut sagt: „Sie surfen die Angstwelle.“ Ja, genau das mache ich, auch jetzt gerade. Ich war gerade ganz weit oben, versuche jetzt sanft abzusteigen. Sanft wird das nicht, werde wohl ein wenig stolpern, fallen und wieder aufstehen. So bin ich.
Fortsetzung. Damit sollte es enden. Nach 1000 Worten. Es ist inzwischen vorbei. So gut wie. Ich hatte Tag X erreicht. Morgens ein Gespräch, dann spontan in einen ehrenamtlich betriebenen Laden gegangen, um mich bezüglich einer Mitarbeit zu erkundigen. Danach bin ich nach Hause. Dort ging es wieder los! Ich lief dann im Stadtteil umher, um Müll zu sammeln. Ablenkung. Graue Wohnblocks. Unvertrautheit. Meine Hände froren in den Einmalhandschuhen. Stiefelte durch den Dreck. Wann hört das endlich auf? Mein Ziel für diesen Tag: Abends zur Tanzimprovisation. Das wollte ich noch schaffen. Schon das Krankenhaus im Kopf. Ich ging zum Tanzen. Mit Bedarfsmedikation im Bauch. Es ist nicht zu übersehen, dass es mir schlecht geht. Ich halte durch, gebe mein Bestes. Der Tanz – der Pfeiler meines Lebens! Ach, könnte ich doch immer tanzen! Wieder zu Hause. Ich legte mich hin. Um Mitternacht wachte ich wieder auf. Ich brauchte noch eine Weile, dann entschied ich ins Krankenhaus zu fahren. Konnte nicht mehr. Der Punkt war erreicht. Ich rief ein Taxi. Auf dem Klinikgelände verirrte ich mich zunächst, fand dann doch die Notaufnahme. Es war verfahren. Ich wollte da bleiben, immer noch mit der Hoffnung, dass es sich bald bessert. Eine Aufnahme war nicht möglich. Das Gespräch mit dem Arzt aber gut. Ich ließ los. Endlich ließ ich los. Noch vor Ort nahm ich das gefürchtete Medikament wieder ein. Niedrig dosiert. Machte mich dann früh morgens auf den Weg zur nächsten Bushaltestelle. Der Weg war angenehm. Ruhig und menschenleer. Das Straßenlicht warm. Ab da lag ich nur noch von morgens bis abends. Völlig erschöpft. Am Samstag noch einmal Panik. Noch einmal die Notfallnummer der Psychiatrie gewählt. Eine freundliche Frau half mir. Sie riet, in den Schlaf zu finden. Ich nahm sie beim Wort und legte mich gegen 17 Uhr hin. Medikamente und Schlaf. Ich schlief, aber nicht viele Stunden am Stück. Zwei Tage ging es so. Immer noch den ganzen Tag Radio. Immer wieder die gleichen Songs. Nicht zu emotional. Damals in den Kliniken lief auch immer Radio von morgens bis abends. Sie untermalt meinen Zustand. Man sitzt, wartet und guckt raus, hört. Und macht Therapie. Ich warte jetzt auch, dass sich mein Zustand bessert. Ich bin dankbar, das Medikament wirkt. Der Schlaf- und Nerventee musste weichen, konnte ihn nicht mehr sehen. Ich brauche jetzt ein wenig mehr von dem Wirkstoff. Was ist jetzt? Ich habe Angst vor Gefühlen. Vor schlimmen Zuständen. Abstürzen. Im Moment möchte ich nichts fühlen. Viel zu viel gefühlt. Dann aber macht mir der Gedanke doch etwas Angst. Nein, ich möchte fühlen. Nur heute nicht. Ich kann diesen Text lesen, ohne in starke Angst zu verfallen. Ein bisschen Unwohlsein. Was war das nun? Ist es meine Grunderkrankung, die durchschlug? Oder waren es Absetzsymptome? Vielleicht beides. Es gab zuvor Warnsignale. Ich habe sie ignoriert. Ich wollte unbedingt von den Medikamenten weg. Wollte mich von der psychiatrischen Versorgung lösen. Unabhängig und frei fühlen. Gesund sein. Es ist jetzt okay. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere, dass ich das gerade nehmen muss. Nur so kann ich zur Zeit leben. 1,25 mg. Das Weglassen dieser kleinen Menge, laut des Arztes „ein Hauch“, brachte mich in diese Lage! Unfassbar! Vermutlich gab mir diese Menge Sicherheit. Die Sicherheit ist brüchig. Muss sie in mir finden. Mich wieder ans Leben heranwagen. Die Dinge wieder an mich heranlassen. Die Angst bewältigen.
Ich erkenne: Ich bin ein neuer Mensch. Etwas ist anders. Ich akzeptiere meine Erkrankung. Nun weiß ich, dass ich trotzdem alles probieren kann, was ich mir wünsche, eben mit der Erkrankung und mit dem Medikament. Und mit Offenheit. Ich sehe den gefürchteten Spätwirkungen ins Auge. Wenn ich Spätdyskinesien bekomme, muss ich damit leben. Dann lebe ich damit. Es findet sich ein Weg. Ich lebe jetzt. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe „Ja“ zu mir gesagt und das Beste daraus gemacht. Mir selbst geholfen. Mir Hilfe geholt. Ich mache jetzt anders weiter!
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | I. J. Melodia
Rochade 110 bpm
Auf deinen nächsten Zug wartend
beginnst du einfach von vorne
die Damen in den Fäusten
ich hätte die Wahl
Doch selbst Schwarz und Weiß
kannst du nicht mehr unterscheiden
Ich erinnere mich
an den Januar
sein Grau
und den August
er brannte rot
Heute rieche ich
unsere Asche
höre kaum die Musik
In meiner Kehle keimt
das Unbehagen
ohne Klang und Farbe
Die Nadel springt von der Platte
ein leises Knistern im Tonarm
der Takt geht dir blau
unter die Brust
blendet aus
Es gab nie ein Verurteilen
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anton August Dudda
Krokodile
Plötzlich Krokodile. Im Park Krokodile, in der Bahn Krokodile, Krokodile überall dort, wo man dachte, hier sei man sicher, hier, wenigstens hier kann einen eigentlich nichts mehr überraschen, Krokodile all over the place wo man dachte, man hätte die Regeln begriffen und sie hätten alles zu einer gewissen Ordnung gebracht, auf der Straße, im Café, im Einkaufszentrum, Krokodile. Krokodile auch an komplizierteren Stellen, Krokodile in Krankenhausbetten, an der Garderobe im Theater, auf der Tanzfläche im Club, Krokodile im Darkroom, Krokodile im Lightroom, Krokodile im Escape Room, Krokodile auf den Lehrstühlen der Fakultäten und Krokodile im Schiffsrumpf, Krokodile in den Zimmern dritter Klasse, den Zimmern zweiter Klasse, den Zimmern erster Klasse, auf Deck und in den Rettungsboten, Salzwasserkrokodile in den Rettungsboten von Flussdampfern und Süßwasserkrokodile in den
Rettungsboten von Ozeankreuzern, sonst könnten sie im Ernstfall ja auch einfach wegschwimmen. Krokodile auch an Orten, die es eigentlich nicht gibt, Krokodile, die nachts unter Kinderbetten lauern, Krokodile im Badspiegel, wenn man vom Zahnpastaausspucken wieder hochschaut, Krokodile in dunklen Kellern mit flackernden Glühlampen, Krokodile in Bäuchen von Verliebten, Krokodile im Hirn von Verrückten, Krokodile im Arsch von Nervösen.
Krokodile auf deiner Nasenspitze als du sagst , du hättest nochmal über alles nachgedacht, Krokodile, die einem vom Herz in die Hose rutschen, Krokodile, die alles immer schon früher gewusst haben, Krokodile, die dich geritten haben müssen, als wir uns küssten, Krokodile von denen man träumt, wenn man mit deinem Geruch in der Nase einschläft, Krokodile im Grundwasser, Krokodile im Abwasser, Krokodile im Mundwasser, Krokodile, die bei Überdosierung giftig sein können, Krokodile, die die Männer weltweit unfruchtbar machen, die Spermienkonzentration verringern, Krokodile im Essen, E110, E112, Krokodile bei Polizei und Feuerwehr, Krokodile, die Drogen verticken und Burger Kings in Brand setzen, Krokodile in der Schlange vor uns, du nimmst die Chicken Nuggets und ich den veganen Whopper, ledig, ledrig, Jacke wie Hose. Krokodile im Nil, Krokodile im Amazonas, Krokodile in der Spree, Krokodile am Strand in der Sonne mit Bikinis und Badehosen, Krokodile am Abend mit Pizza und Wein vor dem Sonnenuntergang, Krokodile, die in den Sternenhimmel schauen und sich klein fühlen, klein und unbedeutend, Krokodile, die in den Arm genommen werden müssten, doch niemand kommt, niemand nimmt die Krokodile in den Arm und wer würde das schon freiwillig übernehmen wollen, die Krokodile zu umarmen, man muss sich ja nur mal diese Zähne anschauen, diese kräftige Kiefermuskulatur und dann diesen zu einem zynischen Grinsen verzogenen Mund.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Yasmin Sibai
orientieren I kein aufwachen sondern eher ein herausfallen aus REMphasen // rausgefadetes träumen // ein herunterdimmen // abschwellen synchron mit dem ausdünnen der dunkelheit // herausgleiten aus schichten //
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julius Katins
Die Begegnung im Zug
Ein Aufprall.
Das Jauchzen verstummte, ein Schrei durchschnitt das Abteil. Stille, bis auf das Rattern des Zuges. Zwei junge Männer weiter vorn blickten sich um. Eine Dame beugte sich schwer in den Gang und schaute mehr interessiert als besorgt, woher das Geräusch kam. Der Greis mir gegenüber verdrehte die Augen, ehe er sich weiter am Sudoku versuchte, und hinten fragte jemand, was denn passiert sei. Sogar ich sah von meinem Buch auf.
Eine Kurve hatte das Fangenspiel der beiden Geschwister beendet. Jetzt schluchzte die Kleine am Boden und der kaum ältere Bruder versteckte sich in einer leeren Sitzreihe. Nur die Augen lugten über die Lehne.
„Bis einer weint“, kam doch immer rechtzeitig der Hinweis. Dieses Mal nicht.
Der Vater erhob sich aus der Vierergruppe neben mir und nahm die Tochter auf den Schoß. Sie verstummte und vergrub das Gesicht in seiner Jacke, als die anscheinend kinderlose Dame fragte: „Was hat denn das Prinzesschen?“
Eine Antwort blieb aus. Die dick-roten Mundwinkel der Dame sanken hinab, sie zog sich zurück. Allmählich nahmen die Leute wieder die Gespräche auf.
Der Junge schlich auf den Fensterplatz neben der Mutter, die am Gang dem Vater gegenüber saß. Die Nase wenige Millimeter vor der Scheibe, starrte der Junge nach draußen und flüsterte über die vorbeisausenden Häuser. Als der Zug durch einen Tunnel fuhr, murmelte er die Sekunden: „Drei... vier... fünf...“
Die Mutter blätterte mit den langen Fingern ihre Zeitschrift um. Leicht sah das aus, als streichle ein Windzug die Seite. Dabei tauschte sie über die Brillengläser hinweg einen Blick mit dem Ehemann. An ihn gelehnt schloss die Tochter die Augen.
Mein Blick wanderte zurück auf die Buchzeile. Schwer lag die Lektüre in meinem Schoß und erinnerte mich daran, wie ich meine Zeit zu nutzen hatte. Ich versuchte zu lesen, doch wieder und wieder verschwammen die Wörter.
Ein Ruck. Der Zug blieb stehen. Das war mein Halt.
Ich fing das Stofflesezeichen aus der Luft, platzierte es in der Buchfalte und schloss die Seiten zusammen. Mit den Fingerkuppen fühlte ich den Ledereinband.
Durch die schon offenen Türen drang eine Bahnsteigdurchsage. Ich zog meine schwarz-lederne Reisetasche unter dem Sitz hervor, legte das Buch hinein und stand auf. Der Junge schaute noch immer aus dem Fenster, das Kinn in den Handrücken gestützt, den Ellenbogen auf der Fensterkante.
Wenn er von seinem Glück doch nur wüsste, dachte ich.
Dann verließ ich den Zug.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at