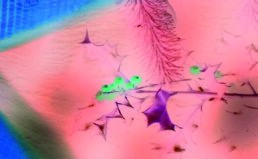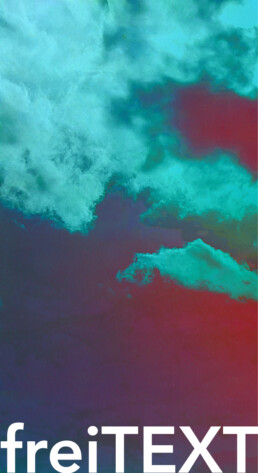5 | Mariusz Lata
5. Dezember 2023Mariusz Lata,Advent-mosaik 2023,Literatur,LyrikAdvent-mosaik,Advent-mosaik
als du in einer frage wohntest
als es zeit wurde
als die sängerin während des konzerts stürzte
& nicht allzu lang danach verstarb
als eines sonntagmorgens der gemüseladen sperrangelweit
offen stand der verkaufsraum hell erleuchtet
als die zeit wurde
das war
das war
das war
als die ente zum sterben auf der wiese landete
als geschichten nicht notwendig waren
als es im september so richtig sommerlich wurde
als der winter einbrach
als du dein älterwerden bemerktest
das war
das war
das war
als die utopie da war
als der vogel phönix sich erhob doch nicht
fliegen konnte
als das werden noch war
als noch nicht alle alles wussten
als die eisblumen den farn grüßten
das war
das war
das war
als es zeit wurde
als die zeit wurde
das war
das war
das war
als für einen film das kino wieder lebte
als die sprache in gestalt des laubs auftrat
als die wiederholungen musik wurden
als es für dich & so manche & manchen erst
einmal aus war mit den antworten
das war
das war
das war
.
Mariusz Lata
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
4 | Christina König
4. Dezember 2023Christina König,Advent-mosaik 2023,Literatur,ProsaAdvent-mosaik,Advent-mosaik
Raststation
Ich war mitten auf einem Autobahnknoten, als mein Wagen den Geist aufgab. Die Asphaltstreifen kreuzten sich und liefen nach links und rechts, vorne und hinten, die Sonne knallte auf mein Armaturenbrett, das Auto hickste, es wurde langsamer und zwei oder drei Kontrollleuchten flammten auf. Am Pannenstreifen hielt ich an. Die Warnblinkanlage klickte wie ein Metronom, links rasten die Autos an mir vorbei und ich zog die Handbremse. In einer halben Stunde sollte ich bei meiner Schwester sein und ihr bei den Vorbereitungen für die Taufe meiner Nichte helfen.
„Was soll das heißen, du hast eine Panne?“ Die Stimme meiner Schwester stolperte. „Wir brauchen dich! Was ist mit den Salaten und der Deko und der Kerze? Und Tante Walli? Du bist die Taufpatin, ich schwör dir, wenn du nicht auftauchst…“
Der Schweiß stand auf meinen nackten Armen. Ich öffnete das Fenster und schloss es im Donnern der vorbeifahrenden Autos sofort wieder. Ich telefonierte mit meiner Mutter, die sagte, sie könnte mich unmöglich abholen, sie müsste noch Besorgungen für meinen Vater machen, dann mit meinem Cousin, der brummte, wenn es unbedingt sein müsste, dann könnte er jetzt losfahren und mich aufklauben, dann mit Tante Walli, der ich erklärte, dass ich sie nicht pünktlich abholen würde. Mitten in ihrer Schimpftirade tauchte der Abschleppwagen auf.
Während die Autos an mir vorbei ihren Zielen entgegenhetzten, balancierte ich am Pannenstreifen und beobachtete den Abschleppfahrer, wie er mein Auto auf seiner Ladefläche festschnallte und die Räder stabilisierte. Das kalt verschwitzte Taufkleid wehte im Luftsog der Autos um meine Beine und zerrte mich vorwärts, ich stemmte mich dagegen, stieg beim Abschleppwagen ein und er fuhr los und von der Autobahn ab; wir kurvten unter den vier Spuren durch und blieben an einer staubigen Raststation stehen. Hinter dem Tankstellenlogo ragte ein Burger King in den glühenden Himmelsdunst. Der Abschleppwagen verschwand, ich schulterte meine Taschen und schleppte zwei Nudelsalate, eine Taufkerze, ein aufblasbares Schwimmlama und meinen Übernachtungsrucksack durch die Glastüren, bestellte etwas Eiskaltes mit viel Zucker und warf mich in einen der harten Sitze. Popmusik dudelte aus den Lautsprechern. Eine Ladung übergewichtiger Männer existierte mit halb geschlossenen Augen in einer Ecke. Sonst war das Restaurant leer.
Mein Cousin antwortete mit einem genervten Daumen-hoch-Emoji, als ich ihm meinen Standort schickte. Mein Onkel schrieb mir eine Nachricht: hab ghört du hast a panne, vielleicht findst ja an feschen kerl der di mitnimmt haha. Meine Schwester fluchte. „Ja super, und ich mach das Buffet jetzt allein oder was? Wer schaut auf Sophia? Also du hast dir wirklich einen Scheißtag ausgesucht für deine Panne.“
Die Eiswürfel klickten in meinem Pappbecher, als ich mit dem Strohhalm umrührte. Hinter meinem Fenster preschten weiterhin die Autos vorbei. Die Glasscheiben verschluckten ihren Lärm. Inzwischen sollte ich bei meiner Schwester sein und die Nudelsalate in schöne Schüsseln füllen, die Markise ausrollen, Tomaten und Mozzarella schneiden, Saucen bereitstellen, Servietten falten, mit Sophia spielen, Anna in den Mittagsschlaf schaukeln und Luftballons aufblasen. Ich rollte den feuchten Becher an meiner Stirn hin und her und schloss die Augen. Hinter den Lidern jagten sich rastlos die Autos. Meine Mutter schrieb: Gibt es dort eine Apotheke, wo Du bist? Dein Vater braucht neue Warzenpflaster. Mama.
Die Resopalplatte meines Tisches war klebrig, wo die Menschen vor mir ihre Getränke verschüttet hatten. Die Angestellten drifteten hinter der Theke hin und her. Meine erhitzte Haut kühlte. Ich sah mich Polster auf die Bierbänke drapieren, Girlanden über Hecken werfen, Zitronensaft pressen, das Lama aufpumpen, Sonnenschirme herumschleppen, Grillkohle suchen, Sandspielzeug wegräumen und mich anmaulen lassen, weil die Taufkerze nicht schön genug war.
Wie Spinnfäden tropften die Minuten von der Decke auf mich herab. Ich fuhr mit den Autos auf ihren grauen Straßen in die Zukunft, zu Kindergebrüll und müden Sektkorken und brutzelnden Grillwürstchen und Tante Walli, die schrie, ihre Füße wären unruhig und jemand sollte ihr Tabletten bringen; Tortencreme klatschte auf hysterisch gemähten Rasen, Rotweinflecken landeten auf Annas Taufgewand, Fürze stahlen sich zwischen Fettschichten und Kleiderfalten durch und alles schmatzte und wieherte und witzelte. Meine Großmutter kniff mir in den Hintern. Der Graue Star meines Vaters starrte in den Pool. Meine Mutter klopfte die Brösel von seinem Schoß und goss pissgelbes Bier in sein Glas. Ich drückte die Handballen in die Augen und meine Schwester drückte mir Kinder und Teller und Windeln in die Arme, die Tischkärtchen platzierten mich neben Tante Walli, die sonst niemand ertrug, und die Rücken meiner Cousinen befragten meine Schwester zu den besten Stilleinlagen. Mein Großvater vergaß meinen Namen. Die Familie meines Schwagers redete mit mir, wenn sie Salz brauchte. Mein Onkel schaute auf meinen Busen und sagte: „So a Verschwendung.“ Die Autos stanken und hupten und fetzten hinter den Fenstern vorbei, sie heulten in meinen Ohren, fegten durch meine Adern, blitzten und blinkten und gleißten durch alle Synapsen und mein Handy vibrierte. Ich öffnete die Augen. Mein Cousin rief an. Eine Weile lang betrachtete ich die graue Kopfsilhouette auf dem Display. Dann schloss ich die Augen wieder.
.
Christina König
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
3 | Sofie Morin
3. Dezember 2023Sofie Morin,POEDU,Advent-mosaik 2023,LiteraturProsa,Advent-mosaik,Advent-mosaik
Falten aufspüren .:. Tag und Nacht
Wir kennen Flügelschläge, oder Reissäcke in anderen Erdteilen, die ich mir so gern verbitten will umzufallen an Weltenden. Wir kennen die Geschichten von feinsten Luftbewegungen, die gar Tornados auslösen, über absurde Entfernungen, die auf keine Landkarte mehr passen.
Diese oder jene Effekte, die wirken, schmetterlingsgleich über jegliche Vernunft hinweg, die wir uns so bitter erarbeitet haben. In der Meteorologie, und überhaupt, wünsche ich mir verstehbare Zeugnisse intelligenten Lebens und lieber keine Unvorhersehbarkeit. Besser Konvektionsströme sauber berechnen, als Divergenzen aushalten müssen.
In meinem Garten vor allem wünsche ich nur sauber angepflanzte Lieblichkeit und nicht mehr zwischen uns als die Flügelspannweite eines freundlichen Falters.
Aber so einfach ist das nicht, denn je genauer ich hinsehe, umso mehr erkenne ich von der Zerbrechlichkeit dieser und jener Schuppen, die sich unter der leisesten Berührung der Fallsucht ergeben. Es hilft nichts, das alles nicht wissen zu wollen, nichts von Tagesrändern und Lebensspannen, die so gering bemessen, dass nur ihr farbensprühendes Aufglühen schon alles vom nahen Ende her beweist. Nichts hilft es, das aufzuspüren, was sich faltet, wie Flügeldecken, wie Zellen, wie die Entfaltung des Lebens nur unter anderem aus mir. Wie all das, was wir vernünftig glauben.
Lieber will ich angemessen ungeduldig sein, mit mir und dem Sprießen, mit dem Überdauern und Tilgen von all der Schuld, die wir auf uns geladen haben mit dieser einen irrigen Idee, die Erde untertan.
Doch sind es zunächst nicht die Wesen des Tages, die meine Zuneigung an sich binden. Der unstete Schmetterlingsflug ist mir kein gutes Beispiel und auch andere vernunftbegabte Menschen sind mir bekannt, die ihn daher verabscheuen, wie das notwendige Aufspüren der Falten selbst.
Die Vermutung liegt nah, wie immer, der Fokus aufs Menschliche, das nicht ohne weiteres human ist, wäre die Wiege dieser falschverstandenen Reflektion. Auch wenn der Ursprung dieser Abneigung zuweilen mit der mutmaßlichen tierischen Effekthascherei begründet wird. Aufreibende Buntsucht und flatterhafte Bühnengeilheit, sagen sie, würden den Abgeneigten die Tagfalter zutiefst unsympathisch machen.
Da loben wir uns doch die Unscheinbaren, welche die Nächte nicht heller machen, als sie es sind. Solche Falter, die auf innere Werte statt auf Farbfeuerwerke setzen. Tarnfarbig halten sie der Ordnung die Treue und falten ihre Flügel stets höflich auf nach Gebrauch. Sie mögen fälschlich als Spinner, Glucken oder verunglimpfend als Nonnen oder Widderchen bezeichnet werden, doch für mich sind sie die wahren Heldinnen und Schmetterlinge, allesamt Schwärmer!
Neueste Forschungen zu Nachtfaltern besagen wohl, sie seien bloß fürs menschliche Auge eintönig gefärbt. In Wahrheit jedoch würden sie so schuppentreu schillern, wie unsere Hinwendung zur Erde, die doch insgeheim innig ist. Kein Faltenwurf in der Wirklichkeit käme dagegen an, wenn einmal die Einfühlung entfesselt wäre, die uns das drohende Fehlen rundum sichtbar mache. Darauf will ich nicht warten!
So stelle ich mich vor diese Mitgeschöpfe und halte kein Maß an sie, das kein Tageslicht kennt. Ich schürfe nach Gründen und belasse sie bei sich wie die Flugfähigkeit unserer Träume. Nichts soll dazu dienen sich die Welt anzueignen, deren Teil wir sind. Ich stelle die Freiheit im Lichtmikroskop scharf und nehme den Zeichenstift in die Hand und nichts sonst.
Und alles genaue Hinsehen ist, du weißt schon, ist Liebe und Frieden daher. Und ich denke, ginge es uns so miteinander!
.
Sofie Morin
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
2 | POEDU: Emma
2. Dezember 2023Poedu,POEDU,Advent-mosaik 2023,LiteraturLyrik,Advent-mosaik,Advent-mosaik
Türchen öffne dich
Meine Süßigkeit ist eine Maus
Die Maus isst Zucker
Und wird zum Pfau
Der Pfau geht durch die Straße
Auch
Die Frau
Sagt: Schau
Ein Pfau
Die Männer rufen an im Zoo
Die Wärter kommen angebraust
Der Pfau, der rennt und spuckt
Den Zucker aus
Zurück ist sie, die kleine Maus
Die huscht hinein ins
Türchen zu
Ruh
Emma (8 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe kam diesmal von Sabine Schiffner:
Erstelle ein Gedicht für ein Türchen von einem Adventskalender, den Du Deiner/m besten Freund:in schenken willst. Mach ihr/ihm also ein Geschenk aus süßen Worten. Schreibe über Deine Lieblingssüßigkeit, oder denk Dir doch einfach eine neue Süßigkeit aus, eine lustige, eklige, oder eine Zaubersüßigkeit.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
1 | Leonie Höckbert
1. Dezember 2023Leonie Höckbert,Advent-mosaik 2023,Literatur,ProsaAdvent-mosaik,Advent-mosaik
Mehrfamilienhausfassade
Später in der Nacht sind oft nur die Fenster der höheren Stockwerke noch hell. Einen Blick in die Fenster auf Höhe des Eingangs kann nur werfen, wer bereits nach Einbruch der Dunkelheit auf der Plastikbank am gegenüberliegenden Straßenrand Platz nimmt. Vielleicht wohnen unten eher ältere Leute, die die Treppen in den fünften Stock nicht mehr schaffen würden. Vielleicht lassen die Menschen unten die Lichter aus, damit Passanten nicht durch die dünnen Gardinen direkt mit neugierigen Blicken auf ihre Esstische springen können. Vielleicht wohnen auch nur zufällig weiter oben die Nachteulen, Schichtarbeiter, Schlaflosen und Rumtreiber. Links und rechts des Treppenhauses hat jede Wohnung drei Fenster, von denen eins immer zur Küche gehört. Nach neun brennt in den Küchenfenstern am seltensten Licht. Dafür hängen dort meistens keine Gardinen oder sie sind beiseitegeschoben. In einer Wohnung steht der Kühlschrank direkt am Fenster und seine Tür verdeckt einen guten Teil davon, wenn sie geöffnet wird. Sie wird oft geöffnet, vermutlich um immer wieder Kleinigkeiten rauszunehmen, in der Wohnung wohnen zwei oder drei Leute zusammen, Studierende vermutlich, manchmal kocht auch jemand, aber eher selten, und die anderen beiden Fenster scheinen nicht den Blick auf ein Wohnzimmer freizugeben, ihre Poster und Kleiderschränke wirken mit Betrachtungsabstand wie in Jugendzimmern, als hätten die Bewohnenden nur diese paar Quadratmeter für alle ihre Selbstausdrucksbedürfnisse.
Ein Fenster im zweiten Stock ist ein Kinderschlafzimmer, meistens ist das Licht aus, wenn die Dunkelheit kommt, unterbrochen nur von wenigen Minuten, in denen manchmal jemand das verschlafene Kind zum Fenster trägt, wahrscheinlich in der Absicht, es wieder in den Schlaf zu wiegen, aus dem es von rastlosen Träumen gerissen wurde. Die Elterngesichter, deren Blick ohne Ankerpunkt auf die gegenüberliegende Fassade trifft, wirken immer erschöpft, aber nie angestrengt. Valerie bewundert das, wenn sie die Beiden zufällig sieht. Meistens geht auch deren Wohnzimmerlicht lange vor vielen anderen des Hauses aus. Zwischen Valeries Füßen sammeln sich ihre ausgetretenen Zigaretten. Die hässlichen städtischen Bänke aus Plastik, das immer an irgendeiner Stelle von Jugendlichen mit dem Feuerzeug angebrannt und schmelzdeformiert wurde, haben den Vorteil, auch nachts nicht besonders kalt zu werden, anders als schickere Bänke aus Metall.
Eins weiter oben, auf der anderen Treppenhausseite gibt es noch andere Eltern. Valerie kennt ihre Gesichter nicht so gut, die Kinder sind schon älter und werden nicht mehr ans Fenster getragen. Sie kennt dafür ihre Stimmen, die hört man im Treppenhaus oft streiten, manchmal mit den Kindern, meistens miteinander, sie schreien sich mit der Rückhaltlosigkeit längst aufgegebener Schamgrenzen an, sie weichen den Blicken der Nachbarn im Treppenhaus nicht aus, Peinlichkeit ist lange zurückgelassen hinter ihrer Wut aufeinander. Durch die Wände, vom Echo des Treppenhauses verzerrt wie eine Megafondurchsage unter Wasser, ist nie auszumachen, worüber sie streiten, nur die erdrückende Atmosphäre des Nicht-Ausweichenkönnens schwappt unter der Wohnungstür hindurch. Manchmal weint eins der Kinder schrill und Valerie denkt, dass man sich einmischen muss, tut es aber nie. Die Wohnung der Familie sieht schon von außen zu voll aus, in den Fenstern hängen Dekoelemente, Traumfänger, auf den Scheiben kleben Windowcolor-Bilder, drinnen stapeln sich Kisten auf den Schränken, um den letzten Raum unter der Decke noch auszunutzen. Valerie stellt sich vor, wenn man die Fenster eines Raums öffnete, würde alles rauspurzeln, was drinnen zu viel ist: die ganzen Sachen, für die kein Platz ist und die ganzen Bedürfnisse, für die kein Raum bleibt. Sie fragt sich, ob dort deswegen auch im Sommer die Fenster immer geschlossen sein werden. Und hofft zugleich, hier nicht mehr zu sitzen, wenn der Winter vorbeigeht.
Das Fenster, das im ersten Stock im Schnitt am längsten hell bleibt, liegt in der Wohnung rechts von der Eingangstür. Dort lebt ein älterer Mann allein. Vielleicht hat er nachts Schwierigkeiten zu schlafen oder er ist einfach gerne lange wach. Sein Fernseher flackert heller auf die Gehwegplatten als das mürbe Licht seiner einzigen Energiesparlampe. Im Fenster sitzt manchmal eine Katze und starrt rüber zu Valerie, sie schauen einander in die Augen und Valerie kann nicht lesen, ob ihr Blick sagt: Ich verstehe dich, ich bewahre dein einsames Geheimnis – oder ob er sagt: Ich werde dich verraten, eines Tages werde ich dich im Treppenhaus verraten. Womöglich beobachtet die Katze sie auch nur aus Langeweile oder weil es ihr sympathisch ist, dass Valerie raucht, der alte Mann vor dem Fernseher raucht auch, Valerie hat ihn tagsüber schon mit dem Aschenbecher am offenen Fenster stehen sehen und nachts verdichten sich manchmal kleine Rauchschwaden in der Ecke, in der der Mann vor dem Fernseher zu sitzen scheint. Wenn die Katze nicht auf der Fensterbank liegt, liegt sie sicher auf seinem Schoß und bildet eine schnurrende Barriere gegen die Einsamkeit, gegen die auch die bekannten Gesichter im Fernsehprogramm nicht immer ankommen können.
Wenn Valeries Hände nicht von der Winterkälte zu steifgefroren wären, würde sie sich gerne Notizen machen, wer wann wie lange wach bleibt, wer zuletzt das Licht löscht und was sie über die Menschen dieser Wohnungen und deren Tageslichtleben weiß. Sie nährt den Verdacht, dass die traurigeren Geschichten hinter den schlaflosesten Fensterlidern wohnen. Aber vielleicht sind das auch nur die Räume, in die sie am liebsten schaut, die Leben, in die sie sich am liebsten projiziert aus ihrem Schutzraum aus Halbdunkelheit heraus. Heute wird sie nicht erfahren, wer zuletzt das Licht ausmacht, denn fast unterm Dach leuchtet ein Fenster auf, das sie nach drinnen winkt. Im vierten Stock hat Alexanders Wecker geklingelt und obwohl sie das von hier unten nicht sehen kann, weiß Valerie, dass er eben seine Arbeitskleidung für die Frühschicht zusammensucht. Sie zieht an ihrer letzten Zigarette, drückt sie zwischen den anderen aus und sammelt alle Stummel des Abends in der hohlen Hand, um sie in die Hausmülltonne zu werfen, bevor sie reingeht. Drinnen muss sie im Treppenhaus noch eine Weile stehenbleiben und Hände und Gesicht aufwärmen, damit Alexander nicht fragt, der verschlafene Alexander, der damit rechnet, dass sie wie immer um diese Zeit von der Spätschicht nach Hause kommt, der keine Ahnung hat, dass Valerie den Job gekündigt hat. Ein Teil von ihr bleibt draußen auf der Bank sitzen, schaut sich selbst in die Fenster und weiß schon genau, wie ihre Geschichte ausgehen wird.
.
Leonie Höckbert
.
Das Advent-mosaik ist dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiVERS | Julo Drescowitz
26. November 2023Literatur,LyrikfreiVERS,Julo Drescowitz
5,0
Du liegst
neben mir
im Bett
und du
fährst dir
auf diese
Art durch die
Haare
wie du es
immer tust,
und deine Arme
sind wie
Äste
und deine
Hände
würde ich unter
Millionen
erkennen;
und ich spüre die
Hitze und
Nässe
unter unserer
Bettdecke
und wir trinken
dieses
Billigbier
aus Dosen
es heißt:
5,0
und die Dosen
sind eiskalt
mit
Kondenstropfen
am Blech;
und wir trinken
das kalte
Bier
und du
fährst dir
durch die
Haare
und
sagst
die eine
Hälfte
deiner Familie
tränke,
weil sie die
Welt
nicht verstehen
würde,
und die andere
Hälfte
deiner Familie
sei tot
weil sie
sie
irgendwann
von Grund auf
verstanden
hätte;
und dann
schweigen wir
einen Moment,
und es ist
dunkel
in meinem
Zimmer
und kühle
Herbstluft
zieht durchs
Fenster
herein
und ich rieche
unsere
Haut
deine
Haare,
und du
trinkst und
lachst und
sagst
du würdest
einfach
nicht
wissen
wohin
du
gehörst
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Chris Lauer
24. November 2023Literatur,freiTEXTProsa,Chris Lauer
Der Gebetsbaum
Wenn Marion in ihrem Schlafzimmer steht, sieht sie auf einen Innenhof hinaus. Der Innenhof gehört zu einem anderen Haus, oder vielleicht auch zu keinem, das weiß Marion nicht. Der Boden ist uneben und die Mauern krumm; Marion stellt sich den Innenhof immer vor wie eine Zahnkrone, die man auf den Kopf gedreht und zwischen die Häuser gesteckt hat, damit der herunterhängende Himmel nicht blank da steht. Irgendwann hat ein Baum angefangen, in der Mitte des Innenhofs zu wachsen. Im Frühling ist dieser Baum ein Ostereierbaum, im Sommer ein Papiergirlanden- oder Weißewäschebaum, im Winter ein Lichterkettenbaum, nur im Herbst hat der Baum, der seine Blätter verliert, keinen Namen. Um dem Baum auch im Herbst einen Namen zu geben, haben Menschen begonnen, Gebete an den Baum zu hängen. Die Gebete flattern als bunte Stoffstreifen im Wind. Marion hört sie bei geschlossenem Fenster, wenn sie in ihrem Schlafzimmer steht, mit hellen Stimmen durcheinander reden. Ein Wort hat Marion noch nicht verstanden. Sie sieht nur, dass je leichter der Baum durch das Verlieren seiner Blätter wird, desto schwerer wird er an Gebeten. Beim ersten Schnee ist der Baum dann so schwer an Gebeten, dass er gekrümmt da steht und kein Vogel mehr Platz hat, um sich auf einen seiner Äste zu setzen. Dann kommt jemand vorbei und sammelt die Gebete ein. Manchmal ist es eine Frau und manchmal ein Mann. Die Frau oder der Mann knoten jedes Gebet einzeln wieder auf und verstauen es in einer Tasche. Für die Gebete, die an den oberen Ästen hängen, müssen sie oder er auf eine Leiter steigen und mit ausgestreckten Armen das Gebet vom Ast entfernen. Nie aber wird dabei ein Gebet zerschnitten. Marion fragt sich, wohin die Gebete verschwinden, was eigentlich mit den Gebeten passiert, die gesprochen werden, wenn der Baum kein Gebetsbaum, sondern ein Ostereier-, Papiergirlanden-, Weißewäsche- oder Lichterkettenbaum ist. Vielleicht fühlen diese Gebete nicht den Wind, der sie immerzu in Bewegung hält, vielleicht sind sie nicht bunt, vielleicht können sie nicht über die Haut gleiten, wie Stoff über die Haut gleitet, und vielleicht sprechen sie nicht mit hellen Stimmen durcheinander. Vor allem müssen diese Gebete einfachere sein, denkt Marion, denn sie brauchen nicht eine Zeit lang angebunden zu werden, so wie man einen störrischen Hund anbindet, bevor man ihn frei laufen lassen kann.
Gerade hängt der Baum wieder voll mit Gebeten und Marion entscheidet sich in diesem Augenblick dazu, zwei weitere anzubringen. Eins für den Baum, denn irgendwann ist Marion klar geworden, dass der Baum zwar die Gebete vieler anderer Leben trägt, er aber nie ein eigenes wird hinzufügen können. Das andere Gebet möchte sie für sich selbst dort anknoten. Marion ist sich unsicher, ob es gegen die Regeln des Gebetsbaums verstößt, aber für ihre Gebete möchte sie keine Stoffstreifen benutzen, sondern ihre beiden Schnürsenkel. Die Schnürsenkel sind mintgrün und viel länger als die anderen Stoffstücke, die an dem Baum hängen, obschon ihre Gebete kurz sind. Da Marion ihre Schnürsenkel nicht entzweischneiden möchte, entschließt sie sich dazu, mit ihnen Schleifen zu binden. Warum Marion keine Stoffstreifen, sondern ihre Schnürsenkel zum Befestigen der Gebete benutzt, hat einen einfachen Grund: Marion trägt den Kampf, den sie mit sich ausficht, in den Beinen. Zunächst hat ihr das erlaubt, ihren Alltag zu ordnen. Einmal morgens und einmal abends, dann dreimal, viermal, fünfmal am Tag. Wenn es Marion nicht gut ging, weil sie essen wollte, ihr dieser Wunsch aber große Angst machte, meldeten sich ihre Beine. Ihr Beine sagten ihr, dass sie gerne laufen würden. Und Marion hielt das für eine gute Idee, denn anstatt dass sie mit sich selbst zusammenarbeitete, ließ sie einfach ihre Beine zusammenarbeiten. Das ging am besten, wenn die Beine ihre Aufgabe ganz schnell und ohne Pause ausführten. Dann bekam Marion das Gefühl, dass überhaupt kein Kampf mehr da war; dass so wie ihre Beine zwei und doch eins waren, auch sie zwei und doch eins war. So lief Marion eine Runde nach der anderen im Park. Sie lief so viele Runden im Park, dass die Muskeln in ihren Beinen anschwollen und mehr Platz in ihren Ober- und Unterschenkeln da war. Sie konnten jetzt nicht mehr nur Marions Kampf, sondern auch ihren Verstand aufnehmen. Dann musste Marion gar nicht mehr nachdenken, wo sie abzubiegen und welche Strecke sie zu laufen hatte, das ging dann ganz von alleine. Aber nach langer Zeit merkte Marion, dass ihr Alltag gar nicht mehr dadurch geordnet wurde, dass sie Runden lief, und dass der Hunger nicht dadurch verschwand. Trotzdem konnte Marion gar nicht mehr aufhören mit laufen. Sie lief Schuhpaar um Schuhpaar kaputt, bis sie plötzlich fürchtete, auch sich selbst kaputtzulaufen. Deswegen fädelt Marion gerade ihre Schnürsenkel aus und geht nach draußen. Eine kalte Brise wirbelt Blätter auf; die Gebete schnalzen laut mit der Zunge, sonst bleiben sie still. Marion schaut in den Himmel hinauf. Er hängt durch, als ob jemand sich in ihn wie in eine Hängematte gelegt hätte. Da sagt sie sich: Diese Nacht wird es Schnee geben. Sie bindet zuerst den ersten Schnürsenkel fest, dann den anderen. Sie braucht gar nicht lange dafür. Dann geht sie zurück ins Haus. In der Nacht steht sie in ihrem Schlafzimmer und schaut hinaus. Sie fragt sich, wie viel Schnee es braucht, um den ganzen Innenhof einzuschneien. Vielleicht so viel, wie es Gebete braucht, um eine Hängematte zu füllen, denkt sie. Dann schläft sie ein. Als sie am nächsten Morgen erwacht, sind die Rollladen noch hochgezogen. Es hat geschneit. Mintgrün.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Claudia Dvoracek-Iby
19. November 2023Literatur,LyrikfreiVERS,Claudia Dvoracek-Iby
momentan
momentan
brauche ich nur
die paar Momente
um auf meine weiße Wand
zu starren
und die Momente davor
um auf dich
um auf dich
um auf dich
im Sonnenlicht
zu schauen
mehr braucht es nicht
um deinen Schatten
um deinen Schatten
um deinen Schatten
auf meine weiße Wand
zu bannen
mehr brauche ich nicht
momentan
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leonie Höckbert
17. November 2023Literatur,freiTEXTProsa,Leonie Höckbert
Junimond
Janni träumt von der perfekten Trennung. Sie träumt davon, dass alles ganz unkompliziert sein kann. Wie in Filmen und Serien. Wo Paare, die jahrelang zusammen waren, sich einfach eines Abends an den Küchentisch setzen können und sagen können: Das war’s. Und dann geht einer von beiden und die andere bleibt am Küchentisch zurück und gießt sich ein Glas Wein ein und trinkt es nachdenklich, aber nicht unbedingt todtraurig, aus. In manchen Filmen, besonders in französischen, findet Janni, besprechen die in Trennung befindlichen Paare sogar ganz am Ende noch ganz Wesentliches, sagen dem Anderen nochmal ein paar ernste Worte über die Persönlichkeit oder das Verhalten oder das Leben und Beziehungen im Allgemeinen und dann entsteht daraus gar kein Streit oder tiefe Verletzung und Beleidigung, sondern ein wertschätzender Austausch, an dessen Ende sich die Trennung wie der ganz richtige Schritt für beide anfühlt. So soll das für Janni sein. Ohne Tränen. Wenigstens, bis die Szene im Film vorbei ist. Sie sehnt sich nach dem Moment nüchterner Klarheit, in dem beide Parteien zugleich erkennen: Aus uns wird nichts mehr. Wir sollten nachts kein Bett mehr teilen. Wir sollten morgens keinen Kaffee mehr füreinander machen. Die Formulierung eine Szene machen erscheint Janni sinnlos. Eine Szene nach ihren Vorstellungen wäre gerade das Gegenteil von dem, was gemeint ist.
Ihre Trennungsgeschichte hat in der fünften Klasse angefangen und ihre Standards gleich zu Beginn hoch angesetzt. Jonas aus der Parallelklasse hatte ihr in der großen Pause ein KitKat Chunky White gekauft. In der nächsten großen Pause hatten sie Händchen gehalten und sich nach der Schule darauf geeinigt, miteinander zu gehen. Ungefähr drei Wochen lang hatten sie Händchen gehalten und Schokoriegel geteilt, bis Jonas nach der Schule sagte, er wolle nicht mehr zusammen sein. Seine Freunde fänden, sie sollten sich küssen, aber er habe keine Lust da drauf. Janni hatte auch eigentlich keine Lust da drauf und genug Taschengeld, um sich selbst KitKat zu kaufen. Sie sagte okay, wir machen Schluss, und Jonas rannte zu seinen Freunden und mit ihnen zum Bus. Statt Enttäuschung hatte Janni eine gewisse Erleichterung gefühlt.
Eine Beziehung überhaupt anzufangen, ist die entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Trennung, deswegen sucht Janni immer wieder auf Dating-Plattformen nach Männern, von denen sie sich trennen kann. Jannis erste Beziehung im Studium ging zwei Jahre lang und als sie sich trennte, war es furchtbar, voller Tränen und Vorwürfe, Gemeinheiten und Selbsterniedrigung. Danach nahm sie sich vor, zu üben.
Sie betrachtet sich selbst auch als eine Art Trainingseinheit für ihre Kurzzeitpartner. Wie ein Kurs im Fitnessstudio oder bei der Volkshochschule. Wer mit ihr fertig ist, oder besser – mit wem sie fertig ist, der kann sich als weitergebildet betrachten und ist dementsprechend gewappnet für die nächste Beziehung. Dass eine Beziehung bestenfalls nicht vom Ende her anfängt, kommt Janni nicht in den Sinn. Heiraten ist für sie nur der Auftakt zu einer Trennung mit mehr Schritten.
Sie probiert verschiedene Methoden aus. Eine Trennung über Textnachricht kommt ihr zwar nicht so moralisch verworfen vor wie immer behauptet, ist aber auch nur die Fälschung des Gefühls, nach dem sie sucht. Sie hat es probiert und obwohl das für sie ruhig und überlegt abgelaufen ist, fehlt ihr die Perspektive des Verlassenen, der natürlich trotzdem völlig verzweifelt sein könnte. Die Trennung muss im Gespräch passieren. Am besten spontan, nicht von langer Hand geplant. Aus einem Impuls heraus, der den Partner auch ganz plötzlich erkennen lässt, dass sie wirklich nicht zusammenpassen. In einem nachlässig im Schlafzimmer versteckten Notizbuch dokumentiert Janni ihre Versuche. Es liegen immer einige Monate oder wenigstens Wochen zwischen den einzelnen Einträgen, um überhaupt einen gewissen Spannungsaufbau für die Trennungsübung sicherstellen zu können. Trotzdem sind zwei Versuche mit der etwas peinlichen Notiz versehen, dass die Internetbekanntschaft, der Janni die Trennung unterbreitete, bei diesem Anlass überhaupt das erste Mal davon gehört hat, dass sie zusammen gewesen wären.
In inzwischen einigen aktiven Jahren Forschung und Proben brachte sie es auf ungefähr zwölf ernstzunehmende Datensätze. Davon war genau eine Trennung auch nur in die Nähe einer soliden Filmszene gekommen. Da waren sie zu zweit nach sechs Monaten regelmäßiger Treffen in einem gerade aufblühenden Sommer in den Park gegangen und hatten so lange schweigend auf einer Parkbank gesessen, dass unumstößlich klar geworden war, dass alle weiteren Treffen drückende Stille wären, sie hatten sich nach sechs Monaten einfach nichts Neues mehr zu sagen. Er sagte, es wäre nicht unangenehm, mit ihr zu schweigen, aber er würde dabei auch nichts Besonderes fühlen. Janni bestätigte. Sie nahmen sich an der Hand und schwiegen noch, bis es dämmerte. Danke, dass du es angesprochen hast, sagte Janni, bevor sie in verschiedene Richtungen aufbrachen. Danke, dass du keine Szene gemacht hast, sagte der Mann, der in sechs Monaten anscheinend gar nichts über Janni gelernt hatte.
Einer ihrer Partner hat gefleht, sie solle ihn nicht verlassen. Drei haben sich von ihr getrennt, bevor sie ihre letzten Worte gut sortiert hatte. Zwei haben sie nach einigen Monaten geghosted und so ein auf andere Art besonders unbefriedigendes Ende geschaffen. Einem Mann hat sie zuvor von ihrer Sehnsucht nach der perfekten Trennung erzählt und als sie es dann versucht hat, hat er sich an das Gespräch erinnert und ist zynisch geworden. Die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht, die Orte sind falsch oder die Dinge, die gesagt werden, unpassend; das Gefühl von entromantisierender Ernüchterung ergibt sich nicht, wird oft überschattet von Jannis Erleichterung, eine ihr längst unbequem gewordene Übungsbeziehung endlich ihrem Zweck zuführen zu können. Viel zu oft wurde geweint. Das ist besonders falsch, dieser Schmerzausdruck, der eine unmittelbare Schuldzuweisung enthält. Wer sich gegenseitig nichts vorhält, sollte nicht heulen, findet Janni.
Auf der Arbeit klickt sie sich den ganzen Tag durch Excel-Tabellen. Neben ihr auf dem Schreibtisch liegt ihr Handy, stummgeschaltet, und leuchtet immer wieder auf, wenn sie eine Nachricht von Tinder oder Bumble bekommt. In der Phase nach einer Trennung wirft sie Netze in alle Richtungen aus, unterhält vier, fünf Konversationen parallel. Erst seit ein paar Wochen arbeitet sie in der Datenanalyse, es ist ihr erster Vollzeitjob, sie lernt viel für ihre eigenen Daten und notiert sich oft Analyseverfahren für den Privatgebrauch. Der Job ist ruhig genug, um nebenher fast identische Nachrichten an mehrere potentielle Trennungsübungspartner zu schicken.
Als der Chef sie Montag morgens ins Büro ruft, ist es das erste Mal, dass Janni den Raum wieder betritt seit ihrem Bewerbungsgespräch. Der Chef bietet ihr einen Kaffee an und einen der Stühle am Schreibtisch, keinen der gemütlichen Sessel in der Ecke. Als der Kaffee vor ihr steht, vor ihm nur ein Espresso, klappt er seinen Laptop zu und sagt, er wolle nicht drumherum reden. Ob sie sich bei ihnen in der Firma wohlfühle? Janni nickte, etwas überrascht von der Frage. „Wir haben nicht den Eindruck“, sagt der Chef und nippt am Espresso. „Sie bringen sich wenig ein und scheinen Schwierigkeiten mit dem Teamgeist unserer Einrichtung zu haben.“ Wer ist eigentlich „wir“, denkt Janni, während sie nichts sagt. „Leider muss ich ihnen mitteilen, dass wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Stellen in ihrem Arbeitsbereich einsparen müssen. Das bedeutet, dass wir uns von Ihnen verabschieden müssen, so leid es mir tut.“ Er trinkt seinen Espresso in einem Zug leer. „Können Sie das nachvollziehen?“ „Ja“, sagt Janni, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Sie sind noch in der Probezeit. Daher gilt ihre Kündigung fristlos. Ich möchte Sie bitten, ihren Platz aufzuräumen.“ Er steht auf und reicht ihr die Hand. „Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Weg.“
Janni lässt ihren Kaffee unberührt stehen und geht zurück zu ihrem Platz, wo ihre letzte Aufgabe noch auf dem Bildschirm offen ist. Es dauert nur wenige Minuten, ihr Handy, ihren Thermosbecher und ihre wenigen anderen privaten Gegenstände in ihre Tasche zu packen und alle privaten Daten vom Rechner zu löschen. Ihre Kollegen scheinen in Mittagspause zu sein, jedenfalls nickt Janni auf dem Weg raus nur der Empfangsdame zu, die als einzige auf ihrem Platz sitzt. Es ist alles ganz unkompliziert. Die perfekte Trennung, denkt sie anerkennend. Und wartet mit den Tränen, bis sie auf der Straße steht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Stefanie Adamitz
12. November 2023Literatur,LyrikfreiVERS,Stefanie Adamitz
flugversuche. eine utopie.
in jeder wohnung wackeln blätterschatten
rauschen blätterzucken
zappeln kleine schattenkinder
sprühen chancen, setzen samen
wuchern üppig feuchte zonen
decken sanft mit licht
was noch nicht
in jeder wohnung wohnt ein komposthaufen
nahrhaft prall und weit und breit
gefüllt mit euren sanften blicken
und tiere atmen schlafes wind
der eine trägt. wohin?
in jeder wohnung wächst ein pflanzenkeim
keimt jeden tag ein neues sein
kein reim,
eine braucht nur sein.
sein weichstes und innerstes
ein pelz aus dir
in jeder wohnung traut eine sich jetzt
ICH zu sagen
das ist deine stimme:
ich bin in jeder wohnung
ich bin ein wort, das dir gefällt
das du sagst und dann im hall
schnallst du seine flügel an
aus jeder wohnung starten flugversuche
wachsen schanzen wacklig in den wind
jedes haus ein igel mit gespreizten stacheln
worte schallen, treiben auf
flieg hoch hinaus und
nimm mich mit
ich bin ein wort im zappelnden wind
im blätternen rauschen
bin ich schatten und licht
bin ich keim und kompost
bin ich zappeln und wind
in jeder wohnung wackel ich blätterschatten
rausche zuckend
und zappel kleine schattenkinder
bin der pelz, der um dich liegt
und dein schatten,
vor dem du dich erschreckst
und lachst
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>