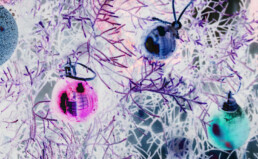22 | Sofie Morin
Das war ein Jahr:
Im Dialog mit Frauen
der Poesie ist
Aufgaben gestellt
die ich mir erfülle
Da ist mehr als das Treiben rundum
Gesichter leuchten heraus und ich
halte meine Mitte ganz still
damit sie da bleiben
Zuneigung verschenkt sich selbst
Außen toben Geschehnisse
die Sendungen sprengen
Wir fassen unser Glück kaum
unbeschadet zu sein
Unsere Uhren tragen rote Nasen
wenn wir Schmerz durchtauchen
Das Schicksal ist milde sonntags
in Zusammenkünften zuweilen ein Gelingen
das in keinen Wochentag je passt
Oder zwischen hochgewachsenen Stämmen Wege
die einsam gut sind
Ich weiß manche durchschreiten Wälder
um Geister zu vertreiben
Ich aber will sie anlocken
in meinen Kreis allesamt
will nichts weiter als Verbindungen
die sich verstehen
auf Wölbungen hin zum Verzeihen
Liebeleien mit Wuchsformen
bestimmen die Monatsfolge:
windberuhigte Schwüre
hellglühendes Verständnis
büschelweises Sprießen
Maultrommeln und ein Flirren
um die Mundränder
Ich kenne diese Melodie
der Hund meiner Kindheit
wird in ihr durchscheinend wie gläsern
Ich huldige den kalten Wintern
die Glaubenssätze verheizen
Von einer Taglichte zu nächsten
frischgepflügte Äcker und Sonnwendfeuer
Die Fackel in meiner Hand entzündet
Gangarten der Fantasie erprobt
Jede Eitelkeit gibt schließlich
dem Schneedruck nach
Das ist alles
Und wenn ich fertiggeschrieben habe
koche ich all meinen Kindern eine Suppe
schreibe unser Zusammensein hinein
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
3 | Sofie Morin
Falten aufspüren .:. Tag und Nacht
Wir kennen Flügelschläge, oder Reissäcke in anderen Erdteilen, die ich mir so gern verbitten will umzufallen an Weltenden. Wir kennen die Geschichten von feinsten Luftbewegungen, die gar Tornados auslösen, über absurde Entfernungen, die auf keine Landkarte mehr passen.
Diese oder jene Effekte, die wirken, schmetterlingsgleich über jegliche Vernunft hinweg, die wir uns so bitter erarbeitet haben. In der Meteorologie, und überhaupt, wünsche ich mir verstehbare Zeugnisse intelligenten Lebens und lieber keine Unvorhersehbarkeit. Besser Konvektionsströme sauber berechnen, als Divergenzen aushalten müssen.
In meinem Garten vor allem wünsche ich nur sauber angepflanzte Lieblichkeit und nicht mehr zwischen uns als die Flügelspannweite eines freundlichen Falters.
Aber so einfach ist das nicht, denn je genauer ich hinsehe, umso mehr erkenne ich von der Zerbrechlichkeit dieser und jener Schuppen, die sich unter der leisesten Berührung der Fallsucht ergeben. Es hilft nichts, das alles nicht wissen zu wollen, nichts von Tagesrändern und Lebensspannen, die so gering bemessen, dass nur ihr farbensprühendes Aufglühen schon alles vom nahen Ende her beweist. Nichts hilft es, das aufzuspüren, was sich faltet, wie Flügeldecken, wie Zellen, wie die Entfaltung des Lebens nur unter anderem aus mir. Wie all das, was wir vernünftig glauben.
Lieber will ich angemessen ungeduldig sein, mit mir und dem Sprießen, mit dem Überdauern und Tilgen von all der Schuld, die wir auf uns geladen haben mit dieser einen irrigen Idee, die Erde untertan.
Doch sind es zunächst nicht die Wesen des Tages, die meine Zuneigung an sich binden. Der unstete Schmetterlingsflug ist mir kein gutes Beispiel und auch andere vernunftbegabte Menschen sind mir bekannt, die ihn daher verabscheuen, wie das notwendige Aufspüren der Falten selbst.
Die Vermutung liegt nah, wie immer, der Fokus aufs Menschliche, das nicht ohne weiteres human ist, wäre die Wiege dieser falschverstandenen Reflektion. Auch wenn der Ursprung dieser Abneigung zuweilen mit der mutmaßlichen tierischen Effekthascherei begründet wird. Aufreibende Buntsucht und flatterhafte Bühnengeilheit, sagen sie, würden den Abgeneigten die Tagfalter zutiefst unsympathisch machen.
Da loben wir uns doch die Unscheinbaren, welche die Nächte nicht heller machen, als sie es sind. Solche Falter, die auf innere Werte statt auf Farbfeuerwerke setzen. Tarnfarbig halten sie der Ordnung die Treue und falten ihre Flügel stets höflich auf nach Gebrauch. Sie mögen fälschlich als Spinner, Glucken oder verunglimpfend als Nonnen oder Widderchen bezeichnet werden, doch für mich sind sie die wahren Heldinnen und Schmetterlinge, allesamt Schwärmer!
Neueste Forschungen zu Nachtfaltern besagen wohl, sie seien bloß fürs menschliche Auge eintönig gefärbt. In Wahrheit jedoch würden sie so schuppentreu schillern, wie unsere Hinwendung zur Erde, die doch insgeheim innig ist. Kein Faltenwurf in der Wirklichkeit käme dagegen an, wenn einmal die Einfühlung entfesselt wäre, die uns das drohende Fehlen rundum sichtbar mache. Darauf will ich nicht warten!
So stelle ich mich vor diese Mitgeschöpfe und halte kein Maß an sie, das kein Tageslicht kennt. Ich schürfe nach Gründen und belasse sie bei sich wie die Flugfähigkeit unserer Träume. Nichts soll dazu dienen sich die Welt anzueignen, deren Teil wir sind. Ich stelle die Freiheit im Lichtmikroskop scharf und nehme den Zeichenstift in die Hand und nichts sonst.
Und alles genaue Hinsehen ist, du weißt schon, ist Liebe und Frieden daher. Und ich denke, ginge es uns so miteinander!
.
Sofie Morin
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiVERS | Sofie Morin
Pilze, ach! (Fungus gemitus)
Ach, Pilze! Geflecht aus Hochmut und verwegenen Träumen. Und keiner gleicht sich. Hörnling bestimmt die Nuancen meiner Regungen je, Erdsterne verklären mir die Zukunft, Morchel kleidet meinen Stolz innen aus. Und Täubling klingt nach dem Spickzettel eines Minnesängers. Nachts, wenn keiner hinschaut, verschlingt er rohe Eier ganz.
Ach, Pilze! Bissfestes Gebaren, beinahe fleischlich, so wölbt sich der Pilzkörper einem Verlangen entgegen, nach Erdgeruch und klebrigen Texturen von Raunächten. So sind sie und so, schießen geweihhoch zwischen Wurzelfingern aus dem Erdreich, durchstoßen mit grellen Farben den moossatten Luftraum, verströmen Sporen wie Milchstraßen in die sichtbare und unsichtbare Welt hinter meinen Augenlidern.
Ach, Pilze! Von oben besehen mag euer Wuchs verstehbar sein, unterirdisch aber, da durchpflügt ihr Wahrheit um Wahrheit nach sternenfernen Gefilden, die Ursuppe, der wir alle entstammen. Und nichts wird gesagt von euren Schleimhäuten, nichts von den prekären Bündnissen, nichts von der Ungewissheit, mit der wir euch pflanzlich anreden. Viel aber von den Lamellen, von der Genießbarkeit und von euren Kappen, wo sie Eicheln nicht ähneln, und wo sie das tun.
Ach, Pilze! Ich singe euch Hymnen von fleischlicher Querung des engumzäunten Begehrens. Nichts, keine Lamelle, keine Rundung widerspricht mir. Die dünne Haut über dem prallen Körper, auch die wird nicht mehr normal sein, wenn wir einander aufs Genaueste besehen haben, Falte um Falte aus der Ummantelung gebügelt, bis wir alle so lustvoll anders sind wie unser eigenes Wollen.
Ach, Pilze! Geflecht aus Hochmut und verwegenen Träumen. Keiner gleicht euch wie ich. Im Herbarium halten wirs miteinander nicht aus, die Feldforschung aber unser Terrain. Aus dem Waldboden taucht ein Vater Erdfrüchte, die mir verborgen waren, und ich spüre es ist meiner. Seine Pilzgerichte lehren mich sachte, Tochter zu sein.
.
Auszug aus: „Liebeleien mit Wuchsformen. Eine translibidinöse Pflanzenkunde.“
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
5 | Sofie Morin
Erster Advent
Der Advent ist unser Refugium. Die kerzenwarmen Grüße hat selbst das Löschpapier nicht verhärmt. Die Karten baumelnd an der Leine über dem Kamin, rotbebändert wie verknotete Zuversicht. Gesammelte Trophäen der Mitmenschlichkeit, saugen sie sich voll mit mistelumkränzten Blicken. Wie tief die Hoffnungen auch hängen mögen, wachsende Vorratshaltung der Wünsche. Sie gehen uns nie aus.
In der Küche wohnt das Leben selbst. Mutters Teig beatmet unsere Sehnsucht. Ihre Zuneigung flüssiges Metall. Insgeheim schlinge ich die Kekse noch warm hinunter. So gehen sie in mir auf wie kein Same je, und mein Körper wird zur Stadt. Ähnlich der, die unweit im Tal flackert. Uns lockt sie nicht. Wir bleiben im Territorium unserer Weiblichkeit.
Großmutter klopft ans Fenster und hat heute den Schnee dabei, den der Wolf sich aus dem Fell geschüttelt hat. Lässt ihn unterm Gejohle der Schwestern zu unseren Füßen auf den Küchenboden rieseln. Ein tiefes Gurren aus nahenden Raunächten kommt mit ihm ins Haus.
Ihr leichtes Gepäck hat sie dabei nicht verraten, sie trug die alte Mär gewandt in der Kraxn. Auf dem Steingut schmelzen die Schneekristalle passend zum Aggregatszustand meiner Sinne. Kein Geruch enthüllt die wilde Natur. Ich sehe mich um und bemerke keine Veränderung. Mutter wischt den See mit ihrer Nachsicht auf. Dieses Augenzwinkern haben wir an ihr noch nie gesehen. Gewiss hat sie im Fell der Nacht die Habergeiß gewittert.
Im oberen Stock die Tante in emsiger Bettstatt zugange. Wir hören sie gut und singen altbekannte Lieder darüber hinweg. Kein Mann habe ihre Lust entstellt. Und uns hat die Mutter vor den Perchten gewarnt!
Um den Küchentisch scharen wir Stoßgebete wie Kinderreime, während das Verlangen unaufhaltsam in uns tropft. Übers Stiegengeländer flocken Sporen der Leidenschaft zu uns herunter, vermischen sich schlierig mit dem Duft aus Großmutters Kaffeemühle. So unschuldig wie möglich sehen wir uns um, ob alles beim Alten geblieben wäre.
Zwiebelmuster aufs Porzellan gemalt und das Begehren an die Wand. Wir lösen einander das Haar. Der Zirbenkranz in der Tischmitte flicht unser Wissen zu einem einzigen Zopf. Lodernd
brennt darauf die erste Kerze.
Zweiter Advent
Tagesanbruch. Wir benennen nicht, was aus den Wäldern steigt. Wie Nebel, die Reste des vorangegangenen Tages und die Hütten halten darunter die Luft an. Aus unserem Schornstein aber steigt Rauch, dessen Schatten uns der Mond auf die Schneedecke legt. Zögerlich hebt sich die Nacht vom ermatteten Firn. Tief die Spuren johlender Schritte darin. Ihr Kettengerassel klingt uns noch in den Ohren, das schwere Klopfen an die Holztür, vom Verlangen, das Einlass begehrt. Glücklich haben die sorgsam geflochtenen Zöpfe uns davor nicht bewahrt.
Wir Schwestern wollen alles sehen. Sowie wir unsere Nasen an die Scheiben pressen, schmelzen die Eiskristalle. Draußen lichten sich unsere Sehnsüchte über dem Tal.
Dunstschwaden ziehen am alten Flusslauf entlang. Erinnerungsfetzen der Geschöpfe, die mit uns leben. Jäh ruft der Eichelhäher, wenn unsere Blicke die Baumgrenze überschreiten. Der Föhnwind hat die Perchten über die Bergrücken getrieben, heute kommt der Nikolo. Ich will über die Alm sehen, bis dahin, wo ich jüngst Haselruten geschnitten, ihr Mark mit meinem Monatsblut gefüllt. Zwischen Wurzelwerk ersteht die Stiefmutter aus Alraunen auf. Ihr Rauchwerk ist handverlesen. Sie betont jedes Wort wie ihr letztes: Alles, was uns wahrhaft gehört, ist geborgt von einem höheren Stern.
Das Mühlrad am Haus dreht sich und dreht uns. Ein leiser Windhauch durch Fensterritzen lässt uns wissen, worin wir geborgen sind. Du irrst dich, klagt die Schwester, nicht Mutterns
Nachsicht war es, ich habe den Schnee vom Küchenboden aufgeleckt!
Horch, Stiegenholzknarren. Herab steigt die Tante in neuem Gewand. Kein Ring an ihrem Finger weist sie aus. Staunend befühlen wir das niegekannte Stickwerk auf ihrer Walkjacke. Fäden aus vielen Jahren gesponnen. Voll Zuversicht bürstet sie sich die Vergangenheit aus dem Haar. Alles Brauchtum ist sinnlich, sagt sie. Wie auf ein Stichwort unter der Hörschwelle holt die Mutter das Kletzenbrot aus dem Ofen. Ob wir rauskönnen, fragen wir, nun, da die Nächte nicht mehr rau sind. Mutter und Tante sehen sich an und brechen in unbändiges Gelächter aus, das die Stube durchsprüht. Wie Wunderkerzen, flüstert die Jüngste und klatscht in die Hände. Ich verstehe den Mond nicht mehr, sagt die andere und schnäuzt sich in ihre Schürze. Wir Schwestern haben uns allzu lange nicht an den Händen gehalten, denke ich und tue es beidseits. Die Hoffnung reicht bis zum Esstisch. Und als läge uns nichts näher, zünden wir darauf die zweite Kerze an.
Dritter Advent
Das Feuer im Ofen ist fast heruntergebrannt. In den welligen Scheiben der Holzveranda brandet das Morgenrot. Tunkt das Haus in einen neuen Tag, noch bevor es verlischt. Ich lege drei Scheite nach, für jede Generation eines. Du hast die Urli vergessen, schimpft meine Schwester, und ich blase beschämt in die Glut. Zahllose Ahninnen, so viele Scheite hast du nicht, sagt die Großmutter und ihre Stimme war nie heller. Unter ihren kundigen Handgriffen wacht die Küche auf. Die Teekanne wiegt beinahe nichts. Nicht in ihren Händen, die einst Tag um Tag Gewänder über die Wäschehobel geschrubbt, weitab des Flussbetts.
Die Sonnenwende naht und der Schnee ist vor der Zeit getaut. Mir gefällt nicht alles, was darunter zum Vorschein kommt, doch ich weine ihm nicht nach. Großmutter kleidet sich in die Farben des Waldes. Eines Tages wird sie nicht zurückkommen. Wimpernumrandet ihr letzter Gruß und ihre Sanftmut bleibt. Käferbrut wird sich von uns nähren, lacht sie unlängst.
Meine Schwester meint, ihre Bluse müsse wohl sauber geworden sein. Atemwolken begleiten sie in die Waschküche. Ihre Herzhaut weicht nicht zurück. Sie trägt meine Bewunderung wie eine Zierde zum Festtag. Ich atme tief durch und gehe hinaus, Feuerholz holen, bevor der Stoß kippt. Kein Knirschen mehr unter den Schuhen. Die Erde ist scheinbar wieder näher gerückt. Stein und Stein schichte ich auf den bemoosten Baumstumpf. Opfergaben an die Treulosigkeit meiner Trauer. Darunter liegt das Tier begraben. Unser Streit darum ist beigelegt. Die Nachsicht hat der Mutter eine Kette um den Nacken gelegt, die alles andere ist als ein Hundehalsband. Der Großmutter hätte das Funkeln gefallen. Gib es nur immer weiter, sagt die Mutter und streicht der Ältesten übers Haar. Die Entbehrungen des Jahres sind über den Blutmond vergessen. Noch ein Viertel, sagt die Mutter. Und wir sehen zu, wie der Germteig beim Ofen aufgeht, wo die Katze am liebsten liegt. Wir haben genug, sagt sie und schlägt den Striezel ins Tuch. Im Tal raufen die Buben um den Sterz, weiß sie und wir mit ihr: Entfesselte Kräfte rauben unseren Mut nicht! Morgen zieht sie ihre Schuhbänder fest.
Der Bach, sonst ein Rinnsal, ist von der Schneeschmelze angeschwollen. Die Holzschaufeln des Mühlrads trinken sich gurgelnd satt und die Jüngste schlürft auf Mutters Schoß Zuversicht aus ihrem Becher. Ich schließe die Holztür mit dem Winterwind hinter mir. Ein Luftzug, der wie meine Großmutter heißt, ist mit mir gekommen und hat einen Docht ausgeblasen. Nicht die erste Kerze, nicht die dritte, frisch angezündete. Die zweite ist es. Die Zeit tut, als wäre nichts geschehen – bald schon, bald! – und lässt uns lichter auflodern.
Vierter Advent
Das ist die letzte lange Nacht. Wir alle vollziehen die uns verbliebenen Rituale der Dunkelheit. Atemluft zwischen Handflächen gewärmt, schüren wir eine Glut, die sich tags vor uns verbergen mag, winden Bänder um entflohene Mythen. Auf dem Fensterbrett die Stille in Milchschalen gegossen, die letzte Anrufung, um die wir sicher wissen. Wenn auch die Großmutter gegangen sein wird, so bleiben wir ruchbar im Schwesternuniversum. Und jede unserer Gesten sei angetan, die Wiederkehr der erstarkenden Sonne zu bezeugen.
Morgen gleichen sich Tag und Nacht. Lockend ziehen Schwaden neuen Glücks dicht an der Hauswand vorbei. Nichts hat uns darauf vorbereitet. Vogelpaare streiten in der Dämmerung lautstark um den Nachwuchs, der ausbleibt. Wartet noch, wartet, will ich sie trösten, die lichte Zeit kommt bald zurück! Sie glauben nicht mir, sondern allein der Witterung der Zeit selbst. Ahnen nicht, dass mich nichts sonst derart verwirrt, wie ihr steter Verlauf.
Was wissen wir schon? Meist sehen wir die Welt durch unser Fenster, schicken unseren Blick hinaus, tags mehr als nachts. Aus Scheiben, das Werk alter Hände, spiegelnd aus Quarzsand getaucht. Heften Zwirnfäden an unsere Bestimmung, verlassen uns auf die Saligen. Dass sie von den Gletschern herabsteigen, uns innewohnen, sobald die Welt aus dem Nebel fällt.
Ich wage einen Schritt vor die Tür. Jetzt ist da ein Glitzern von tanzenden Schneeflocken rund um mich. Tränen kristallisieren auf meinen Wangen. Ich gehe bis zur Grenze. Dort treffe ich sie. Sie bietet mir Obst an, das ich zunächst nicht annehmen will. Einen glasierten Apfel, glänzend und ahnungsvoll süß knackend. Sie lacht, beißt selbst hinein. Die Apfelhaut rotglühend in ihrem Mund wie das Schwesternzahnfleisch. Sie bückt sich, die Haare fallen ihr über die Schultern nach vorn, ich glaube es sind meine, formt mit bloßen Händen aus der Erde neues Leben. Reicht es mir. Das und die Bitte, es unterm Gaumendach zu verwahren.
Zurück in der Stube sehe ich meine Schwestern verändert an. Die Mutter birgt ihr Gesicht in Kinderhaut weich. Am Tisch ist mein Platz frei. Die Karten liegen über ihn verstreut, wie kleine Zündflammen, schmelzen die Schatten der Schriftzeichen, über Jahre ins Holz gekerbt. Ihr Abdruck ist weithin nahbar. Wir wissen, was diese Umarmung bedeutet und behängen die Äste. Das Christkind zählt drei Tage von der Sonnenwende hinauf. Verlässliches Uhrwerk meiner Geborgenheit. Die baumelnden Schokokugeln in weißes Fransenpapier geschlagen, sind ihre Zahnräder. Vier Kerzen zitieren uns die Himmelsrichtungen. Morgen gleichen sich Tag und Nacht. Die Feuer werden die Hänge hell erleuchten. Alles hat uns darauf vorbereitet.
.
Sofie Morin
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
24 | Sofie Morin
Wie der Christbaum schwimmen lernte, der hätte der unsrige werden sollen
Nur diesen einen Wunsch habe ich, nur diesen, nichts sonst wünsche ich mir zu Weihnachten, habe ich zu dir gesagt: Lass uns zusammen einen Baum aussuchen, habe ich gesagt, für uns. Und mir den Baum dabei schon als einen geschmückten gedacht, und das gemeinsame Aussuchen so, als gäbe es uns mit einem gemeinsamen Heim rund um diesen Baum.
Mich daran zu gewöhnen, dass du in letzter Minute doch nicht kannst, dazu habe ich bereits genügend Zeit gehabt. Anscheinend nicht ausreichend. Vorhin noch, allein vor dem Christbaumstand, habe ich meine Zuversicht durchschwommen, und womöglich auch die deine. Quer zur Fließrichtung, das in jedem Fall. Jedenfalls in dem Fall unseres verfehlten Zusammentreffens, wieder einmal.
Es ist wahr, finde ich nun, so wie ich den Baum unverhüllt durch die Straßen schleppe, so wie ich mich dahinschleppe und den Baum nur als Vorwand, ohne dich. Es ist wahr, die besinnungslose Freude kennt uns kaum mehr. Ansatzlos heben wir uns von allem ab, was wir einst waren und nie sein werden. Die Ringe an unseren Fingern haben ab dem ersten Augenblick von unserer komplizierten Verfassung gezeugt: nicht zusammenpassend. Wohl haben wir vorgeblich unwissend getan, als hätten wir uns bei unseren Treueschwüren versprochen. Und dennoch, eine Tatsache, nicht nur an Feiertagen: Du wie ich einem anderen Menschen zugetan.
Das Ausharren und Zuwarten seither unsere Lebensaufgabe. Oft umsonst. Darum also, der Baum, den ich allein über den losen Neuschnee schleife, den Baum, den du nicht mit mir trägst, verzweifelt, als ginge es darum ein Wettrennen zu gewinnen. Auf befestigten Straßen eile ich, als könnte mich das retten, oder auch nur etwas von uns, und denke an die Zeit, als Anfang war und Frühling freilich und meine Verfügbarkeit zum Beispiel durchaus zur Debatte gestanden ist. Mit zusammengebissenen Zähnen haben wir uns einst einander vorgestellt. Um das Schlimmste zu verhüten, das wir noch kaum ahnten, das Schlimmste, das meine Offenbarung sein mochte oder deine.
Ich und der Baum bewegen sich über die Friedensbrücke, als gäbe es keine andere denn diese schicksalshafte Querung. Wiewohl die Richtung stimmt, unterwegs zu dir, ist meine Lust entvölkert. Ich denke an Wildbienen, die ich den domestizierten immer schon vorgezogen habe, und denke bereits an unseren Baum getunkt in ein Das-wäre-auch-zu-schön-gewesen! Und spüre ihn entgleiten, den Christbaum, der hätte der unsrige werden sollen, aus meinen verkrampften Händen, hinab, als wäre da kein Geländer, in die Donau, wo ich ihn kurz darauf treiben sehe, wie unsere Zuversicht: gegen die Strömung.
.
Sofie Morin
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiVERS | Sofie Morin, Marion Tauschwitz, Jutta von Ochsenstein, Dorina Marlen Heller
Amerika zeigt: Flagge
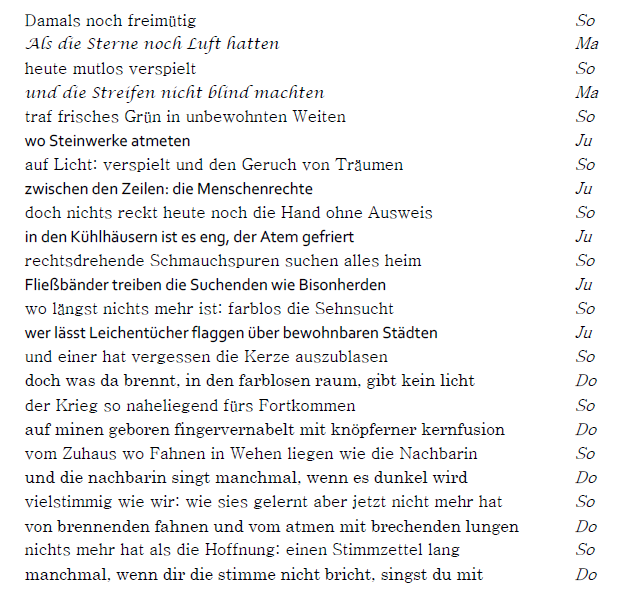
.
Sofie Morin (So), Marion Tauschwitz (Ma), Jutta von Ochsenstein (Ju), Dorina Marlen Heller (Do)
zu Frank Lloyd Wright „Composition in light”, Interpretation der amerikanischen Flagge,
Glasfenster für das Landhaus von Avery Coonley, Riverside, Illinois, um 1912,
(Glas, Zinkstege, bemalter Holzrahmen, 135,6 x 30,5cm)
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Dorina Marlen Heller & Sofie Morin
bachmann*brennt*immer
ein lyrischer Funkenflug zwischen Dorina Marlen Heller und Sofie Morin
*bachmann brennt*
sie brannte in der nummer 66
sie ist dort verglimmt wo
man den tiber schon riechen kann
jeden tag der boccanera in den
schwarzen schlund gestiegen
treppe rauf treppe runter
immer die wörter im kopf
die wörter im mund
immer im wettlauf mit der
verhassten gestundeten zeit
im traum wieder an den gittern gerüttelt
seine hände halten sie nicht
schon lange nicht mehr
morgens für den ersten rauchlungenzug
den kopf auf die via giulia gebeugt
ein paar häuser weiter der wutgesang delle donne
no alle isteriche nel movimento
no algioca di potere fra donne
sie nimmt noch einen zug
glühende asche auf den küchenboden
heute nur ein brandfleck
morgen
brennts.
.
.
.
denn eine brennt*immer
und längst ist nichts gelöscht
was nur so scheint
wie wir und wir und
unsere brandgefährlichen Reden
Das sind all unsere Todesarten
heute oder war es gestern
morgen bestimmt immerdar festgelegt
auf den HöllenschlundzwischenunserenBeinen
dunkle Erdteile wie Venus
die uns bewohnt uns insbesondere
wie Rausch und Sperrung im Mund
In einer Zeit von unregelmäßiger Bedeutung
schrieb sie und sie beschrieb sie
auf dem Spielfeld Sprache fraglos zumutbar
Erklär mir: Leben
Denn kein treffenderes Blatt schwamm je
einer Mündung entgegen
nicht eines darunter das nicht Bläue gewesen wäre
Und was wenn es nicht mehr reicht
aus dem Zimmer zu gehen
wenn das Ersticken bereits anfängt?
Denn irgendwann reicht es
Nicht mehr.
.
Ingeborg Bachmann verbrannte am 17. Oktober 1973 in ihrer Wohnung in Rom, in der Via Giulia Nr. 66.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at