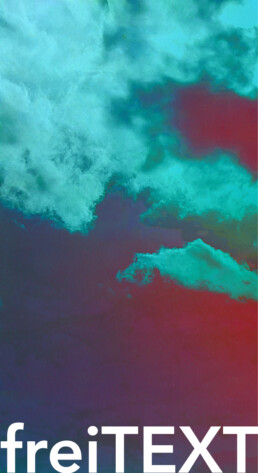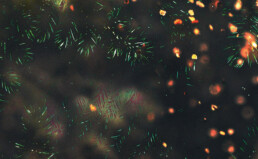1 | Leonie Höckbert
Mehrfamilienhausfassade
Später in der Nacht sind oft nur die Fenster der höheren Stockwerke noch hell. Einen Blick in die Fenster auf Höhe des Eingangs kann nur werfen, wer bereits nach Einbruch der Dunkelheit auf der Plastikbank am gegenüberliegenden Straßenrand Platz nimmt. Vielleicht wohnen unten eher ältere Leute, die die Treppen in den fünften Stock nicht mehr schaffen würden. Vielleicht lassen die Menschen unten die Lichter aus, damit Passanten nicht durch die dünnen Gardinen direkt mit neugierigen Blicken auf ihre Esstische springen können. Vielleicht wohnen auch nur zufällig weiter oben die Nachteulen, Schichtarbeiter, Schlaflosen und Rumtreiber. Links und rechts des Treppenhauses hat jede Wohnung drei Fenster, von denen eins immer zur Küche gehört. Nach neun brennt in den Küchenfenstern am seltensten Licht. Dafür hängen dort meistens keine Gardinen oder sie sind beiseitegeschoben. In einer Wohnung steht der Kühlschrank direkt am Fenster und seine Tür verdeckt einen guten Teil davon, wenn sie geöffnet wird. Sie wird oft geöffnet, vermutlich um immer wieder Kleinigkeiten rauszunehmen, in der Wohnung wohnen zwei oder drei Leute zusammen, Studierende vermutlich, manchmal kocht auch jemand, aber eher selten, und die anderen beiden Fenster scheinen nicht den Blick auf ein Wohnzimmer freizugeben, ihre Poster und Kleiderschränke wirken mit Betrachtungsabstand wie in Jugendzimmern, als hätten die Bewohnenden nur diese paar Quadratmeter für alle ihre Selbstausdrucksbedürfnisse.
Ein Fenster im zweiten Stock ist ein Kinderschlafzimmer, meistens ist das Licht aus, wenn die Dunkelheit kommt, unterbrochen nur von wenigen Minuten, in denen manchmal jemand das verschlafene Kind zum Fenster trägt, wahrscheinlich in der Absicht, es wieder in den Schlaf zu wiegen, aus dem es von rastlosen Träumen gerissen wurde. Die Elterngesichter, deren Blick ohne Ankerpunkt auf die gegenüberliegende Fassade trifft, wirken immer erschöpft, aber nie angestrengt. Valerie bewundert das, wenn sie die Beiden zufällig sieht. Meistens geht auch deren Wohnzimmerlicht lange vor vielen anderen des Hauses aus. Zwischen Valeries Füßen sammeln sich ihre ausgetretenen Zigaretten. Die hässlichen städtischen Bänke aus Plastik, das immer an irgendeiner Stelle von Jugendlichen mit dem Feuerzeug angebrannt und schmelzdeformiert wurde, haben den Vorteil, auch nachts nicht besonders kalt zu werden, anders als schickere Bänke aus Metall.
Eins weiter oben, auf der anderen Treppenhausseite gibt es noch andere Eltern. Valerie kennt ihre Gesichter nicht so gut, die Kinder sind schon älter und werden nicht mehr ans Fenster getragen. Sie kennt dafür ihre Stimmen, die hört man im Treppenhaus oft streiten, manchmal mit den Kindern, meistens miteinander, sie schreien sich mit der Rückhaltlosigkeit längst aufgegebener Schamgrenzen an, sie weichen den Blicken der Nachbarn im Treppenhaus nicht aus, Peinlichkeit ist lange zurückgelassen hinter ihrer Wut aufeinander. Durch die Wände, vom Echo des Treppenhauses verzerrt wie eine Megafondurchsage unter Wasser, ist nie auszumachen, worüber sie streiten, nur die erdrückende Atmosphäre des Nicht-Ausweichenkönnens schwappt unter der Wohnungstür hindurch. Manchmal weint eins der Kinder schrill und Valerie denkt, dass man sich einmischen muss, tut es aber nie. Die Wohnung der Familie sieht schon von außen zu voll aus, in den Fenstern hängen Dekoelemente, Traumfänger, auf den Scheiben kleben Windowcolor-Bilder, drinnen stapeln sich Kisten auf den Schränken, um den letzten Raum unter der Decke noch auszunutzen. Valerie stellt sich vor, wenn man die Fenster eines Raums öffnete, würde alles rauspurzeln, was drinnen zu viel ist: die ganzen Sachen, für die kein Platz ist und die ganzen Bedürfnisse, für die kein Raum bleibt. Sie fragt sich, ob dort deswegen auch im Sommer die Fenster immer geschlossen sein werden. Und hofft zugleich, hier nicht mehr zu sitzen, wenn der Winter vorbeigeht.
Das Fenster, das im ersten Stock im Schnitt am längsten hell bleibt, liegt in der Wohnung rechts von der Eingangstür. Dort lebt ein älterer Mann allein. Vielleicht hat er nachts Schwierigkeiten zu schlafen oder er ist einfach gerne lange wach. Sein Fernseher flackert heller auf die Gehwegplatten als das mürbe Licht seiner einzigen Energiesparlampe. Im Fenster sitzt manchmal eine Katze und starrt rüber zu Valerie, sie schauen einander in die Augen und Valerie kann nicht lesen, ob ihr Blick sagt: Ich verstehe dich, ich bewahre dein einsames Geheimnis – oder ob er sagt: Ich werde dich verraten, eines Tages werde ich dich im Treppenhaus verraten. Womöglich beobachtet die Katze sie auch nur aus Langeweile oder weil es ihr sympathisch ist, dass Valerie raucht, der alte Mann vor dem Fernseher raucht auch, Valerie hat ihn tagsüber schon mit dem Aschenbecher am offenen Fenster stehen sehen und nachts verdichten sich manchmal kleine Rauchschwaden in der Ecke, in der der Mann vor dem Fernseher zu sitzen scheint. Wenn die Katze nicht auf der Fensterbank liegt, liegt sie sicher auf seinem Schoß und bildet eine schnurrende Barriere gegen die Einsamkeit, gegen die auch die bekannten Gesichter im Fernsehprogramm nicht immer ankommen können.
Wenn Valeries Hände nicht von der Winterkälte zu steifgefroren wären, würde sie sich gerne Notizen machen, wer wann wie lange wach bleibt, wer zuletzt das Licht löscht und was sie über die Menschen dieser Wohnungen und deren Tageslichtleben weiß. Sie nährt den Verdacht, dass die traurigeren Geschichten hinter den schlaflosesten Fensterlidern wohnen. Aber vielleicht sind das auch nur die Räume, in die sie am liebsten schaut, die Leben, in die sie sich am liebsten projiziert aus ihrem Schutzraum aus Halbdunkelheit heraus. Heute wird sie nicht erfahren, wer zuletzt das Licht ausmacht, denn fast unterm Dach leuchtet ein Fenster auf, das sie nach drinnen winkt. Im vierten Stock hat Alexanders Wecker geklingelt und obwohl sie das von hier unten nicht sehen kann, weiß Valerie, dass er eben seine Arbeitskleidung für die Frühschicht zusammensucht. Sie zieht an ihrer letzten Zigarette, drückt sie zwischen den anderen aus und sammelt alle Stummel des Abends in der hohlen Hand, um sie in die Hausmülltonne zu werfen, bevor sie reingeht. Drinnen muss sie im Treppenhaus noch eine Weile stehenbleiben und Hände und Gesicht aufwärmen, damit Alexander nicht fragt, der verschlafene Alexander, der damit rechnet, dass sie wie immer um diese Zeit von der Spätschicht nach Hause kommt, der keine Ahnung hat, dass Valerie den Job gekündigt hat. Ein Teil von ihr bleibt draußen auf der Bank sitzen, schaut sich selbst in die Fenster und weiß schon genau, wie ihre Geschichte ausgehen wird.
.
Leonie Höckbert
.
Das Advent-mosaik ist dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Leonie Höckbert
Junimond
Janni träumt von der perfekten Trennung. Sie träumt davon, dass alles ganz unkompliziert sein kann. Wie in Filmen und Serien. Wo Paare, die jahrelang zusammen waren, sich einfach eines Abends an den Küchentisch setzen können und sagen können: Das war’s. Und dann geht einer von beiden und die andere bleibt am Küchentisch zurück und gießt sich ein Glas Wein ein und trinkt es nachdenklich, aber nicht unbedingt todtraurig, aus. In manchen Filmen, besonders in französischen, findet Janni, besprechen die in Trennung befindlichen Paare sogar ganz am Ende noch ganz Wesentliches, sagen dem Anderen nochmal ein paar ernste Worte über die Persönlichkeit oder das Verhalten oder das Leben und Beziehungen im Allgemeinen und dann entsteht daraus gar kein Streit oder tiefe Verletzung und Beleidigung, sondern ein wertschätzender Austausch, an dessen Ende sich die Trennung wie der ganz richtige Schritt für beide anfühlt. So soll das für Janni sein. Ohne Tränen. Wenigstens, bis die Szene im Film vorbei ist. Sie sehnt sich nach dem Moment nüchterner Klarheit, in dem beide Parteien zugleich erkennen: Aus uns wird nichts mehr. Wir sollten nachts kein Bett mehr teilen. Wir sollten morgens keinen Kaffee mehr füreinander machen. Die Formulierung eine Szene machen erscheint Janni sinnlos. Eine Szene nach ihren Vorstellungen wäre gerade das Gegenteil von dem, was gemeint ist.
Ihre Trennungsgeschichte hat in der fünften Klasse angefangen und ihre Standards gleich zu Beginn hoch angesetzt. Jonas aus der Parallelklasse hatte ihr in der großen Pause ein KitKat Chunky White gekauft. In der nächsten großen Pause hatten sie Händchen gehalten und sich nach der Schule darauf geeinigt, miteinander zu gehen. Ungefähr drei Wochen lang hatten sie Händchen gehalten und Schokoriegel geteilt, bis Jonas nach der Schule sagte, er wolle nicht mehr zusammen sein. Seine Freunde fänden, sie sollten sich küssen, aber er habe keine Lust da drauf. Janni hatte auch eigentlich keine Lust da drauf und genug Taschengeld, um sich selbst KitKat zu kaufen. Sie sagte okay, wir machen Schluss, und Jonas rannte zu seinen Freunden und mit ihnen zum Bus. Statt Enttäuschung hatte Janni eine gewisse Erleichterung gefühlt.
Eine Beziehung überhaupt anzufangen, ist die entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Trennung, deswegen sucht Janni immer wieder auf Dating-Plattformen nach Männern, von denen sie sich trennen kann. Jannis erste Beziehung im Studium ging zwei Jahre lang und als sie sich trennte, war es furchtbar, voller Tränen und Vorwürfe, Gemeinheiten und Selbsterniedrigung. Danach nahm sie sich vor, zu üben.
Sie betrachtet sich selbst auch als eine Art Trainingseinheit für ihre Kurzzeitpartner. Wie ein Kurs im Fitnessstudio oder bei der Volkshochschule. Wer mit ihr fertig ist, oder besser – mit wem sie fertig ist, der kann sich als weitergebildet betrachten und ist dementsprechend gewappnet für die nächste Beziehung. Dass eine Beziehung bestenfalls nicht vom Ende her anfängt, kommt Janni nicht in den Sinn. Heiraten ist für sie nur der Auftakt zu einer Trennung mit mehr Schritten.
Sie probiert verschiedene Methoden aus. Eine Trennung über Textnachricht kommt ihr zwar nicht so moralisch verworfen vor wie immer behauptet, ist aber auch nur die Fälschung des Gefühls, nach dem sie sucht. Sie hat es probiert und obwohl das für sie ruhig und überlegt abgelaufen ist, fehlt ihr die Perspektive des Verlassenen, der natürlich trotzdem völlig verzweifelt sein könnte. Die Trennung muss im Gespräch passieren. Am besten spontan, nicht von langer Hand geplant. Aus einem Impuls heraus, der den Partner auch ganz plötzlich erkennen lässt, dass sie wirklich nicht zusammenpassen. In einem nachlässig im Schlafzimmer versteckten Notizbuch dokumentiert Janni ihre Versuche. Es liegen immer einige Monate oder wenigstens Wochen zwischen den einzelnen Einträgen, um überhaupt einen gewissen Spannungsaufbau für die Trennungsübung sicherstellen zu können. Trotzdem sind zwei Versuche mit der etwas peinlichen Notiz versehen, dass die Internetbekanntschaft, der Janni die Trennung unterbreitete, bei diesem Anlass überhaupt das erste Mal davon gehört hat, dass sie zusammen gewesen wären.
In inzwischen einigen aktiven Jahren Forschung und Proben brachte sie es auf ungefähr zwölf ernstzunehmende Datensätze. Davon war genau eine Trennung auch nur in die Nähe einer soliden Filmszene gekommen. Da waren sie zu zweit nach sechs Monaten regelmäßiger Treffen in einem gerade aufblühenden Sommer in den Park gegangen und hatten so lange schweigend auf einer Parkbank gesessen, dass unumstößlich klar geworden war, dass alle weiteren Treffen drückende Stille wären, sie hatten sich nach sechs Monaten einfach nichts Neues mehr zu sagen. Er sagte, es wäre nicht unangenehm, mit ihr zu schweigen, aber er würde dabei auch nichts Besonderes fühlen. Janni bestätigte. Sie nahmen sich an der Hand und schwiegen noch, bis es dämmerte. Danke, dass du es angesprochen hast, sagte Janni, bevor sie in verschiedene Richtungen aufbrachen. Danke, dass du keine Szene gemacht hast, sagte der Mann, der in sechs Monaten anscheinend gar nichts über Janni gelernt hatte.
Einer ihrer Partner hat gefleht, sie solle ihn nicht verlassen. Drei haben sich von ihr getrennt, bevor sie ihre letzten Worte gut sortiert hatte. Zwei haben sie nach einigen Monaten geghosted und so ein auf andere Art besonders unbefriedigendes Ende geschaffen. Einem Mann hat sie zuvor von ihrer Sehnsucht nach der perfekten Trennung erzählt und als sie es dann versucht hat, hat er sich an das Gespräch erinnert und ist zynisch geworden. Die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht, die Orte sind falsch oder die Dinge, die gesagt werden, unpassend; das Gefühl von entromantisierender Ernüchterung ergibt sich nicht, wird oft überschattet von Jannis Erleichterung, eine ihr längst unbequem gewordene Übungsbeziehung endlich ihrem Zweck zuführen zu können. Viel zu oft wurde geweint. Das ist besonders falsch, dieser Schmerzausdruck, der eine unmittelbare Schuldzuweisung enthält. Wer sich gegenseitig nichts vorhält, sollte nicht heulen, findet Janni.
Auf der Arbeit klickt sie sich den ganzen Tag durch Excel-Tabellen. Neben ihr auf dem Schreibtisch liegt ihr Handy, stummgeschaltet, und leuchtet immer wieder auf, wenn sie eine Nachricht von Tinder oder Bumble bekommt. In der Phase nach einer Trennung wirft sie Netze in alle Richtungen aus, unterhält vier, fünf Konversationen parallel. Erst seit ein paar Wochen arbeitet sie in der Datenanalyse, es ist ihr erster Vollzeitjob, sie lernt viel für ihre eigenen Daten und notiert sich oft Analyseverfahren für den Privatgebrauch. Der Job ist ruhig genug, um nebenher fast identische Nachrichten an mehrere potentielle Trennungsübungspartner zu schicken.
Als der Chef sie Montag morgens ins Büro ruft, ist es das erste Mal, dass Janni den Raum wieder betritt seit ihrem Bewerbungsgespräch. Der Chef bietet ihr einen Kaffee an und einen der Stühle am Schreibtisch, keinen der gemütlichen Sessel in der Ecke. Als der Kaffee vor ihr steht, vor ihm nur ein Espresso, klappt er seinen Laptop zu und sagt, er wolle nicht drumherum reden. Ob sie sich bei ihnen in der Firma wohlfühle? Janni nickte, etwas überrascht von der Frage. „Wir haben nicht den Eindruck“, sagt der Chef und nippt am Espresso. „Sie bringen sich wenig ein und scheinen Schwierigkeiten mit dem Teamgeist unserer Einrichtung zu haben.“ Wer ist eigentlich „wir“, denkt Janni, während sie nichts sagt. „Leider muss ich ihnen mitteilen, dass wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Stellen in ihrem Arbeitsbereich einsparen müssen. Das bedeutet, dass wir uns von Ihnen verabschieden müssen, so leid es mir tut.“ Er trinkt seinen Espresso in einem Zug leer. „Können Sie das nachvollziehen?“ „Ja“, sagt Janni, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Sie sind noch in der Probezeit. Daher gilt ihre Kündigung fristlos. Ich möchte Sie bitten, ihren Platz aufzuräumen.“ Er steht auf und reicht ihr die Hand. „Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Weg.“
Janni lässt ihren Kaffee unberührt stehen und geht zurück zu ihrem Platz, wo ihre letzte Aufgabe noch auf dem Bildschirm offen ist. Es dauert nur wenige Minuten, ihr Handy, ihren Thermosbecher und ihre wenigen anderen privaten Gegenstände in ihre Tasche zu packen und alle privaten Daten vom Rechner zu löschen. Ihre Kollegen scheinen in Mittagspause zu sein, jedenfalls nickt Janni auf dem Weg raus nur der Empfangsdame zu, die als einzige auf ihrem Platz sitzt. Es ist alles ganz unkompliziert. Die perfekte Trennung, denkt sie anerkennend. Und wartet mit den Tränen, bis sie auf der Straße steht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
mosaik40 - auf zehenspitzen über das parkett
mosaik40 - auf zehenspitzen über das parkett
Sommer 2023
.
INTRO
„Hoffnung ist ein komisches Ding. […] Wenn du dir deine Hoffnungen genauer besiehst, wirst du vielleicht schockiert feststellen, dass sie in Wirklichkeit eine große turmähnliche Struktur aus Walknochen sind.“ (Margarita Athanasiou, aus dem Englischen von Jonas Linnebank, S. 36)
Wir setzen große Hoffnungen in diese Ausgabe. Es ist zwar eine Jubiläumsausgabe, aber irgendwie sind wir wenig zum Jubeln aufgelegt. Zum Teil liegt das sicher an politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die uns beschäftigen. Dann haben wir aber auch einiges an Arbeit, strukturieren intern um, teilen Verantwortlichkeiten neu auf, planen einen Umzug u.v.m.
„Und dann natürlich Texte, die alles vergessen lassen. Buchstaben erfühlen. Wörter im Gesamten. Es ist auch ein Einlassen, verlangt Offenheit, Aufmerksamkeit.“ (Sinnlichkeit*, S. 54)
Dieses Erfühlen, dieses Einlassen auf Texte, auf andere Lebensrealitäten und auf das jeweilige Gegenüber – das soll auf keinen Fall abhanden gehen; trotz allem Stress, Druck, Niedergeschlagenheit, Frust und was wir alle immer wieder – ob wir es wollen oder nicht – fühlen und womit wir in unserem Alltag sonst so konfrontiert sind. Rücksicht und Umsicht, die Menschlichkeit an sich, sollen uns in Tagen wie diesen nie abhanden kommen – auch wenn das bedeutet, manchmal nachts „auf Zehenspitzen über das Parkett“ (Michael Spyra, S. 24) zu schleichen.
Viel Freude mit dem Einlassen auf diese – sinnliche – 40. Ausgabe der mosaik.
euer mosaik
Inhalt
Umrandungen
Larissa Seide – Der Wassermann
Stefan Ebner – ich habe heute laut gedacht
Leonie Höckbert – Bahnansage für niemanden
Claudia Eilers – Hinter Glas
Trennungen
Sarah Hensel – Pass auf
Anna Fišerová – Aufspaltung
Lena Schätte – Husten
Muri Darida – Insomnia II
Michael Spyra – erste Inversion
Dazwischen
Charlotte Milsch – Kratzende Schleifen auf Sand
Paul Schömann – Wiedersehen
Selina Holešinsky – Die Welt von innen
Kea Lisanne Hinsch – Schneemagnetisch
Gloria Ballhause – Zäune
Kunststrecke von Levi Pritz
BABEL – Übersetzungen
Tote Körper als Handpuppen, ein Rucksack aus menschlicher Haut, ein Turm aus Walknochen, ein Gartenzwerg auf dem Kopf: Befremdlich, ja makaber, und doch hochpräzise und zutiefst poetisch sind die Bilder, die uns in den Texten der BABEL-Auswahl begegnen. In drastischer Sprache erzählen sie von Angst, Verlust und Tod, brennen sich in ihrer grotesken Metaphorik in unser Gehirn – und bleiben doch nicht ohne Ironie und sogar Leichtigkeit.
Margarita Athanasiou – Fear / Angst; Hopes / Hoffnung (Englisch)
Shai Schneider-Eilat – */* (hebräisch)
[foejәtõ]
Sinnlichkeit spielt bei der Erstellung, Erfahrung und Vermittlung von Literatur eine große Rolle. Literatur kann mit den Augen gelesen, mit den Ohren gehört, mit den Fingern erfühlt und noch auf viele andere Weisen erlebt werden. Wirken Texte, wenn sie mit mehreren Sinnen in euch eindringen, anders? Wenn ja: inwiefern? Lässt sich die Textwahrnehmung von einem Sinneseindruck in einen anderen „übersetzen“? Wenn ja: Was macht das mit einem Text?
Kreativraum mit Tara Meister
.
.
>> Infos, Leseprobe und Bestellen
11 | Leonie Höckbert
Der letzte Gang
Zu Weihnachten gab es in ihrer Familie traditionell sehr viel Essen und noch mehr Bemerkungen darüber, wie schlecht so viel Essen ist. Mit etwas Glück gab es für Louisa auch den ein oder anderen ganz persönlichen Kommentar über ihr diesjähriges Weihnachtsgewicht. Wie bei der Gans, nur andersrum. Man wartete offenbar auf die mageren Jahre.
Ihre Kindheit war glücklich gewesen, glaubte sie, aber durch die letzten Jahre des ersten Erwachsenenalters fraß sich die wachsende Vermutung, dass sie bei damaligen Familienfeiern nur durchs Kindsein geschützt worden war vor den verstecken Spitzen und offenen Attacken der Verwandten. Sie saß zwischen den Beinen des Couchtischs und den Beinen der Großeltern auf dem Boden und was gesprochen wurde, ging buchstäblich über ihren Kopf hinweg. An die Weihnachtsfeste dieser Jahre dachte sie mit einem kerzenwachsweichen Gefühl zurück. Der Geruch der Tanne und des Parfüms ihrer Mutter und der von Holz, das im Kamin verbrannte, das alles gehörte so sehr zum Damals, dass Louisa es jetzt unpassend fand, an diesem Weihnachten, wo der Kamin genauso brannte und ihre Mutter dasselbe Parfüm benutzte und Tannen so rochen, wie sie es immer tun würden.
Louisa war in diesem Jahr aus Weihnachten rausgewachsen. Wie für jede Jahr buchte sie ein Zugticket nach Hause, wo ihr Vater sie mit jährlich müderem Gesicht abholen würde. Vor dem Kleiderschrank hatte sie ängstlich überlegt, welche Bemerkungen ihre Kleiderwahl provozieren könnte, und hatte dann direkt unterm Brustbein eine kleine Wut über diese Sorge entdeckt. Ein kleiner bitterer Zorn, den sie später in Ruhe genauer betrachten wollte. Sie spürte die Last der Vorweihnachtszeit, die man von Kindern fernhält. Die vielen Stunden auf der Suche nach passenden Geschenken, die sie sich leisten konnte, erschöpften sie und vom Plätzchenbacken bekam sie Rückenschmerzen. Niemand hatte sie nach ihrer Wunschliste gefragt. Weihnachten zehrte ihren Dezember auf und Louisa betrank sich zum Ausgleich mehrfach am Glühweinstand. Während sie schwallweise Glühwein erbrach, dachte sie daran, wie grotesk es war, nach inneren Blutungen auszusehen, aber nach den Gewürzen des Dr. Oetker Aktions-Aufstellers zu riechen.
Erst im Zug zu ihrer Familie fiel ihr die kleine Wut wieder ein. Sie war noch da. Louisa schaute durch ihr Spiegelbild im Zugfenster hindurch und wunderte sich. Sie freute sich nur auf ihren kleinen Neffen. Dem könnte sie im passenden Moment beiläufig die Ohren zuhalten, wenn sich die Erwachsenen als Komplimente getarnte Beleidigungen ins Gesicht sagten.
Abgesehen von ihren Eltern gab es für sie eigentlich kaum einen Grund, jedes Jahr wieder mit wachsenden Heiligabendbefürchtungen in den Zug zu steigen, dachte sie. Der Gedanke zog zusammen mit den Lichtern der Vorstadt an ihr vorbei. In ihrem Koffer fielen die Plätzchen mit den Streuseln im Zuckerguss durcheinander und brachen den Zimtsternen die Ecken ab. Ihr Ankommen wurde etwas leichter, als ihr Vater sie schon im Festtagshemd am Bahnsteig umarmte und nach demselben Rasierwasser roch wie vor zwanzig Jahren. Er sah nicht bedeutend müder aus als bei ihrem letzten Besuch. Weihnachten hatte keine Vorboten gesandt.
Der erste Gang bestand aus Salat und noch vergleichbar frischer Wiedersehensfreude. Selbst enge Verwandte haben sich alle paar Monate nochmal für eine Stunde etwas zu erzählen. Der Salat war sehr gut. Ihre Cousins waren sehr witzig und erzählten viele Geschichten aus ihrer neu gegründeten Firma. Als sie erzählten, dass sie und die meisten Mitarbeiter oft von zu Hause arbeiteten, sagte ein Onkel, zu seiner Zeit hätte man noch richtig gearbeitet. Ein Salatlöffel wurde vielleicht strategisch laut zurück in eine Schüssel fallen gelassen. Louisa leerte ihr vom Anstoßen übriges Glas Sekt, ihre Mutter war ihr schon eins voraus.
Im Anschluss gab es Tomatensuppe. „Ich liebe Tomatensuppe“, sagte Louisa, und setzte ihrer Suppe eine Schlagsahnehaube auf. Ihre Tante lachte und sagte, so würde sie Suppe auch lieben. Sie hatte keine Sahne genommen. Louisas Mutter, die Köchin, schwieg auf ihren Teller. Ihr Vater sagte, „du hast als Kind Tomatensuppe schon geliebt, weißt du noch? In der Schublade unterm Herd war immer eine Dose Tomatensuppenpulver“. Sie wusste es natürlich noch ganz genau. Manchmal hatte sie heimlich das Pulver pur genascht. „Suppe aus Pulver?“, fragte ihre Oma. „So Instantzeug ist aber nicht so gut für das Kind“. Ein Cousin sagte, „naja, das waren die Neunziger“. Das Gespräch wand sich dem Mauerfall zu. Über Ossi-Witze konnten noch immer alle gemeinsam lachen.
Zwischen zwei Gängen wurden die Gläser wieder aufgefüllt und der kleine Neffe herumgereicht. Seine Mutter beantwortete Fragen dazu wie er schlief, wie er aß, für welche Kita er vorgemerkt werden sollte. Louisa ging ins Bad und wünschte sich, jemand würde sie etwas fragen. Sie war erst vor weniger als zwei Jahren zu Hause ausgezogen. Es war ihr erstes Weihnachten ohne ihren Exfreund, den ihre Familie gut gekannt hatte. Als sie sich die Hände wusch, sah ihr Spiegelbild über dem Waschbecken etwas selbstgerecht aus. Sie übte ein Lächeln für den Rückweg zum Tisch. Da stand schon der Hauptgang bereit. „Und“, sagte ihre Oma zu ihr, als sie sich wieder setzte, „wann bringst du auch noch jemanden mit“, und nickte in Richtung des Babys auf dem Schoß seiner Mutter. „Na vorerst wohl dann erstmal nicht“, sagte Louisas Opa, ehe sie selbst antworten konnte. Louisa sah auf und ihm ins Gesicht, ihr Opa sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an, als würde er um seine Augen herum Platz machen wollen für das daraus sprechende Urteil über Louisas Beziehungsscheitern. Die Mutter ihres Neffen fragte, ob man ihr die Kartoffeln reichen könnte und ordnete sie dann neben dem Gemüse an, das sonst ihren Teller füllte.
„Isst sie noch immer kein Fleisch?“, fragte Louisas Opa ihren Bruder. „Nein, ich esse noch immer kein Fleisch“, antwortete seine Frau selbst. „Ich esse selbst kaum mehr welches“, sagte Louisas Bruder, auf dessen Teller drei Stücke Braten von Soße unförmig gebadet wurden. Ihr Onkel machte einen Vegetarierwitz, den er im Internet gelesen hatte. Die Frau ihres Bruders lachte nicht mit und Louisa versuchte ihren Blick zu fangen, aber sie schien Verschwörung nicht nötig zu haben. „Mir liegen Tiere eben zu sehr am Herzen“, sagte sie fast unbeeindruckt. Man war sich einig, dass das ja jeder halten könne, wie er wolle, so lange sie nicht versuchten, den Kleinen zum Vegetarier zu erziehen.
Glücklicherweise sagte in diesem Moment Louisas Tante zu ihrer Mutter, „wie machst du das nur, dass das Fleisch so zart wird, das zerfällt ja richtig“. Ihre Mutter lächelte aufrichtig und sagte, „freut mich, dass es dir schmeckt, das ist gar nicht schwer, sondern nur eine Frage davon, wie lange man den Braten im Ofen lässt“. „Ah ja“, sagte ihre Tante, „deine Zeit zum Kochen immer hätte ich ja mal gerne“. Für eine Weile sagte niemand mehr etwas und Louisas Mutter leerte das Glas und ließ daneben ihren Teller halbvoll.
Als sich kleinere Gespräche zwischen Sitznachbarn entspannen und auch Louisa sich etwas entspannte und in ihr Weinglas starrte, fragte ihr Cousin neben ihr, wie zu jeder Familienfeier seit fast zwei Jahren, „was studierst du nochmal?“ Und sie hatte nicht übel Lust, zu lügen. „Kulturanthropologie“, sagte sie trotzdem. „Ach das“, sagte ihr Cousin. „Warum studierst du mit deinem super Abi nicht eigentlich was Richtiges?“, mischte sich ihr anderer Cousin ein. Sein Bruder sagte, „ach komm, sie ist doch schön genug, um mal jemanden zu heiraten, der Geld verdient“. „Danke“, sagte Louisa tonlos in ihr Weinglas und stand abrupt auf, um ihrer Mutter beim Abräumen zu helfen. In der Küche sortierte sie Bestecke in die Besteckschublade der Spülmaschine, eine Arbeit, die ihrem Bedürfnis, etwas irgendwo rein- oder draufzuknallen, nicht gerecht wurde. Ihre Mutter nahm derweil viele Glasschälchen aus dem Kühlschrank, von denen sie die Frischhaltefolie zog. An der Folie hatten sich Kondenswassertropfen gebildet und Louisa musste hörbar Schlucken. Ihre Mutter strich ihr mit etwas ungezielten Bewegungen liebevoll über den Nacken. Als Louisa von der Spülmaschine aufsah, noch immer nicht ganz weggeblinzelte zornige Tränen im Augenwinkel, lächelte ihre Mutter sie für einen Augenblick ganz sanft und gerührt an. „Louisa“, sagte sie dann, „kannst du noch Getränke aus dem Keller holen? Nüchtern erträgt man das hier ja alles nicht“. Sie wies auf einen Sechser-Getränketräger aus Plastik neben der Tür.
Im Keller war es angenehm kühl nach der Hitze von Essen, Alkohol, Gesprächen und Kerzen, aber wie immer dämmrig. Die Glühbirnen hier unten hielten vermutlich schon seit den Achtzigern durch und schafften es nicht bis in die letzten Winkel des kleinen, dunkel gestrichenen Raums unter der Treppe, in dem die Getränke gelagert wurden. Sie füllte den Plastik-Träger nicht sofort mit Wein aus den Regalen und Sekt aus dem kleinen Kühlschrank, sondern lehnte sich einen Moment lang mit dem Kopf gegen die kalte Wand. Der Rauputz bohrte sich in ihre Stirn. Hier im Getränkekeller roch es schon immer viel mehr nach Keller als in den Räumen daneben. Der Geruch selbst war kalt, nicht direkt modrig, aber auch nicht frisch, als würden dort viele ungewaschene Äpfel lagern, die bei Minusgraden durch den Winter gebracht werden sollten. So lange Louisa sich erinnern konnte, hatte ihre Familie nie Äpfel im Keller gelagert. Sie lehnte an der Wand und drückte den Kopf dagegen, bis ihre Stirn brannte, und lauschte dem Gluckern der Wasserrohre. Als Kind war sie nie tief in den Raum hineingegangen und auf der Flucht vor unklaren Bedrohungen immer die Treppe so schnell es ging wieder hinaufgerannt. Sie dachte an das gemeinsame Auspacken im Wohnzimmer gleich und versuchte sich vorzustellen, wie sich zum Beispiel ihr Bruder über ihr Geschenk freute.
Aber an das in ihr vergrabene Weihnachtsgefühl kam sie nicht mehr dran und sie hatte die wachsende Wut der letzten Wochen nicht vergessen. Sie sagte sich, dass auch da noch das Kind in ihr lebte, der trotzige Anteil eines egoistischen Mädchens, das gerne beachtet werden wollte. Die geraubten Kindheitsgefühle würden weder der Weihnachtsbaum noch das Kaminfeuer im Wohnzimmer zurückbringen. Die vielen kleinen Verletzungen des Abends würden nicht zurückgenommen werden und sich zu denen der letzten Jahre gesellen. Geschenke auspacken konnte man aber ja trotzdem. Sie nahm den Kopf vom Putz und rückte ihren Gesichtsausdruck zurecht. Mit sechs vollen Flaschen im Träger machte sie sich wieder auf den Weg die Treppe hoch. Oben warteten sie schon mit dem letzten Gang. Auf dem Heimweg würde die Keksdose leer unnötig viel Platz in ihrem Koffer wegnehmen, zu Hause würde sie die letzten verlassenen Zimtsternecken rausschütteln und die Dose ganz oben auf einen Küchenschrank schieben und nicht an sie denken, bis wieder Dezember wäre.
.
Leonie Höckbert
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: