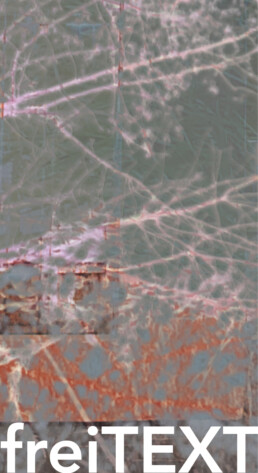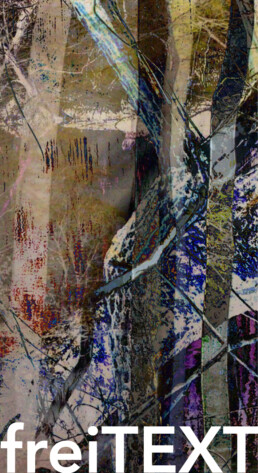freiTEXT | Susanne Schmalwieser
Wir beide haben immer schöne Anziehsachen
Zu diesem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt lebt Claudia in Australien und mit ihr niemand, den sie liebt. Probleme eines unglücklosen Lebens; doch von den Palmen sieht sie meistens nur die langen Schatten; bedrohlich ihr entgegenwachsend. Gedruckt aus der Zeitung entwischt und mit dem Boot über die See gefahren. Süßlich säuselnd in der Brandung, auf dass sie sich ihnen hingibt und dort ertrinkt.
Claudia sitzt auf der anderen Seite der Welt und winkt. Durch einen Bildschirm hindurch, in Georgs Küche hinein. der sitzt da mit seiner Teetasse und ist gespannt, von Claudias Tag zu hören, so wie sie seit Wochen immer von seinem hört. Täglich um neun, ihre Zeit, halb zwei, seine Zeit. Tastendrücken routiniert wie Zähneputzen.
Die Milchflaschen sind um sechzig Cent teurer geworden, sagt Claudia, und das Pfand nicht mehr. Bei uns auch; das erinnert mich an die Jugend, antwortet Georg, als wir donnerstags Pfandflaschen gesammelt haben, fürs Ausgehen am Freitag. ans Münzen-Aufklauben am Bahnhof Mödling und Münzen-Klauen aus der Tasche der Mutter und ans schlechte Gewissen deswegen, den ganzen Abend lang tanzend unter den Lichtern des einen Lokals oder des es anderen. Witzig, antwortet Claudia, dass wir diese Lokalnamen noch kennen, nach all den Jahren, und ich mir heute kaum die Busstation merken kann, über der ich lebe.
„Frühe Demenz?“, fragt Georg. „Ich glaube, Depression“, sagt Claudia.
„Oh“, meint Georg am anderen Ende der sie beheimatenden Kugel. Stille zwischen ihnen. Stille in jedem ihrer Räume; der eine sonnendurchflutet, der andere von Nacht umfangen.
Dann fragt Georg: „Gefällt es dir denn nicht in Australien?“
Gefallen, denkt Claudia. Gefallen hat ihr mit siebzehn mit der Mutter zehn Tage lang in Paris zu sein. Die erste Großstadt, der Bus durch Montmartre hinauf, endlich einmal zu sagen: „ich hab mir den Eiffelturm kleiner und das Moulin Rouge grösser vorgestellt“. Die verbindende Suche nach billigem Wein und gratis Aktivitäten, die Fußschmerzen nach Fußmärschen, um die Metropreise zu vermeiden. Gefallen hat ihr Wien, die ersten Wochen mit den neuen Freundinnen, das tägliche Nudeln-Kochen und -Essen und die Happy Hours in Clubs mit Musik, deren Text keine von ihnen verstanden hat. Der Stand vor der Uni mit den Ein-Euro-Reclamheften, die Stunden im Lesesaal „Altes Buch“, die Regentage im Seminarraum und die geschnorrten Zigaretten. Und gefallen hat ihr Georg. Die Sommer in Kärnten mit ihm und seiner Familie, die Zugfahrten in kurzer Hose und heruntergezogener Sonnenblende vor Beginn der Zeitrechnung ihres selbstbestimmten Lebens.
„Es ist so komisch, daran zu denken“, sagt Claudia, „dass es mir doch so gut gehen soll. Dass es uns gut gehen soll. Wir beide haben gut zu essen. Wir beide haben immer schöne Anziehsachen. Wenn ich nachhause komme, habe ich um niemanden Sorge, als um mich. Also klar, es gefällt mir, ich mach das Beste draus“, sagt Claudia, „aber einmal ein vertrautes Gesicht zu sehen, das wäre schön“, sagt Claudia.
„Das glaub ich dir“, sagt Georg.
„Und eine Person, die mich wirklich liebt.“
„Klar, sicher“, sagt Georg.
„Die mich versteht.“
„Ja, verstehe ich“, sagt Georg.
Auf irgendwessen Seite tropft ein Wasserhahn.
„Bitte besuch mich“, sagt Claudia.
Auf irgendwessen Weltseite: ein Martinshorn.
„Ich hab das Geld nicht, Claudia.“
„Ich borg‘s dir.“
Georg wackelt seine Handflächen dem Bildschirm entgegen.
„Nein, nein, nie. Das könnt ich nicht annehmen, ich hasse es in jemandes Schuld zu stehen.“
„Ich lad dich ein.“
Georg lacht nur.
Durch Claudias Nase wandert eine Träne nach oben, kitzelnd ins Augenlid.
„Da borg ich mir noch lieber von meiner Familie was.“
Dass ich dir nach all den Jahren nicht zumindest etwas ähnliches bin, denkt Claudia, aber sie fragt: „Wirst du‘s machen?“
Georg sagt: „Nein.“
Claudias Blick wandert vom Bildschirm in eine unbestimmte Ferne.
„Es wird alles so viel teurer, Claudia, wir müssen an unsere Zukunft denken.“
„Wir sind doch immer ohne Geld ausgekommen, und miteinander ausgekommen.“
Claudia denkt an die Ferien in Kärnten bei Georgs Familie. Kein See unter ihren runzeligen Fingerspitzen je wieder so blau wie dieser eine erste. Jenseits aller Moden durch die Stadt fahren auf Rädern ohne Gangschaltung. Fremde Wörter in der eigenen Sprache lernen und Zucchininudeln essen. Niemand hat von Claudia Geld gefordert, fürs Wohnen oder Essen, nur den Müll zur Tonne tragen hat sie sollen, zwei oder dreimal in der Woche. Georg hat sie dabei immer begleitet und sich für den Vater entschuldigt, als hätte der Claudia nicht ein erstes Stück Zukunft geschenkt mit einer Extramatratze und einem Extrabesteck. Aber das war vor Beginn der Zeitrechnung ihrer selbstbestimmten Leben, vor jeglicher Zeitrechnung der Schuld.
„Schau dir die Welt an, Georg, andere Leute haben so viel weniger als wir. Wir selber hatten einmal so viel weniger, als wir heute.“
„Eben“, sagt Georg.
„Eben“, sagt Claudia.
Georg zählt: Er hat drei horizontale Linien auf den Händen und zwei vertikale. Gesamt sind das zehn Linien unter zehn Fingern.
Claudia zählt: Der Wasserhahn tropft dreimal, dann pausiert er einen Schlag, dann wieder dreimal. Der erste Tropfen klingt höher, als die weiteren zwei.
Georgs Eltern haben nicht über Geld geredet. Manchmal, wie heute, zuckt Georg, wenn Claudia so tut, als wäre Geld wie alles andere, das Menschen besitzen: Konkret; austauschbar. Als hätte das alles keine Bedeutung mehr: Dass Claudia mehr verdient als er, dass die Eltern nicht über Geld reden wollen, dass er und die Frau im Bildschirm tagelang um den Bahnhof gestreunt sind zum Münzen-Klauben, dass die Milchflaschen jetzt sechzig Cent teurer sind, aber das Pfand nicht mehr. Wäre Georg wie Claudia, glaubt er, wäre er Teil dieser Menschheit, die über die andere nur in Formeln spricht. Angst davor keine Angst mehr haben zu müssen. Luxusprobleme, denkt Georg und schämt sich; wir beide haben doch alles was wir brauchen und dazu auch noch immer schöne Anziehsachen.
Claudia kennt diese Stirn. Die beiden Falten, parallel gelegt zu den dunklen Augenbrauen. Sie weiß, dass ihre Bitten vergebens sind.
„Ich vermisse dich, Georg, wirklich.“
Georg sagt: „Ich dich auch.“
Die Schatten der Palmen sind im Dunkeln verschwunden. Morgen werden sie zurück sein, und Claudia unter ihnen der kleinste Mensch der Welt. Manchmal wird sie Zeitung lesen und manchmal aufs Meer schauen, in der Hoffnung, dass es, wenn schon nicht Georg, dann ein Kopfhaar oder eine Hautschuppe von ihm heranträgt. Dass es zumindest in einer anderen Zustandsform ihn schon einmal berührt hat.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Sigune Schnabel
Trägt jeder Körper eine Spur Verwegenheit
I Wurzeln
Es kann Jahre dauern, bis ich den Boden
erforscht habe, den Regen und die Nacht.
Wir reiben uns aneinander,
und es gibt Zonen, die noch nicht
ausgelotet sind nach all der Zeit.
Im Winter trägt meine Rinde
das Weiß des Anfangs,
eine Stille, die schneit,
schreit.
II Stamm
Ich gehe nicht auf dich zu.
Du legst die Hände
auf meinen Körper, weil Sätze
auf der Haut zerfallen.
Als Mutter noch Sprache war,
bin ich aus Gedichten geboren,
habe mich geschüttelt, bis die Worte brachen.
Du hast mich gesehen
im Wasserspiegel eines Sees.
Wir gehören der gleichen Familie an.
Die Fremde hat längst ihre Rinde gelassen.
III Astwerk
Ich will viele sein,
streife dich aus verschiedenen Richtungen.
Meine Haut spricht am schönsten
mit der Erde.
Wie du heißt, vergesse ich am nächsten Morgen,
und doch nehme ich drei Worte
mit zu mir.
Gemeinsam loten wir Berührungen aus.
Deine Augen sind aus Moos,
und die Landschaft ruft aus mir heraus.
Sieh mich vom Ursprung her.
Meine Geburt war leise.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anna Fišerová
T
Es ist früher Abend und ich sitze im Bus, teile mir abgestandene Luft mit schwitzenden Menschen, schaue aus dem Fenster, nervös, weil ich keinesfalls meine Haltestelle verpassen möchte. Die rechte Seite des Busses neigt sich gefährlich nah dem Straßenrand zu, während wir uns auf engen Serpentinen einem Ziel nähern. Ich steige aus, atme Abgase und Wärme ein, vergrabe meine Hände in den Hosentaschen und bewege mich nach vorn, bis mir T in der Dunkelheit entgegenkommt.
Er begrüßt mich, bietet mir dampfenden Tee aus der Thermoskanne an, ich nehme den Becher lächelnd entgegen, probiere einen Schluck und verbrenne mir die Zunge. Mein Gesicht verziehend hole ich Luft und möchte etwas sagen, doch T schüttelt den Kopf und hält mir den Mund zu, seine Finger verströmen dabei einen seltsamen Eigengeruch.
„Psst“, macht er.
Ich nicke.
T nickt auch.
Zusammen durchkreuzen wir die Obstbaumplantage, ziehen unsere Schuhe aus, lassen sie im Gras liegen. Ich muss aufpassen, dass mir T nicht entwischt. Schaue ich einmal weg, ist er bereits auf einen der Bäume gesprungen, bewirft mich mit Birnen und Pflaumen, springt auf meinen Rücken und ich muss ihn von mir runterschütteln wie einen lästigen Käfer. Wir liegen im Gras und meine Unterlippe zuckt, während er mir Apfelstücke in den Mund stopft. Als ich das Kerngehäuse wegwerfen will, setzt T einen strengen Blick auf und schüttelt den Kopf. Hartes Fruchtfleisch knackt zwischen meinen Zähnen, Kerne bleiben in meinen Hals stecken und Worte auch.
Unsere Mägen blubbern und in unseren Mundwinkeln hängen noch Reste vom Obst. Wir halten uns gegenseitig unsere Füße ins Gesicht, sie riechen nach Dreck und Gras und irgendwie nach altem Teppich. Dann stecken wir sie zurück in ausgelatschte Turnschuhe, zwischen meinen Zehen haben sich Erdkrumen verfangen und sich unter meine viel zu langen Zehennägel gegraben.
Wir laufen runter in die Stadt, T tänzelt leichtfüßig auf jedem Geländer, schlägt Räder auf jeder Kante, gefährlich nah über dem Abgrund. Ich beneide ihn um seine Furchtlosigkeit, ich habe immer Angst und T nie, aber er ist umsichtig mit mir. Er verzieht sein Gesicht zu einem hämischen Grinsen, steckt seine Zunge raus, um im selben Moment seine Augen zu verdrehen. Ich hole ihn ein, ziehe an seinem Haar, das sich weich und fettig vom Schweiß anfühlt.
Unsere Schritte hallen durch enge Gassen, kindliches Lachen durchdringt die nächtliche Stille, in der Luft liegt der Geruch von warmen Gebäck.
T kauft mir einen Lebkuchenmann und ich reiße ihm den Kopf ab.
Wir schleichen uns ins Wohnheim, mit großen Augen am Pförtner vorbei, rennen die Treppenstufen hoch, schließen die Tür hinter uns ab und schnappen erschöpft nach Luft.
Ich besuche T zum ersten Mal, sein Zimmer ist klein und mit gelbem Anstrich versehen, es riecht fremd, aber auch nach Marmelade, er bietet mir an diesem Abend zum zweiten Mal Tee an und ich verbrenne mir wieder die Zunge. Auf der sonnengebleichten Tapete stehen Schimpfwörter auf Russisch und von draußen dringt Lärm durch die dünne Wand aus Pappmaschee, dröhnender Bass und grölende Stimmen, vorbeifahrende Autos, das Rauschen einer Autobahn. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, stecke den Kopf in den verschmutzten Himmel.
T macht das Fenster zu und zeigt mir seinen Wintermantel, all seine Mützen und die Löcher in seinen Socken. Wir werden unterbrochen, als etwas in seiner Jackentasche vibriert. „Da muss ich rangehen“, sagt er und es ist der erste Satz, den er an diesem Abend sagt.
Er setzt sich auf den Boden und verschränkt seine Beine, umschließt mit langen Fingern seine Handyhülle. T spricht mit ernstem Blick und seine Stimme ist genauso gekräuselt wie seine Stirn. Aus seinem Mund kommen Worte, die ich nicht verstehe, vereinzelte Fetzen tragen einen vertrauten Klang.
Als er auflegt, setze ich mich neben ihn und er zeigt mir seine Großeltern, swipet Bilder von rechts nach links: бабуся і дідусь im Theater, auf dem Markt, auf dem Sofa und am Strand. „Das ist das Schwarze Meer“, sagt T. „Meine Großeltern haben Angst. Aber sie sagen, dass man sich daran gewöhnen kann. Man gewöhnt sich an die Angst.“
Das ist alles, was ich über sie erfahre, er beginnt, über das Schwarze Meer zu sprechen und hört nicht mehr auf. „Weißt du, es ist wirklich so schwarz, so schwarz, dass es deine Beine und Arme verschlingt.“ Und ich zweifle nicht daran. „Meine Katze ist im Krieg gestorben. Dann habe ich angefangen zu lesen“, endet er kurz angebunden, reicht mir ein T-Shirt und frische Socken. Wir schleichen uns durch den Flur, zu den Bädern, dort putzen wir uns die Zähne, dabei schmiert mir T Zahnpasta ins Gesicht.
Als er die Tür abschließt und das Licht ausmacht, fallen mir die Augen zu, kurz bevor mich meine Träume einholen, erscheint T, so muss er als Kind ausgesehen haben, mit faltigem Gesicht und eigenartig müdem Ausdruck, in schwarze Wellen springend und nach Luft schnappend. Dann taucht er auf und an seinen Schläfen klebt nasses Haar.
Am nächsten Morgen entdecke ich T am anderen Ende des Zimmers und kann nicht widerstehen, ihn eine Weile zu beobachten. Er hat sich mit buckeligem Rücken über sein E-Piano gebeugt und Kopfhörer aufgesetzt, um mich nicht zu wecken. Doch manchmal lacht er laut los, singt mit, gibt schrille Töne von sich, rauft sich entrüstet das Haar, wenn der Ton nicht stimmt. Der Morgen ist kalt und ich liege mit ausgestreckten Gliedmaßen auf seinem Bett, warte darauf, dass er mich bemerkt, warte auf sein erstes Wort, doch er würdigt mich keines Blickes, eingenommen von der lautlosen Musik. Erst als ich aufstehe und mir Hemd und Hose überziehe, hebt er den Blick und sieht mich kurz an. Er wirft mir einen Apfel zu und zieht seine Jacke über, wir sprinten zusammen am Pförtner vorbei, dann bringe ich ihn schweigend zur Schule.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Simon Scharinger
Was es gibt. Versuch einer Liste
(A)
Die Aprikosenbäume gibt es.
Die Aprikosenbäume bei Inger Christensen gibt es.
Die Asche in meiner Hand gibt es.
Die Antwort auf meine Frage gibt es, zumindest hoffe ich das.
Den Adamsapfel gibt es.
Die Altgebliebenen gibt es.
Das Allein-Sein in jeder Stunde gibt es.
Das Auschwitz in den Büchern gibt es.
Das Auschwitz außerhalb von Büchern gibt es.
Den Anus als primäres Geschlecht gibt es.
Die Akropolis gibt es.
Den Anfang im Wort gibt es.
Die Architektur von deinem Zuhause gibt es.
Die Abtreibung als Recht gibt es.
Die Ausländer im Inland gibt es.
Die Ausländer im Ausland gibt es.
Das Andere gibt es.
Die Angst gibt es.
Das Auseinander-Setzen in der Schule gibt es.
Die Anschläge in Wien, in Paris etc. gibt es.
Die Anschläge außerhalb Europas gibt es, sie interessieren aber nicht.
Die Anschläge, fast ausnahmslos ausgeführt von Männern, gibt es.
Die an.schläge gibt es.
Die Aktionen gibt es, bei Hofer, Billa, Spar, Marina Abramovic´ und unübertroffen bei Pjotr Andrejewitsch Pawlenski.
Das ABC gibt es.
Das ACAB gibt es.
Das Agitative gibt es, bei Brecht, bei Gruber, bei Schlingensief, bei Hubsi Kramar.
Das Abschieben gibt es, von Verantwortung, von Schuld, von Pflicht, zusammengefasst im Abschieben von Menschen.
Den Anfang, dem ein Zauber innewohnt, gibt es.
Die Artikel in diesem Text gibt es.
Das Aus gibt es.
(B)
Die Blätter von Aprikosenbäumen gibt es.
Die Blätter von Ahorn, Kastanie, Buche und Eiche gibt es.
Die Balkone in Innenhöfen gibt es.
Den Balkan gibt es.
Das Babylon im 1. Wiener Gemeindebezirk gibt es, sprachverwirrt.
Das Bescheidene in Wünschen gibt es.
Das Baiser auf Torten gibt es.
Die Besen in Abstellräumen gibt es.
Die Brombeeren bei Inger Christensen gibt es.
Das Brot als Waffe gibt es.
Die Beerdigung des Kommunismus gibt es und seine Auferstehung.
Die Beliebigkeit in der Kunst gibt es.
Die Blunzn als Schimpfwort gibt es.
Die Bombe in Hiroshima gibt es und die in Nagasaki.
Das Beben von Valdivia gibt es, nebst dem grundsätzlichen Beben.
Das Balancieren in der Liebe gibt es.
Die Bücher von Friederike Mayröcker gibt es.
Die Bums‘n in Schärding gibt es.
Die Behörden hörig den Behörden gibt es.
Die Beamten gibt es.
Die Beleidigung von Beamten gibt es.
Die Brust von dir in meinen Händen gibt es.
Den Balsam für die Seele gibt es.
Die Backen gibt es, zusammengezwickt, gekniffen, errötet, immer eine Art Anus ummantelnd.
Die Bakchen gibt es. Und größenwahnsinnige weiße Regisseure, die sich an ihnen versuchen; im Chor, mittels Fließbandarbeit, auf faschistoide Weise Faschismus beleuchtend.
Die Besamung von Kühen gibt es.
Das Banale gibt es.
Die Banane gibt es.
Den Brand nach einem Rausch gibt es.
Den Brand der Wälder in Australien gibt es.
Das Beten von Auswendiggelerntem gibt es.
Die Bigotterie gibt es.
Das Bienensterben gibt es.
Die Blumen und die Blätter von Aprikosenbäumen gibt es.
Die Blicke, die ganz wie Flammen tanzen, gibt es; bei Marina Zwetajewa.
Das Biegsame gibt es, bei Birken, Rückrädern, etc. pp.
Das Bikini-Atoll gibt es – le bikini, la premiére bombe an-atomique – und seine Fischer und kontaminierten Thunfisch und Verstand.
Die Bierdeckel von Martin Peichl gibt es, und die im Café Bendl, einem um die Ohren fliegend.
Die Besinnlichkeit, die immer bloß Besinnlosigkeit meint, gibt es. Und sie ist zu verwerfen.
Die Bettgeher gibt es, bei diesen Mietpreisen vielleicht bald wieder.
Die Bretter, die eine Welt bedeuten, aber niemals die Welt, gibt es.
Den Blumenanbau, der Leben nimmt und Freude schenkt, gibt es.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Poedu - Text des Monats April
Mein Drache heißt Rache
Er ist ganz groß und stark und kracht gern
ins Wohnzimmer. Er ist
10 m lang, er liebt gerne
Fisch. Er hasst Aale
und kann fliegen.
Fairouz
(7 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe diesmal kam von Slata Roschal:
Stell dir vor, dass in deinem Zimmer ein Phantasietier lebt. Mit dem du spielen, toben, reden, alles machen kannst. Denke dir einen passenden Namen für das Tier aus und schreibe ein Gedicht darüber mit mind. 5 kurzen Zeilen. Zeichne das Tier.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sigune Schnabel
Schuld
Ich bin schuld an dem Kälteeinbruch. Mir fällt es schwer, das zu sagen, aber ich muss der Wahrheit ins Auge sehen. Das pflegte schon Alba zu betonen, als ich noch mit ihr zusammenlebte. Alba war überhaupt sehr viel daran gelegen, den Verursacher zu finden, sei es von fauligen Äpfeln, verlorenen Socken oder zu viel Pfeffer im Essen. In den meisten Fällen war das einfach, denn außer uns beiden wohnte hier keiner. Es gab aber auch die weniger eindeutigen Bereiche. Mit „weniger eindeutig“ meine ich: Alba verspürte mehr Gewissheit als ich, dass der Schuldige bereits feststand, um nicht zu sagen: Es herrschte eine empfindliche Uneinigkeit, die ohne Weiteres nicht beseitigt werden konnte. Jedenfalls nicht, indem wir aufeinander zugingen. „Gespräch“ bedeutete nämlich, dass Alba redete und ich zuhörte. Hielt ich mich nicht an diese Regel, wurde der Zustand kritisch zwischen uns.
Warum also gerade ich für diesen Kälteeinbruch verantwortlich bin und nicht etwa Alba oder das Rotkehlchen vor dem Haus? Die Sache ist einfach, denn es gibt mehrere Indizien, die gegen mich sprechen. Ich werde nicht versuchen, mich zu verteidigen. Die Würfel sind gefallen. Wie sagt man so schön: Der Weise versteht, wenn die Zeit reif ist, Einsicht zu zeigen.
Am Wichtigsten ist die Tatsache, dass erst mit meiner Rückkehr aus Winterfeld der Frost sichtbar wurde; vorher, so hatte mein Nachbar beteuert, war die Wiese vor dem Haus nur vom Regen benetzt. Vielleicht, so könnte man einwenden, handelte es sich bloß um eine Korrelation, einen losen, zufälligen Zusammenhang zwischen den Erscheinungen. Auf Begriffe hat Alba immer großen Wert gelegt. Nie durfte der falsche über die Lippen kommen, besonders, wenn es sich um meine Lippen handelte, denn, da war sie sich sicher, von solchen Begriffen wurden sie wund. Falsche Wörter taten nämlich weh. Nicht nur in den Ohren. Sie hinterließen Verletzungen. Sichtbare. Auch auf der Haut. Alba war eine fürsorgliche Frau. Das sagte sie oft zu mir, weil sie dachte, ich würde es sonst nicht bemerken. Sie traute mir selten zu, dass ich auch ohne ihre Hilfe auf gute Gedanken kam, plausible Annahmen in meinem Kopf bildete. Soll ich ihr etwa verübeln, dass sie mir hin und wieder Hinweise gab?
Was die Temperatur betrifft: Alles spricht dafür, dass ich sie mit nach Hause gebracht habe. Wie das passieren konnte? Ganz einfach: Während der Fahrt fröstelte ich. Und zwar ununterbrochen. Hätte sich die Kälte zwischendurch davongemacht, auf einer Raststätte oder kurz vor der letzten Tankstelle, hätte ich noch argumentieren können, es handele sich um eine neue, mir fremde Kälte. Aber ich weiß, dass die anderen Recht haben. Schließlich hat sie kein einziges Mal von mir abgelassen. Die gesamte Fahrt über streifte sie meine Haut. Berührte mich unter dem Pullover. Gut, da kann sie vielleicht auch nicht so leicht hervorkriechen und sich davonmachen, schließlich trage ich meine Kleidung eng. Auf jeden Fall sprechen die Tatsachen gegen eine Korrelation.
Einen Punkt hätte ich fast vergessen: Ich habe immer einen kühlen Kopf bewahrt. Also versteckt sich die Kälte sogar in meinen Zellen. Alba glaubt das nicht, jedenfalls nicht die Sache mit dem Kopf. Sie meint, der Frost liege bei mir tiefer – im Übrigen ist sie deshalb ausgezogen –, aber auch sie irrt sich. Jedenfalls manchmal. Wichtig ist, sie nicht darauf anzusprechen. Sonst geht es heiß her. Und davon will der Kälteeinbruch nichts wissen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Christopher Schmall
gren_zen
wiese steinern umfriedet
manch halm beugt sich hinüber
manch löwenzahnkopf
regenschwer
pflastersteine
eingefügt in asphalt
der stellenweise neu gegossen wurde
die weiße markierungsfarbe
die den radweg beschreibt
ergraut zunehmend
wie auch die zebrastreifen
an der kreuzung und
die mauern ringsum
ich knöpfe die jacke zu
setze die maske auf
schalte mein handy aus
schließe mund und augen
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Carolina Reichl
Die Verteilung des Glücks
Du drückst das Gesicht in das Kopfkissen und heulst. Du hast die Nachprüfung nicht geschafft und musst das erste Jahr wiederholen. Ich sitze neben dir und streichle dir über den Rücken.
„Ich wäre gerne wie Katrin“, sagst du. „Ihr gelingt immer alles, ohne dass sie sich dafür anstrengen muss. Das ist unfair.“
Ich nicke. Es ist kein Geheimnis, dass das Glück in unserer Familie ungleich verteilt ist. Während du dich mit Mathe, Pickeln und den dummen Sprüchen deiner Mitschüler quälst, schreibt Katrin gute Noten, sieht gut aus und ist beliebt. Sie hat ein lautes, heiteres Lachen und ist umgeben von Menschen, die genauso lachen. Wenn man Katrin sieht, hat man das Gefühl, leben ist einfach, glücklich sein etwas, das jeder auf die Reihe kriegen sollte.
Ich beneide sie, weil sie nichts zu bedrücken scheint.
*
Unsere Mutter hält Katrin die Zigaretten vors Gesicht.
„Du bist erst vierzehn! Versprich mir, dass du das nie wieder machst!“, brüllt sie. Katrin schaut schuldbewusst zu Boden. Mutter dreht sich zu uns.
„Und ihr, ihr fangt erst gar nicht damit an!“
„Versprochen“, sagen wir im Einklang.
Wir gehen in Katrins Zimmer. Sobald die Tür zu ist, zündet sie sich eine neue Zigarette an. Sie schwört uns, dass sie damit nie aufhören wird. Sie liebt Camel Blue. Schon als Kind fand sie die Verpackung toll, wegen der blauen Farbe und des Kamels. Du nimmst ihr die Packung aus der Hand und liest ihr die Warnhinweise vor.
Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen.
Raucher sterben früher.
„Hast du nicht Angst?“, fragst du.
„Wovor?“
„Dass du auch Krebs bekommst.“
Sie schüttelt den Kopf.
„Daran denk ich nicht.“
Wir sitzen auf deinem Bett und schauen aus dem Fenster. Es dämmert. Wir sehen, wie Katrin das Haus verlässt und sich eine Zigarette anzündet. Sie ist die Erstgeborene und das unangefochtene Lieblingskind unserer Mutter. Sie verzeiht Katrin alles, auch dass sie sie immer wieder beim Rauchen erwischt.
„Es wäre schön, wenn wir noch einen Vater hätten, der könnte dann dich oder mich bevorzugen“, sage ich. Du seufzst.
„Weißt du noch, wie er war?“
Du schweigst. Dann: „Schwer zu sagen. Er war damals schon viel im Krankenhaus.“
Du warst fünf, als er starb, ich vier, Katrin sieben. Sie müsste bestimmt die ein oder andere brauchbare Erinnerung an ihn haben, doch ich traue mich nicht, sie zu fragen.
Sie spricht nie über ihn.
Würde ich sie fragen, ob sie sich an ihn erinnern kann, bevor er krank wurde, würde sie vermutlich mit den Schultern zucken und sagen: „Was bringt das schon?“
*
Katrin sitzt mit großen Augenringen beim Frühstück. Ihre Haare riechen stark nach Rauch. Es wundert mich, dass unsere Mutter nichts dazu sagt.
Ich flüstere ihr zu: „Du stinkst.“
Sie gibt mir einen Tritt.
„Au!“, schreie ich.
„Ist was?“, fragt unsere Mutter. Ich schüttle den Kopf.
Ich frage mich, ob sie nicht merkt, dass Katrin sich in der Nacht regelmäßig rausschleicht oder ob sie es nicht merken will. Auf Katrins Unterarmen sind verwischte Stempelreste und Armbänder von den Klubs zu sehen, an denen sie am Vorabend war. Wir sitzen noch bei Tisch, da setzt Katrin sich ihre Kopfhörer auf. Sie dreht auf die oberste Lautstärke. Ich glaube, Katrin braucht den Lärm. In der Stille wird sie nervös. Erst ein Lärmpegel, der es einem unmöglich macht, sich noch auf irgendwas zu konzentrieren, lässt sie innerlich ruhig werden.
Du klopfst an meine Tür.
„Darf ich reinkommen?“, fragst du. Ich nicke. Du setzt dich auf mein Bett.
„Ich mach mir Sorgen um Katrin.“
Du verstehst nicht, wieso sie sich ständig wegschleicht. Du bist mittlerweile 16, du dürftest am Wochenende fortgehen, aber das machst du nicht. Du magst den Lärm, die grellen Lichter und das Gedränge nicht und am allerwenigsten magst du die Vorstellung, die Kontrolle zu verlieren und am nächsten Tag so verkatert wie Katrin zu sein, dass man nichts anderes machen kann, als im Bett zu liegen, als wäre man krank.
Du zögerst, ehe du hinzufügst: „Man sagt so Sachen über Katrin.“
„Was für Sachen?“
Dass sie am meisten Shots trinken kann und bei Partys als erste kotzt. Dass ihre Brüste geil sind und dass ihre Brüste ohne BH gar nicht so geil sind. Dass jeder auf sie steht und dass sie nichts für was Ernsthaftes ist, weil sie sich am Schulklo fingern lässt.
„Glaubst du, das stimmt?“, fragst du. Wir überlegen hin und her.
Wahrscheinlich nur Gerüchte, sagen wir uns dann.
Irgendwann hört das schon wieder auf.
*
Katrin geht nach Wien studieren und ihre Geschichten erreichen uns noch immer.
Als sie das nächste Mal nach Hause kommt, sprichst du sie darauf an.
„Ist doch egal“, sagt Katrin. Sie macht, worauf sie Lust hat und jeder, der darüber ein schlechtes Wort verliert, ist neidisch. Stolz zeigt sie dir Fotos, mit wem sie gerade schreibt.
„Wie lange willst du noch so weitermachen?“, fragst du. „Hast du nicht das Gefühl, dass es reicht? Willst du dir nicht irgendwann einen Freund suchen?“
„Nein“, sagt Katrin. „Und Kinder will ich auch nicht. Ich bleib lieber allein.“
Du verdrehst die Augen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass man ohne Kinder glücklich wird. Du willst zwei, vielleicht sogar drei.
Sie zündet sich eine Camel an und äschert dir vor die Füße.
„Du machst dich damit nur kaputt“, sagst du.
*
Wir kommen zum Mittagessen. Du bist gerade in deine erste eigene Wohnung gezogen.
„Schön hast du’s“, sagen wir. Du wohnst allein. Es gibt Frittatensuppe und Schnitzel. Nach der Hauptspeise sagst du, dass etwas in dir wächst. Du versuchst wiederzugeben, was die Ärzte gesagt haben. Am Montag wirst du mit der Chemo anfangen. Du weißt es schon länger, du wolltest uns nicht beunruhigen.
Ich frage nach Metastasen.
Du sagst: „Nein.“
Dann: „Doch.“
Ich drücke meine Lippen gegen die Faust, ersticke den Schrei mit offenem Mund. Katrin weint in deinen Armen. Du streichelst ihr über den Rücken. Die ganze Trauer, die eigentlich deinen Körper erschüttern sollte, scheint in Katrins gewichen zu sein. Ich denke: Es hätte sie treffen sollen.
Als Katrin aufgehört hat zu weinen, sehe ich genau, wie sie sich zusammenreißen muss, um sich nicht vor deinen Augen eine Zigarette anzuzünden.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Martin Piekar
zwischen den anschlussschlitzen der luft
verschwindet abstoßung
& doch, da die neugier, die bedeutung
fasst mich, ein verbrannter griff, ihrer, meiner
die bedeutung fasst mich an
sie fragt, ob ich ihren newsletter abonnieren will
wir sind unsere daten, denke ich
da huscht die bedeutung um die ecke
wir sind der rohstoff des einundzwanzigsten jahrhunderts
ich fresse bildschirmlicht um licht
wie leer ich mich fühle, wenn es in jedem stimmfang
jeder werbung, jedem hack um mich geht
warum wollt ihr mich?
mich substanzloses ich, ich begreife mich nicht
ich als akzidenz der plastiktüte
eine junge frau schob sie mir zu
voll windeln & brot & bat mich, sie zu entsorgen
ich behalte sie, weil es sich cool anfühlt
etwas illegales zu besitzen
verleiht irgendwie substanz, dieses verruchte
vor einem selbst
kanister schwarzgebrannter sehnsucht, auf offner straße
wir prosten uns zu, jeder nimmt die leere an
& trägt sie mit sich
um nicht von ihr verschlungen zu werden
realisten sind die schlimmsten utopisten
diese plastiktüte wird dich überleben
denn wie es in server hineinhallt, schallt nichts, nichts
nichts mehr hinaus
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Lisa Gollubich
Hädensa®
Eine Hommage an die Hämorrhoiden
„Zwei Mal Hädensa, bitte“, schallte es durch die Apotheke.
Die Apothekerin schaute mich einen Moment lang an. Auch ihre Kollegin von der anderen Kassa war aufmerksam geworden, und auf meine Bestellung folgte ein Moment der Stille.
„Groß oder klein?“, flüsterte sie, indem sie den Kopf vorreckte.
„Groß“, sagte ich trocken.
Zu Hause legte ich eine Packung in die Medikamentenlade und die andere ins Regal im Badezimmer. Der Applikator und die Packungsbeilage kamen direkt in den Müll, denn wir waren ja schon lange miteinander bekannt.
Meine Frau fragte mich, als sie mittags aufgestanden war:
„Hast du die Hädensa gekauft?“
Ich führte sie ins Badezimmer, wo die Packung wie in der Apotheke hübsch drapiert im Regal lag.
„Die andere ist in der Medikamentenlade, Schatz“, sagte ich.
Am Nachmittag saßen wir beim Kaffee zusammen und sie erzählte vom Nachtdienst auf der proktologischen Station. Weil sie Springerin war, war sie auf keiner Station länger als eine Woche. Sie sagte, sie sei froh darüber. Kaum Zeit genug, um sich über irgendwelche Beschwerden Sorgen zu machen.
Für gewöhnlich ist die Proktologie ein unschöner Bereich. Ich erinnere mich noch genau an einen Besuch beim Proktologen, der mir einmal vor vielen Jahren einen schmerzhaften Polypen ausgetrieben hatte. Die schneeweiße Unterlage färbte sich hinter meinem Rücken plötzlich bedrohlich bräunlich-rot, und erst als ich mich umdrehte, sah ich das Unheil, das der Proktologe nonchalant hinnahm wie ein Kanaltaucher. „Alles in Ordnung, Herr Meier!“
„Nächste Woche bin ich wieder auf der Psychiatrie“, sagte meine Frau dann.
Ich war gewissermaßen ihr Supervisor. Alle aufgetretenen Probleme besprach sie zuerst mit mir. Im Grunde bestand ein Problem immer aus einer Unvorhergesehenheit, die eine Anpassungsleistung erforderte. Darin lag die tagtägliche Anstrengung eines Krankenpflegers.
„Meine Hämorrhoiden sind wieder zu spüren“, sagte sie.
„Das ist die Arbeit, Liebling“, sagte ich.
Wenn meine Frau in mehreren, aufeinanderfolgenden Turni auf dem Klo verschwand, wenn die Klotür ohne Spülung aufging, wenn das Händewaschen ausgiebiger wurde, tja, dann wusste ich, was Sache war.
Und auch ich, in der Sukzession, vernahm dann ein leichtes Jucken am Ausgang der Dinge. Ich konnte es zuerst nicht glauben, war das die Fortsetzung meiner proktologischen Vergangenheit?
„Polypen sind keine Hämorrhoiden, Markus“, sagte meine Frau dann.
„Ich habe keine Polypen mehr, wie kommst du darauf?“, schnauzte ich zurück.
Da erzählte mir meine Frau zum hunderttausendsten Mal, wie sie vor gut dreißig Jahren von ihren Hämorrhoiden erfahren hatte.
„Mama hat gleich gesagt: Wenn’s unaufhörlich kratzt, sind das die Hämorrhoiden, mein Schatz.“
Geradezu stolz war meine Frau auf ihre Hämorrhoiden! Als wäre es eine Auszeichnung, ein Verdienst schlechter Gene oder ungünstigen Lebensstils, Krampfadern im Hintern zu haben!
Am späten Nachmittag zog ich mich zurück, um im Bürozimmer zu lesen. Silvia ging ab und zu vorbei und ich warf ihr durch die offene Tür einen giftigen Blick zu. Ich war froh, als sie sich gegen sechs Uhr für die Arbeit fertig machte.
„Wieder die Proktologie!“, seufzte sie vor dem Gehen ins Büro hinein. „Baba!“
Jetzt war ich mir also volle zwölf Stunden selbst überlassen. Ich ging ins Badezimmer und überprüfte die angebrochene Hädensa. Meine Frau hatte sie offenbar schon verwendet, denn etwa ein Zehntel der Tube war ausgedrückt. Dann warf ich einen Blick in die Medikamentenlade: die zweite Hädensa war unversehrt.
Und es begann, es begann tatsächlich zu jucken. Ich streckte mich, schüttelte das linke, dann das rechte Bein, machte eine Kniebeuge und ging in die Grätsche, aber es juckte, juckte weiter! Was nun? Ach, wenn Silvia doch jetzt da wäre!
Ich nahm mein Handy zur Hand und schrieb eine Nachricht.
Ich liebe dich, mein Schatz!
Der Bildschirm blieb dunkel. Wahrscheinlich hatte sie gerade Dienstübergabe.
Mit Erleichterung blickte ich auf die nächste Woche – aber da lauerte schon das nächste Grauen. Wahrscheinlich würde mich Silvia schon am Montag dazu nötigen, in der Apotheke nach Praxiten zu fragen. Und ein paar Stunden später würde ich selbst das nicht abzuschüttelnde Verlangen haben, eine Beruhigungstablette zu nehmen.
Da ging der Bildschirm an.
Ich dich auch, Bärli! Nächste Woche – leider – wieder – Proktologie!
Mir fiel das Herz in die Hose. Ich ging zur Medikamentenlade, nahm die Hädensa heraus und verschwand auf der Toilette.
Benommen lag ich am Abend auf der Couch im Wohnzimmer und ließ mich von einer Naturdoku berieseln. Ich wusste, dass vor dem Wiedersehen mit Silvia noch die ganze Nacht lag. Und was würde sie dazu sagen, dass ich die Hädensa – auch verwendet hatte?
Vor dem Zubettgehen langte ich noch einmal nach der Tube und drückte ein wenig daran herum, damit es so aussah, als hätte ich sie nicht verwendet. Ich schlief so gut, dass mich erst das Türschloss weckte.
„Guten Morgen ohne Sorgen, Schatz!“, rief Silvia beim Hereinkommen in die Wohnung.
„Warum bist du denn so gut gelaunt?“, fragte ich noch schlaftrunken im Türstock erscheinend.
„Die Hädensa ist echt ein Wunderding! Juckreiz ade!“
Betreten stand ich da, und vernahm ein weiteres Kratzen. Ich empfand es als eine große Ungerechtigkeit, dass die Hädensa bei ihr half, und bei mir aber nicht.
„Oh, was ist denn los?“, fragte Silvia. „Ist irgendetwas Schlimmes passiert?“ Und nach einer kurzen Pause augenzwinkernd: „Hast du etwas angestellt?“
Ich gestand ihr die ganze Hädensa-Misere, sie lachte und sagte:
„Ich kenne da jemanden! Da mache ich gleich einen Termin aus!“
Am Nachmittag, nachdem Silvia ausgeschlafen hatte, machten wir uns auf den Weg zu Dr. Schmolli, einer Heilpraktikerin.
„Eigentümlicher Name: Dr. Schmolli! Wer heißt denn bitte so?, fragte ich meine Frau.
„Alle Heilpraktiker haben ihre Eigentümlichkeit“, sagte sie abwinkend.
„Bist du dir sicher, dass das eine vertrauenswürdige Ärztin ist?“
„Nein, Heilpraktikerin, habe ich dir ja schon gesagt.“
Mit einem Hinterwäldlerbus fuhren wir durch eine von Bäumen gesäumte Villenallee. Die Straße endete bei einem Kreisverkehr, der zum Umkehren gedacht war, und gerade an seiner Hinterseite sah ich schon jemanden winken, eine große, blonde Frau mittleren Alters mit halblangem, gewelltem Haar. Ich fühlte unmittelbar eine große Neugierde.
„Hallo Silvia!“, rief sie uns entgegen. „Wieder die Hypochondrie ausgebrochen? Kein Problem für Dr. Schmolli!“
Meine Frau grüßte sie überschwänglich mit einem Bussi links und rechts. Sie hatte mir nie etwas von einer Freundschaft mit einer Schmolli erzählt. Ich ließ mich von den beiden auf die Terrasse leiten. Bald saßen wir auf gemütlichen Sitzmöbeln und Silvia fachsimpelte über die psychologische Dimension ihrer Arbeit.
„Kann natürlich schon verstehen, dass das auch den Partner belastet“, kommentierte Dr. Schmolli.
„Ist natürlich eine Tabu-Körperzone und ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft“
„Es hat ja schon einmal bei jedem gekratzt“
Daran reihten sich Ausführungen darüber, dass man umso häufiger Medikamente verwendet, je leichter verfügbar sie sind, und sie erzählte von ihrem Ex-Mann, der stets zwei Kisten Bier im Keller stehen hatte – was sie selbst zum Trinken verleitet hatte. „Gott bewahre, das waren Zeiten!“, lachte sie.
„Und was sagen Sie dazu, Markus?“, fragte Dr. Schmolli dann.
Ratlos blickte ich von Gesicht zu Gesicht, und sagte schließlich:
„Wer hat denn behauptet, dass ich ein Hypochonder bin?“
Da faltete sich die Doktorin elegant aus dem Sitzmöbel und verschwand im Haus. Ich warf Silvia einen fragenden Blick zu. Sie blieb still und lächelte erwartungsfroh.
Im nächsten Moment erschien Dr. Schmolli in der Terrassentür, ich sah schon das Türkis der Tube blitzen. Es war eine Hädensa, die sie in der Linken hielt.
„Die ist für Sie, Markus“, sagte Dr. Schmolli beim Überreichen.
Kurze Zeit später fuhren wir schon wieder die Allee hinab. Ich wunderte mich, weshalb wir so eine lange Fahrt in Kauf genommen hatten, nur um eine überall erhältliche Hädensa zu bekommen. Aber ich war zugegeben froh über ein eigenes Exemplar.
Als wir nach Hause kamen, beeilte sich Silvia ins Bad. Sie musste sich fertig machen für den Nachtdienst. Ich ließ die Hädensa in der Jackentasche und setzte mich wieder ins Büro, um zu lesen. Hädensa kann warten, dachte ich mir.
Gegen Abend, meine Frau war längst im Dienst, bemerkte ich wieder ein leichtes Kratzen. Ich ging ins Vorzimmer und nahm die Tube aus meiner Jacke. Ihr Design war mir seit so vielen Jahren im Grunde so vertraut wie meine Frau. Die Farbgebung, die altmodische Schrift mit den ungewöhnlichen horizontalen Strichen über dem Umlaut. Und da fiel es mir erst auf: Da stand HEDENSA. HEDENSA statt HÄDENSA. Ich konnte es nicht glauben. Dr. Schmolli hatte mich getäuscht. Und Silvia hatte es gewusst.
Ich ließ die Tube einfach fallen und stapfte ins Bad. Ich schluckte Luft, als ich den Platz leer vorfand, und mit drei weiteren Schritten stand ich im Wohnzimmer bei der Medikamentenlade – l e e r!
Ich musste mich an Ort und Stelle setzen. Schwindlig war mir. Ich dachte an die Nachtapotheke. Welche hatte heute noch einmal Dienst? Sollte ich es mit der Hedensa versuchen oder wirkt ein Placebo nicht, wenn man Bescheid weiß? Und dann kratzte es wieder, es kratze unsäglich.
Da hörte ich mein Handy piepsen. Einen Moment blieb ich wie zum Trotz sitzen. Dann bewegte ich mich langsam auf allen Vieren ins Büro und langte danach, fast krachte es vom Büchertisch auf den Boden.
Bärli, Bärli, bin doch wieder auf der Psychiatrie! Denkst du bitte ans Praxiten? Bitte,
danke, ganz lieb!
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at