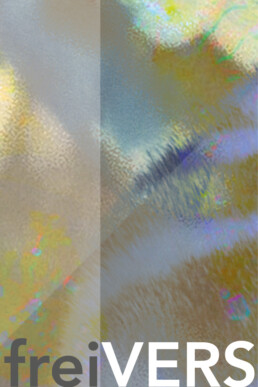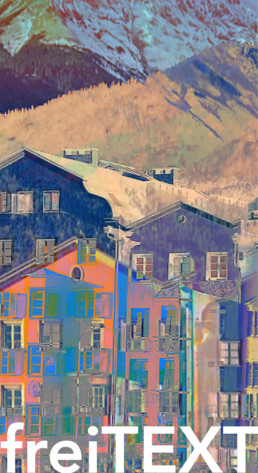freiVERS | Judith Klara Lüdtke
Näher
Näher an das Fenster ran, aus dem Wohnzimmer hinausblicken
Näher an das Fenster ran, hinausschauen
Auf den Zwetschgenbaum
Auf das dunkle Fenster gegenüber
Auf die grünen Pfosten
Auf die wilde Rose
Auf den Farn
Erinnerungen in Holz, Glas, Stein, Pflanzen, Lichtern, Farben
Alles in Farben
Bäume der Bilder, die ich male
Bäume aus Bildern, die ich male
Bäume aus Fenstern
Bäume in Fenstern
Geht da die Geschichte weiter?
Fängt sie da an, sich in Kapiteln auf Äste zu verteilen?
Fängt sie da an weiterzuwachsen?
Fängt sie da an?
Immer weiter zu wachsen
Immer weiter zu blühen
Mit der Gewissheit, dass im neuen Frühling die Blätter wieder kommen?
In Ästen trauriger Tage
Wächst das Holz geprägter Stunden
Erinnerungen an den Ästen
Erinnerungen in den Blättern
Erinnerungen in den Fenstern, in denen sie sich spiegeln
Erinnerungen in Bäumen
Bäume in Bildern, die ich male
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sabine Dreßler
Familie
Bei uns hat jeder seinen eigenen Platz am Tisch. Wir sind zu viert. Also auch vier Stühle. Die Stühle sehen alle gleich aus: Holz, weiß lackiert, ausgepolsterte Sitzfläche, überzogen mit gräulichem Kunststoff, abwischbar. Ich sitze immer nahe der Schrankwand mit Blick auf die Küche. Maren sitzt links von mir, Mutti rechts. Und mir gegenüber, an der Balkontür und mit Blick aus dem Fenster sitzt Vati. Er hat den schönsten, den hellsten Platz. Hell genug, um Sonntag darauf ausgiebig Zeitung zum Kaffee zu lesen. So, genau so sitzen wir immer: zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendbrot. Ich weiß nicht mehr, wie das gekommen ist, wie das entschieden wurde, dass Vati mit Fensterblick und ich mit Küchenblick sitzen und nicht andersherum. Dass wir immer so sitzen und nicht etwa rotieren oder sitzen, wie es uns gerade passt. Aber es ist so.
In letzter Zeit ist Vatis Platz beim Abendbrot häufig leer. „Wartet nicht auf mich, es wird heute spät“, sagt er ins Telefon und dann legt Mutti auf, setzt sich rechts von mir an den Tisch und schweigt. Und kaut lang an einem Bissen. Und so kräftig, dass ich ihre Kiefernmuskeln sehen kann. Und dann schweigen wir auch und kauen. Niemand von uns wäre auf die Idee gekommen, sich auf Vatis Platz, auf den schönsten, den hellsten Platz zu setzen. Er ist frei. Mutti könnte es tun. Ich könnte es tun. Maren. Einfach so. Aber niemand von uns setzt sich da hin. Das würde alles durcheinanderbringen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Torsten Siche
nach Hause kommen
ein Sommer wie Chlor und Pommes
einst und ewig im Treppenhaus
warten die Schuhe auf den Herbst
oder wer auch immer sich hierher verirrt
früher roch es treppauf nach Rhythmus
treppab die Scheibe Wurst
noch nudelwarm die Aussicht
auf süße Tüten oder Pizza für drei
jetzt duckt sich das Dach
im Niesel wächst etwas
zwischen den Dönerresten
abgerissene Zettel aufgeweichte Bitten
eine Katze beinahe unleserlich
vermutlich vermisst ein Klavier
zu verkaufen ein Auto oder ein Käfig
für alles was sich wegsperren lässt
abgeschüttelt die Zwiebelringe
unter den Schuhen weder Takt
noch Feingefühl in den Krümeln
der Dagebliebenen
ein Winter wie Mäusekot
hinter den Zierleisten jetzt und immer
wartet ein Kuss auf sein Echo
im Treppenhaus
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sonja Lauterbach
Zwischen Lametta und Plastiktanne – Die große Leere in der Vorhölle der Besinnlichkeit
Es begab sich aber zu der Zeit, dass man mich bat, etwas Besinnliches zu schreiben. Ein harmloses Wort, sollte man meinen. Doch inzwischen klingt „Besinnlichkeit“ wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Epoche – irgendwo zwischen Schallplatte, Telefonzelle und intakter Aufmerksamkeitsspanne.
Ich nahm also an. Das war mein erster Fehler.
Der zweite war, tatsächlich damit anzufangen.
Denn seien wir ehrlich: Wer hat denn bitte noch Muße, sich zu besinnen? Meine Besinnung liegt seit Jahren in der Warteschleife des globalen Kundenservice. „Ihre Besinnung ist uns wichtig. Wenn es um die perfekte Stimmung geht, drücken sie die Eins, …“
Vorfreude ist auch nicht mehr das, was sie mal war
Früher, so heißt es, begann Weihnachten, wenn der erste Schnee fiel. Heute beginnt es, wenn der Algorithmus entscheidet, dass du bereit bist, Geld auszugeben. Im September. „Cozy Christmas Vibes“ auf Spotify, während draußen noch Wespen im Biergarten tanzen. Das ist keine Einstimmung – das ist eine Drohung.
Ich wollte mich also einstimmen. Ich zündete eine Kerze an – Bio, fair gehandelt, klimaneutral versandt, selbstverständlich mit moralischem Zertifikat – und wollte etwas schreiben über Schnee, Stille, Zauber.
Dann kam eine Push-Nachricht: „Nur noch 3 Tage! 40% auf alle Weihnachtsartikel! Tannenbaum-Emoji 🎄“
Es waren noch 47 Tage bis Weihnachten.
Feldforschung im Glühweinmilieu
Vielleicht, dachte ich, muss man raus. Auf den Weihnachtsmarkt. Das wahre Leben spüren.
Der Glühweinduft! Das Lachen der Kinder! Die Wärme der Gemeinschaft!
Ich kam an – und fand: einen Outdoor-Ausschank mit QR-Code-Bezahlsystem. Meine Finger waren zu kalt, die App zu langsam, das WLAN zu schwach. Der Glühwein kostete 5,50 €, die Tasse 3 € Pfand, und als endlich alles bezahlt war, war das Getränk bereits kalt.
Der Duft? Desinfektionsmittel.
Die Kinder? Am Handy.
Die Gemeinschaft? Jeder für sich, aber gemeinsam frierend.
Neben mir sagte ein Mann ins Telefon:
„Nein, ist nicht so besonders. Ja, ich komm bald heim.“
Ich nickte innerlich. Er sprach für uns alle.
Sinnlichkeit auf Sparflamme
Sinnlichkeit, hieß es, sei das Ziel.
Doch was ist Sinnlichkeit in einer Welt, in der selbst der Glühwein digitalisiert wurde?
Früher war’s ein Keks zu viel. Ein Kuss im Kerzenlicht, das Wachs tropfte, und niemand beschwert sich, weil es schön war. Heute tropft nur noch das WLAN.
„Alexa, spiel Weihnachtsmusik.“
„Ich habe keine Verbindung zum Internet.“
Das ist der wahre Weihnachts-GAU: der Zusammenbruch der Datenverbindung. Kein Engel, kein Stern, kein Halleluja – nur das kalte Schweigen der Sprachassistentin.
Die moralisch korrekte Zielgruppe
Und dann sehe ich euch vor mir – ja, euch, liebe Zuhörende.
In euren ethisch geprüften Wollpullis, mit einem ökologisch einwandfreien schlechten Gewissen.
Ihr habt eine Gans gekauft, die ein gutes, veganes Leben hatte – bis sie es nicht mehr hatte. Und ihr habt Geschenke organisiert, die nicht Freude bringen sollen, sondern Gewissensberuhigung: Eine Ziege für Afrika. Im Namen von Tante Gertrude. Die Ziege weiß nichts davon, aber ihr habt es getan – und das zählt. Das Foto der Referenz-Ziege ähnelt stark ihrem Gesicht, als Tante Gertrude das Zertifikat auspackte.
Ihr seid erschöpft. Nicht vom Feiern. Vom Versuch, es moralisch richtig zu tun.
Ihr wollt Wärme – aber der Strompreis friert selbst den Elektrokamin ein.
Der große Kollaps
Also schreibe ich. Nicht besinnlich, nicht festlich, sondern: erschöpft.
Weihnachten ist längst kein Fest mehr, es ist ein Projekt. Ein kollektives Burn-out mit Glitzer und Beleuchtung.
Die Engel? Haben gekündigt.
„Unbezahlte Überstunden im Himmel? Sorry, Petrus, das machen wir nicht mehr. Wir gründen jetzt eine Consulting-Firma – oder werden Influencer. Bessere Arbeitszeiten, gleiches Strahlen.“
Der Trotz der Letzten
Und trotzdem – wir feiern weiter.
Nicht, weil es schön ist, sondern weil wir es noch können.
Wir wissen, dass es albern ist. Und genau darin liegt der Trost.
Wenn 37 Handys gleichzeitig „Stille Nacht“ spielen, jedes mit einer anderen Latenz, entsteht etwas Großartiges: der schiefe Chor der Unvollkommenheit.
Das ist vielleicht das neue Besinnliche – das Wissen, dass wir keine Besinnung mehr haben. Und das neue Sinnliche – die Sehnsucht nach einer Minute Ruhe, in der niemand etwas bestellt, bewertet oder liked.
Epilog mit Glühweinresten
Ich wünsche euch keine frohe Weihnacht. Froh ist überbewertet.
Ich wünsche euch eine erträgliche.
Geschenke, die so nutzlos sind wie dieser Text – und gerade deshalb perfekt.
Einen Moment, in dem niemand fragt, ob das jetzt nachhaltig genug ist.
Und wenn Alexa wieder streikt, sagt einfach: „Dann eben nicht“ – und singt selbst.
Denn nur, wer nichts mehr erwartet, kann noch überrascht werden –
von einem Lächeln, einem funktionierenden Lichterkettenstecker,
oder der ehrlichen Stille nach dem kollektiven Weihnachtswahnsinn.
Frohe Ratlosigkeit.
Und möge euer Fest so schön scheitern, dass ihr es später gern erzählt.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Katalin Balassa
Uhrwerk und Teig
Ich knete die Wörter gerne.
Ein Teig mit Leben und Wärme,
ein wenig Ruhe,
er hebt sich selbst.
Innere Gänge,
luftige Schächte,
gewölbter Rücken,
klebrige Ränder,
Reste am Finger.
Kaum Regeln –
nur atmen lassen.
Es ist nicht immer einfach.
Deutsch ist wie ein Uhrwerk.
Gnadenlos genau.
Und manchmal schmerzhaft strukturiert.
Sein Takt gibt Klarheit:
Klang der Berge,
weit über der Nebelgrenze.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sarah Niklowitz
Kafkas Schloss
Flinke Augen huschen über Seite 201, während die Kuppen von Zeigefinger und Daumen der rechten Hand sich bereitmachen. Umblättern. Ein Prozess, der in Zeitlupe einem Vorspiel gleicht, beginnend an der oberen rechten Ecke, erst mit zwei Fingern, dann nur noch mit dem Zeigefinger sanft über die Kante streichend, bis das Papier schwach wird und sich mit einem stummen Seufzen auf den Rücken fallen lässt. Es genießt den neugierigen Blick auf seine Rückseite und lehnt sich entspannt zurück, bis das Augenpaar sich dem nächsten Blatt widmet und das Zusammenspiel aus Daumen, Zeigefinger und Seufzen von vorn beginnt. Das Schloss genießt die Zärtlichkeiten 220 Seiten lang. Ob Kafka sich im Grabe umdreht, um dieses Grauen nicht zu sehen oder zufrieden lächelnd jede Berührung seines Werkes beobachtet, bleibt sein wohlgehütetes Geheimnis. Die Neugier ist groß, was er wohl davon hielte, dass seine Zeilen sich als Herumtreiber entpuppten. Das Schloss, den Kinderschuhen längst entwachsen, geht ohnehin seine eigenen Wege, zumindest lässt es sich bereitwillig auf jedes neue Hände- und Augenpaar ein, das sich von ihm angezogen fühlt. So kommt es, dass Kafkas Werk Abenteuer erlebt, von denen wir Menschen nur lesen können. Diese Reise endet in 18 Seiten. Der Abschied ist ein vertrauter Ablauf für beide Beteiligten, ein Auf Wiedersehen zwischen einer weit gereisten Geschichte und Fingern, die trotz ihrer Jugend bereits 276 Beziehungen dieser Art führten. Alle endeten auf dieselbe Weise. Die Gedanken verharren noch drei tiefe Atemzüge auf dem letzten Satz, bevor sich der Einband wieder um die Seiten schließt. Ein letztes Mal streicht diese Hand über seinen Rücken, ein Abschied mit Aussicht auf ein Wiedersehen, vielleicht in ein paar Jahren. Das stumme Versprechen einander nicht zu vergessen gefolgt von der Übergabe an den Turm der Gelesenen. Wäre dieses Werk ein einfaches Buch, würde sein Weg hier enden, auch wenn die Chance auf ein oder zwei neue Bekanntschaften nicht auszuschließen sind. Die Wahrscheinlichkeit des Verblassens unter einer Ansammlung von Staubkörnern ist hoch. Doch diese Ausgabe von Kafkas Schloss ist nicht für den frühen Ruhestand bestimmt. Dieses Werk folgt einem anderen Schicksal.
Zwischen in Klarsichtfolie überzogenen Einbänden finde ich mich wieder. Der Boden des Aluminiumregals fühlt sich kalt an, doch meine Nachbarn wärmen mich an Vorder- und Rückseite. Leise brummendes Neonlicht hüllt den Raum in einen leicht muffigen Gelbstich, der mir bedeutet, dass ich wieder zu Hause bin. Die Ecken meines Einbands dröseln sich mit jedem Griff weiter auf, wie splissige Haarenden. Mir wohlvertraute Hände streichen sanft darüber, bevor sie mich zurück ins Regal stellen – so schlimm scheint es noch nicht zu sein. Jedes Leben hinterlässt seine Spuren, auch das eines Bibliotheksbuches. Meine Reisen verbringe ich weitgehend als stiller Beobachter, doch zurück im zweiten Regalfach von oben unter dem Schild Romane K-L teile ich meine Erlebnisse mit dir. Wir Bücher sehen mehr als du denkst. Wir erinnern uns an jeden Blick, der uns je traf, jede Hand, die uns einst hielt. Wenn du das nächste Mal in einer Bibliothek stehst, halte einmal inne und nimm dir Zeit, genau hinzuhören. Wenn du es schaffst, deine eigenen Gedanken ganz leise zu stellen, kannst du uns hören. Das emsige Wispern zwischen den Seiten, während Rückkehrende von ihrem letzten Abenteuer erzählen und Neuankömmlinge darüber philosophieren, wer sie wohl als erstes auswählt und über den Scanner zieht, dessen Piepsen die Leihfrist von vier Wochen einläutet. Mascha Kalékos Sei klug und halte dich an Wunder berichtet mir gerade von der salzig-heißen Träne eines Herren mit rauen Fingerkuppen, die sie auf Seite 22 traf als Heinz Kahlaus Fundsachen sich den Weg in unser Zwiegespräch bahnen. Das Atmen fällt mir schwer, es wird langsam eng zwischen K und L und ich hoffe auf einen baldigen Reiseantritt. In diesem Jahr stehen meine Chancen gut, denn der Geburtstag meines Schöpfers wird groß gefeiert. Jeder möchte ein Stück von ihm haben und so war ich in den letzten Monaten mehr unterwegs als die meisten anderen hier. Selbst die Neuerscheinungen blicken mir neidvoll hinterher, wenn ich in fremden Taschen das Haus verlasse. Heute schließe ich meine Augen zwischen Kahlau und Hesse, der sich wohl verirrt hat, was manchmal passiert, wenn die Tochter des Bibliothekars zu Besuch ist. Sie findet, Hermann Hesse passt besser zu Mascha und mir als zu Hemingway, die diskutieren ihr immer zu laut, sagte sie einst. Gerade gehe ich vom Dösen in einen tiefen Schlaf über, da reißt mich ein gekonnter Handgriff aus meinen Träumen, noch bevor sie beginnen. Ich wurde vorbestellt. Auf dem Wagen mit den Bereitstellungen für den nächsten Tag ist mir ein wenig frisch um den Einband und es kribbelt in den aufgedröselten Ecken. Wer mich wohl morgen abholen wird?
Es duftet nach Sandelholz, die Heizung haucht dem großen Raum mit stetem Rauschen Wärme ein. Zwischen Seite 31 und 32 steckt eine Postkarte aus Kreta mit verblasster Tinte. Liebe Grüße von Oma und Opa. Aus der anderen Ecke des Raumes schallen abwechselnd fremde Stimmen aus einem Laptop-Lautsprecher, meine momentane Besitzerin scheint ein wenig wortkarg in diesem Spektakel. Doch ich spüre ihre Blicke auf mir. Sie hat es mir gemütlich gemacht, ich liege eingekuschelt in die warmen Worte ihrer Großeltern auf einer Decke, die so weich ist, wie ich mir die Konsistenz einer Wolke vorstelle. Fernab jeder Realität besteht diese aus 100 Prozent Wolle. Das ungeduldige Wippen mit ihrem rechten Fuß unter dem großen Holztisch, auf dem der plappernde Laptop seinen Platz hat, macht mich nervös. Tschüss! Das erste und letzte Wort, das in diesem Raum heute gesprochen wurde. Ein tiefer Seufzer lässt Bildschirm und Tastatur miteinander verschmelzen. Als sie sich unter die wolkenweiche Decke schiebt, lande ich auf ihrem Schoß und spüre, wie ihr Körper ruhiger wird, der Atem tief und gleichmäßig. Meine Seiten legt sie so zart um, als drohten sie beim nächsten Windhauch auseinanderzufallen. Obwohl sie einen leichten Gelbschleier vorweisen, sind sie von robuster Qualität. Ich verstehe meinen Auftrag und versuche meine Seiten möglichst zu entspannen, damit sich die Hände, die mich halten, nicht an mir schneiden können. Es gibt Momente, da bemühe ich mich um extra scharfe Kanten. Immer dann, wenn ich merke, dass jemand mich nur benutzt, um Eindruck zu schinden und überhaupt nicht an einem ehrlichen Kennenlernen interessiert ist. Dem letzten Junggesellen bescherte ich nach dem vierten Date in einer Woche ein blutendes Rinnsal aus dem rechten Zeigefinger, als er mich viermal an derselben Stelle aufschlug und sein Gegenüber mit denselben Worten einzunehmen versuchte, wie bereits drei Male zuvor. Manchmal besteht meine Aufgabe darin Trost zu spenden und zuzuhören, doch dann und wann nehme ich es mir heraus ein Zeichen zu setzen. Die bräunlich gefärbten Flecken auf den entsprechenden Seiten tragen alle Bibliotheksbücher, wenigstens die, die in ihrem Leben mindestens eine bitter geweinte Träne gekostet haben. Oft sind wir die einzigen, die den Schmerz eines gebrochenen Herzens wirklich zu Gesicht bekommen. Wenn du jemanden dabei erwischt, der seine Nase tief zwischen unseren Kapiteln vergräbt, dann sei dir sicher, dieser Mensch hat ein reines Herz. Die Augen geschlossen, halten sie uns dicht an ihr Gesicht und atmen unsere Seele ein. Unser Duft aus bedrucktem Papier, Tränen und Blut ist für die einen ein Graus und versetzt andere in einen Rausch der Glückseligkeit. Die letzten Monate versanken in einem Kreislauf aus Enge im Aluminiumregal, unterbrochenen Gesprächen mit Mascha und Reisen in Rucksäcken, Jutebeuteln, mal behandschuhten und mal schwitzigen Händen. Tränen, Stimmen, Düfte fremder Schlaf- und Wohnzimmer, Zugfahrten, sanfte Berührungen, Scannen, Piepsen, Rückgabefach, zweites Regalbrett von oben zwischen K und L. Zwei Wochen vergehen und ich langweile mich in meinem Regalfach. Fast hätte mich der Staubwedel erwischt, doch gerade rechtzeitig greift eine zittrige Hand nach mir, ich stolpere und falle auf den braunen Teppichboden. Keuchend werde ich aufgehoben und getätschelt, wie ein Kind mit aufgeschlagenem Knie. Mir ist, als würde man mir ein bunt gemustertes Pflaster aufkleben, damit die Wunde besser heilen kann. Der Scanner piepst, vier Wochen bin ich dein. Eingehüllt in Leder und Chanel No. 5 trete ich meine Reise an, nichtsahnend, wie besonders sie für uns beide sein würde.
Die samtige Textur von Eichenholz schmiegt sich an meinen Rücken und ich lausche aufmerksam seinen Erzählungen, während meine neue Besitzerin sich auf unser Rendezvous vorbereitet. Es kann nicht mehr lange dauern, denn das Zischen des Kessels geht langsam in ein Gurgeln über. Beinahe andächtig gießen die vorhin noch zittrigen Hände das heiße Wasser in die Tasse, aus der sogleich ein dampfender Wall aus Pfefferminz emporsteigt. Stille. Die Atmosphäre gleicht dem Moment nach einem gemeinsamen Abend mit Freund:innen, die nach stundenlangem Lachen, Reden und Philosophieren den Heimweg antreten. Pfefferminz, Chanel No. 5 und ein mir unbekanntes Aroma vermischen sich und ich werde von kalten, aber sanften Händen begrüßt. Ich spüre ein Lächeln, so wohlwollend und wehmütig zugleich, dass meine Seiten ins Flattern geraten und das Umblättern schwerfällt, doch gemeinsam schaffen wir es. Dreizehn Schlucke Pfefferminztee und 57 Seiten. Dann verstummen die Hände, die mich halten. Draußen wird es dunkel und nur eine Stehlampe mit beblümtem Schirm direkt über dem Sessel, auf dem wir es uns gemütlich gemacht haben, hüllt den Raum in eine friedvolle Stille. Ich spüre, wie ich langsam Richtung Teppichboden gleite und falle schließlich weich. Diesmal bleibe ich liegen. Kein angestrengtes Keuchen, mit dem ich aufgehoben werde, nicht einmal der kleinste Atemhauch. Frieden. Pfefferminz, Chanel No. 5 und Frieden.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Avy Gdańsk
aus Männern werden Nymphensittiche
mit roten Bäckchen, angeblich, wenn
sie mich sehen: deine Beobachtung
befriedigt den Prinzen in mir, dem
deine Heimat unablässig schmeichelt
doch sollte man einem Land
keinen Glauben schenken, wenn
es einen zu verwandeln sucht: meins
erzählt nur Märchen über dich, weiß
und weiß nichts: hier
sieht man nur deine Haut und
deinen Halbmond, dem auch ich
mit spitzen Hörnern begegne – meine
agnostischen Instinkte schlagen, meine
mystischen schmiegen sich an; ich
löse dich immer noch aus Worten, mit
denen ich dich überzogen habe und schlüpfe
in deine Djellaba – einmal werde ich
alles von dir, du alles
von mir tragen, bis
dahin versöhne ich dich mit dem Schnee
und finde heraus, wie man böse Zungen
entgiftet
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martin Ködelpeter
gespenster
1 die gladiolen sind frisch geschnitten. sie stehen aufrecht in einer gläsernen, nach oben schmal zulaufenden vase. durch das helle glas kann man im wasser einzelne luftbläschen erkennen. sie sitzen auf den stielen und auf den schwertförmig in die höhe strebenden blättern. einige bläschen haben sich auch am glas gesammelt. knapp oberhalb des vasenrands, etwa auf halber höhe der gewächse, spreizen sich die ersten blüten von ihren stängeln ab. ihre form ist die komplizierteste. eine frau berührt mit ihrem zeigefinger vorsichtig eines der gelben fruchtblätter. die kinder, die sich im halbkreis um sie versammelt haben, nicken. sie wissen, dass das geheimnis darin besteht, nur das zu malen, was man tatsächlich sieht. nachdem die kinder mit ihrer arbeit begonnen haben und die pinsel ihren weg durch die bereitgestellten farbkästen suchen, verändert sich das klima im raum. die angestrengte, wie ein boot schwankende stille, die kleinen, über das raue aquarellpapier streichenden fäuste, die gleichgültigkeit der gladiolen in ihrer vase, all dies ist plötzlich kaum mehr zu ertragen.
2 das misstrauen gegenüber den worten, bis in die haarspitzen ist es dir gewachsen, tropft auf die schuhe, hinterlässt überall seine spuren. schon bald sickert es in die druckerpatronen, die dir von ihren haken im elektronikgeschäft unverhohlen ins gesicht lachen.
3 und wieder: der alte traum, in die wälder zu gehen, eine höhle zu graben, abseits der rahmen menschlicher proportion. im schatten der eichen findest du dich zwischen zweigen verstreut. beschämt, nicht zerbrechen zu können, wenn ein tier auf dich tritt.
4 die flügel sind zerbrochen. schmutz bedeckt das nasse gesicht. unmöglich, den jungen vogel zu orten, der dir aus der dunkelheit ein lied über sein porzellanenes federkleid singt.
5 und sicher, es ist reizvoll, die gewalt abzuwägen, das scharnier an der tür durch die augen des entschlossenen räubers zu sehen. und die gewalt, die deine finger bewohnt und die auch das eisen bewohnt, das du auf deinen fingern geschickt zu balancieren vermagst, schreibt seine kerben in den asphalt breiter straßen, fügt seine spuren behutsam in die kiefer und augenhöhlen blauviolett schimmernder nachmittage.
6 du trägst die steine in deinen händen. die steine tragen die namen der väter. die väter tragen keine steine. sie sind tot. an einem bach bleibst du stehen. du legst die steine ins wasser, drückst sie hinab wie den kopf eines kindes, drückst sie hinein in den boden des bachs. schon bald beginnen die steine zu schluchzen. du hältst sie fest. du hältst die steine wie seifenstücke, deren schäumende leiber nur darauf warten, deinem griff zu entgleiten, nach oben zu flitschen und dir die namen der väter mit felsiger tinte ins angstvoll verzerrte antlitz zu schreiben.
7 es sind die zähne, die vergessen, die stunden zu addieren, der kiefer, der über das knirschen der wochen in verwirrung gerät.
8 und jeden tag kommt ein neuer tag und rüttelt an den ästen der träume, rüttelt das nachtobst aus dir, das du aufliest und mühsam zerkleinerst, das du, gebeugt über das schneidebrett, zurück in den körper zu stopfen beginnst. und auch die kerne und stiele und auch die schalen und die zu boden gefallenen teile stopfst du zurück in den körper, alles stopfst du zurück und leckst schließlich sogar den saft von der klinge des messers. leckst mit der zunge die zähne, die den dunklen geschmack noch einen moment festzuhalten verstehen.
9 das foto zeigt dich auf einer breiten allee. der ort ist dir unbekannt. nichts wirkt vertraut. ist es überhaupt eine allee? jemand scheint das negativ mit einer chemischen lösung bearbeitet zu haben. jede dunkelheit, jeder kontrast - weggeätzt. du blinzelst, suchst im grauweißen rauschen nach einem bekannten detail. doch da ist nichts. nur du und dein im grellen licht beinahe transparent gewordener schatten.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Marlies Blauth
mein Haus
besitzt viele Windungen
Korridore
führen durch die Jahrzehnte
am Ende haben wir
manchmal Neues gebaut
einen Ruheraum
eine Kleiderkammer
einen Gedanken –
jetzt
breitet sich Halbleere aus
staubige Spuren
lebendiges Erbe
jemand fragt
ob du hier
überhaupt noch wohnst
mein Nein
hat einen Bittergeschmack
den ich nicht aussprechen will
das Herz sortiert
trübe Bilder aus
ohne dich
gäbe es auf der Südseite
keine Sonnenblumen!
zu manchen Zeiten hast du
mir Wörter geschenkt
glanzvolle
helle
erleuchten seitdem
jedes Zimmer
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tamàs Török
Hitze
Sobald die Tür zum kühlen Treppenhaus hinter mir ins Schloss fällt, wird mir jedes Mal aufs Neue klar, wieso die Sonne eine Gottheit war.
Der Winkel, in dem ihr Licht auf die Speckbacherstraße in Innsbruck fällt, ändert sich und meine Winterdepression wird zur Atemnot zwischen glühendem Asphalt. Ich senke den Blick vor ihrem Glanz und suche Zuflucht in den Schatten.
Egal hinter wie vielen Fachbegriffen und Zahlen man sie auch zu verstecken versucht, das subjektive Empfinden ihrer mich beinahe in die Knie zwingenden Macht bleibt dieselbe.
So, wie ich sie bei meinen Winterspaziergängen suche, wie eine in die kalte Dunkelheit jenseits des wärmenden Lagerfeuers verbannte Motte, beginnt der Sommer für mich an jenem Tag, an dem ich die Straßenseite wechsle, um vor ihr zu fliehen. Es ist zur selben Zeit, in der das üppige Jeansblau des Frühlingshimmels dem ausgewaschenen Look des Sommers weicht, in dem unser weißes Inferno so lautlos wütet.
Die mich umgebenden Hausfronten sind ausdruckslos wie die Dünen von Arrakis, hinter deren gesenkten Rolllädenlidern die Bewohner sich wie fiebrige Gedanken wälzen.
Eine Biene klammert sich an eine gefallene Blüte auf dem sengenden Fußgängerweg, nuckelt noch im Todeskampf am Blütenstaub.
Ein Moped surrt an mir vorbei und ich denke an eine Mücke aus Metall.
Soll ich über den Zebrastreifen sandwalken wie Timothée?
Sirenen heulen in der Ferne, die nie verstummt sind, die drückende Stille war also bloß Einbildung, meine Entrückung ein Placebo. Alles ist wie immer. Die Krankenwagen kommen immer näher mit ihrer sterbenden Fracht, zerbröseln meinen Kopf im Vorbeifahren in einer Explosion aus Schall. Sobald sie um die Ecke biegen, werde ich ganz von allein wieder ganz.
Zivilisten hupen, weil es an den Ampeln staut und auf jedes Hupen antworten zwei, drei weitere kniggegerechte Revolverschüsse im gezähmten Westen.
Die Minuten rinnen an den Kirchtürmen herab, wie Harz an Baumstämmen und ihr Klingeln vermischt sich mit dem Krächzen von auf Regenrinnen harrenden Raben.
Worauf sie harren? Auf frisches Aas.
Und sie warten nicht umsonst, denn in den Menschenbrüsten pocht es vor Wut und Einsamkeit, die Herzen im Rippenkäfig gefangene Berserker, denen jeder Grund recht und einer zu viel ist. Denn die Gefühle herrschen wieder im zivilisierten Durcheinander, das Denken wurde vom Lagerfeuer verbannt.
Was sonst so leicht fällt, ist plötzlich schwer. Nicht pöbeln, zuschlagen, nachtreten und draufspucken, nachdem die zittrige, auf ihren Rollator gestützte Pensionistin mit den Muschelpralinen und der Kochrumflasche im Korb sich an der Kassa vordrängelt, eine größere Herausforderung, als sich Leser von Proust und Woolf eingestehen möchten.
Andererseits verschlingen das Weltgeschehen und die wirtschaftliche Lage schon seit Jahren die schimmligen Madeleines im Panikraum der Selbstbeherrschung.
Was mal wirklich schön wäre, wäre eine Pause. Von allem.
Einfach mal Siesta machen und die Welt Welt sein lassen.
Wie viel einfacher doch alles wäre, wenn wir weniger erwarten könnten. Zuerst von uns selbst und dann allmählich von all den anderen, anstatt durch das Vakuum der Hitze zu rasen, nur um auszubrennen und zu verglühen, wie durch die Einsamkeit des Weltraums stürzende Sterne.
Wir schwitzen schließlich alle und der Herbst kommt früh genug.
An zu Tuendem wird es uns niemals mangeln. Das Leben ist unerschöpflich, aber ich bin es nicht.
Cut. Stop.
Aus die Maus.
So wie damals im Kindergarten, als ich mit vom Mittagessen prallem Bauch mürrisch wurde, ist es höchste Zeit für ein Nickerchen auf meinem Rorschachtest aus Schweiß und Leinen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at