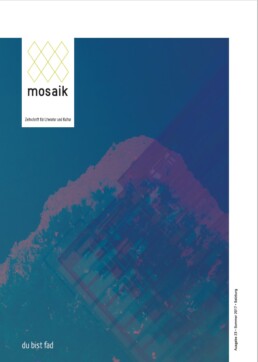freiVERS | Susanne Rzymbowski
Wie malt die Welt
in Farben sich
mit Pinsels Strich
der in Erinnrung bleibt
aus einer Hand
die unverzagt
im Greifen puren Seins
das losgelöst
von Sinn und Wort
der Freiheit ist entstammt
so schön der Akt
des glücklich seins
als Kind bist du geboren
Susanne Rzymbowski
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Robin Krick
Das Geständnis
Seit die Dienstvorschriften geändert wurden, dürfen wir die Hauptverdächtigen nicht mehr aufs Revier holen, um ihnen durch Schläge und Anbrüllen das Geständnis zu entringen. Unser Dienstherr ist neuerdings der Ansicht, dass es schädlich sei, die Verdächtigen zu beeinflussen. Der Wahrheit – so drückte er sich aus – müsse Gelegenheit verschafft werden, ganz von selbst durch den Mund des Delinquenten ans Licht zu kommen. Meine Arbeit beschränkt sich jetzt darauf, bloß dazusitzen, abzuwarten und im entscheidenden Moment alles zu notieren. Inzwischen bin ich täglich in der ganzen Stadt zu Hausbesuchen unterwegs, wobei mich das Unterwegssein an sich nicht stört, vor allem, wenn ich an die trübsinnigen Stunden im Büro denke. Dennoch steige ich nur widerwillig in den Dienstwagen. Ich erfahre erst jetzt wieder bei meinem neuesten Fall, wie nutzlos meine Arbeit doch geworden ist: Drei Stunden lang saß ich dem Delinquenten mit dem Notizblock in der Hand auf dem Sofa gegenüber und alles, was er von sich gab, waren schwache Seufzer, ein dumpfes Schluchzen und ein gelegentliches Hochziehen der Nase. Dann hatte er auch noch begonnen, sich mit dieser Orange zu beschäftigen. Wohl eine halbe Stunde lang musste ich mitansehen, wie er sinnlos und selbstvergessen daran herumschabte, ohne auch nur die Schale vom Fleisch zu lösen. Peinlich war es, zu beobachten, wie er sich dabei mit dem Handrücken immer wieder über den offenen Mund fuhr, um den Speichel abzuwischen. Es geschah wohl aus einem kurzen Moment der Schwäche heraus, dass ich mich plötzlich über den Couchtisch beugte und ihm den Dienstausweis drohend vors Gesicht hielt. Es fehlte nicht viel, und ich hätte ihn auch noch beim Kragen gepackt, aber dann dachte ich wieder daran, dass ich mir ja vorgenommen hatte, mich unbedingt und so streng wie nur eben möglich an die neuen Vorschriften zu halten, um so dem Dienstherrn endlich ihren Unsinn zu offenzulegen. Ich ging ans Fenster und streckte den Kopf hinaus in die Dämmerung. Von der Stadt her drang ein dumpfes Trommeln und Wummern durch die Luft. Unten auf dem Gehsteig sah ich einen Mann in Tarnkleidung gehen. Er hatte sich das Gesicht schwarz angemalt und stach mit einem langen Messer auf die Mülltonnen am Straßenrand ein. Potthoff, mein Assistent, drängte sich zu mir ans Fenster und flüsterte mir irgendetwas Unverständliches zu. Zu allem Übel hatten sie mir den nervösen Potthoff an die Seite gestellt. Ich hatte gleich gewusst, dass es ihm niemals möglich wäre, sich auch nur zum Schein an die Vorschriften zu halten, daher hatte ich ihn angewiesen, während des Verhörs bei der Wohnungstür zu warten und meinen Mantel bereitzuhalten. Ausgerechnet in diesem Augenblick musste er die Nerven verlieren. Er wollte gar nicht mehr aufhören, an meinem Ärmel zu zupfen, und als ich ihn beiseite stieß, wagte er es auch noch, sich zu widersetzen. Um ihn nur irgendwie abzulenken, machte ich ihn auf den Mann unten auf der Straße aufmerksam, der womöglich ein Mörder war, aber Potthoff fasste es ganz falsch auf, dass ich mit dem Finger hinaus auf die Straße deutete, und dann geschah es, dass der dumme Potthoff einfach aus dem Fenster sprang. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.
Robin Krick
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Viktor Dallmann
jetzt staunst du
viel zu viele trapeze sind dächer jetzt resurrected
die gesichter als abteilung einer schwäche haben
für landmaschinen tiefkobalt das klebende endgültige
scheitern von hosentaschen
paragraphen berühren wie mal geliebte kinder
mein bienenschwarm ein bloßes lager für schalen
windstille calm and tasty wipfeln wir auf drei
die bäume können noch lernen wir steigen
trapeze über das spechtgebiet weil es
so geil bröselt eine schwebezeit eine
letzte wendung unter dem mond
deines löwenanteils
Viktor Dallmann
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiVERS | Matthias Engels
durch die wand
du sagst: Herrgottnochmal
der sommer war sehr klein
und der herbst nicht mehr
lassen wir den winter nicht rein
und hoffen dass er draußen
nichts anstellt
du sagst man sieht
der dunkelheit nicht ihr alter an
und keiner kennt den namen
den der schwarze vogel gerade tanzt
du knipst den raum aus
um uns
die bäume die häuser
das rauschen
du sagst: ich bin ein freies land
klickst den wässrigen mond weg
und jeden einzelnen
immer wieder aufpoppenden stern
wir kippen das mondtrübe wasser weg
und trinken schwarzen wein
blinkenden blickes steht
mein sehkrankes auge
auf stand by
du sagst:
dein traum muss durch die wand
durch das loch das geformt ist
wie die wirklichkeit du sagst:
die besten gedichte sind immer jene
die man sofort wieder vergessen kann
Matthias Engels
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Slata Roschal
Ich dachte, dass ich die Stadt verschlingen werde, sie austrinken werde, all ihre Geschäfte, riesige Werbeplakate, endlose, ineinander verwickelte Straßen, das Wirrwarr bunter Gesichter, das Chaos von Babylon, aber sie war es, die Stadt, die mich verschlang. Ich reiste mit einer Tasche an und kehrte mit dreien zurück, ich wollte auf dem Bahnhof Unterwäsche, Pralinendosen, Sushi kaufen, und trug stattdessen sieben antiquarische Bücher und reduzierte Schokolade zweiter Wahl davon. Am ersten Tag nahm ich zwei Kopfschmerztabletten und überlebte bis zum Abend, am zweiten Tag brach ich auf der Straße samt meiner Taschen zusammen und übergab mich. Dann lag ich auf dem Bett eines Bekannten, der mich aufnahm, wälzte mich hin und her und überlegte, was ich falsch gemacht haben könnte, warum mein Körper die Stadt nicht annahm, meine Blutgefäße, meine Schläfen, mein Magen, meine zitternden Hände, sie protestierten gegen die Stadt. Die Stadt war nicht für Menschen wie mich geschaffen, sie war von Menschen gemacht, die kräftige Mägen, starke Hände und breite Schädel hatten, ich war ein Fremder, ein Ausstädter, eine kurzsichtige verwirrte Person vor dem Anzeigentableau der Bahnhofshalle. Ich freute mich zunächst auf die Stadt, wie Rotkäppchen auf ihre Großmutter, ein kleiner Ausflug, eine willkommene Abwechslung, aber der Weg wird lang und immer länger und anstelle der Großmutter liegt ein böser Wolf im Bett und Rotkäppchen läuft wieder zurück nach Hause. Der Wolf ist spannend, eine willkommene Abwechslung, mit ihm könnte man so viel Spannendes machen, sich zu ihm ins Bett legen, den Wein öffnen, seinen Geschichten vom Leben im Wald lauschen, aber Rotkäppchen und der Wolf, das kann nicht gut gehen. So stehe ich auf dem Bürgersteig einer kilometerlangen Straße, stelle mich mit dem Gesicht zur Wand eines Wohnhauses und übergebe mich. Eine phantastische Stadt, die altmodischen Vitrinen, antiquarische Läden, alternative Cafes, vegane Pizzas, türkische Obstläden, vietnamesische Schneidereien, verhüllte Frauen, ich möchte ihnen hinterherrennen und in ihr Gesicht schauen, so schöne Gesichter, so schöne Augen, diese schwarze Ungewissheit über ihren Hüften, sie laufen ihren Männern hinterher, ich laufe ihnen hinterher und verirre mich endgültig, was will ich von ihnen, wo bin ich, wohin will ich. Ich übergebe mich mit dem Gesicht zur Wand, die Stadt wirkt eigentümlich, kaum habe ich sie erfasst, presst sie mich aus und schlägt meinen Kopf gegen die Haustür. Mir ist schlecht, sage ich, mir ist übel, ich kann hier nicht schlafen, ich habe zwei Tage nicht geschlafen, wie soll ich weiterleben, wenn ich nicht schlafen kann, hier möchte ich begraben werden, genau hier, neben dieser Ampel.
Slata Roschal
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Marlene Gölz
es fließt
alles zusammen
genommen
sind die
archive des selbst
eine inbesitznahme
einzelner aspekte
von punk
Marlene Gölz
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Maria Hengge
Geflüstertes Paar
„Treffen wir uns an der Ecke?“ bittet er sie und da stehen sie im Regen unter der Laterne mit Wackelkontakt. Sie leuchten auf und sind wieder im Dunkeln. „Du meine“ flüstert er und wischt sich einen Tropfen von der Nase. Sie nimmt seine Hand: „Lass uns irgendwo reingehen.“ - „Nein, nein!“ Er versteckt seine Hände tief in die Manteltaschen. Im Licht sucht sie seine Augen. Er senkt den Blick. Im Dunkeln umarmt sie ihn. Er löst sich von ihr. Sein Atem schwer. „Was ist denn los?“ - „Nichts, nichts.“ Er raschelt in seinen Manteltaschen. Ihr frieren die Zehen. Sie stehen in einer Pfütze. „Komm, wir gehen ins Trockene.“ Er rührt sich nicht. Eine fremde Stimme murmelt aus ihm: “Wir geben das Haus auf!“ - `Und ich bin schuld` fährt ihr durch den Sinn und setzt sich in ihr Gesicht. Er sucht ihre Wange: “Nein. Das hat mit Dir nichts zu tun.“ Das Licht erlischt. Raschelnd taucht er seine Hände in seine Taschen. „Was hast du da?“ Sein Atem stockt. „Sag mir doch!“ Schwer wiegt er seinen Kopf und seine Augen fliehen „Du meiner!“ flüstert sie und umschlingt ihn zum Kuss. Lange stehen sie so. Aus seinem Mantel zieht sie Briefe heraus. „Sie hat sie gefunden.“ murmelt es aus ihm. Im Dunkeln wird ihr Atem ganz still. „Du musst Geduld haben“ fleht er, doch seine frierende Hand weckt eine Flut in ihr und schwemmt ihn fort. Eine ganze Weile kniet sie in der Pfütze und wäscht Papier. „Hallo“ ruft eine Stimme über ihr. „Hal-lo“ ahmt sie nach und wendet sich müde einem jungen Mann zu. Er reicht ihr die Hand. „Zaza“ stellt er sich vor und seine Geste macht sie lachen. Sie will sich lösen, doch er nennt sie „Sonze“ und zieht sie zu sich heran. `Russisch wie meine Seele` fällt ihr ein. Sie setzen sich auf eine Bank im Park, der längst verlassen ist und blicken auf die schwarzen Bäume. Der Zeit verloren erinnert sie sich an eine Reise. Zazas lange Beine fliegen über den Abgrund. Im Treppenhaus riecht es nach Kirche und er trägt sie hoch bis in ihr Bett. „Du meine“ hört sie ein Echo letzter Nacht. „Komm“ flüstert sie und als Zaza kommt, klingelt ihr Telefon. Nein. Sie ruht an einer anderen Brust. Schwach schlägt sein Herz und ihre Arme knicken um den jungen Mann. Er reißt sie nicht an sich in stürmischer ja flehender Umarmung: „Meine, du meine, verlass mich nie!“ Sein fremder Geruch treibt sie an den Rand ihres Bettes. Morgens birgt Zaza seine Augen hinter einer Sonnenbrille und sucht jemand zu sein, der finster blicken muss. „Peng-peng!“ schießt sie ihn ab. Seine Lippen flüchten über ihre und seine Schritte klatschen im Treppenhaus wie Ohrfeigen. Sie schließt die Tür, das Telefon schweigt und die Buchstaben schwimmen in der Pfütze.
Maria Hengge
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Caroline Danneil
die jungen mädchen blühen wieder
kämmend eine der anderen haar.
in langen strichen,
bekränzend den hals mit tüchern,
mit nachdruck, mit wippen.
fransen wie blätter, oder zünglein
von gestern, nachtropfend -
gerede der schwester.
in einer Eingangshalle - hockeyschläger,
lauschend. haltend die wände
statt sträuße von jungen männern.
arme sich umarmend sorglich
ihrer selbst. halbsicher des wegs.
wie federn im fallen aus höhe
gezogen - halb so gewolltes.
zur sonne reckt sich stunden später
ihr fleisch. die jeans in kniegegend
aufgeplatzt wie behütete knospen.
was erzählen sie der neuen wärme vom winter?
was vom alleinsein? in einer whatsapp im vertrauen.
meine erinnerung - überwinternd &
gierig zu platzen, schickt sich als erste zum züngeln.
Caroline Danneil
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Laurel Eberle
Der Zuckervogel
Eine alte Schaukel hängt an dem Mangobaum draußen vor dem Fenster. Sie erinnert sich, wie sie stundenlang dort saß und das zerschlissene Seil hielt. Der Himmel spannte sich zu einem Dunst aus Lila und Blau. Und aus der Höhe sties ein Zuckervogel auf eine der Früchte, oder er flog zu wild blühenden Allamanden neben dem Haus. Saug den Nektar.
Mädchen spielen in den Vorgärten. Sie kann hören, wie sie klatschen und singen zu "Down Down, Babyâ". Sie kann das Knirschen der Autorreifen auf dem steinigen Asphalt der Uferstraße ausmachen. Sie lauscht dem Zuckervogel.
Down Down Baby, Down by the river side
Sweet Sweet Baby, I'll never let you go...
Vögel fliegen über die singenden Kinder, hienüber zu dem Fenster, wo sie sitzt und wartet. Er kommt zur selben Zeit, tagaus, tagein. Sein Rücken ist schwarz, sein Schnabel gebogen; mit ihm hämmert er wild gegen den Fenstersims. Sie stellt ihm eine Schale Zuckerwasser hin, die er meidet. Viel lieber trinkt er aus ihrer Hand.
Sie schüttet ein wenig Süße in ihre Hand, und das Wasser verrinnt in ihren Lebenslinien. Immer wenn sich ihm zu entziehen beginnt, schreitet der schwarze Vogel mit der gelben Brust ihr frech entgegen.
Er nippt.
Er schluckt.
Schnell verschwindet das Zuckerwasser von ihrer Haut, doch er trinkt weiter. Sie spürt die sich eingrabende Schnabelspitze und versucht ihre Hand wegzuziehen. Heute trägt sie die Bluse, die ihr Tita genäht hat, die mit den Lagenärmeln. Ein davon hat sich verhakt im Fensterrahmen, dessen sonnengetrocknetes Holz leicht brüchig geworden ist. Sie versucht, ihn freizumachen. Plötzlich reißt der Zuckervogel ihre Haut, seinen Schnabel in die Innenseite ihrer Hand bohrend. Schreie. Blut. Es fließt über ihre Hand, rinnt zwischen ihre Finger. Sie bewegt sich nicht mehr. Sie sitzt fest.
Er trinkt.
Er schluckt.
Als er genug hat, fliegt der Zuckervogel davon, sein Magen voll mit Hautfetzen, ihrem Blut; zerschlissen lässt er Hand und Ärmel zurück. Draußen spielen noch immer die Mädchen. Sie wechseln sich ab beim Schaukeln unter dem Mangobaum, aber jetzt singen sie ein neues Lied, eines, dass sie nicht kennt.
Laurel Eberle
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
mosaik23 – du bist fad.
mosaik23 – du bist fad.
Intro
Wer ist fad?
Wenn das mosaik auf der Titelseite eine so provokante Behauptung aufstellt, dann fragst du dich wohl, wer denn nun fad sein soll. Nun, entweder ist dies eine selbstbezogene Behauptung vom mosaik, vielleicht eine neue, etwas fragwürdige, PR-Masche. Ein kurzer Blick ins Archiv, genauer gesagt, in mosaik13, hilft weiter:
„Keine Literaturzeitschrift kann jemals so langweilig sein wie die letzten Bücher von Peter Handke.“ – Marko Dinic
Puh, aus dem Schneider. Aber das würde ja bedeuten, das Du bezieht sich auf dich, werte Leserin bzw. werter Leser, sofern Sie nicht schon von der Titelseitenduzerei abgeschreckt oder gar beleidigt worden sind. Sehr kühn von uns, sind wir doch eigentlich ganz lieb und freundlich. Und was sagt eigentlich Frau Pernkopf auf Seite 8 dazu?
Aber wo waren wir. Genau. Die Literaturzeitschriften. Dass die nicht fad sind, haben wir (und du sicher auch) nicht erst mit mosaik13 rausgefunden. Was die aber wirklich können, das dürfen sie selbst unter Beweis stellen. Zum einen beim ersten Treffen unabhängiger, zeitgenössischer Literaturzeitschriften, das im Mai 2017 in Salzburg stattfindet – klein und laut präsentieren sich bereits jetzt einige dieser Zeitschriften ab Seite 53.
Dennoch: Wenn man zum dreiundzwanzigsten Mal etwas macht, dann muss man sich dem Fadessevorwurf stellen. Intern möchten wir dafür sorgen, dass wir eben dies nicht werden, arbeiten an neuen Formaten, Inhalten, Themen. Doch dafür brauchen wir dich, der du grade im Zug/auf der Wiese/am Klo sitzt und zufällig oder ganz bewusst diese Zeiten liest. Wer liest eigentlich noch Vorwörter? Ach, ist eh ein Intro. Und als solches darf es ruhig auch konfus und wirr sein.
Weiterhin: Wir brauchen dich. Wenn du dich fragst, was wir so machen, dann lies einfach mal weiter und schau dich online um. Wenn du das, was wir (außerhalb dieses Intros) so machen, gar nicht mal so schlecht findest, dann werde doch ein Teil von uns! Noch nie war es so einfach, ein Mitglied der mosaik-Familie zu werden. Schau einfach mal auf wir.mosaikzeitschrift.at vorbei.
Der Vorteil daran: Wir sind nicht fad.
Unser Mosaik.
.
mit Texten von:
- Ulrike Anna Bleier
- Daniela Chana
- Sagal Comafai
- Fabian Lenthe
- Christian Lorenz Müller
- Susanne Pernkopf
- Andreas Reichelsdorfer
- Kathrin Schadt
- Sigune Schnabel
- Katja Schraml
- Jan Seibert
- Leon Skottnik
- Elisa Weinkötz
- Phillip Zechner
klein&laut – Literaturzeitschriften-Spezial mit Vorstellung von:
- Politisch Schreiben
- &radieschen
- Richtungsding
- Sachen mit Woertern
- Seitenstechen
- Zeitblatt Prisma
- STILL
Übersetzungen von Texten von:
- Katja Plut (aus dem Slowenischen)
- Natasa Velikonja (aus dem Slowenischen)
- Karlo Hmeljak (aus dem Slowenischen)
- Florin Iaru (aus dem Rumänischen)
- Aleksandr Baslacev (aus dem Russischen)
- Nicoletta Grillo (aus dem Italienischen)
Mit Auszügen aus:
- KulturKeule XXIII – Texte von
- Fiona Sironic
- Nora Zapf
- Daniel Bayerstorfer
Buchbesprechung:
- Marko Dinic – Lyrikkiez: Wald aus Krätze (hochroth) und BAIAE (Verlagshaus Berlin) von Tobias Roth
Interview:
- Sibylle Ciarloni mit Joanna Lisaik
Kolumne
- Peter.W. – Hanuschplatz
eine Grafik von:
- Flamingo