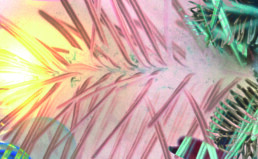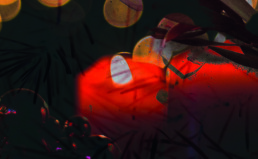13 | Georg Großmann
Mühlkreisberechnung
die Landschaft hier ist
mehrgeschossig
fiebrig, unstet
wechselt ständig
ihr Niveau
ist überall
und nirgendwo
ist Senke, Hang und
Kuppe an einem
Fleck
die Landschaft hier ist
durchstockwerkt
ist mit Wald bestockt
ist mit Wiesen bespannt
mit Häusern getupft
in denen sich weitere
Stockwerke anfügen
kleinteilig, feiner
abgestuft, filigran
erschlossener Raum
wie
eine winzige Schublade
die man aus einem Möbel-
gebirge zieht
ein Mikrokosmos
ein Setzkasten im
leuchtenden Moos
in dem wir
versteckt – in der
Nähe der Wälder, die
auch durchstockwerkt
vom
Wurzelkeller bis
zur Kronendach-
terrasse
alles verschachtelt sich
in die Höhe, dreht
sich, kippt seitwärts
kriecht in die Kerben
springt aus den Leiten
wie Erker hervor
wölbt sich den
Wolken entgegen
.
Georg Großmann
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
12 | Mario Thunert
Gleiszeit
Regen fällt
und gefriert
auf der Stelle
auf der Schwelle
spiegelt schlicht
das künstlich grelle
Neonlicht
beleuchtet
künstlich schnelle
Abschiedspflicht
Blicke wagen
nicht mehr viele
nutzen den vom Markt wehenden
Nelkenduft
für ein Lächeln
ist keine Zeit
der Zug
kommt wieder
aus dem Takt
.
Mario Thunert
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
11 | Thomas Empl
Benno
Ich war einmal aus Versehen bergsteigen.
Beinahe katatonisch saß ich in der Straßenbahn nach Fushimi, in der Hoffnung, den Touristen am „Schrein der tausend Tore“ zuvorzukommen. Wie so oft in den letzten drei Wochen hatte ich kaum geschlafen und mich in der Dämmerung aus dem Sechzehner-Schlafsaal geschlichen. Mein Plan war, mir den Fushimi Inari-Taisha anzuschauen und danach in dessen Umgebung zu frühstücken, weshalb ich die Händler auf der Hauptstraße ignorierte, die mir unter Entschuldigungen ihre Bento-Sets feilboten. Tatsächlich herrschte am Tempel noch angenehme Ruhe; um seine Traufbalken hing der Morgennebel. In seinem Rücken sah ich die berühmten, orangefarbenen Tore, die einen Steinweg umschlossen, den Hügel hinauf. Ich ging los, womöglich gab es noch einen Nebenschrein. Etwas seltsam, dass nach vielleicht hundert Toren ein Getränkeautomat am Wegrand stand, in dem ein Mineralwasser teure 300 Yen kostete. Ich bemerkte, dass ich meine Wasserflasche im Hotel vergessen hatte, aber ich würde gleich unten zum Frühstück etwas trinken.
Ich ging und ging, schon fast eine Stunde durch die immergleichen Tore. Da würde ja jetzt noch was kommen. Ah – da. Eine Lichtung, eine Art Hügelvorsprung, von dem man auf Kyoto schauen konnte, über dessen münchnerischem Stadtbild die Sonne aufging. Gut, dachte ich.
Dann sah ich das Schild.
現在地 – You are here. Ein roter Punkt.
Ich war erst ein Drittel des Weges gegangen.
Meine Zunge klemmte trocken in meiner Mundhöhle, die Schlaflosigkeit stach in meine Venen. Ich hatte Hunger. Jede Vernunft hätte gesagt: Geh zurück.
Geh rauf, sagte mein Großvater.
Obwohl ich seinen Namen als zweiten Vorname trage, kenne ich meinen Großvater nicht. Er starb ein Jahr vor meiner Geburt an einem Krebsleiden. Ich kenne seine Stimme nicht, und nur ein einziges sepiafarbenes Bild, das eher nach 1890 aussieht als nach 1990. Weste, Wanderstock, Hut. Mein Großvater war Postmann im oberbayerischen Hausham. Er war in der SPD. Aber vor allem, das weiß ich, vor allem war er Bergsteiger. Und jetzt sagte er, oder wenn Ihnen das lieber ist, telegraphierte er mir: Wer anfängt, einen Berg zu besteigen, der muss auch bis zum Gipfelkreuz.
Ich bin kein Bergsteiger. Endlose Jahre lang wurde ich die schwierigsten Routen hinaufgescheucht, im strömenden Regen, bis zum Erbrechen, lernte als Achtjähriger die Nähe von Leben und Tod. Du lebst, wenn du dich gscheit am Seil festhältst, du stirbst, wenn du von der Felskante rutschst.
Ich wiederhole: Ich gehe nie bergsteigen. Ich war sehr müde. Ich hatte zwei Drittel Berg vor mir und ein Drittel hinter mir.
Natürlich ging ich rauf.
Ich verbot mir die Automaten, deren Inhalt – ich schwöre es – teurer wurde, je höher ich kam. Wie in Trance trieb es mich durch den Schlauch der Torbögen, die immer schiefer und immer roter mein Blickfeld einsperrten, ein schräger Tunnel für einen schrägen Jungen, seit drei Wochen allein auf fremden Gleisen.
Als ich nach Stunden oben ankam, hörte ich etwas, das ich seit drei Wochen nicht mehr gehört hatte: Deutsch. Plötzlich war ich umgeben von Deutschen. Ein Gipfelkreuz gab es nicht, keine Automaten mehr. Die Aussicht war unten beim Wegdrittel besser gewesen, hier versperrten hohe Bäume die Sicht. Warum hätte jemand hierherkommen sollen?
.
Thomas Empl
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
10 | Sigune Schnabel
Ich habe eine Schneehaut bekommen
Ich weiß noch, wie sie zum ersten Mal überfror
und mich die Erde widerwillig trug.
Ich ging auf ihr spazieren.
Frostblumen blühten grau.
Als ich die Felder erreichte,
knackte die Stille
vor Kälte. Ich legte ihr die Hand
auf den Rücken,
aber sie schob mich fort.
Ob sie alleine weiterzieht,
fragte ich sie.
Ihr Körper nickte.
Ihr Gesicht war weiß.
.
Sigune Schnabel
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabelhttps://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sofie-Steinfest
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
9 | POEDU: Tulinchen
Tiramisu
Ich stehe in der Küche
Und backe Sachen voller leckerer Gerüche.
Ein bisschen Kekse, Kaffee und Mascarpone
Mische ich dazu
Und im Nu
Hab ich ein Tiramisu!
Ich will grad gehen
Und schnappe mir meinen Schuh.
Doch da riech ich das fertige Tiramisu!
Ich kann gar nicht wiederstehen
Und statt zu gehen
Muss ich mal nachsehen:
Ist noch was da?
Vielleicht ja?
Vielleicht nein?
Ich mag diesen Reim!
.
Tulinchen (11 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe kam diesmal von Sabine Schiffner:
Erstelle ein Gedicht für ein Türchen von einem Adventskalender, den Du Deiner/m besten Freund:in schenken willst. Mach ihr/ihm also ein Geschenk aus süßen Worten. Schreibe über Deine Lieblingssüßigkeit, oder denk Dir doch einfach eine neue Süßigkeit aus, eine lustige, eklige, oder eine Zaubersüßigkeit.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
8 | Gundula Schiffer
Wippende Feuer-Seiten
Und die zwei Kerzen schauen
mich so traurig an
kleine schluchzende Feuer-Augen
„Du wirst es schon noch schaffen
ganz, den Schabbat zu halten“, klagen
sie zum Trost mich zärtlich an
Die zwei Kerzen sind gütig, stehen
auf dem Holztisch im Flur, zwei Engel
die leicht schwankende Glut eines natürlichen Lichts
das bereits Kulturtechnik, darum ebenfalls verboten ist
ab jetzt, taucht mein Haus in die wundersame Stimmung
eines Fests, in ein Dunkelgold, das immer freitags, das
ganze Jahr, gegen Abend bei uns einzieht – der Schabbat
schlägt selbst dem schrillen Sommer ein Schnippchen.
Die zwei Kerzen sind gütig, sie schauen still
zu, wie ich weiterschreibe, feiern glimmend ihre
Genugtuung, dass es in mir zu arbeiten beginnt:
das grelle Flutlicht des Bildschirms, der starre
Blick der Salzsäule, meiner Schreibtischlampe
beflecken mein Gewissen, sie erscheinen mir
wie Einbrecher. Liebste Sätze, die ich zu Kabbalat
Jedid Nefesch erschaffe, sind mir Tränen worden
schaue ich zu den Kerzen: Slicha, ich lerne es noch
wie man einen Text notiert im Kopf, so schlägt es
der Rabbiner vor. Eine Nacht lang euch zuschauen
wie ihr herunterbrennt, zwei schöne Königskinder
die Schechina selbst hat euch geboren. Wirklich
füllen zwei Kerzen, deren wippende Zungen uns
Poeme andeuten, die leeren Seiten des Schabbats.
.
Gundula Schiffer
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
7 | Susanne Gurschler
Wegskizze
Eigentlich sollte der Vollherbst
Hagebutten und Schafgarben
In meinen Stoffbeutel schieben
Doch da mauern an aufgesetzter Stelle
Ahnen- und Familienforschung eine Kapelle
zu protokollieren im Verein mehr oder weniger
Verwurzelung, internationale Treffen
Gedenkbuch und Kerzendienst
Zum ewigen Licht plätschert
namenlos kaltes Wasser
in den Brunnen Elisabeths
Wenig später ein Stöckl mit Holzdach gelichtet
in Kiefern und Fichten, erbaut 1946
im Sommer von Anton und Josef
zum Dank für die gesunde Heimkehr, die gesunde
des Vaters und der Söhne [deren fünf ohne Josef]
Sonnseitig Stall um Stall im Rücken und
Steilhang: Hof um Hof und viel trockenes Holz
schob der Berg, spuckte Geröll oder röchelte
Schneemassen, war immer erst das Vieh
zuschanden, Glocken läuten trotzdem seit immer
Balkenreiche Nester über Tal
gestellt, und nur von unten
scheint der Himmel weit
Schattseitig brüchiger Kalkstein geschichtet
unter Etagenmoos, von schweren Händen geschlichtet
tagaus tagein, nachtaus nachtein zu Mehl verglüht
und da nun – wie bestellt: ein bis in den Kern mürber
Knochen gebettet auf feuchtem Holz
Gegenüber bleiche Wurzelstöcke auf
fast nacktem Rücken, Bäume gefallen wie Soldaten
im Sturm, herausgeschält und weggebracht
nur einige der stumpfen Stangen quergelegt
damit nichts nachrutschen kann von oben
Kein Andachtsfeuer zündete der Brandmeister
auf dem Holztisch überm Felsvorsprung, wo
längst faltige Stämme die Sicht verstellen
wo Schmugglergeschichten geronnen zum Pfad
und gierige Finger suchen eine andere Gefahr
Rechter Hand bewegte Erde, halb gekegelt
überm Bachlauf und unter diesem Betanien, das derzeit
zum Grabtuch von Turin in seinen Vorraum holt
aber immer noch das Kruckenkreuz an der Hauswand trägt
nur an der Panoramatafel ist der Ort ein weißer Fleck
In Marmor gelistet die Priester der Expositur, verewigt auch
die Saga des von Gewehrkugeln Getroffenen, unter frischen Blumen
wie alle die in 14-fach geweihter Erde, trägt diese dennoch weniger Namen
wichtiger seit je eh die Vulgonamen
wer sie nicht kennt, ist nicht von hier
Unterm Gekreuzigten mit päpstlichem Segen ausgerollt
die Zutaten für vollkommene und unvollkommene Ablässe
hinter der Kirchentür dutzendfach: Maria hat geholfen
Nichts jedoch den 31, die MDCXXXIIII an der Pest
gestorben, die wallfahrend kam und sie begrub
So erodiert die Anschlagtafel
nicht seit heut
gibt die Zelle keinen Laut
Das Giatlahaus, wie alle ordentlich Holz um die Hütte
wenige Mist auf dem Haufen und eine Handvoll Vieh verteilt
auf der Weide, hinterm Haus wird die Betonwand hochgezogen
da und dort stapeln plastikfaulig Marshmallows in vanillegelb
und barbierosa, trauerschwarz und lindgrün
Nur kurz der Kran höher
als der Kirchturm, der Motor
lauter als die Glocke
Den Pestweg entlang, den Zeilen nach schon
Ernst Jandl ging, vorbei am holzumrandeten Marterl
mit Maria Mutter Gottes und Rosenkranz hinterm Draht
und immerzu Blühendem in Beton, verhängen sich Gedanken
in mehrfach offenen Wunden
Sicher, sagen sie, war der Boden
hier nie, sicher waren hier immer nur
die Wurzeln und das Amen im Gebet
.
Susanne Gurschler
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
6 | Stephan Kaiblinger
Leuchtturmwärter
Als sein Wecker läutete, lag Markus bereits seit Stunden wach. Rasch kochte er sich Kaffee, stieg die Wendeltreppe in den obersten Raum empor und überprüfte, ob das Leuchtfeuer mittlerweile ausgeschaltet war. Dann inspizierte er alle Mechanismen und Scharniere. Trotz seines hohen Alters war der Turm in tadellosem Zustand. Nichts musste gerichtet oder geölt werden. Die Funkverbindung zur Steuereinrichtung im Rathaus war stabil, im digitalen Fehlerprotokoll fand sich nicht ein einziger Eintrag und auch die turmeigene Radaranlage, eine kostspielige Anschaffung, wie der Bürgermeister erklärt hatte, wies kein einziges Schiff aus, das nachts zu nahe an die Küste gefahren war.
„Eine Ausnahme. Das ist eine absolute Ausnahme, die ich hier mache. Normalerweise wohnt kein Mechaniker in unserem Turm“, hatte der Bürgermeister gesagt, als Markus sich ihm vorgestellt hatte. „Dafür gibt es eigene Firmen, die schicken wen, wenn es Probleme gibt. Ist auch billiger.“
Markus wusste, dass der Bürgermeister recht hatte. Einmal pro Monat eine Überprüfung zu machen genügte hier vollauf. Und das Leuchtfeuer schaltete sich jeden Abend automatisch ein, sobald die Sonne zu sinken begann und erlosch am nächsten Morgen. Auch dafür brauchte es ihn nicht. Menschen waren fehlbarer als Maschinen, denn Maschinen vergaßen nicht, das wusste Markus seit seinem Studium nur zu gut. Und doch war er hier, als „Leuchtturmwärter“, den es im Berufsregister der Küstenstadt eigentlich nicht mehr gab. Aber weil Markus jemanden kannte, der jemanden kannte, hatte der Bürgermeister für ihn diese „absolute Ausnahme“ gemacht.
In dieser Rolle kannte Markus sich nur zu gut: die Ausnahme. Der überflüssige Zusatz, ohne den es eigentlich besser funktionieren würde. Der alles ein wenig komplizierter machte, als es eigentlich sein musste. Auch Lena hatte zu ihm gesagt: „Du bist lieb, aber ohne dich ist es gerade einfacher.“ Immerhin hatte sie darauf verzichtet, ihn mit etwas wie „es liegt nicht an dir, es liegt an mir“ zu vertrösten. Lena hatte das Leben kapiert. Sie haute nicht einfach ab, weil sie es nach einer Trennung zuhause nicht mehr aushielt. Für Lena musste niemand mehr Ausnahmen machen, sie wusste, wer sie war und was sie wollte. Sie war notwendig. Markus nicht. Er war die Überbrückungskonstruktion. Die zweite Sicherung, wo eine genügte. Mitgedacht und mitgemeint, aber nicht notwendig. Er war halt da.
Markus sah auf sein Handy. Kein Anruf in Abwesenheit. Alle Leben da draußen funktionierten auch ohne ihn. Er trank einen Schluck Kaffee und starrte in die Ferne. Es war der erste schöne Tag seit langem. Die Sonne kletterte langsam über den Horizont, keine einzige Wolke trübte die Aussicht. Nach dem Frühstück würde er Sport machen. Dann die Vorräte prüfen und jeden Raum des Leuchtturms. Vielleicht würde er heute etwas lesen, Bücher hatte er genug dabei. Aber bislang waren seine Gedanken zu laut gewesen, um sich auf die Buchseiten konzentrieren zu können. Wenn er gekonnt hätte, wäre er auf die Aussichtsplattform hinausgetreten und hätte seinen übervollen Kopf in die Tiefen des Meeres geleert. Stattdessen lauschte er dem Wellenrauschen. Irgendwann, da war er sich sicher, würde es sein Grübeln ersticken. Bis es so weit war, würde er hierbleiben.
„Ausnahmsweise“, hatte der Bürgermeister gesagt.
.
Stephan Kaiblinger
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
5 | Mariusz Lata
als du in einer frage wohntest
als es zeit wurde
als die sängerin während des konzerts stürzte
& nicht allzu lang danach verstarb
als eines sonntagmorgens der gemüseladen sperrangelweit
offen stand der verkaufsraum hell erleuchtet
als die zeit wurde
das war
das war
das war
als die ente zum sterben auf der wiese landete
als geschichten nicht notwendig waren
als es im september so richtig sommerlich wurde
als der winter einbrach
als du dein älterwerden bemerktest
das war
das war
das war
als die utopie da war
als der vogel phönix sich erhob doch nicht
fliegen konnte
als das werden noch war
als noch nicht alle alles wussten
als die eisblumen den farn grüßten
das war
das war
das war
als es zeit wurde
als die zeit wurde
das war
das war
das war
als für einen film das kino wieder lebte
als die sprache in gestalt des laubs auftrat
als die wiederholungen musik wurden
als es für dich & so manche & manchen erst
einmal aus war mit den antworten
das war
das war
das war
.
Mariusz Lata
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
4 | Christina König
Raststation
Ich war mitten auf einem Autobahnknoten, als mein Wagen den Geist aufgab. Die Asphaltstreifen kreuzten sich und liefen nach links und rechts, vorne und hinten, die Sonne knallte auf mein Armaturenbrett, das Auto hickste, es wurde langsamer und zwei oder drei Kontrollleuchten flammten auf. Am Pannenstreifen hielt ich an. Die Warnblinkanlage klickte wie ein Metronom, links rasten die Autos an mir vorbei und ich zog die Handbremse. In einer halben Stunde sollte ich bei meiner Schwester sein und ihr bei den Vorbereitungen für die Taufe meiner Nichte helfen.
„Was soll das heißen, du hast eine Panne?“ Die Stimme meiner Schwester stolperte. „Wir brauchen dich! Was ist mit den Salaten und der Deko und der Kerze? Und Tante Walli? Du bist die Taufpatin, ich schwör dir, wenn du nicht auftauchst…“
Der Schweiß stand auf meinen nackten Armen. Ich öffnete das Fenster und schloss es im Donnern der vorbeifahrenden Autos sofort wieder. Ich telefonierte mit meiner Mutter, die sagte, sie könnte mich unmöglich abholen, sie müsste noch Besorgungen für meinen Vater machen, dann mit meinem Cousin, der brummte, wenn es unbedingt sein müsste, dann könnte er jetzt losfahren und mich aufklauben, dann mit Tante Walli, der ich erklärte, dass ich sie nicht pünktlich abholen würde. Mitten in ihrer Schimpftirade tauchte der Abschleppwagen auf.
Während die Autos an mir vorbei ihren Zielen entgegenhetzten, balancierte ich am Pannenstreifen und beobachtete den Abschleppfahrer, wie er mein Auto auf seiner Ladefläche festschnallte und die Räder stabilisierte. Das kalt verschwitzte Taufkleid wehte im Luftsog der Autos um meine Beine und zerrte mich vorwärts, ich stemmte mich dagegen, stieg beim Abschleppwagen ein und er fuhr los und von der Autobahn ab; wir kurvten unter den vier Spuren durch und blieben an einer staubigen Raststation stehen. Hinter dem Tankstellenlogo ragte ein Burger King in den glühenden Himmelsdunst. Der Abschleppwagen verschwand, ich schulterte meine Taschen und schleppte zwei Nudelsalate, eine Taufkerze, ein aufblasbares Schwimmlama und meinen Übernachtungsrucksack durch die Glastüren, bestellte etwas Eiskaltes mit viel Zucker und warf mich in einen der harten Sitze. Popmusik dudelte aus den Lautsprechern. Eine Ladung übergewichtiger Männer existierte mit halb geschlossenen Augen in einer Ecke. Sonst war das Restaurant leer.
Mein Cousin antwortete mit einem genervten Daumen-hoch-Emoji, als ich ihm meinen Standort schickte. Mein Onkel schrieb mir eine Nachricht: hab ghört du hast a panne, vielleicht findst ja an feschen kerl der di mitnimmt haha. Meine Schwester fluchte. „Ja super, und ich mach das Buffet jetzt allein oder was? Wer schaut auf Sophia? Also du hast dir wirklich einen Scheißtag ausgesucht für deine Panne.“
Die Eiswürfel klickten in meinem Pappbecher, als ich mit dem Strohhalm umrührte. Hinter meinem Fenster preschten weiterhin die Autos vorbei. Die Glasscheiben verschluckten ihren Lärm. Inzwischen sollte ich bei meiner Schwester sein und die Nudelsalate in schöne Schüsseln füllen, die Markise ausrollen, Tomaten und Mozzarella schneiden, Saucen bereitstellen, Servietten falten, mit Sophia spielen, Anna in den Mittagsschlaf schaukeln und Luftballons aufblasen. Ich rollte den feuchten Becher an meiner Stirn hin und her und schloss die Augen. Hinter den Lidern jagten sich rastlos die Autos. Meine Mutter schrieb: Gibt es dort eine Apotheke, wo Du bist? Dein Vater braucht neue Warzenpflaster. Mama.
Die Resopalplatte meines Tisches war klebrig, wo die Menschen vor mir ihre Getränke verschüttet hatten. Die Angestellten drifteten hinter der Theke hin und her. Meine erhitzte Haut kühlte. Ich sah mich Polster auf die Bierbänke drapieren, Girlanden über Hecken werfen, Zitronensaft pressen, das Lama aufpumpen, Sonnenschirme herumschleppen, Grillkohle suchen, Sandspielzeug wegräumen und mich anmaulen lassen, weil die Taufkerze nicht schön genug war.
Wie Spinnfäden tropften die Minuten von der Decke auf mich herab. Ich fuhr mit den Autos auf ihren grauen Straßen in die Zukunft, zu Kindergebrüll und müden Sektkorken und brutzelnden Grillwürstchen und Tante Walli, die schrie, ihre Füße wären unruhig und jemand sollte ihr Tabletten bringen; Tortencreme klatschte auf hysterisch gemähten Rasen, Rotweinflecken landeten auf Annas Taufgewand, Fürze stahlen sich zwischen Fettschichten und Kleiderfalten durch und alles schmatzte und wieherte und witzelte. Meine Großmutter kniff mir in den Hintern. Der Graue Star meines Vaters starrte in den Pool. Meine Mutter klopfte die Brösel von seinem Schoß und goss pissgelbes Bier in sein Glas. Ich drückte die Handballen in die Augen und meine Schwester drückte mir Kinder und Teller und Windeln in die Arme, die Tischkärtchen platzierten mich neben Tante Walli, die sonst niemand ertrug, und die Rücken meiner Cousinen befragten meine Schwester zu den besten Stilleinlagen. Mein Großvater vergaß meinen Namen. Die Familie meines Schwagers redete mit mir, wenn sie Salz brauchte. Mein Onkel schaute auf meinen Busen und sagte: „So a Verschwendung.“ Die Autos stanken und hupten und fetzten hinter den Fenstern vorbei, sie heulten in meinen Ohren, fegten durch meine Adern, blitzten und blinkten und gleißten durch alle Synapsen und mein Handy vibrierte. Ich öffnete die Augen. Mein Cousin rief an. Eine Weile lang betrachtete ich die graue Kopfsilhouette auf dem Display. Dann schloss ich die Augen wieder.
.
Christina König
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: