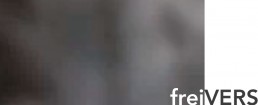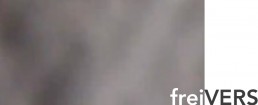freiTEXT | Hey, Palsson!
11. März 2016Prosa,Projekt,Hey Palsson!Literatur,freiTEXT
Salzeis
„Heppa, Heppa, Hepal! So morsche Pfoten und wo hast du deine richtigen Handschuhe gelassen?“ Und ich lache, denn für die Beiden könnte es doch nicht besser gehen. Die alte Lochsocke pufft sich über links und an der anderen hängen deine Kleinstfinger. Ganz schön heiß hier! Gestern im Straßenglück die flitzende Bekanntschaft mit offenen Armen geschnappt und spendiert, dass sich die Flammen fetzten.
Mein Trinkgeld hattest du unter den Tisch geschlagen, weil dein Stolz brüllte. Und danach, das übliche Dankbare mit den Gläsern und auf Matratzen. Der abscheuliche Rauschmorgen geht mir davon, als du mich durch die Tür fragst: „Ist es okay, wenn ich in deine Dusche pinkel?“
Hey, Palsson!
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Renate Aichinger
6. März 2016Lyrik,Renate AichingerLiteratur,freiVERS
#einbrennen
seele
verkühlt
herzen
blickdicht verschlossen
sterbekerzen
verflackern die sicht
totaugen
stechen blicktief die iris
er
reichen uns trotzdem nicht
Renate Aichinger
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Merle Müller-Knapp
4. März 2016Prosa,Merle Müller-KnappLiteratur,freiTEXT
Märtyrer
Hallo, ich bin Dirk. Ich bin eine Made. Ich rette deinen Knochen, dein Bein, vielleicht rette ich sogar dein Leben.
Geboren wurde ich in einem Labor. Inakzeptabel, denkst du jetzt vielleicht, Hygiene-Desaster oder Fahrlässigkeit. Zeit für einen Facebook-Post? Nein, tatsächlich steht mein Leben im Zentrum des eben genannten Labors.
Ich bin keine Otto-Normalmade, meine Heimat liegt fern von Biotonne oder Kothaufen. Ich bin Produkt bewusster Anzucht. Das Ei, dem ich mich entwand, lag auf dem Boden einer Plastikschale und tatsächlich war es ein Mensch, der mein Ei dort neben vielen anderen Eiern arrangierte.
Jetzt bin ich einen Tag alt und wurde soeben verpackt. Zusammen mit Barcode, Mindesthaltbarkeitsdatum und einigen hundert anderer Maden bin ich auf dem Weg zu dir. Mein Etikett stellt klar: ich bin steril, sowohl was meine Keimflora als auch meine Fortpflanzungsfähigkeit angeht.
Wäre ich eine Otto-Normalmade, ich würde mir vermutlich grade ordentlich den Bauch vollschlagen. Kompost oder Tierkadaver, wer weiß. Stattdessen hungere ich. Ich warte auf dich.
Wäre ich eine Otto-Normalmade, nach 20 Tagen würde ich mich verpuppen. Ich würde die Nährstoffe meiner vorangegangenen Fressorgie in Flügel und große Augen wandeln. Dann würde ich meinen Kokon durchbrechen und ich wäre eine Fliege, eine große Fliege. Lärmend würde ich durch dein Zimmer schnellen und meinen Leib mit Maximalgeschwindigkeit gegen das Fensterglas werfen. Vielleicht würde ich dabei bewusstlos werden.
Ich bin aber keine Otto-Normalmade. Ich bin eine Biomade. Das bedeutet: erst helfe ich dir und dann muss ich sterben. Fliegen werde ich nie.
Du brauchst meine Hilfe, weil dein Körper versagt. Du hast deine Haut verletzt, irgendwo und irgendwie, vermutlich schon vor einiger Zeit, und weil dein Immunsystem an seinen Aufgaben scheitert, brauchst du mich.
Deine verletzte Haut hat sich zur Bedrohung gewandelt. Deine ehemalige verletzte Haut, sollte ich vermutlich sagen, denn da wo alles vielleicht ganz undramatisch begann, klafft jetzt ein Loch. Wundheilungsstörung und Infektion als Stichwörter für meinen Einsatz.
Wenn ich bei dir ankomme, bin ich sehr hungrig. Ich sabbere viel. Sabbern gehört zu meinen Essgewohnheiten. Tatsächlich beginnt mein Verdauungsprozess nämlich schon vor meinem Mund. In meinem Speichel lösen sich tote Zellen und Dreck. Das ist gut so, denn beides findet sich vermutlich in deiner Wunde. In meinem Speichel lösen sich auch Bakterien, sogar solche, die deine Ärzte seit Monaten erfolglos zu bekämpfen versuchen. Den Glibber aus meinem eigenen Speichel und den darin gelösten Dingen esse ich dann. Ich räume deine Wunde auf.
Die Ärzte haben dich vielleicht gewarnt. Du könntest meine Anwesenheit als Kribbeln spüren, ganz selten wird mein Vorhandensein dir auch Schmerzen bereiten. Sehen musst du mich aber immerhin nicht. Das könnte dich nämlich stressen und Stress ist schlecht für die Wundheilung.
Nachdem man mich in deiner Wunde abgesetzt hat, werde ich verpackt. Hinter weißer Watte und beruhigend breiten Pflasterstreifen vollbringe ich mein Werk. Erst drei Tage später holt man mich hervor. Zu diesem Zeitpunkt bin ich vermutlich mächtig dick. Deine Wunde wird mein Fest gewesen sein.
Deine Wunde wird auch mein Ende sein. Wenn ich deine toten Zellen, deine Bakterien, deine Fäulnis gegessen habe, habe ich nicht nur mein Aufgabenspektrum als Biomade erfüllt, nein, ich gelte dann auch als kontaminiert. Deine ehemaligen Schadstoffe in meinem Bauch bedeuten meinen Tod.
Hätte ich Augen, ich würde in Richtung Fenster blicken. Oder wenigstens in die Neonröhren am Krankenhaus-Filament. Ein letzter Moment im Licht, die Melodramatik reizt mich. Ich habe aber keine Augen und so sterbe ich in Dunkelheit. Der Arzt wird mich vermutlich in einen Bottich mit hochprozentigem Alkohol werfen. Dort löse ich mich auf.
Ich glaube nicht, dass mein Tod mit körperlichen Schmerzen einhergehen wird, meine Nervenzellen sind nämlich kaum vorhanden. Nichtsdestotrotz, du lieber Mensch: ich sterbe für dich. Ich werde niemals fliegen können, niemals sehen können, niemals zwei haarige Beine aneinander reiben können.
Also bitte ich dich um Sinnhaftigkeit für meinen Tod.
Hör auf zu rauchen, geh regelmäßig zur Fußpflege oder besorg dir einen ambulanten Krankendienst. Kümmer dich um dich selbst. Diese eine ekelhafte Wunde soll deine letzte sein.
Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche mir ein nächstes Leben als Otto-Normalmade.
Merle Müller-Knapp
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Katie Grosser
28. Februar 2016Lyrik,Katie GrosserLiteratur,freiVERS
Leuchtturm
Wir alle sind auf einer Reise
Mal kreuz, mal quer, mal parallel
Unendlich viele schreiten vor uns
Auch nach uns reißt der Strom nicht ab
Mal führt die Reise in die Irre
Ein Umweg kann gar schmerzvoll sein
Die Kreuzung wirft auf große Fragen
Der Blick nach innen – eine Pein
Und doch nach vorn die Füße tragen
Die meisten auf der Reise lang
Denn Umkehr, Umweg manchen scheinet
Wie Niederlage schmetternd groß
Für andre Umweg ist ein Segen
Der kommt verborgen dann daher
Eröffnet ungekannte Wege
Wer mutig ist, der nimmt ihn an
Doch woher Mut und Willen nehmen
Worin der Tapfren Antrieb liegt
Auch wenn die Wege hart und steinig
Und Angst mit dunklen Händen greift
Es ist ein Licht, das sie anblicken
Dem unbeirrt sie folgen stets
Es leuchtet hell in ihrem Innern
Als Leuchtturm zeigt es ihren Weg
Bezwingt die quälend großen Fragen
Umwege, Angst und Umkehr all
Es spendet Kraft und Hoffnung ihnen
Der Seele Nahrung immerfort
Ein jeder Leuchtturm leuchtet anders
Als helles Licht aus anderer Quell
Für manche Glaube ist der Antrieb
Für andre ein Versprechen ist’s
Erfolgeshunger kann gar treiben
Und Trauer nicht nur dunkel sein
Ein Kindheitstraum kann Anstoß geben
Auch Sehnsucht nach Verstorbenen
Mein Leuchtturm, der mir weist den Weg
Der Umwege erträglich macht
Auf Fragen Antwort finden lässt
Bist du und all dein strahlend Licht
Katie Grosser
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Marlene Schulz
26. Februar 2016Prosa,Marlene SchulzLiteratur,freiTEXT
Die Wand
Mona wusste noch nicht genau, wie sie die einzelnen Teile aufhängen sollte. Sie hatte ein Stück von einer Wand für ihre Geschichte im Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt bekommen, vier Meter breit und hoch bis zur Decke, die sie bereits kakaobraun gestrichen hatte. In die Mitte hatte sie einen großen weißen Bilderrahmen gehängt, der leer war.
Aus goldfarbener Pappe hatte sie Moderationskarten in unterschiedlicher Größe geschnitten, die sie jetzt mit einem weißen Stift beschriftete.
Zuerst: Karl, einundsiebzig, fährt im Sommer mit dem Feinrippunterhemd auf dem Moped und bringt Eric zur Schule.
Danach: Eric, sieben Jahre alt, nur noch wenige Tage bis zu seinem achten Geburtstag.
Dann: Erics Klamotten und die Sachen in seinem Schulranzen riechen nach Mottenkugeln. Ihhh, sagen die anderen Kinder.
Mona verteilte die Karten auf der Wand, befestigte jede mit einem Klebestreifen.
Jetzt schrieb sie: Karl macht Rechenaufgaben mit Eric, wenn er welche auf hat.
Dann: Eric muss nachts Windeln tragen, da er sonst ins Bett macht.
Noch eine neue Karte: Eric schläft mit im Ehebett seiner Großeltern Gisela und Karl.
Mona pinnte die neuen Karten auf die Wand, stellte zwei, die bereits hingen, noch einmal um.
Dann beschriftete sie weiter den zurechtgeschnittenen Karton: Gisela, neunundsechzig, hat Wasser in den Beinen, kann kaum noch laufen.
Danach: Gisela lernt mit Eric Sachen für die Schule auswendig. Manchmal singt sie mit ihm ein Lied.
Und: Eric ist Giselas ein und alles, hier kann sie wiedergutmachen, was mit Silvia schief gelaufen ist.
Die goldenen Karten machten sich gut auf der kakaobraunen Wand.
Weiter: Silvia ist gerade wieder in der Klinik auf Entzug und wird sich dort Hals über Kopf verlieben. Dieses Mal ist es der Richtige wird sie wieder mal schwören.
Dann kommt: Silvia wohnt nur ab und zu im Haus der Eltern. Mit ihren beiden Söhnen Eric und Marcel kann sie nichts anfangen.
Die nächste Karte: Marcel ist zehn Jahre älter als Eric, siebzehn, wohnt unterm Dach, hat sich dort eine Muckibude eingerichtet und macht gerade eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann.
Bevor sie die neuen Pappen an die Wand klebte, beschriftete Mona noch eine weitere: Marcel bringt ab und zu ein Mädchen mit nach Hause. Sie kommen ihm aber meist schnell abhanden.
Und noch eine: Eric hat keine Freunde.
Mona heftete die Karten an die Wand, hängte um, manche weiter nach unten, andere mehr nach rechts und oben, eine ganz links.
Jetzt schrieb sie weiter, dieses Mal eine größere Pappe: Die Lehrerin aus der Schule sagt, es ist nicht gut, dass Eric im Ehebett der Großeltern schläft.
Dann: Das Bauamt hat Gisela und Karl Geld für das kleine Haus geboten, in dem sie wohnen und das ihnen gehört.
Neue Karte: Inzwischen hat sich eine Neubausiedlung um sie herum gebildet. Ganz viele gleiche Häuser mit unterschiedlich farbigen Eingangstüren.
Danach: Karl und Gisela haben das Kaufangebot des Bauamtes ausgeschlagen.
Und zuletzt: Einmal in der Woche spielt Marcel mit seinem Bruder Fußball auf dem Bolzplatz. Manchmal hat Marcel keine Zeit.
Mona hängte die restlichen Karten an die Wand, sortierte nochmal neu, schaute sich die Sätze von etwas weiter weg an, prüfte, bis alle den richtigen Platz hatten.
Dem Bilderrahmen gegenüber platzierte sie eine Sofortbildkamera auf einem Stativ mit einer Anleitung für den Selbstauslöser. Dann legte sie eine Rolle Klebeband zum Abreißen auf den Boden und stellte eine zweite Schachtel mit weißen Stiften dazu, nahm einen davon heraus und schrieb direkt auf die Wand, unter den Rahmen:
Machen Sie ein Foto von sich, hängen Sie Ihr Bild in den Rahmen und schreiben Sie etwas zu dieser Kartengeschichte hinzu, direkt auf die Wand. Nur zu!
Marlene Schulz
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Thomas Wagner
21. Februar 2016Lyrik,Thomas WagnerLiteratur,freiVERS
Prominenz in der Pampa
Ein unfreundlicher Tag
Auf dem Rückweg vom Kaufland werde ich von der Seite angesprochen
Eine erste Begegnung aber Ich erkenne ihn sofort
Ein waschechter Refugee
So viel habe ich schon darüber gehört und gelesen
Über nichts wird so viel berichte
Nichts erhitzt so sehr die Gemüter
Weltgeschichte vor meinen Augen
Er hält mir ein Schreiben hin
Mit Stadtwappen, Aktenzeichen und Rechtsbehelfsbelehrung
Deutschland zeigt ihm gleich seine schönste Seite
Er soll sich bei der Caritas melden
Das heißt wir haben ein Stück denselben Weg
Englisch spricht er nicht also gehen wir schweigend
Ich in meinem zehn Jahre alten Adidas Anorak
Per Definition also in Markenklamotten
Er in irgendwas Abgerissenen
Wahrscheinlich etwas Gespendetes oder aus dem Container
Die Hosenbeine zu kurz
Die Jackenärmel zu lang
Viel ist nicht dran an dem Kerl
Hängende Schultern
Müder Gang
Der Auftritt passt so gar nicht zu dem
Was sie ihm alles nachsagen
Wofür er alles verantwortlich sein soll
Die Spaltung der Gesellschaft
Die Spaltung Europas
Sogar die vormals heißgeliebte Bundesmutti bringt er ins trudeln
Wir kommen vorbei an der Ecke
Dort wo die Brombeerhecke
Letzten Sommer runtergebrannt ist
Der Wind Fetzen von blauen Plastesäcken
Gegen einen Zaun drückt
Pestschwarze Erde
Auf der es nur noch Abschaum, Tod und Müll aushält
Willkommen in meiner Welt
Was denkt er wohl wenn er das sieht?
Vertrau nie wieder den Verlockungen eines Gauners am Mittelmeer?
Denn auch wenn die Flugzeuge über unseren Himmel
Die unterlegene Welt
Nicht mit Bomben
Sondern nur mit Amazonpäckchen und blasierten Geschäftsleuten traktiert
Hat er im Großen und Ganzen
Nur die Station in diesem Irrenhaus gewechselt
Wo die Einen ihn mit Plüschtieren bedrängen
Und die Anderen gleich die Zähne zeigen
Als ob er nur wegen ihnen gekommen wäre
Wir sind schon ein erschütterndes Duo
Ich nicht der typisch deutsche Prinzipienreiter mit ständig zusammengekniffenen Arschbacken
Und er mit Sicherheit nicht der arabische Machohengst mit Anschlagsplänen
Die Stars sind eben in echt anders als man denkt
Die Wolkendecke reißt auf
Und die verfluchten Götter schauen auf uns herab
Lachen höhnisch über ihren Schabernack den sie mit uns Menschen treiben
Sie hören die Brandenburgischen Konzerte von Bach
Nuckeln an Weintrauben
Und fühlen sich köstlich unterhalten
Instrumentalisiert von jeder Seite
Steckt mein Begleiter einfach nur in dem gleichen Dilemma wie jeder Artgenosse
Auch er wurde einmal von einem Mann gezeugt
Und von einer Frau zur Welt gebracht
Die ihn nicht gefragt haben
Ob er das überhaupt will
Und nun sind sie tot
Oder haben ihn vergessen
Die Folgen darf er selbst ausbaden
Lasst ihn in Ruhe
Er ist nicht der Feind
Aber vielleicht wird er mal Verbündeter
Zum Abschied tippe ich mit zwei Fingern an meine nicht vorhandene Hutkrempe
Er nickt lethargisch
Ich schau ihm noch kurz nach
Dem gebeugten Spielball des Schicksals in Menschenform
Take care Du Superstar
Thomas Wagner
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Pascal Andernacht
19. Februar 2016Prosa,Pascal AndernachtLiteratur,freiTEXT
Wiener Episoden, Erste
Montag, 7. Jänner, welches Jahr? Das weiß ich nicht. Wird schon eines geben. Seh nach. Stört mich nicht. Montag Morgen, zu früh zum Denken, die Glieder sind schlaff, und der Spiegel im Bad beschlagen. Das kalte Wasser ins Gesicht, Traum. Traumwelt. Wo bin ich hier? Ich weiß es, aber ich will es nicht. Sie sitzt draußen. Ich steh hier.
Mittwoch. Ich habe das Bad verlassen. Was soll ich denken? Die Tür fiel ins Schloss. Es war nicht sie. Es war ihre Freundin. Ich reiß sie auf und eile hinaus. Es ist heiß. Die Sonne hinter den Wolken. Grauer Schleier. Aber heiß. Nebenan teeren sie die Straße. Aber die Hitze verfolgt mich. Die U-Bahn ist nur einige Blöcke entfernt. Ich habe keine Lust den Bus zu nehmen, also laufe ich.
Mittwoch, etwas später. Hastig würge ich die Spinattasche hinunter. Der Kakao schmeckt ausgezeichnet. Wische die Krümel von meinem Shirt. Könnte schwören, ich hätte keine Schuhe an. Aber da sind sie. Ich bewege die Zehen. Muss albern kichern. Man sieht mich an. Die Türen schließen sich und wir fahren los. Noch ein bisschen. Gegenüber, da liest sie ein Buch. Irgendwas Englisches. Ich langweile mich. Draußen ist es dunkel. Und nur das Innere spiegelt sich hell in den Scheiben. Ich am dunkelsten.
Donnerstag. Sie liest wieder. So gelangweilt. Ich schau genauer hin. Fear. Zweig. Warum nicht auf Deutsch, denke ich. Minimalistisch.
Freitag. Die Ausschweifungen zehren an mir. Er findet kein Halt. Amok. Zweig. Flut überflutet den Tunnel. Und ich denke: Herrliches Licht.
Samstag. Sie steigt aus. Ich bin allein. Der Zug nicht.
14 Uhr 35. Station. Machen wir mal einen Halt. Das Bein müde auf dem Parkett. Tänzel mal hinauf. Die Treppe rollt und rollt. Und wieder Licht. Wieder heiß. Es brennt. Das Haar fackelts ab. Und ich bin kahl. Gedankenwelt.
19 Uhr 20. Der Schlüssel steckt im Schloss und ich dreh ihn um. Wunder mich noch, wie er dahinkam. Sie sitzt da und schaut aus dem Fenster. "Hallo." "Hallo" kommts zurück. Ich geh in mein Zimmer und leg mich aufs Bett. Sie kommt dazu.
Montag. 13. Jänner. Ein anderes Jahr. Es ist aus. Die Wunde klafft am Finger. Und wieder in der Bahn. Kein Zweig mehr. Dafür Deutsch. Der Baum ist kahl. In meinem Kopf rauscht "Junge Römer".
Wenig später: Kontrolle. Hab den Schein vergessen. Muss hinaus. 100er wird fällig. A paar Zerquetschte. Ich zuck die Schulter. "Hab' ich net." "Hab ich doch." Weiß noch nicht. Die Rechnung ist da. Was scherts mich? Werden wir sehen. Die Wohnung kalt und leer. Das Bett. Ein Stuhl. Der Fernseher auf dem Pappkarton. Darin die Alben. Darin die Bücher. Die paar. Und nebenan hört man sie singen.
Mittwoch: Wie vor einem Jahr. Die Tür fällt ins Schloss. Oder ist es schon länger her? Diesmal bin ichs. Vielleicht wirds auch erst bald geschehen.
Donnerstag: Zeitlos. Was ist Zeit? Ich geh und ich fall und ich steh und die Zeit geht irgendwie weiter, aber ich denke nur ich lächle und wenn ich aufhör zu denken, was dann?
Sonntag: Mutter geht immer in die Kirch. Sollte ich wohl auch mal. Meint sie. Schließlich sei das nicht abträglich. Und ein Muss. Aber muss ich denn mit ihr? Ich lass es mir auf der Zunge zergehen und dabei schmilzt mein Kopf. Und dann greif ich sie und zerr sie hinaus. Ne Backpfeife tuts auch. Sie weint. Arme Mama, denke ich mir, wird bald nichts mehr mit der Kirch. Ich sags ihr ins Telefon. Sie weint.
Dienstag. 21. Jänner. Man könnt meinen, das Leben wär zu fabelhaft, um den Moment zu kosten. Denkste. Ich strecke die Zunge raus und koste den Regen. Denke, wie lecker diese Schlammpfütz doch sein müsst, da, zu ihren Füßen. Ich schau an ihr auf und denk mir, hübsche Latern.
Mittwoch. Auf dem Weg zum Schauspielhaus. Denk mir, was gäbs schon zu sehen. Vielleicht gibts ja was. Könnt auch in der Oper stehen. Aufm Programm! Staat oder Volk? Ist doch egal. Was machts schon, ob's Staat oder Volk? Auf den billigen Plätz'. Aber die Schlange ist lang. Und auf die Bühne will ich nicht. Also Schauspielhaus. Dort seh' ich sie wieder. Liest mal wieder. Die Krone baumelt am Baum. Ich hab gezahlt, sag ich laut, man schaut mich an, und ich nehm mir eine.
Donnerstag. Ich schmeiß sie fort. Nichts Gescheits. Dies und das. Und jenes. Jenes interessiert mich besonders. Normalerweise. Ich lese es und schneid es mir aus. Dann hängts im Bad. Am Spiegel. Der sonst immer beschlagen ist. Seltsam. Duschen ohne Ende. 'S Bad wird niemals sauber.
Freitag: Maria-Magdalena. Die Überschrift. Das Bild. Ich küss das Bild und ich küss den Text. Schmeckt nach Tinte. Ich schau mich an, seh aber keinen Fleck. Könnt ja abgebrochen sein, denk ich mir, und man hats mich bedruckt. Aber nein. Verschmitztes Lächeln. Verschwitzt. Weiß und weiß. Was kann ich schon seh'n?
Samstag: Heuer! Heute solls sein! Ich geh hin. Ich klopf. Sie macht auf. Ich klopf auf den Tisch. "Gut siehst aus! Gut hörst dich an." "Danke." Sie sagts nicht, aber ich sehs ihr an. Das rote Cover. Blutüberlaufen. Blutunterströmt. Hübsch. Ich denke an Banana. Greif mir eine. Alles Banane. Essen, Schlingen, weg damit. Leere Schale. Nun ist alles gelb. Die Sonne strahlt in den Kern. Kernforschung. Was betreib ich hier? Sie sitzt da und schaut mich an und auch ich sitz da und schau mich an. Nein. Stopp. Schau sie an. Und ich sage: "Gratulation." "Danke dir."
Sonntag: Jetzt. Als hät' ich Sünden zu bereuen. Sind mir die liebsten. Ich sprech mit dem Pfaffen, ich habe ihn kaum erkannt. Alt ist er geworden. "Gott tut ihnen nicht gut.", sage ich. "Ich weiß.", erwidert er. "Aber steht ihnen gut." "Ihnen auch." Wir lachen, schütteln Hände. "Grüß mir Frau Mama. War schon lange nicht mehr hier." Wir sitzen in einer Bar und bechern eimerweise. Eimer mit Chips und Flips und Knabbereien. Der Whiskey sitzt tief. Der Äppler auch. "Ein Saft wär mir lieber gewesen." "Vergiss den Saft."
Montag, 27. Jänner. Heuer gehts weiter. Ich steig nicht aus. Verfolg sie nicht. Weiter. Ihre Füß' über die Schwelle. Ich seh auf das Schild und geschwind eil' ich hinterher. "Drei-Fünfzig." Ich zahl. Es ist nicht viel. War ja nicht weit. Die Koffer hat sie in der Hand. Die Tasche. Passt viel rein. Würd' gern wissen was. Hab das Gesicht nicht vergessen. Besonders nachts. Wenn ich's vom Bett aus sah. War schön. Schön anzusehen. Das Fenster offen. Die Jalousien auch. Und dann haucht sie einem die Nacht um die Ohren. Stolz stolzer stolziert sie die Ringstraß' entlang. Wohin des Weges, meine Holde? Deine? Sie lacht und entreißt mir das Gepäck. Immer brav zu Fuß. Nimm mich noch einmal in den Arm. Schlingt sich um mich. Wehrlos. Das bin ich. Ich stoß sie weg. Und sage: "Wiederhol es gern." Kuss. Wange. Verflogen.
Mittwoch, 28. Jänner. Gähn. Müd. Dunkel. Immer im Kreis. Auf und ab den Ring. Vielleicht find ich die Hinterlassenschaften. Drecks Köter. Scheiße. Klebts an mir wie sonst auch immer. Jetzt regts mich auf. Die Bahn zischt vorbei. Und das Rad, das klingelt. Und das Radio tönt herüber. Und in meinem Kopf rauscht der Verkehr.
Donnerstag, 29. Jänner. Ganz vergessen.
Sonntag, 1. Jänner. Neujahr. Ich lieg krank im Bett. Kopf schmerzt. Die Flasche neben mir. Ich küsse sie. Aber sie ist tot. Na, nicht tot, aber so leblos. Sie schläft. Und ich habe ihren Rausch geschlafen. Ausgeschlafen. Zieh die Decke weg, und merke, sie liegt gar nicht mehr da. Im Bad rauscht das Wasser.
Sonntag, 2. Jänner. Ich hab mich ausgesperrt. Sie ausgesperrt. Wer ist jetzt der Klügere? Es ist dunkel. Die Rollos sind unten. Und was ich sehe, ist das Licht des Weckers. Und das Licht von der Steckleiste. Könnt sie umlegen. Dann geht auch der Router aus.
Mittwoch. Zeit später. Es ist still. Ich hör sie nicht. Ich seh sie nicht. Ich riech sie nicht. Ich schließ die Augen, schleich ich aus dem Haus. Schleich ich zurück, tu ichs auch. Manchmal geh ich darum herum. Manchmal hinten rein. Das freut sie sehr. Dann sieht sie mich auch. Aber nur erhascht und erahnt. Nichts Essentielles. Ekstase. Mutter ruft an. Sie lästert. Das tut sie gern.
Dienstag: 25. Jänner. Liebes Fräulein. Hab ich zu ihr gesagt. Ich hab ihr wieder was abgenommen. Hab gezahlt. Ehrlich. Hab ich zu ihr gesagt. Dank' schee auch. Torkel heim. Leucht mir den Weg. Doch sie geht aus. Wohin, frag ich sie. Doch sie sagt nur: Nichts. Sie weiß es nicht. Kann sein. Weiß nicht, wann sie wieder kommt.
Mittwoch: Die Ungeduld wächst. Wohin? Das weiß ich auch nicht. Kalt ist's. Es schneit. Die Heizung tot. Ich auch. Kopf leer. Im Bett. Schau aus dem Fenster. Drüben weiß ich -
Freitag: Lange Nacht. Die Bahn ist voll. Die Fliege schlaff. Und der Frack - bekleckert. Teure Sache. Für nichts zu schade. Aber bereuen tu ichs doch. Hät' nicht so lange bleiben sollen. Wär ich auch nicht gegen die Stang' gelaufen. Tut noch immer weh. Das Brett vorm Kopf.
Sonntag: Stelldichein mit Klaus und den anderen. Sie funkelt mir zum Abschied zu. Oder war es ein Willkommen? Wie dem auch sei, hab sie gehalten. Rosiger Körper, rosige Haut. Und so kalt. Ich bin direkt in Flammen aufgegangen.
Spät am Abend: -
Sonntag, spät in der Nacht: Es ist eigentlich schon Montag.
Montag: Das Buch lag da. Confusion. Habs in der "3". Liegen lassen.
Pascal Andernacht
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Mareen Bruns
14. Februar 2016Lyrik,Mareen BrunsLiteratur,freiVERS
unsere beine haken sich so schwer in kanalwände
da ist wieder diese augenahnung, sezierte verwunderung
vielleicht glück - ich möchte das du anheben
vielleicht das Ich aus seinen verstellungen lösen
wieder am fluss sitzen
so meine daumen lebenslinien in deine handteller reiben
können wir später lebendiges daraus essen
Mareen Bruns
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | S. H. Schild
12. Februar 2016Prosa,S. H. SchildLiteratur,freiTEXT
Der Werkeks
Langsam verblasste die Sonne hinter der zackigen, schwarzen Silhouette der Bergkette. Letzte orange Strahlen klammerten sich an das Massiv, drängten sich dahinter hervor, um noch einige Sekunden länger ihre Wärme in das Tal hinab zu werfen. Die Dunkelheit rückte näher heran, legte sich schwer auf das Licht und überschattete es bis es nichts weiter war als ein Glanz in der Ferne. Für einen kurzen Moment spiegelte es sich noch in den Schneekuppen des Gipfels, sodass die Bergkette feuerrot in der Schwärze des Nachthimmels aufflammte. Dann verschwamm die Dunkelheit, zog sich über sie und nahm jegliche Form aus der Welt.
Stein schlug auf Stein.
Immer wieder schnalzte das harte, zischende Geräusch auf. Funken stoben, erhellten für den Bruchteil einer Sekunde die Schwärze und spiegelte sich in drei Augenpaaren, die sich um das Lager versammelt hatten. Ihr kalter, weißer Atem hing in kleinen Wolken zwischen ihnen. Dima rieb sich die bloßen Hände und schreckte hoch, als ein Ast hinter ihm knackte. Sein Atem stockte, die Funken bissen sich in das Holz und ein schwacher Schein erhellte plötzlich seine Sicht. Kahlgefressene Bäume drangen aus der Dunkelheit hervor. Eine dicke, weiße Schneedecke verlor sich zwischen den Stämmen, ihre ebenmäßige, reine Oberfläche durch einzelne Spuren zerstört. Die Flammen wurden stärker, ließen das Holz flackern und warfen zuckende Schemen über die glänzenden Schneekristalle.
Wieder knackte es. Dimas Kopf fuhr herum. Eine Gänsehaut rannte über seinen Rücken, die nichts mit der Kälte zu tun hatte, die in seinen Kleidern saß. Immer schneller stoben die Wolken seines Atems durch die eisige Luft und vernebelten seinen Blick.
„Wir sind hier sicher, Dima“, hob sich Viktors tiefe Stimme über das Knacken des Feuers. Jost bewegte sich und seine Kleidung raschelte leise neben ihm.
„Die Wälder hier sind sicher“, kam auch seine grummelnde Zustimmung. „Wir haben nichts zu befürchten.“
Dima riss seinen Blick aus der gähnenden Dunkelheit los, die sich um sie erstreckte und stellte den Kragen seines Mantels auf, als könnte er sich dadurch vor den Gefahren schützen, die dort hinter ihm lauerten. Er umschlang mit den Armen seine Knie, zog sie fest an sich heran und starrte in die tanzenden Flammen, deren Wärme bereits die Kälte in seiner Nase wegschmolz.
Schneeflocken fielen durch die nackten Baumkronen zu ihnen herab, bedeckten sie, dämpften ihre Geräusche und hüllten sie in ihrer Stille ein. Wie Statuen verharrten sie am Feuer, starrten in die hellen Flammen und verloren sich in den Bildern, die sie dort sahen. Er bemerkte die klare, blau leuchtende Scheibe nicht, die über ihnen am Himmel erschien. Nackte Äste durchzogen die kalte Oberfläche wie schwarze Adern.
Irgendwo schrie eine Eule.
Nicht nur einmal knackte ein Ast jenseits der Dunkelheit.
Dima verkroch sich immer tiefer in die Weiten seines Mantels und ignorierte den Drang, sich umdrehen zu müssen. Die Welle der Kälte rollte über ihn hinweg, schwappte über seinen Rücken, umklammerte seinen Hals und kämpfte gegen die Wärme. Mit beinahe unmerklichen Bewegungen robbte er weiter an die Flammen heran. Das Feuer leckte gefährlich nahe an seinen Beinen, doch er spürte die Wärme nicht.
Erst als er das raschelnde Geräusch von Papier neben sich hörte, erwachte Dima aus seiner Starre und blickte mit suchenden Augen auf. Viktor kramte in seiner Tasche, produzierte ein braunes Päckchen daraus hervor und öffnete es mit steifen Fingern. Als er Dimas Blick bemerkte, schenkte er ihm ein leichtes Lächeln und bot ihm das Päckchen mit einer auffordernden, stillen Bewegung an. Dima reagierte verspätet, erwiderte schnell das Lächeln, doch er machte keine Anstalten, das Päckchen an sich zu nehmen. Stattdessen griff er selbst in die Tiefen seines Mantels, stieß auf die glatte, kalte Oberfläche der Box darin und zog sie hervor.
Viktors Lächeln verschwand. Seine Lippen formten eine harte Linie. Ein Schatten huschte über sein Gesicht und sein Blick flackerte alarmiert zu Jost.
„Was ist das?“, fragte er mit seiner tiefen Stimme, mit erzwungener Ruhe. Er hatte das Päckchen achtlos in den Schnee fallen lassen. Jost richtete sich ruhig auf, drehte sich um und ließ seinen dunklen Blick durch den Wald schweifen.
Plötzlich verunsichert, drehte Dima die Box in seinen Händen, strich mit seinen Fingern unschlüssig darüber. Er brach den Blickkontakt ab, besah sich die Box in seinen Händen noch einmal genauer, als würde erst in diesem Moment in ihm der Gedanke nach ihrer Sinnhaftigkeit aufkommen.
„Sind das –“, stockte Viktor und noch einmal flackerte etwas in seinem Blick. „Sind das –“, brach er noch einmal ab. Seine Zunge zuckte über die Lippen als er sichtlich mit dem Wort rang. „Sind das… Kekse?“
Josts Kopf schnellte bei dem Wort zu ihnen und eine plötzliche Nervosität ergriff Besitz von ihm. Immer schneller wandte er sich um, doch eine Bewegung ließ ihn für einige Sekunden innehalten. Mit dem Kopf im Nacken starrte er in den Himmel hinauf und blankes Entsetzen ergoss sich über sein Gesicht, als er dem kalten Schein des Mondes entgegenblickte.
Mit einem Satz war er auf den Beinen, begann auf das Feuer einzutreten und mit wilden Bewegungen Schnee darauf zu schaufeln. Im gleichen Moment sprang auch Viktor auf, packte seine Tasche und bückte sich noch einmal, um mit fahrigem Arm das Päckchen an sich zu reißen.
Dima schreckte vor den beiden zurück, spürte ihre Panik, die blanke Angst. Schnell stieß er sich vom Boden ab, stolperte einige Schritte durch den Schnee, klammerte sich an der Box fest. Mit weit aufgerissenen Augen warf nun auch er einen Blick zum Mond.
Etwas Leises knirschte hinter ihnen.
Eine schmerzhafte Gänsehaut rann seinen Rücken hinab, als er an seinen Ursprung dachte.
„Was ist los?“, keuchte er mit leiser, gehetzter Stimme. Jost schaufelte eine letzte Handvoll Schnee auf das Lager, erstickte die kleinen Flammen und somit auch das Licht. Plötzliche Dunkelheit brach über sie herein.
„Was ist los?“, fragte Dima noch einmal, dieses Mal panischer. Langsam fiel der blaue Schein des Mondes zu ihnen herab, erhellte die weißen, kahlen Baumstämme und die glitzernde Schneedecke.
Als hätte ihn Viktor erst jetzt bemerkt, starrte er ihn an, machte einen Satz auf ihn zu und griff mit wildem Blick nach der Box in seinen Händen. Dima wehrte sich nicht, ganz im Gegenteil drückte er ihm den Behälter beinahe schon entgegen. Ohne einen weiteren Augenblick zu verschwenden, riss Viktor den Deckel ab und sog scharf die Luft ein, als ihm der köstliche Duft von Erdnüssen und Schokolade entgegenschlug.
„Erdnüsse und Schokolade“, verpackte er seine Geruchswahrnehmung in Wörter.
Hinter ihnen knackte es wieder. Etwas Schweres zog sich über den Schnee, der unter der Last knirschend zusammensackte.
Jost hatte es auch gehört, denn er drehte sich blitzschnell um die eigene Achse. Sein Atem ging keuchend schnell. Ein hoher, verzweifelter Laut brach sich aus seiner Kehle los.
„Sie kommen“, hauchte er und begann auf der Stelle zu springen. „Wir müssen los!“
„Was ist passiert?“, wagte Dima noch einmal den Versuch, doch das Knirschen kam immer näher. Viktor warf die Box mit einer kräftigen Bewegung in die Dunkelheit des Waldes, packte aus dem Schwung heraus noch Dimas Hand und zerrte ihn mit sich, als er zu laufen begann. „Was ist los?!“
„Wer nimmt Kekse in den Wald mit?!“, kreischte Jost neben ihnen, seine zu hohe Stimme mit Panik verfremdet. „Man nimmt keine Kekse mit in den Wald!“
Ein tiefes Knacken vor ihnen schnitt ihnen den Weg ab. Schlitternd kamen sie zum Stehen. Ihr keuchender Atem hing wie Rauchschwaden in der Luft. Jost drehte sich im Kreis, visierte immer wieder eine neue Richtung an, schreckte im gleichen Moment jedoch wieder davor zurück, als er ein weiteres Knirschen hörte.
„Verdammt, verdammt, verdammt“, drang die Verzweiflung zwischen Atemzügen aus ihm hervor. „Wer nimmt Kekse mit in den Wald?!“
Grelle Augenpaare öffneten sich in der Schwärze zwischen den Bäumen. Das Knirschen nahm zu, der Schnee arbeitete unter der Last. Mit jeder weiteren Sekunde näherten sich die Geräusche, schlossen sie in sich ein. Die Dunkelheit griff nach ihnen, verschlang Jost und riss ihn mit sich. Sein panischer Schrei wurde von einem lauten Knistern und Knacken verzehrt. Viktor jammerte auf, stieß Dima aus dem Weg und stürzte sich selbst in die Dunkelheit. Dima kam im Schnee zum Liegen, kroch auf allen Vieren durch die beißende Kälte.
Seine Hand prallte gegen etwas Hartes. Der Geruch von Erdnüssen wehte zu ihm heran, begleitet von einem tiefen Grollen. Etwas Kantiges traf seinen Arm und kam in einer Falte des Mantels zum Liegen. Er griff danach als er weiterrobbte, sich zwischen zwei duftenden, runden Körpern hindurchquetschte und gegen den Schnee trat bis er sich in vollem Lauf wiederfand. Als er seine Hand öffnete war sie braun von geschmolzener Schokolade.
Er hörte lange nicht auf, zu rennen.
Immer noch hallten die Schreie der anderen in seinem Kopf wieder.
Denn man nimmt keine Kekse mit in den Wald.
S. H. Schild
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | SAID
7. Februar 2016Lyrik,Migration & Flucht,SAIDLiteratur,freiVERS
fische von jenseits des meeres
sie sammeln sich und sind bestrebt, nicht aufzufallen. die hand halten sie vor den mund, als könnte sie das stottern verdecken.
man munkelt von einem virus; er wird unter flüchtenden verbreitet und verursacht stottern.
hier treffen sie sich und schweigen. sie warten auf olleg, den mann mit dem weißen hut. dem vernehmen nach hat er selbst auf der flucht seinen hut aufbehalten.
nach einbruch der dunkelheit zahlen sie eintrittsgelder und gehen gemeinsam in den park. dort hängen die fische in den bäumen und spenden gerüche.
hinter gazeschleiern beten sie dann. die fische schnappen nach luft, als wollten sie sich bedanken für die gebete.
beim abendessen bleibt ein platz leer. der des zurückgewanderten zwischenrufers –
der einzige, der die sprache der fische verstand.
sie sitzen im restaurant, dessen lichter sich im meer spiegeln.
ihre hände verscheuchen das licht – doch das licht ist stärker als die flüchtlinge. diese sind erregt, sehen die ankommenden schiffe und warten auf neue nachrichten.
jemand schüttelt eine kleine glocke. dann erzählt olleg von dem anderen land, von der langsamen zeit –
die anwesenden beginnen zu schluchzen.
olleg gestikuliert und beschwört sie auf einheit:
„jede berührung mit den reisenden wäre verrat.“
er deutet an, daß die fische dann nie mehr zu ihrer sprache zurückfinden würden.
„die von jenseits des meeres kommen, bringen neuigkeiten mit sich und einen geruch“,
dann warnt er vor diesem geruch und seiner wirkung.
vom gemäßigten schweigen ausgehend, fragen einige der anwesenden, warum sie längere zeiten brauchen für eine neue farbe.
„wir müssen an die fische denken. seit der zwischenrufer zurückgekehrt ist, schweigen sie“,
er räuspert sich und spricht weiter:
„wer weiß, was alles unter den reisenden ist, hörgeschädigte, spitzel, künftige verbrecher. sie alle haben aussagen unterschreiben müssen, damit sie ausreisen durften. ihr erkennt sie an dem trübe gewordenen blick.“
schließlich warnt er:
„wer glaubt, eine berührung mit den reisenden, heilt das stottern, irrt sich.“
olleg kennt die furcht der flüchtenden. für gewöhnlich überwinden sie sie mit dem wort, mit dem rufen.
doch jetzt, angesichts der ankommenden schiffe, brauchen sie einen halt. olleg weiß das:
„ihr müßt lernen, unbequem zu leben in der fremde –
sonst zerstört sie euch.“
SAID
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at