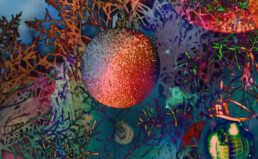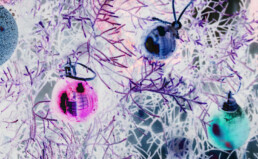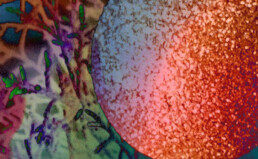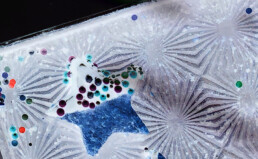freiVERS | Manon Hopf
29. Dezember 2024Literatur,LyrikfreiVERS,Manon Hopf
ich suche ein trauer
wort für den ausbleibenden
schnee
das unvollständigkeits
erleben ob es mehr als drei
generationen braucht
bis der schnee schnee ist
von gestern eine neue semantik
gefunden
wurde für die augen ob
zukünftige fluten
das jahr abschließen können
mitreißen wie eine decke
weißer schnee this too is
water ob wir neue metaphern finden
für winter über wintern
wenn selbst unsere leichen
nicht mehr erkalten
wenn das frösteln wie eine erinnerung
über uns kommt beim öffnen
der brummenden kühlschranktür
ich weiß nicht wo ich über
wassern werde die hand
ins eisfach gelegt dort habe ich
eine leere
krippe aufgebaut neben
einer handvoll baby cheeses
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Suse Schröder
27. Dezember 2024Literatur,freiTEXTProsa,Suse Schröder
Formtat
Unsere Eltern warten auf Nachricht. Die sind wir ihnen schuldig. Ständig rufen sie an, aber wir gehen nicht ran. Wir wollen nicht die immer gleichen Gespräche führen. Wir beschließen, aus einer Brauselaune heraus, ihnen zu schreiben. Dafür brauchen wir Input, um ihnen glaubwürdig zu erscheinen und uns selbst zu glauben, und Briefpapier. Bis-dann-H holt ihre alte Postmappe und Stifte. Wir greifen zu.
Wir spielen Wetter Befinden Tätigkeit Essen.
Hab‘s-schön-M schreibt: Gewitter Gabelspagetti Gehen Gut.
Viele Grüße-O findet das zu fad, greift aber auf Hab’s-schön-Ms Gs zurück:
Gerölldonner Gähnen Gnoccisgebraten ganzgutsoweit. Gegen das Gähnen hat Bis-dann-H was. „Gähnen kann auf Langeweile und Müdigkeit hinweisen. Erschöpfung sogar. Da rufen deine Eltern doch erst recht an.“
„Wir könnten Fragen stellen.“
„Ja, kurze! Auf die sie Lust haben schriftlich zu antworten.“
Tschüss-K hört gar nicht mehr auf zu nicken, hat aber auch keine Idee für eine mögliche Umsetzung.
„Unsere Eltern sind doch Generation Handy. Die wollen digital und nicht Zettel und Stift. Meine tippen selbst ihre Einkaufszettel ins Phone.“
„Aber über Post freuen sie sich auch, oder?“
„Wenn‘s keine Rechnungen sind, ja!“
„Sollen wir Fragen zu offenen Rechnungen stellen? Vielleicht sind sie dann erleichtert, dass sie keine haben und wollen uns das dann mitteilen.“
„Mhhh…“, meint Bis-dann-H, während Tschüss-K, Viele-Grüße-O und Hab’s-schön-M wie wild zu schreiben anfangen. Alles-Liebe-Ch schaut zu, wartet ab. Beim G hatte er nicht geglänzt, sich viel blaue Tinte über die Schreibhand geschmiert und nicht mal vorlesen wollen.
„Morgensonne Marmorkuchen mittelmäßig Machen“, liest Tschüss-K und merkt beim Vorlesen, dass sie damit nicht punkten wird. Kein*e andere*r hat eines ihrer Wörter. Diese zählen nur, wenn sie für die anderen ansprechend und für die elterliche Post inspirierend sind.
Viele-Grüße-O liest wieder als Letzter. Auf seinem Blatt stehen mehrere Wörter zu jedem Buchstaben.
„Montagswetter Mäuseschwänze Mittagslaune Magnolienschauen.“
„Mensch, Viele-Grüße-O, richtig lyrisch“, sagt Tschüss-K, weil sie das Gefühl hat, die Stimmung etwas anheizen zu müssen, um sich nicht allein defizitär zu fühlen. Die anderen schweigen, kritzeln Kreise, malen Quadrate auf ihre Briefpapierränder.
„P“, sagt Hab’s-schön-M und tobt übers Papier.
„Pfützenregen Pfannkuchen Piktogrammezeichnen platt“, liest sie schreiend vor, nachdem sie den letzten Buchstaben aufs Papier gesetzt hat. „Eierkuchen oder Pfannkuchen?“, fragt Bis-dann-H und Hab’s-schön-M kann sich nicht entscheiden, weil Pfannkuchen so gut passt, sie aber lieber Eierkuchen mag. „Mit den Piktogrammen finde ich stark“, sagt Viele-Grüße-O und Tschüss-K: „Ja, vielleicht schreiben wir gar nicht, sondern zeichnen.“ Für Minuten ist es still. Hier wird gedacht. „Joa“, sagt Alles-Liebe-Ch und kritzelt auf seinem Papier. Mit rotem Kopf zeigt er seine Zeichen-Zeichnungen in die Runde. Wir raten, aber auch nach dem zehnten Versuch schüttelt Alles-Liebe-Ch den Kopf. Eine Chance haben wir reihum noch. Trotz gegenseitiger Beratung lösen wir keines seiner Bilder auf und verlieren die Lust. „Wollen wir fertig werden? Auf mich übt das ganz schönen Druck aus“, sagt Viele-Grüße-O und Bis-dann-H verschwindet wieder in ihrem Zimmer. Wir hören sie kramen. Sie kommt freudestrahlend mit einem Stapel Postkarten zurück, verwischt sie auf der Tischplatte und legt Briefmarken dazu. Für jede*n von uns eine. „Sucht euch das Bild aus, was euch als erstes anspricht“, sagt sie und Tschüss-K muffelt: „Spielen wir Therapie oder was?“ Bis-dann-H ignoriert Tschüss-K’s Kommentar und formuliert ein mögliches Ziel: „Wir schreiben jetzt jede*r für sich, lecken die Briefmarken an, kleben sie auf und ab geht die Post.“ „Einfach so aus der Kalten?“, fragt Alles-Liebe-Ch. Alle nicken instant, weil das jetzt ein Ende finden soll.
Hab’s-schön-M stellt ihren Handywecker: „Auf! Fünf Minuten!“ Und dann schauen wir uns an, grabschen uns einen Stift, greifen eher wahllos jede*r eine Postkarte und kritzeln los. Als Hab’s-schön-Ms Wecker schrillt, haben wir rote Gesichter, eine flache Atmung, beschriebene Postkarten und Durst. Bis-dann-Hs Vorräte sind bereits aufgebraucht. Wir gehen gemeinsam zum Späti, auch weil davor ein Briefkasten steht. Nach und nach werfen wir alle etwas zu feierlich, Alles-Liebe-Ch sogar sehr albern, unsere Post ein. Ob sich unsere Eltern gefreut, uns gar zurückgeschrieben haben, erzählen wir uns ein anderes Mal. „Abgemacht?“, fragt Tschüss-K. Und dann legen wir alle unsere Hände übereinander und sagen unisono: „Abgemacht!“, sehr laut zur eingeschalteten Laterne hinauf und also in die Nacht, erleichtert und froh, dass wir Dinge geregelt kriegen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
24 | Helene Lanschützer
24. Dezember 2024Literatur,ProsaAdvent-mosaik,Advent-mosaik,Advent-mosaik 2024,Helene Lanschützer
Stille Nacht in c-Moll
Feli sitzt am Badewannenrand mit angezogenen Knien unter ihrem Kleid, das sich darüber dehnt wie ein Zirkuszelt. Vor dem Badezimmerspiegel steht Mama und beugt sich über das Waschbecken, biegt die Wimpern mit einer schwarzen Bürste nach oben, legt rosa Farbe auf, dass die Wangen glänzen, kämmt sich die Haare. Manchmal kämmt Mama auch Felis Haare und flechtet ihr danach einen Zopf, einen Rapunzel-Zopf, der bei den Ohren beginnt und bis über den Rücken reicht. Meistens muss sich Feli aber selbst eine Frisur mit einem von Mamas schwarzen Gummis machen, dann schauen die Strähnen oben wie kleine Hügel heraus und die kürzeren Haare fallen vorne in die Augen.
„Heute ist Weihnachten“, sagt Mama und steckt Feli eine glitzernde Haarspange in die Stirnfransen. „Weihnachten ist der einzige Tag im Jahr, wo alle hoffen, dem Glück zu begegnen.“ Sie klingt nicht glücklich. Aber ihr scheint es besser zu gehen, ihre Wangen leuchten rosa und sie hat Feli eine halbe Frisur gemacht.
Jetzt nimmt sie ein Glasfläschchen aus dem Schrank.
„Was ist das?“
„Ein Duft.“ Sie sprüht sich den Duft auf ihren Hals, auf die Handgelenke und reibt sie an den Innenseiten aneinander.
„Was ist das für ein Duft?“ Feli beugt sich wie Mama eben über das Waschbecken und versucht zu lesen, was auf der Flasche steht, kann die Buchstaben aber nicht zu Wörtern zusammenfügen.
„Das ist Parfum de Noël.“
Parfö de Noäl riecht nach Punsch vom Weihnachtsmarkt und den Zimtsternen, die sie bei Felis Freundin zuhause gebacken haben.
„Ist da Punsch drin?“, fragt sie.
„Aber nein.“ Jetzt zuckt es um Mamas Mundwinkel. Kurz sieht sie glücklich aus. „Es ist ein Duft, der nach Zimt riecht. Nach Zimt und Weihnachten.
Sie nickt. „Parfö de Noäl.“
„Das ist Französisch. Irgendwann fahren wir nach Paris, nur wir beide. Zum Eiffelturm und den Croissants.“ Feli nickt wieder. Letzte Woche wollte Mama mit ihr nach Italien, nachdem sie Nudeln aus der Dose aufgewärmt hat.
„Irgendwann essen wir Spaghetti in Venedig auf dem Markusplatz, nur wir beide.“
Feli freut sich schon, wenn sie es schaffen, eine Reise in den Supermarkt zu machen, in die Gemüseabteilung, meistens landen sie bei den Konserven.
Heute hat Mama aber sogar die Jalousien von ihrem Schlafzimmerfenster aufgezogen und gelüftet, im Zimmer hängt noch der Rauch des Nachbarn, der über ihnen auf dem Balkon seine Zigaretten ausdrückt. Heute lässt Mama die Welt in die Wohnung hinein, weil Weihnachten ist. Sogar das Bett hat sie gemacht, falls auch die Oma ins Zimmer hineinschaut.
Auf dem Küchentisch liegen die Zimtsterne, die Feli von ihrer Freundin mitbekommen hat. „Die können wir zum Tee servieren“, sagt Mama und holt Tassen aus dem Geschirrspüler. Feli setzt sich auf das Sofa. Das Wohnzimmer ist im gleichen Raum wie die Küche, Mama nennt es Allzweckzimmer. Sie streicht über den sonnenblumengelben Stoff, er ist glatt, hat keine Falten und Dellen wie sonst, wenn jemand ganz lange darauf liegt. Mama holt die kleine Holzkrippe aus dem Schrank, der Weihnachtsstern über dem Dachgiebel hat früher geleuchtet, doch die Batterien sind schon lange leer. Feli stellt ihren Playmobil-Weihnachtsbaum daneben. Er ist viel zu klein, aber sie haben keinen größeren Baum. Mama hat darauf vergessen und Feli heute Morgen mit zehn Euro noch losgeschickt. Die Weihnachtsbaumverkäuferin hat gelacht. „Mit zehn Euro bekommst du gerade mal einen Ast“, sagte sie und gab ihr dann einen Ast. Aber ohne die zehn Euro zu nehmen, die Feli ihr mit der rechten Fäustlingshand hinhielt. Der Weihnachtsbaumast liegt jetzt neben den Zimtsternen auf dem Küchentisch, ein paar Nadeln sind schon abgefallen.
„Gleich kommen Oma und Opa“, sagt Mama. „Erzähl ihnen nichts davon, dass ich oft müde bin. Das verstehen sie immer falsch. Und hol deine Blockflöte aus dem Zimmer. Wenn es zu viel wird, dann kannst du ein paar Lieder vorspielen.“
Die Lehrerin in der Schule hat immer von einer Weihnachtsstille gesprochen, wenn sie die Kerzen am Adventkranz angezündet hat. Still ist es auch am Küchentisch, als Opa, Oma und Tante Elisabeth auf der Küchenbank sitzen, von groß nach klein, sie erinnern Feli an die unterschiedlich heruntergebrannten Kerzen am Kranz vom ersten bis zum dritten Advent. Tante Elisabeth ist Omas Schwester und wäre an Weihnachten ganz allein gewesen, deshalb ist sie auch mitgekommen, weil sie hier vielleicht hofft, dem Glück zu begegnen. Oma hat Erbsensuppe mitgebracht, die Mama im gleichen Topf aufwärmt, in dem sie vorher das Teewasser erhitzt hat.
„Die Zimtsterne sind hart“, sagt Oma.
„Die habe ich gebacken.“ Feli kratzt den Glitzer von der Haarspange ab. Er fällt auf das grüne Tischtuch.
„Man kann sie gut in den Tee tunken“, sagt Opa und tunkt die weiße Zuckergussspitze in den Tee.
„Es ist schön, euch wieder einmal zu sehen“, sagt Tante Elisabeth. Feli kann sich nicht erinnern, sie jemals gesehen zu haben.
„Wie geht es euch? Man hört nicht oft etwas von dir.“ Oma sieht Mama an.
„Gut geht es uns“, Mama streicht über Felis Kopf. „Sonst würden wir uns melden.“
„Und die Arbeit? Du bist doch nur zu Hause.“
„Mama, ich bin selbstständig. Da arbeitet man zu Hause“, sagt Mama. Feli hat Mama noch nie das Wort Mama zu einer anderen Frau sagen hören. „Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir nächstes Jahr nach Paris fahren wollen, nur wir beide.“
Feli sagt nichts. Mama nimmt die Hand von ihrem Kopf. Feli duckt sich schnell, bevor die andere Hand darüberstreichen kann, und spielt mit dem durchsichtigen Batterien-Häuschen des Weihnachtssterns, macht den schwarzen Schalter an und aus.
„Was wünschst du dir zu Weihnachten, Felicitas?“, fragt Opa.
„Ein Pony“, antwortet Feli. „Ein Pony mit einer Mähne, die man kämmen kann.“
„Das nächste Mal bringe ich Batterien für den Weihnachtsstern mit“, sagt Opa. Feli weiß, dass es lange dauern kann, bis aus dem nächsten Mal wieder ein dieses Mal wird.
„Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht“, sagt Oma über ihren Kopf hinweg, Mama protestiert, das Gespräch läuft weiter. Feli holt das Jesuskind aus der Krippe und lässt es auf das Dach des Stalls klettern. Die Stimmen werden lauter, bald würde es einen Streit geben, bei dem die Türen und Sätze knallen. Bei dem Oma irgendwann ihre Handtasche nehmen würde und ohne ihren Mantel die Wohnung verlässt und Opa ihr mit dem Mantel hinterhergeht.
„Ich kann es nicht mehr hören“, ruft Mama jetzt und Feli möchte auch nichts mehr hören.
„Was riecht denn hier so?“, fragt Tante Elisabeth auf einmal.
Das ist Parfö de Noäl, will Feli sagen, aber da ruft die Oma: „Jessas, die Suppe!“, und Mama rennt zum Herd, wo die Suppe anbrennt, und stellt ihn aus. Sie greift sich mit Daumen und Zeigefinger an die Nasenwurzel, das macht sie immer, wenn sie erschöpft ist.
„Soll ich etwas auf der Flöte spielen?“, fragt Feli.
„Das ist doch eine gute Idee“, sagt Opa und Feli holt ihr Notenheft, schlägt Stille Nacht auf, weil es das einzige Lied ist, was sie gut kann. Sie presst die fünf Finger der linken Hand auf die oberen Löcher und beginnt auf dem g. Das Lied kann sie auswendig, sie muss gar nicht auf die Noten schauen. Auf einmal wird es still im Raum. Eine Weihnachtsstille, denkt Feli und als sie am Ende des Liedes angekommen ist, fängt sie wieder von vorne an. Sie würde nicht mehr aufhören, Stille Nacht zu spielen, weil es noch nie so weihnachtlich still im Allzweckzimmer gewesen ist. Es gibt keinen Streit, keine lauten Stimmen mehr, nur noch Stille Nacht auf der Blockflöte. Manchmal holt sie kurz Luft, streicht sich die Spucke von den Lippen und macht weiter. Sieben Mal fängt sie von vorne an, bis sie eine Hand an der Schulter spürt. Sie riecht den Weihnachtsduft. „Jetzt ist es genug“, sagt Mama. Und Opa applaudiert.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
23 | POEDU: Mira – Regina – Inga
23. Dezember 2024Literatur,Lyrik,Advent-mosaikAdvent-mosaik,Poedu,POEDU,Advent-mosaik 2024
Die Wunschliste
Ich wünschte, hinter unserem Haus stünde ein Pferd und dieses Pferd gehörte mir.
Ich wünschte, es hätte eine goldene Mähne.
Ich wünschte, es würde mich in den Wald tragen.
Ich wünschte, ich würde in eine Welt gelangen, die noch nie zuvor jemand betreten hat.
Ich wünschte, dort gäbe es Trauben, so groß wie Fußbälle.
Ich wünschte, dort gäbe es Bücher in allen Sprachen.
Ich wünschte, ich könnte sie verstehen.
Mira, 11 Jahre alt
***
Ich wünschte, ich hätte ein Buch mit vielen Geschichten, das ich nie zu Ende lesen könnte.
Ich wünschte, ich könnte den Binärcode auswendig, dann könnte ich mit Robotern in ihrer Muttersprache sprechen.
Ich wünschte, ich hätte eine Traummaschine, mit der man sich die Träume aussuchen kann, ich hätte dann keine Alpträume mehr.
Ich wünschte, es gäbe Reginerischland wirklich, dort wäre ich die Königin.
Ich wünschte, Süßigkeiten wären gesund.
Ich wünschte, ich lebe in der Villa Kunterbunt.
Ich wünschte, ich könnte in die Zukunft schauen, aber ich wüßte nicht, welche Geschenke ich bekomme.
Regina, 9 Jahre alt
***
Ich wünschte, ich dürfte den ganzen Tag nur lesen.
Ich wünschte, dass ich eines Tages um die Welt reisen würde.
Ich wünschte, ich würd' in London leben.
Und ich wünschte, ich könnte anderen Menschen helfen und Freude bringen.
Inga, 14 Jahre alt
***
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder.
Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
Dieser Impuls kam von Anke Bastrop:
Poesie und Wünschen sind fest miteinander verbunden, und zwar das ganze Jahr lang. Genau genommen kennt das poetische Wünschen keinen Raum und keine Zeit, keine Bedingungen und keine Grenzen. Stellt euch also vor, euer Wünschen wäre ganz frei. Alles, einfach alles dürft ihr sagen … natürlich auch eure Herzensdingwünsche – alles ist erlaubt ...
>> mehr POEDU-Texte auf mosaikzeitschrift.at
>> zum Bestellen: POEDU – das Buch und POEDU – das zweite Buch
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
22 | Sofie Morin
22. Dezember 2024Literatur,LyrikAdvent-mosaik,Advent-mosaik,Sofie Morin,Advent-mosaik 2024
Das war ein Jahr:
Im Dialog mit Frauen
der Poesie ist
Aufgaben gestellt
die ich mir erfülle
Da ist mehr als das Treiben rundum
Gesichter leuchten heraus und ich
halte meine Mitte ganz still
damit sie da bleiben
Zuneigung verschenkt sich selbst
Außen toben Geschehnisse
die Sendungen sprengen
Wir fassen unser Glück kaum
unbeschadet zu sein
Unsere Uhren tragen rote Nasen
wenn wir Schmerz durchtauchen
Das Schicksal ist milde sonntags
in Zusammenkünften zuweilen ein Gelingen
das in keinen Wochentag je passt
Oder zwischen hochgewachsenen Stämmen Wege
die einsam gut sind
Ich weiß manche durchschreiten Wälder
um Geister zu vertreiben
Ich aber will sie anlocken
in meinen Kreis allesamt
will nichts weiter als Verbindungen
die sich verstehen
auf Wölbungen hin zum Verzeihen
Liebeleien mit Wuchsformen
bestimmen die Monatsfolge:
windberuhigte Schwüre
hellglühendes Verständnis
büschelweises Sprießen
Maultrommeln und ein Flirren
um die Mundränder
Ich kenne diese Melodie
der Hund meiner Kindheit
wird in ihr durchscheinend wie gläsern
Ich huldige den kalten Wintern
die Glaubenssätze verheizen
Von einer Taglichte zu nächsten
frischgepflügte Äcker und Sonnwendfeuer
Die Fackel in meiner Hand entzündet
Gangarten der Fantasie erprobt
Jede Eitelkeit gibt schließlich
dem Schneedruck nach
Das ist alles
Und wenn ich fertiggeschrieben habe
koche ich all meinen Kindern eine Suppe
schreibe unser Zusammensein hinein
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
21 | Marina Büttner
21. Dezember 2024Literatur,LyrikMarina Büttner,Advent-mosaik,Advent-mosaik,Advent-mosaik 2024
Erinnerung
Wir holten das Moos aus dem Wald.
Es ging Richtung Wintersonnenwende.
Die Zeit war rar. Doch das Moos holten
wir immer. Es glitt feucht unter die Haut.
Der Duft, in dem später das Jesuskind lag.
Der Vater hob es vorsichtig aus der Erde.
Der Waldrand stand dämmernd. Wir
gingen nach Feierabend, viel Arbeit war da.
Wir waren zu zweit. Weihnachten kam.
Der Duft des Vaters nach Sägespänen,
der Geruch von Moos. Ich schmückte
die Krippe. Das Kind war ganz nah.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
20 | Guillermo Millán Arana
20. Dezember 2024Literatur,ProsaAdvent-mosaik,Advent-mosaik,Advent-mosaik 2024,Guillermo Millán Arana
Eierpunsch
Obwohl wir in derselben Kleinstadt wohnten, sah ich meinen Großvater nur bei bestimmten Familienfesten. Traf trifft es besser, denn ich sah ihn oft. Ich erinnere mich an einen Herbstabend, als ich mit meinen Eltern auf dem Heimweg von einer Gaststätte war, als in einer Seitenstraße eine Kneipentür vor uns aufging und sein scharfes Lachen zu hören zu war. Durch eines der beschlagenen Sprossenfenster sah ich meinen Großvater mit hochrotem Gesicht in einer Gruppe von Männern stehen. Er packte einen jungen Kerl, aus seinem Schützenverein, denke ich, am Kragen, nahm ihn grob in den Schwitzkasten und verpasste dem verlegenen Burschen mehrere Backpfeifen mit der freien Hand. Die anderen schienen sich zu amüsieren, klatschten, johlten meinem Großvater zu. Ich sah hinauf zu Mama. Sie sagte nichts. Dann stupste sie mich an und wir gingen weiter. Ich weiß nicht, ob meine Mutter wollte, dass ich das sehe.
So munter er in der Gesellschaft seiner Freunde war, setzte mein Opa auf Familienfesten sein Schweigen durch. Dafür musste er nichts unternehmen, oder zumindest nicht aktiv, da er mit seinem Naturell für Ruhe sorgte. Für gewöhnlich apathisch, haftete seinem Ausdruck, vor allem zu Tisch, eine gewisse Verärgerung an, ja fast ein unterdrückter Zorn. Die zuckenden Augenbrauen, die zusammengepressten Lippen, das leicht abgewandte Gesicht, der fliehende Blick, der, wenn man ihn erwischte, nur mit einer Art automatischem Misstrauen entgegnet wurde; das alles vermittelte uns anderen Familienmitgliedern die stille Botschaft, im Grunde unerwünscht zu sein, dass er den Abend lieber allein verbringen wollte.
Auch wenn die Stimmung auf solchen Familienfeiern lebhafter wurde, geschah das nur zu seinen Bedingungen. Zu Weihnachten etwa löste sich das Gemüt meines Großvaters nur, wenn es Eierpunsch gab. Obwohl ich ein kleines Mädchen war, konnte ich ausrechnen, wie sich seine Stimmung veränderte, wenn er trank. Zwei Gläschen waren das goldene Maß, dann überkam Opa eine seltsame Rührseligkeit. Das war uns Kindern unangenehm, denn in der Phase des Abends wurde er auf seine Weise zutraulich: Mein Cousin Tommy bekam zum Spaß einen Tritt in den Hintern, mir fuhr er erst mit sanfter Hand durchs Haar, um mir zur Pointe mit einem Jauchzer an den Zöpfen zu ziehen, und Max, der Sohn meiner Tante Sabine, der laut Mama aus einer flüchtigen Liebesnacht entstanden war, nannte Opa „mein kleiner Bastard“.
Beim sechsten Gläschen wurde er allmählich gemein. Er frotzelte über jede unserer Ideen, fast mit einem Krächzen, begleitet von einem Schwung seines gedrungenen Leibes. Schon damals kam mir seine Ausgelassenheit gezwungen vor, als erlaube ihm der Suff, seine höhnischen Zwischenrufe in die Form eines Lachens zu kleiden. Die Erwachsenen stellten sich für gewöhnlich dumm, vor allem nach dem Essen: Die Frauen wandten sich ab, plauderten am Erwachsenentisch, die Männer gingen zum Kindertisch, um Skat zu spielen und zu rauchen, während wir Kinder Zuflucht vor Opa suchten. Wenn er mir viel Angst machte, suchte ich Mama mit den Augen. Stumm erwiderte sie meinen Blick und schaute dann verlegen auf die Tischdecke. Für Oma war es am schlimmsten. Abends, oft waren wir Kinder noch wach, kam unweigerlich die Zeit, in der sie meinen Großvater ins Bett bringen musste. Später, wenn wir Kinder im Flur spielten, hallte sein Schnarchen als Echo seiner Hänseleien aus dem Schlafzimmer.
Nur durch Zufall erfuhr ich, dass Opa den Eierlikör zubereitete, aus dem Oma dann zu Weihnachten den Eierpunsch machte. (In der Verwandtschaft ging man davon aus, dass nur Oma etwas damit zu tun hatte, und jedes Jahr aufs Neue erntete sie aufrichtiges Lob für den guten Punsch. Wenn ich Eier nur rieche, wird mir übel; trotzdem habe ich diesen Eierpunsch oft und gern getrunken.) Einmal, ich war etwa fünfzehn, fuhren wir unangemeldet zu meinen Großeltern. Heiligabend war noch eine Woche hin. Die Englischlehrerin hatte darauf bestanden, den zweiten Teil von Henry IV aufzuführen, und mein Bruder sollte John Falstaff spielen. Mama hatte schleunigst sein Kostüm zusammenzunähen, für das sie Omas Stoffsammlung durchstöbern wollte. Oma stand zunächst ganz verdutzt in der Tür und ich war mir kurz sicher, dass sie uns nicht reinlassen würde. Aber Mama schob sich murmelnd an ihr vorbei und ging auf den Dachboden. Oma bat mich ins Haus, und deutete verstreut mit dem Kopf zur Küche. Bevor ich eintrat, schien sie zu zögern, aber sie tat nichts. Opa stand hemdsärmlig in der Küche. Auf der Arbeitsfläche vor ihm lagen die Zutaten ausgebreitet: Eier, Rum, Puderzucker, ein Glas Wasser, eine Vanilleschote. Fast eindringlich lud er mich ein, einzutreten. Sorgfältig verrührte er Schritt für Schritt alle Zutaten. Aus der Vanilleschote schnitt er mit geübter Hand das Mark heraus.
Er sprach kaum, murmelte gelegentlich vor sich hin, dass man den Fusel aus dem Supermarkt nicht nehmen dürfe, weil man sonst die heilige Jungfrau beschmutze. Oder auch, dass die ganze Welt im Ei stecke. Aber das wirklich Erstaunliche war, ihn so in etwas vertieft zu sehen, so in sich ruhend. Oft habe ich darüber nachgedacht, ob er an jenem Nachmittag sein wahres Wesen offenbarte. Aber auf der Weihnachtsfeier zeigte er sein übliches Gesicht. Diesmal fiel ihm mein Bruder zum Opfer. Mein Opa, der schon beim siebten Gläschen war, grölte ihm zu, er solle doch Shakespeare rezitieren. Mein Bruder antwortete nur: „Fuck you.“ Großvater brüllte vor Lachen. Als mein Bruder später an ihm vorbeiging, schlug ihm Opa so heftig in den Nacken, dass mein Bruder vornüberfiel und erst einmal liegen blieb. Mama sagte nichts, sie sah Opa nicht einmal an. Wir halfen meinem Bruder auf die Beine und gingen sofort heim. Nach dem Vorfall haben wir nur noch im kleinen Kreis gefeiert.
Opa starb ein paar Jahre nach Oma. Mama, die ihn hin und wieder im Pflegeheim besuchte, sagte uns eines Tages am Esstisch, dass es ihm schlecht gehe. Ich sah sie an und hatte das Gefühl, dass sie sich seinen Tod wünschte, aber ich sagte nichts. Einige Wochen später teilte sie uns mit, dass er gestorben sei. Ich glaubte, Erleichterung in ihrem Gesicht zu sehen, und schwieg. Neulich habe ich zum ersten Mal versucht, mit ihr über Opa zu sprechen. Sie sagte, sie wisse genauso viel über ihn wie ich.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
19 | Doris Leeb
19. Dezember 2024Literatur,LyrikAdvent-mosaik,Doris Leeb,Advent-mosaik,Advent-mosaik 2024
Ich sage euch an
Es brennt ein Wutbäuchlein
Erst eins
Dann zwei
Dann dreihundert
Dann vier
Dann steht das Patriarchat vor der Tür
Ist das Kind schon?
Glänzt der Baum schon?
Duftet der Keks schon?
Hat sie eh schon?
Noch nicht?
Na sog amoi!
Wo sama denn?
No de erlaubt se.
Erlauben sie mal.
Sie. sie.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
18 | Chili Tomasson
18. Dezember 2024Literatur,ProsaAdvent-mosaik,Advent-mosaik,Chili Tomasson,Advent-mosaik 2024
Die Brücke am Ostufer
Die Kinder spielen Fußball. Sie spielen ohne schreiende Väter neben dem Platz. Sie spielen ohne weiße Markierungen am Spielfeld. Sie spielen mit einem Plastikball auf einer Wiese.
Ich öffne das Fenster in der Küche.
Das Wetter am Wochenende bleibt beständig. Montags fällt die Temperatur unter 20°, aber die Stromleitungen sind intakt.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand. Die Solarpanele wurden staatlich gefördert und vergangenen Sommer auf dem Dach montiert. Die Einfahrt ist mit hellgrauen Steinen gepflastert und eine schmale Mauer trennt sie an beiden Seiten vom Rasen. Das Gras ist kurz geschnitten und jeden Frühling freue ich mich über die ersten Triebe der Stockrosen.
Seitdem die Brücke gesperrt ist, brauche ich jeden Tag mehr als eine Stunde, um in die Arbeit zu kommen. Der Ausbau der Straßen wurde bereits vor Jahren versprochen, aber die Bauarbeiten haben erst vergangenen Mai begonnen. Ich denke, dass es noch mehrere Jahre dauern wird, bis die Umfahrungsstraße fertiggestellt sein wird.
Im Sommer erscheint mir der Berufsverkehr lauter als sonst. Es ist schon hell, wenn ich auf die Hauptstraße einbiege und ich bemerke, wie sich die Hitze allmählich über den Asphalt legt. Die Luft entfaltet sich langsam und schwer. Im Rückspiegel erkenne ich das Ausmaß der äußeren Bezirke. Sie wachsen stetig und orientieren sich an den Büros im Zentrum und den Fabriken im Süden der Stadt.
Im Sommer habe ich, wie alle anderen, die Fenster unten, während ich an der Ampel warte.
Der Regen zieht nach Südosten ab, von Norden her lockern die Wolken allmählich auf. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Temperaturen erreichen 17° bis 22°.
Arbeitszeiterfassung:
Arbeitsbeginn: 09.00
Kaffeepause: 11.15
Arbeit: 11.30
Mittagspause: 13.00
Arbeit: 13.30
Kaffeepause: 16.00
Arbeit: 16.15
Arbeitsende: 18.00
Seit vermehrt über Einbrüche berichtet wurde, versperre ich das Garagentor und die Eingangstür hinter mir, wenn ich zu Hause ankomme. Es verursacht keinen Mehraufwand und verschafft Sicherheit.
Ich weiß, dass alle hören, wenn ich nach Hause komme. Trotzdem rufe ich immer nach ihnen, während ich mir die Schuhe ausziehe.
Vom Küchenfenster aus kann ich den ganzen Garten überblicken. Kommendes Wochenende werde ich den Rasen mähen und die Hecke schneiden. Die Stockrosen haben bereits zu blühen begonnen und die Tage sind lang.
Abends erzähle ich von der Arbeit. Wir sprechen über die Prognosen der bevorstehenden Wahlen. Ich schneide das Gemüse und wasche den Salat. Dann essen wir alle gemeinsam zu Abend.
Kühl, trüb, unbeständig. Im Süden sind leichte Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt hier gegen 2000m Höhe. Ansonsten bleibt es größtenteils trocken. Leichter bis mäßiger Nordwestwind. 13° bis 18°. In 1500m Höhe um 5°.
Bevor ich schlafen gehe, sitze ich noch eine Weile im Wohnzimmer und lese in den Fachmagazinen.
In der darauffolgenden Nacht träume ich erneut:
Vom Ostufer aus sehe ich die Abschussrampen und Raketenfelder. Das Einfamilienhaus steht am Stadtrand.
Die Luftwaffe hat nach eigenen Angaben gestern drei Kampfflugzeuge im Süden des Landes abgeschossen;
oder
Drei Kampfflugzeuge seien mittags in der südlichen Einsatzzone abgeschossen worden.
Die Behörden machten bislang keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Die Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden. Die Streitkräfte wehrten zuletzt weitere Angriffe im Süden ab. Dort spielen die Kinder Fußball. Sie spielen ohne schreiende Väter neben dem Platz. Sie spielen ohne weiße Markierungen am Spielfeld. Sie spielen mit einem Plastikball auf einer Wiese.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
17 | Georg Großmann
17. Dezember 2024Literatur,LyrikAdvent-mosaik,Advent-mosaik,Georg Großmann,Advent-mosaik 2024
Der Nachtkrabb
(ein altes Lehrmärchen)
Kinder des Tages
hellt nicht die Nacht
mit dem Weiß eurer
Augen
das Dunkel, das die Welt
umflort
beherbergt böse
Kreaturen
gehorcht den Uhren, den
Liedern der Stunde
und klettert nicht in den Ofen
der Nacht, klettert
in den Alkoven
und macht
die Augen häutig und
still
morgen Früh, wenn Gott
will
–
meidet die Nacht
seid nicht des nachts
im Wald, auf freiem
Felde, wenn die
Geister aus dem
Nebel brechen
wenn der Nachteulenfresser kommt
und schlaflose Kinder
ins hinterste Finster
des dichtesten Waldes
verschleppt
ein Riese, man nennt ihn
den Nachtkrabb
ein tiefschwarzer Vogel
groß wie ein Stadel
geht auf gefiederten
Stelzen
greift mit gefiederten
Fingern
stößt mit seinem Sensenschnabel
rote Höllenschreie aus
schaut mit seinen Kohleaugen
dreht den Federkopf zur Seite
pickt nach euch wie ein
fallender Baum
sieht euch von Weitem
sieht euch von oben
kommt schon geflogen
hört jedes Knistern von
Zweigen
hört jedes Flüstern und
Schweigen
sucht nach den
Kindern, den
sturen
(hört auf die Uhren!)
lässt sich die
Abweichler munden
(folgt brav den Stunden!)
Nachtkrabb, gefiederter
Riese
reibt euch mit Grobsand
Wunden ins Fleisch
reibt euch das Augenlicht
aus eurem Angstgesicht
legt euch die ewige
Nacht in den
Schädel
hält euch im Dunkel
fest, dem ihr
gefrönt
schindet euch
Kinder des Tages
hellt nicht die Nacht
mit dem Weiß eurer
Augen
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen: