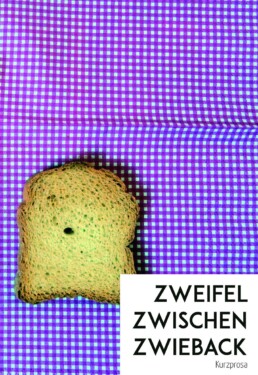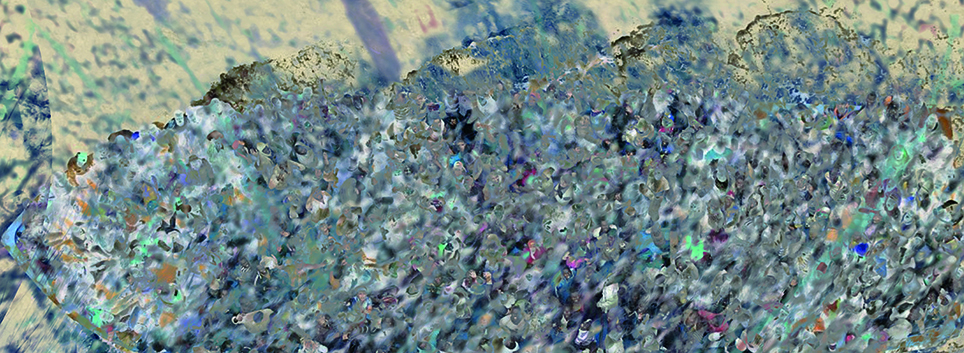ZZZ 10/12 | Katrin Theiner
Katrin Theiner, 1981 in Steinheim (Westfalen) geboren. Hat 2006 den Sprung aus der Provinz nach Berlin geschafft – mit einem Magister in Germanistik und Medienwissenschaft in der Tasche. Sie arbeitet als Texterin und Schreibcoach und veröffentlicht online und in Literaturzeitschriften. Aktuelle Texte sind in der„Trashpool“ und in „Das Prinzip der sparsamsten Erklärung“ zu finden. Sie war Finalistin beim Literaturpreis Prenzlauer Berg 2016 und veröffentlicht im Herbst 2016 Erzählungen beim Hamburger Literatur Quickie Verlag.
Katrin ist Teil von Zweifel zwischen Zwieback, der Kurzprosa-Anthologie zur 20. Ausgabe des mosaik. Ihr Text "Die Dunkelheit störte, die Locken auch" ist einer von 12, die anonym ausgewählt wurden, sich in diesem Band zusammenfinden und am 2. Dezember 2016 erschienen sind.
-
Buchstabierte Blumen
Vielleicht könnte ich ihre Welt besser verstehen, wenn ich in ihren Schuhen laufen würde.
Aber ich lasse sie schlafen. Durch die getönten Scheiben sah alles, was nichts mit uns zu tun hatte, nutzlos aus. Verlassene Fabrikhallen, übersonnte Weiden, breitschultrige Wassertürme und dahingekleckerte Häuser. Spargelfelder schmissen sich vor uns hin, Wolkenschwärme malten fliehende Schatten auf zu große Felder. Wir fuhren die Strecke zum vierten Mal. Tim und ich. Zweimal hin, zweimal zurück. Vorbei an dem Bahnübergang mit den gelben Schranken, daneben die verhüllten Tennisplätze, gleich das Rapsfeld mit den Gülletanks, die spitz zum Himmel zeigten. Der Zug glitt zu leise über die Schienen. Mir fehlte etwas. Das Rumpeln, die Geräusche, das Knacken von Lautsprechern. Irgendwas Echtes, am besten was zum Anfassen oder Riechen. Vielleicht etwas, das in der Hand schmolz, sich auflöste, einen klebrigen Film auf der Haut hinterließ. Etwas, das zu mir gehörte, wie Nowitzki zu den Mavericks. Etwas, das mir das Gefühl geben konnte, noch in meinem Körper zu stecken, diesem Ding, das ich immer für zu Peter Parker gehalten hatte – vor dem Spinnenbiss. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt roch alles nach ihr. Und über ihren Duft hatte ich mein Lakers-Trikot gezogen, die Nr. 24. Das hielt ich für das mindeste, auch wenn es das alte Trikot meines Vaters war, das er mir dagelassen hatte, an dem Tag, als er ausgezogen war. „Mach was draus“, hatte er gesagt und mich angeschaut, als warte er auf eine Entschuldigung für die letzten vierzehn Jahre.
weiterlesen im freiTEXT >>
-
Wind, Kind, Blind, Rind
Polly, so möchte sie genannt werden, habe ich in einem Forum für Allergiker kennengelernt. Erst schrieb ich mir mit Ellen, die unter kreisrundem Haarausfall und einer pelzigen Zunge litt und gerade dabei war, einer Unverträglichkeit gegen Zitrusfrüchte und vielleicht auch gegen ein neues Waschmittel auf die Schliche zu kommen, aber auf ihrem Profil-Bild hatte sie dieses typische Verena-Gesicht; schmales Kinn, pädagogisches Lächeln, durchsichtige Zahnkanten, massenweise Wirbel am Haaransatz, und so sehr ich mich auch bemühte, es fühlte sich einfach falsch an, sie nicht Verena zu nennen. Irgendwann schrieb sie, ich solle doch an einer Pekannuss ersticken, ich sei geisteskrank und seitdem hat sie nicht mehr geantwortet. Gestern schrieb mir Polly und erzählte von Nährstoffmangel, Brust-Migräne, einer abgebrochenen Darmsanierung und ihrer Liebe zu Nirvana. Ich beichtete ihr, dass mein Schnäuzer alleine dafür dient, die Blätterkrokanthaut in meinem Gesicht zumindest zwischen Nase und Mund zu unterbrechen und dass Schließfrüchte aller Art mein Tod seien. Come as you are, schrieb sie und heute treffen wir uns.
weiterlesen in mosaik16 >>
 Landschaft zum Verschwundensein
Landschaft zum Verschwundensein
Der Herr Onkel war tot. Den Mund voll brauner Fichtennadeln, den Bart auch, als hätte er einen zu großen Löffel Suppe in sich hineingeschaufelt, bei dem die Nudeln zwischen seinen Lippen wieder rauskamen. Oder als hätte er vor Hunger seine eigenen Bäume gefressen und war an Rinde, Harz und Zapfen erstickt. Die Tannenschonung hatte angefangen ihn zu beerdigen, warf Sand auf seinen muffigen Kompostsarg aus Ästen und Laub, aber bevor der Wald den Grabstein setzen konnte, den letzten Spruch aufgesagt hatte, und der Herr Onkel hätte es verabscheut, das Gefasel um Himmel, usw. usf., hätte geschrien, mit Gott und so hätten nur Arschkriecher was am Hut, und bevor die Bäume hinter der Lichtung an der Grabstätte für immer für Ruhe sorgen konnten, hatte ein Waldarbeiter seine Leiche in moosgrünen Gummistiefeln im Unterholz entdeckt.
weiterlesen im freiTEXT >>
14 | Katrin Theiner
Taximann
Ich fahre immer über den Stern. Jeden Morgen. Erst die Zigarette an der Siegessäule weckt mich auf. Seit 15 Jahren umrunde ich die Goldelse und dann geht es rechts ab nach Moabit, einen Stammkunden abholen – eine ganz arme Sau. Geschäftsmann. Schlaganfall. Ich bringe ihn zur Tagespflege. Kurz vor dem Haus in dem er wohnt, ist meine Tankstelle. Ich tanke voll, laufe geduckt durch die anhaltende Schlechtwetterfront und kaufe im Shop Zigaretten und einen Schwamm. Morgens, wenn ich den Motor starte und die Belüftung angeht, steigt dieser Geruch in meinen Benz. Heizung, kalter Rauch, belegte Brötchen und der klamme Dunst vieler Fahrgäste. Als hätte jeder von ihnen etwas zurückgelassen. Irgendwie motiviert mich das. Radio an, Scheiben wischen, Rückwärtsgang, los. Bald kann ich die goldene Viktoria auf ihrer Säule sehen. Sie ist so etwas wie eine Arbeitskollegin geworden. Und die Erste, die mich morgens begrüßt. Jedes Mal versuche ich so lange wie möglich ihr Gesicht anzusehen. Als würde dort eine Regung kurz bevorstehen. Wir kennen uns eben verdammt lange.
Der Geschäftsmann sitzt festgeschnallt in meinem Auto und gibt komische Laute von sich. Er trägt einen gelben Jogginganzug und weiße Sportschuhe. Seine Frau hat beim Abschied geweint. Ob er sie noch erkenne, wisse sie nicht. Ihm wird kalt sein. Ich öffne meine Lederjacke, drehe die Heizung höher. Der Rückspiegel umrahmt seine gesunde Gesichtshälfte. Schon von weitem sehe ich seine Pflegerin. Ich bremse, damit der Matsch nicht auf ihren Kittel spritzt. Mit laufendem Motor bleibe ich stehen und ziehe die Silberfolie in langen Stücken von meiner Schrippe. Die Heizung nimmt den Geruch von Kochschinken mit und pustet ihn durch den Innenraum. Beiße ab, muss weiter. Der Bus ist heute pünktlich und mit ihm das Radio-Programm: „Verdamp lang her“. Wie fast jeden Tag. Die Stimme nervt, der Akzent ist wunderbar.
Von hier fahre ich zum Alex. Immer. Wohin mich die Fahrgäste schicken, bestimmen sie, von wo es losgeht, ich. Mir gefällt die Mischung aus Routine und Unvorhersehbarem. Nach 19 Jahren am Lenkrad, erkenne ich die drei Taxi-Typen sofort. Es gibt die Gestressten: Sie haben nicht damit gerechnet, plötzlich in einem Taxi zu sitzen. Irgendwelche Umstände zwingen sie, bei mir einzusteigen. Sie winken hektisch, reißen ruckartig die Tür auf und nennen atemlos ihr Ziel. Meist sitzen sie hinten, krallen sich an die vorderen Kopflehnen und würden am liebsten selber fahren. Jede rote Ampel ist eine Zerreisprobe für ihre Nerven. Sie kramen in ihren Portemonnaies, noch bevor wir das Ziel erreicht haben und geben wenig Trinkgeld.
Ich lasse die Waschmaschine rechts liegen und fahre weiter durch den Wintermorgen. Die Scheibenwischer geben den Takt vor, Niedecken den Text.
Wenn Kinder bei mir mitfahren, begucken ihre kleinen Gesichter staunend die Stadt. Ich habe keine Kinder. Das passte einfach nicht. Meine Kunden sind meine Familie. Und dazu die Goldelse, der Konrad auf dem Adenauer Platz, Prinz Albrecht an der Schlossstraße und das Steinmädchen auf der Wieck-Promenade. Im Auto sind mir die Routinierten am liebsten – Typ zwei. Weil sie so unkompliziert sind. Sie fahren oft Taxi und das merkt man ihnen an. Sie steigen meist vorne ein, nennen ihr Ziel und sind dann ruhig. Taxi fahren gehört zu ihrem Alltag, sie haben die wenigen Regeln verstanden und sind entspannte Beifahrer. „Von A nach B“ ist ihr Motto und das ist auch meins. Richtung Karl-Liebknecht-Straße ist eine Baustelle. Der Telespargel lässt die Häuser klein werden. Seine Spitze steckt in dicken Wolken. Da will ich jetzt hin. Zum Taxistand in Turmnähe. Am Alexanderplatz reihe ich mich ein in die Schlange von Taxen. Frühstückspause bei Santanas „Maria“ und leichtgeöffnetem Fenster. Kauend lasse ich mich nach vorne rollen und kauend nicke ich einer jungen Frau und ihrem Begleiter zu, die vor der Beifahrertür im Schneegestöber stehen. Sie bringen den Geruch von nassen Haaren und Kälte mit ins Auto und halten verschneite Rucksäcke auf dem Schoß. Er schnallt sich langsam an. Sie hat den Platz in der Mitte gewählt. Der Platz des Schlaganfall-Geschäftsmanns bleibt frei. Ich stelle mir die drei nebeneinander vor. Verrückt. „Nach Buch“, sagt der Typ leise. 18,3 Kilometer. Ich fahre los und sehe ihre Gesichter im Rückspiegel. Die Haut des Mädchens ist dunkel. Dicke, schwarze Brauen trennen ihre Stirn von der Augenpartie. Sie sieht müde aus, hat ein nettes Gesicht. Ihre Eltern werden aus dem Süden kommen. Spanien oder Griechenland. Was will sie mit ihm? Narbiges Gesicht, Bomberjacke, dunkelblaue Wollmütze. Für eine Glatze ist es wohl zu kalt, schießt es mir am Planetarium durch den Kopf. Ich folge dem Navi und genieße die Zeit, in der die Zwei unter meiner Beobachtung stehen. Sie starren schweigend ins Schneegestöber. Er greift nach seiner Mütze, nimmt sie kurz ab und im Rückspiegel leuchtet seine goldene Kopfhaut auf. Er streicht drüber, zieht schnell wieder die Mütze auf. Das eingefallene Gesicht wird noch nicht lange so aussehen. Seine Augen liegen tief, aber in ihnen glänzt es jung. Rostock- Lichtenhagen wird ihm sicher kein Begriff sein. Da war er ein Hosenscheißer. Ich tippe auf Mitläufer, aber das macht die Sache nicht besser.
Wir verlassen die Stadt nach Nord-Ost und nehmen die glatte A10. In 19 Jahren habe ich viele Glatzen gefahren. Früher habe ich diskutiert, heute nicht mehr. Ich bin Dienstleister, kein Pfarrer. Das Mädchen hebt die Hand und streichelt ihrem Freund über ein Tattoo am Hals. Von hier sieht es aus wie eine zerlaufene Umweltplakette. Er reißt den Kopf vor, fegt ihre Hand weg. „Lass“. Sie lehnt sich zurück, reibt sich die Augen. Musik an: Taxi-Hits. „Ich fahr Taxi. Ich fahr Taxi. Tag und Nacht. Der Job ist so mies, doch ich brauch den Kies.“
Ich beschließe, sie sind Typ drei. Nicht der klassische Typ drei, aber Typ zwei und Typ eins schon gar nicht. Sie sind schweigsamer, passiver, aber gehören zu den Korrekten. Die Korrekten fahren selten Taxi, planen ihre Fahrten und bemühen sich, die Regeln zu befolgen. Oft strahlen sie Unsicherheit aus, fragen vorab nach dem Preis. Sie sind aufmerksam, achten auf den Verkehr, auf mich. Sie sind sich darüber bewusst, in meinem Raum zu sein. Und hier passt man sich an.
Wir bewegen uns durch verschneite Felder. Frau Paradis singt mit zarter Stimme und es wird mir egal, ob sich die Glatze ihr Leben versaut. Um das Mädchen ist es schade. Wäre sie meine Tochter, würde ich ihr die Welt zeigen. Ich würde sparen, sie verwöhnen, um ihr zu erklären, man lebt doch nur einmal. „Vas-y Joe, Vas-y fonce.“
Am Karower Teich ist die Fahrbahn gefroren. Die Glatze hat die Augen geschlossen. Die Augenlider zucken unruhig. Ich tippe ihn auf Mitte Zwanzig. Was ihn wohl zu seiner Einstellung gebracht hat und dabei das hübsche Mädchen an die Hand zu nehmen? Berlin ist groß und täglich schwimmt die bunte Jugend über meine Rückbank. Aber die beiden sind besonders. Sie ist besonders schön, er macht mich wütend. Nach Micky Reinckes Kurztrip zum Eifelturm, spielt Fredl Fesl die ersten Akkorde seines Taxilieds. Ich hasse es. Nur wegen des Textes hat es einen Platz auf meiner CD. Bei so was bin ich konsequent.
Buch liegt vor uns. Der Schnee verdeckt die graue Platte. Es ist stickig. Die Glatze legt den Arm um das Mädchen. Ihre schwarzen Haare fließen in langen Strähnen über seine Jacke und verdecken die bunten Aufnäher. „An der Kirche vorbei“, sagt sie und taucht zwischen mir und dem Beifahrersitzt auf. Ich stelle das Navi aus. „Nächste rechts.“ Zwischen kargen Bäumen taucht ein beiger Gebäudekomplex auf. Mein Hals ist eng. Ich drehe Chapins Stimme leise. „It was somewhere in a fairy tale, I used to take her home in my car“.
Ich habe es plötzlich eilig, die beiden loszuwerden. „Links am Hauptgebäude vorbei“, sagt sie, zeigt durch die Windschutzscheibe. Er greift von hinten in ihre Haare und zieht sie immer wieder durch seine linke Hand, als würde er ein Haarband entfernen. Der große Parkplatz ist leer. Mit laufendem Motor bleibe ich stehen; eine Minute, die nicht endet. Ich schwitze. Ohne dass ich den Preis nenne, reicht sie zwei Zwanziger nach vorne und öffnet mit der anderen Hand die rechte Tür, den Oberkörper über ihren Freund gelehnt. Er schaut apathisch zu. Der Zähler zeigt 37,70 Euro. Dann verschwinden beide im Winter. Ich fahre an, drehe die Musik lauter. Westernhagen ist bei mir, als der Schnee alles verwischt: „Chemozentrum Berlin-Buch“. „Nun fahr schon los, ich will nach Hause, Taximann. Nun fahr schon schneller und halt nicht dauernd an“.
Katrin Theiner
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
mosaik20 - Zweifel zwischen Zwieback
Zweifel zwischen Zwieback
Intro
Das soll ein Thema sein? Was soll man denn da schreiben? Wem ist denn das eingefallen?
Nein, leicht haben wir es unseren Autor*innen nicht gemacht. Und wir haben selber auch gezweifelt, ob zur zwanzigsten Ausgabe des mosaik der Zwieback ein geeignetes Thema ist, haben uns zwischen Zwetschgen und Zwiebeln (und ganz klar gegen „Zwanz-ich“ oder „2.0“) entscheiden müssen. Aber eine Buchausschreibung braucht ein Thema – und so bewegen wir uns mit ZZZ nach „X“ zur zehnten Ausgabe 2014 nicht nur im Alphabet voran.
Viel ist passiert seit der letzten vergleichbaren Ausschreibung. Auch diesmal wurden die Texte für diese Zusammenstellung aus den zahlreichen Einsendungen, die um dieses Thema kreisen, anonym ausgewählt. Ein Dank an dieser Stelle an die Jury: an Sigrid Klonner, Marlen Mairhofer und Christian Lorenz Müller.
Dass uns der Junge von der Zwiebackpackung in Texten begegnen würde, konnten wir ahnen, in welche Körperöffnungen er bröseln kann oder welche Rolle er in der Weltgeschichte gehabt hat, nicht. Uns freuen die zahlreichen zweifelnden Texte, die Beziehungen, die Erinnerung oder die Logik an sich in Frage stellen. Zwischendurch mussten wir uns fragen, ob sich der eine oder andere Text zu weit vom Thema entfernt – die Kreativität der Autor*innen hat uns dann aber nicht mehr zweifeln lassen.
Ein großer Dank gilt Manuel Riemelmoser als leitenden Lektor dieses Bandes sowie Felicitas Biller, Marko Dinic und Antonia Leitgeb, die ihn (und uns) dabei unterstützt haben. Ein Dankeschön auch an Gabor Schuster vom Verlag Neues Leben, der uns und der edition mosaik das Vertrauen entgegenbringt – und nicht zuletzt auch an die Literaturabteilungen von Stadt und Land Salzburg sowie dem Bundeskanzleramt Österreich und der ÖH Salzburg, die unsere Arbeit in den letzten Jahren ermöglicht haben.
Zwanzig Ausgaben des mosaik liegen mit dieser hinter uns – wir hoffen, dass noch viele folgen mögen. Darum bedanken wir uns bei jeder und jedem von euch, die ihr gerade dieses Vorwort lest und damit ein Teil des mosaik seid. Ohne dich wäre das alles hier nicht möglich. Vielen Dank.
Zwölf Texte von zwölf Autor*innen wurden von der Jury ausgewählt:
- Silke Vogt – Unzweifelhafte Zwieback-Geschichten
- Andreas Reichelsdorfer – Gesetze der Logik
- Lea Wintterlin – Das Fahrrad
- Veronika Aschenbrenner – Wir nennen sie Marbella
- Lisa Viktoria Niederberger – Das Pelzchen
- Katrin Theiner – Die Dunkelheit störte, die Locken auch
- Arne Kohlweyer – Sandbankräuber
- Marlene Schulz – morning has broken
- Sven Heuchert – Neuware
- Ulrich Moebius – Home sweet Home
- Fabian Bross – Kichererbsen
- Petrus Akkordeon – wer rollt den stein
freiTEXT | Katrin Theiner
Buchstabierte Blumen
Vielleicht könnte ich ihre Welt besser verstehen, wenn ich in ihren Schuhen laufen würde.
Aber ich lasse sie schlafen. Durch die getönten Scheiben sah alles, was nichts mit uns zu tun hatte, nutzlos aus. Verlassene Fabrikhallen, übersonnte Weiden, breitschultrige Wassertürme und dahingekleckerte Häuser. Spargelfelder schmissen sich vor uns hin, Wolkenschwärme malten fliehende Schatten auf zu große Felder. Wir fuhren die Strecke zum vierten Mal. Tim und ich. Zweimal hin, zweimal zurück. Vorbei an dem Bahnübergang mit den gelben Schranken, daneben die verhüllten Tennisplätze, gleich das Rapsfeld mit den Gülletanks, die spitz zum Himmel zeigten. Der Zug glitt zu leise über die Schienen. Mir fehlte etwas. Das Rumpeln, die Geräusche, das Knacken von Lautsprechern. Irgendwas Echtes, am besten was zum Anfassen oder Riechen. Vielleicht etwas, das in der Hand schmolz, sich auflöste, einen klebrigen Film auf der Haut hinterließ. Etwas, das zu mir gehörte, wie Nowitzki zu den Mavericks. Etwas, das mir das Gefühl geben konnte, noch in meinem Körper zu stecken, diesem Ding, das ich immer für zu Peter Parker gehalten hatte – vor dem Spinnenbiss. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt roch alles nach ihr. Und über ihren Duft hatte ich mein Lakers-Trikot gezogen, die Nr. 24. Das hielt ich für das mindeste, auch wenn es das alte Trikot meines Vaters war, das er mir dagelassen hatte, an dem Tag, als er ausgezogen war. „Mach was draus“, hatte er gesagt und mich angeschaut, als warte er auf eine Entschuldigung für die letzten vierzehn Jahre.
Ich fasste ins Feucht meiner Achselhöhlen, tastete schnell über die drahtigen Haare und roch kurz an meinen Fingern, die ein stechenden Geruch verströmten. Tim schlief und ich schaute weg von der flirrenden Welt vor dem Fenster, die aussah, als bräuchte sie eine Mittagspause, suchte und blickte umher, ob ich heute Morgen auf der Hinfahrt nicht vielleicht etwas im Zug verloren hatte, das mir, während ich es wiederfand, sagen konnte, wer ich denn war, jetzt, wo ich mit ihr geschlafen hatte. Irgendein Ding, das mir den Schwindel nahm, diesen Strudel, der mich vom Boden ansaugte, mich zerkaute und mich wahllos zusammengesetzt in diesen Zug zurück nach Berlin fallen ließ, die Arme am Rücken befestigt, die Füße nach hinten zeigend, die Haare zerrauft und voller Kletten, den Magen überschäumend und das Grinsen nicht nachlassen wollend.
Etwas, das mich mit Echtheit wusch, wie die stumpfgewordene Ringe meiner Eltern, die zwischen unnützen Gegenständen in einer asiatischen Schale im Bad meiner Mutter lagen, an der getrocknete Zahnpasta klebte. Ein Déjà-vu wäre gut. Dieses Gefühl von Vorahnung und Erlebtem, das mich erst an ein früheres Leben und dann doch nur an die Szene aus einem der Filme meines Vaters erinnerte, die ich heimlich schaute, wenn er Frühdienst hatte. Ich brauchte was, das diesem Tag Konturen gab, mein verrutschtes Weltbild zurück hinter Glas brachte, in sein mattes Passepartout schob und mir versicherte, dass es wirklich passiert war. Mit ihr. Und mir.
Tim lehnte mit dem Kopf am Fenster. Die rechte Gesichtshälfte endete glatt an der Scheibe, die um den Mund beschlug. Die dünnen Arme lagen ruhig im Schoß, der in lange, dürre Beine überging. Sie sahen wie abgeknickte, zerkratzte Leuchtröhren aus, drängten unter einem kurzen Schottenrock hervor und endeten zusammengekreuzt zwischen Sitzbank und Mülleimer in orangenen Air Max. An der Sohle klebte matschiger Rittersporn. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Auf Tims ärmellosem Hemd lösten sich sehr kleine Schokoladenstückchen auf und sanken zwischen die maisgelben Streifen in den Stoff. der ragte in orangenen Buchstaben aus der Öffnung einer aufgenähten Brusttasche heraus und ich fühlte mich irgendwie angesprochen, aber es waren nur drei Buchstaben auf einem angefangenen Schokoriegel.
Eine Woche vorher war meine Klasse mit Herrn Dallos zur Bundesgartenschau gefahren und eine Woche vorher war Tim neu in meine Klasse gekommen. Eine Woche vorher waren wir den schiefgetretenen Sohlen unseres fetten Lehrers durch den Bahnhof von Brandenburg an der Havel gefolgt, durch beige, Bild-Zeitung haltende Truppen mit Blumenkohlhelmen und vorbei an touristischen Fragebeantwortern in BuGa-Uniform. „Ich bin der King“, sagte Marc mit Terminator-Stimme, fasste sich an die Eier und spuckte sein grünes Kaugummi gegen ein zerkratztes Schild mit der Aufschrift „Die Wiege der Mark Brandenburg“. Tim blieb in der Nähe von Herrn Dallos, war neu, ein Fremdkörper abseits der Klasse und sorgte für Getuschel. „Der Name...und die Frisur. Die Schuhe“, sagte Rahel, zeigte auf die großen, schwarzen Martens an Tims Füßen, zog und zerrte an ihrem Shirt und schob ihre BH-Bügel bühnenreif zurück unter ihre dicken Brüste. Wir aßen Bifi, fragten uns alle, warum es ausgerechnet die Bundesgartenschau sein musste, zu der wir einen Ausflug machten und liefen über die Jahrtausendbrücke, auf der uns Herr Dallos zu einem Gruppenfoto für die Flur-Collage zusammentrieb. Tim hatte sich durch die Menge geschoben, stand hinter mir, ich konnte die dünnen Unterarme an meinem Rucksack spüren. „Zu den Nachtschattengewächsen da lang“, schrie Rahel, leckte sich die Lippen und blitzte in Tims Richtung. „Herr Dallos, wächst hier auch Hanf?“, fragte Miro und guckte irgendwie Heisenberg. Tim blickte nicht auf, kratzte schwarzen Lack von den Fingernägeln und hörte Herrn Dallos zu, der seinen Lageplan im Uhrzeigersinn drehte, die Augen verkniff und „Orchideenschau, Aussichtsturm, Orchideenschau, Aussichtsturm“ zu sich selbst sagte. Dann wühlte er mit seiner Zunge durch den Mund und klemmte sie kurz zwischen die durchsichtigen Kanten seiner feucht glänzenden Schneidezähne.
Vor uns lagen Havelwiesen, bepfadete Gräserstreifen, Beete, Stauden, Blütenteppiche und dunkelgrüne Heckenblöcke.
Dazwischen Info-Türme, Langnese-Stände und Sprenganlagen, die Wasserschleifen in arroganten Bögen hoch warfen. In der Kühle der Luft lag die Erwartung an volle Wege, beige besetzte Bänke und überfüllte Papierkörbe, an denen Wespenschwärme um Eispapier jagen. „Herr-er Dallos-los, sie-ie haben-en da was a-am Kinn-inn“, schrien Rahel und Mell zeitversetzt und nahmen die Shining-Zwillingshaltung ein. Herr Dallos fasste sich an seinen grauschwarzen Vollbart, der seine dicken Wangen optisch aufquollen ließ. „Am Anderen“, kreischten die beiden synchron in die Menge, rannten und schubsten sich gekrümmt in ein Tulpenbeet in Zwischentönen und griffen sich dabei fest zwischen die Beine. Unser Lehrer sah aus, als würde er zu seinem Depardieu-Schnitt den passenden Blick suchen und rief: „Wir treffen uns in zwei Stunden an Aussichtsturm C. Keiner verlässt die Wege, keiner reißt Blumen ab und niemand geht alleine.“ Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, schob den Lageplan zwischen den rechten Träger seines Rucksacks und biss in eine Nektarine, dass ihm gelber Saft zwischen seine fetten Finger lief. Ich hatte bemerkt, dass Tim mich beobachtete und ich beobachtete Tim, um zu schauen, ob sich unsere Blicke wirklich jedes Mal trafen, wenn ich schaute oder ob es auch Momente gab, an denen sie ins Leere liefen. Ich war unsicher und weil sich unsere Augen an diesem Tag fünf- bis zehnmal begegnet waren, bekam ich feuchte Hände und übte ein schüchternes Lächeln ein. Die Anderen bemerkten das nicht. Sie waren vorgelaufen, als sie ein garagengroßes, aus
Stiefmütterchen geformtes Quitscheentchen entdeckt hatten, das sich an verformten Buchsbaum schmiegte. „Ich gehe zum Muschihaus“, sagte Tim mit leiser Stimme zu mir und schob sich schwarzgefärbte Haarsträhnen hinter die Ohren. „Kommste mit?“
„Muschihaus?“
„Orchideen.“
Schweigend setzten wir uns in Bewegung, liefen über kunstvoll gewundene Wege aus butterweichen Sportplatztartan vorbei an vollgepflanzten Booten, Gerüstwäldern voll hochgetriebener Schlingpflanzen, Pflanzenfrachten in Kübeln, bis wir einen Miniaturweinberg sahen, hinter dem sich das Orchideenhaus versteckte. In der Ferne hatten sich Rahel, Mell, Miro und ein paar andere auf einer nicht zu betretenden Wiese niedergelassen. Die Mädchen hatten ihre Jacken ausgezogen, rollten sich in Tops einen kaum vorhandenen Abhang hinab und bewarfen sich mit abgerissenem Gras. Tim sah meinen Blick, sah mich an, fragte: „Willst du zu denen?“, wickelte ein Überraschungsei aus rosaweißer Folie und hielt mir ein Stück braunweiße Schokohülle hin. „Ne, gar nicht“, sagte ich, blickte zu Boden, nahm das halbe Ei in die Hand und fühlte die weiche, angeschmolzene Stelle, an der Tims Finger die Schokolade angefasst hatten. „Kann nicht ohne“, sagte Tim und schob sich die andere Hälfte in den Mund. „Ohne was?“, fragte ich. „Zucker“, sagte Tim kauend und lief vor. „Und das?“, fragte ich, lief auch los und zeigte auf das gelbe Plastikei in Tims Hand.
Wir gingen vorbei an einem Schild, das uns in den Duftgarten locken wollte und betraten das Orchideenhaus, eine aus Backsteinen errichtete Halle mit feuchter Luft und Kirchenatmosphäre. Ich wartete auf das Einsetzen von Orgelmusik, flüsterte Tim “Ch’muss ma“ zu und kassierte dafür ein synchrones „Schschsch…“ von einem Rentnerpaar, das an einem Schild mit der Aufschrift „Brassia Rex“ herumfingerte. Wir gingen raus, ich lief durch kniehohes Kraut, steuerte eine überschaubare Tannenschonung an und pinkelte auf den mit braunen Nadeln bedeckten Boden. An meinen Fingern fühlte ich den stumpfen Schmelz der Schokolade, die ich noch schmecken konnte, wenn ich mit der Zunge im Mund umherfuhr. Ich griff nach meiner Hose, dem Gürtel und spürte, dass Tim hinter mir stand, „Lass“ sagte und mit der Hand in meine Boxershorts fasste. Ich schwitze, blickte nach unten, sah einen schwarzen Schuh zwischen meinen Jordans, sah ein Tattoo auf dem dünnen Arm, Buchstaben, die sich in rythmischen Bewegungen am Gummi meiner Boxershorts rieben und nicht preisgaben, was sie bedeuteten.
se rose se rose se rose se a rose se rose e rose se a rose
Ich spürte Tims Stirn an meiner Schulter. Atem, der süß in meine Kapuze drang, ich schmeckte die Schokolade an meinen Zähnen und stemmte mich gegen die kräftigen Griffe zwischen meinen Beinen. Der Geruch von Waldmeister schob sich durch das Gebüsch, irgendwo surrte ein Rasenmäher, ich biss keuchend in meine Faust und kam in Tims Hand.
Schweigend zog ich meine Hose an, meine Jacke aus, breitete sie auf den waldigen Boden und bot Tim einen Platz darauf an, nachdem ich ein paar hochgewachsene Kletten mit lila Blüten zur Seite gedrückt hatte. Schweigend setzten wir uns und mein Blick fiel auf Tims Arm, von dem sich die Buchstaben My soul is a rose leicht hochnarbten. „Was heißt das?“, fragte ich und fasste vorsichtig auf die geschwärzte Haut. „Das, was da steht“, sagte Tim, lehnte sich gegen meine Schulter und sagte für den Rest des Tages nichts mehr.
In der nächsten Woche kam Tim nicht zur Schule. Die Sommersonne trug den Geruch von trocknenden Pfützen über den Schulhof und ich schleppte mich durch die Tage, dachte an Tim, an den Ausflug, konnte keinen Pass mehr werfen und Kemal rief:
„Was bist’n Du für’n Forward, Chris!“
Donnerstag der Zettel in meiner Tasche. Morgen, sieben Uhr am Bahnhof.
Der nächste Tag war einer der Tage, an denen es beim Aufstehen zu heiß war. Ich zog mein gelbweißes Lakers-Trikot an. Mit passender Hose. Ich fror, sah Jesse Pinkman beim Cornflakes essen zu, aß auch Cornflakes und schrieb meiner Mutter einen Zettel.
Wortlos stellten wir uns auf dem Gleis nebeneinander. Wortlos stiegen wir in die Regionalbahn, die ihren Zielort Brandenburg an der Havel angeberisch auf kleinen Displays verkündete. Ich sah Tim fragend an. Tim zuckte mit den Schultern, biss in einen Kinderriegel, wickelte den Rest zurück in die Folie und ließ ihn in einer Tasche verschwinden. Wir sahen schweigend aus dem Fenster. Ich schwitzte, bekam meine normale Stimme nicht hin, schwitzte noch mehr, roch kurz an mir. Deo. Wir stiegen aus dem Zug, liefen durch den leeren Bahnhof, über die leere Jahrtausendbrücke, im Anlauf auf die umgärtnerten Tartanbahnen in Richtung Tannenschonung am Orchideenhaus. Ich bildete mir ein, genau die sichtgeschützte Stelle zu sehen, an der wir eine Woche zuvor gesessen hatten und genau da, zwischen den gebogenen Kletten und dem herübergesamten Mohn, breitete Tim einen dünnen Sommermantel aus Jeans aus, auf den wir uns setzen. In der Hand das gelbe Plastikei. „Du darfst“, sagte Tim, ließ sich nach hinten fallen und schloss die Augen. Ich ploppte das Ei in zwei Hälften und zog eine in Papier gewickelte Elfe heraus, die ich kurz ansah und in meiner Hosentasche verschwinden ließ. Ich schaute Tim an, sah auf die kleine Beule, die die Karos des Schottenrocks verbog und schämte mich. Für die Gedanken der Mädchen, das Räuspern von Herrn Dallos, wenn er „Tim“ sagte, die Ignoranz und die Blicke der Jungs und meine Blicke, die anders gemeint, aber von denen der Anderen nicht zu unterscheiden waren. Ich schämte mich für meine Scham und dafür, dass ich die NBA-Mindestgröße und zwei Haustürschlüssel für ein schwieriges Leben gehalten hatte. Meine Handgelenke, auf die ich mich gestützt hatte, taten auf einmal verdammt weh und dann bekam ich von dem gurgelnden Geräusch des Brunnens vor dem Orchideenhaus, Blasendruck, aber ich traute mich erst pinkeln zu gehen, als ich glaubte, Tim sei eingeschlafen. War sie aber nicht.
Als Tim neu in unsere Klasse gekommen war, war sie ohne Zweifel das schönste Mädchen, das ich jemals gesehen hatte und jetzt lag sie zwischen Brandeburger Klee und Brennesseln in meinem Arm. „Ch‘such mir bald nen neuen Namen aus“, flüsterte sie und küsste in die weiche Stelle oberhalb meines Jochbeins.
„Penny oder so.“ „Mary Jane“, sagte ich.
„Gisèle.“
„Bloß nicht. Morgan?“
Meine Haut kratzte, meine Knie hatten Grasflecken, Halme steckten im Nylon meiner Shorts und langsam schwand der Schweißgeruch an meinen Fingerkuppen. Ich wartete auf Durchsagen, auf den Schaffner. Wartete auf die kleinen Löcher, die er in meine Fahrkarte knipste. Oder darauf, dass er jemanden beim Schwarzfahren erwischte, zufrieden den Quittungsblock zücken würde, mit willismäßigen Lachfalten um den Mund. Ich wartete, dass irgendetwas passierte, das man jemandem erzählen könnte, der nicht dabei gewesen war. Ich würde es nicht erzählen, wollte es mir selber erzählen, mit Worten, die uns umrahmten, Tim und mich und unseren Tag. Ich wartete auf das Gefühl, das man hat, wenn man ein Rätsel gelöst hat. Wie Mel Gibson, als ihm klar wurde, dass seine Frau alle vor den Aliens retten wollte. Ich blickte mich um, suchte und wartete darauf, das Negativ dieses einen Tages zu finden, das Negativ als Vorstufe zum fertigen Bild, das ich mir in meinem Kopf zu machen versuchte. Ein Bild von mir. Von ihr. Von dem Ganzen. Ich las Schilder mit Strichmännchen, die vormachten, wie man sich zu verhalten hatte, las das Poster einer Sprachschule, schaute nach Handlungsanweisungen, die mir zeigten, was in meinem Leben jetzt zu machen war. Was war als nächstes dran? Ich wartete darauf, dass uns jemand sah. Tim und mich, zusammen in diesem Zug nach Berlin. Jemand, der direkt blickte, dass wir nicht zwei Fremde waren, die zufällig beieinander saßen, wie noch auf dem Klassenfoto auf der Jahrtausendbrücke. Ich dachte an Bruce Wilis, wie er sich als Schakal neue Identitäten schaffte, dachte an Mädchennamen, betrachtete Tim, schaute auf ihre Füße, dachte an ihre Berührungen, sah, wie die Neonlichter des Tunnels die schmalen Konturen ihres Gesichts streichelten.
Vielleicht könnte ich ihre Welt besser verstehen, wenn ich in ihren Schuhen laufen würde.
Ich nannte sie Sandra, Lili, Skyler und wünschte, die Glastür zur ersten Klasse würde sich öffnen und meine gesamte Schulklasse würde genau jetzt an uns vorbei durch den Zug laufen. Miro, Rahel, Mell und die Anderen. Ich wünschte, mein Vater und meine Mutter würden durch den Zug laufen. Herr Dallos, Trainer Leuk, die namenlosen Nachbarn, Saul Goodman.
Ich wünschte, sie alle würden uns sehen. Tim und mich.
Als der Zug in Potsdam hielt, wachte Tim auf. Sie sah mich an, leckte sich um den Mund, dass mich ein feuchter Spuckefilm anglänzte, sagte „Betty.“ Ich musste lachen, sagte: „Sarah J.“ Sie sagte: „Mary-Kate“, schob ihren tätowierten Arm in ihren Rucksack, zog eine Familienpackung Toffifee heraus, riss die Folie ab und steckte sich gleich zwei Stück in den Mund. Ich sah auf die offene Packung, auf das Bild mit den drapierten Karamelltöpfchen und der braunen Schrift. Ich fasste in meine Hosentasche, tastete nach dem spitzen Hut, dem Zauberstab, dem lila Gewandt und hielt Tim die Plastikfigur vor die Nase.
„Fee.“
Katrin Theiner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
"Niveau, weshalb, warum!?" - die mosaik-Lesereise Deutschland
5 Städte, 7 Lesungen, 21 AutorInnen, 3800 Kilometer
Nach der famosen Reise durch Bayern begaben wir uns erneut auf Roadtrip und packen Autorinnen und Autoren ein, um mit Ihnen den Westen, Osten und Norden Deutschlands zu erobern: vom Wohnzimmer bis zum Technoclub, vom Kulturcafé bis zur Buchdisko - und das druckfrische mosaik18 war mit im Gepäck!
-
Mo, Köln, Weltempfänger
"Nein, ich lecke sicher nicht Peters Füße!"
Die erste Strecke war nicht nur die längste, sondern auch die mühsamste. Zwei Stunden Stau und so. Dafür wurden wir in Köln im wunderbaren Weltempfänger von Christoph Danne, Anke Glasmacher und Miriam Berger empfangen.
-
Berlin
Wenn du in Berlin aus dem Auto steigst, die schwere Holztür zur Unterkunft öffnest und dich dahinter ein großgewachsener Herr, einzig mit einem Leopardenfellmantel bekleidet, fragt, ob du "rein willst", bevor dreißig Herren in aufreizenden Lederklamotten an ihm und dir vorbeigehen - dann denkst du dir: Berlin, du kannst so Klischee sein!
-
Di, ORi
"Pizza, Pasta, Spielzeuglaster."
Bärlin erwartete uns: Im ORi trafen wir Matthias - es lasen Miku Sophie Kühmel, Nora Deetje Leggemann und Philipp Schulz mit uns.
Mi, Kater Blau
"Sperrstunde ist ein Austriazismus."
Es gibt den Moment im Leben, an dem man weiß: ok, das ist jetzt wohl der geilste Ort, an dem man je lesen wird... Willkommen im Kater Blau:
-
Der Abend begann mit einer Gesprächsrunde mit Vertretern von Sachen mit Woertern, SuKuLTuR, Metamorphosen und uns. Es wurden die Gemeinsamkeiten und Schwierigkeiten debattiert, ein neues Literaturprojekt zu starten und zu betreiben.
https://www.facebook.com/sachenmitwoertern/photos/a.483837824994073.114331.200967913281067/1137883316256184/?type=3
"Dass digital zu produzieren auch koste, betonte Josef Kirchner von der österreichischen Literaturzeitschrift mosaik, die kostenlos vertrieben wird. Auch in Blogs stecke viel Arbeit, deren Produkt hinterher gratis konsumiert werde. Da liege der Zwiespalt: 'Einerseits will man prinzipiell Niedrigschwelliges produzieren, andererseits aber nicht die Gratiskultur fördern.'"
[zum Beitrag auf Deutschlandradio Kultur]
https://soundcloud.com/user-694573966/podiumsdikussion-der-magazine-metamorphosen-mosaik-sachen-mit-wortern-und-dem-verlag-sukultur
Im Anschluss lasen Jannis Poptrandov, Doris Wirth, Karl Clemens Kübler und Lisa Viktoria Niederberger.
https://soundcloud.com/user-694573966/lisa-viktoria-niederberger
[zu den Aufzeichnungen der übrigen Lesungen]
Do, Buchdisko
Von der Disko in die Disko. Nach dem Acidbogen benötigten wir erstmal etwas Ruhe und zogen uns in die beschauliche Buchdisko in Pankow zurück. Zusammen mit Katrin Theiner konnten wir uns intensiv den Texten widmen und Kräfte für die nächsten Tage sammeln.
Fr, Hamburg, Chavis
Hamburg tat dies, was es am besten kann: ein Sauwetter haben. Wir machten das beste draus und vergnügten uns an der Reeperbahn. (Lesend im Chavis, natürlich...). Auf Einladung der Hafenlesung lasen Elisa Helm, Rick Reuther und Claire Walka. Marko Dinic las spontan die deutsche Übersetzung des anwesenden Palästinensischen Dichters Ghayath Almodoun.
-
Sa, Erfurt, Kunststücke
Auf halben Weg heim liegt Erfurt. Dort startete vor kurzem die Reihe "Kunststücke" - bei der zweiten Auflage der WG-Lesungen waren wir zu Gast. Mit uns lasen Mario Osterland und Peter Neumann. Musik kam vom unglaublichen littlemanlost.
-
So, Salzburg, Atelier du Bureau
"Es gibt so Dörfer, da denkst dir: Zieh aufs Land und verreck!"
Machen wir uns nichts vor: Sieben Tage im selben Auto, im selben Zimmer. Jeden Tag Autofahren, jeden Abend Lesung und Party. Es gibt schlimmeres. Aber wie das all die Rockbands gemacht haben, ohne sich die Schädel einzuschlagen, bleibt uns ein Rätsel. Da tut so ein herzlicher Empfang wie am letzten Abend im Atelier du Bureau gut. Dort kreuzten sich die Lesereisen von uns und von Nico Feiden, der in Salzburg sein neues Buch (findet ihr auch in mosaik18) vorstellt.
Alle Fotos findet ihr hier.
Vielen Dank an Lisa Viktoria Niederberger, Marko Dinic und Peter.W. - und an alle unsere Freunde und Partnerinnen überall, die uns bei der Organisation unterstützt haben. Ohne euch gäbe es keine mosaik Lesereise.
Du willst das mosaik auch in deiner Stadt? schreib@mosaikzeitschrift.at
mosaik-Lesereise Deutschland
5 Städte, 7 Lesungen, 21 AutorInnen, 3000 Kilometer
Nach der famosen Reise durch Bayern begeben wir uns erneut auf Roadtrip und packen Autorinnen und Autoren ein, um mit Ihnen den Westen, Osten und Norden Deutschlands zu erobern: vom Wohnzimmer bis zum Technoclub, vom Kulturcafé bis zur Buchdisko - und das druckfrische mosaik18 ist mit im Gepäck!
Köln
Mo, 11.4., 20:00
Weltempfänger (Venloer Straße 196) - Reihe Hellopoetry!
Wir beginnen gleich mit einem Paukenschlag: Die Reihe HELLOPOETRY! lädt uns nach Kölle - Christoph Danne und Anke Glasmacher, die wir aus mosaik16 und mosaik17 kennen, sind als LokalmatadorInnen mit dabei. Es lesen:
Musik von Miriam Berger
Sei dabei...
Berlin
Di, 12.4., 20:00
ORi (Friedelstraße 8)
"KünstlerInnen jeglichen Alters finden hier eine Plattform, um ihre eigenen kreativen Ideen und Visionen zu entwickeln, umzusetzen und zu präsentieren." - könnte vom mosaik sein, ist aber vom Mission Statement des ORi. "Raum für Raum" heißt es, wenn das eine auf das andere trifft.
- Marko Dinic
- Miku Sophie Kühmel
- Nora Deetje Leggemann
- Lisa Viktoria Niederberger
- Peter.W.
- Philipp Schulz
Sei dabei...

Mi, 13.4., 20:30
im Kater Blau - Acidbogen (Holzmarktstraße 25)
Wenn, dann stilecht! Oben rattert die S-Bahn, unten kriechen noch die letzten Leichen der gestrigen Party raus. Es treffen sich vier unabhängige Literaturprojekte auf Einladung der Sachen mit Wœrtern und stellen sich vor:
- metamorphosen
- Sachen mit Wœrtern
- SuKuLTuR
- und ja: auch wir...
Es liest (je ein/e Verterter*in pro Projekt):
Sei dabei...

Do, 14.4., 20:00
Buchdisko (Florastraße 37) Es darf wieder ruhiger werden. Sozusagen eine Auslockerungsrunde in der gemütlichsten Buchhandlung in Pankow, wo wir auf Katrin Theiner und Tobias Roth treffen.
Sei dabei...

Hamburg
Fr, 15.4., 19:30
Chavis Kulturcafé (Detlev-Bremer-Straße 41)
Und ab geht es nach St. Pauli an die Reeperbahn. Wenn schon Hamburg, dann aber wirklich!
- Gayath Almodoun
- Marko Dinic
- Elisa Helm
- Lisa Viktoria Niederberger
- Peter.W.
- Rick Reuther
- Claire Walka
Sei dabei...

Erfurt
Sa, 16.4., 17:00
Wohnzimmerlesung - Reihe "Kunststücke"
Wir kennen es schon: Nach einer Partyeinheit folgt die Gemütlichkeit. In Erfurt - auf halbem Weg zwischen Hamburg und Salzburg - werden wir in einer WG Willkommen geheißen. In Kooperation mit In guter Nachbarschaft und dem Literatufestival Erfurt lesen:
Musik von Little Man Lost
Sei dabei... -
Salzburg
So, 17.4., 18:00
Atelier du Bureau - "Welcome Back"-Party
Und weil wir nicht genug haben, setzen wir noch ein Heimspiel obendrauf. In gemütlicher Runde gibt es Anekdoten, Wiedersehensfreude und einen Spezialgast, der sein neues Buch mitbringt:
Buchpräsentation Nico Feiden
Sei dabei...
mosaik16 - united in diversity
mit:
- André Patten
- Andrea Weiss
- Andreas Rentz
- Andreas Schumacher
- Camena Fitz
- Carla Hegerl
- Christoph Danne
- Dennis Mombauer
- Hannah Hofbauer
- Hydra
- Irena Habalik
- Josef Kirchner
- Judith Keller
- Kadir Özdemir
- Katharina Kral
- Katie Grosser
- Katrin Theiner
- Lisa Köstner
- Lütfiye Güzel
- Mairinger Lina
- Manuela Varga
- Marko Dinic
- Martin Fritz
- Martin Piekar
- Matthias Engels
- Michael Wolf
- Miku Sophie Kühmel
- Niklas L. Niskate
- Patrick Valouch
- Peter.W.
- Sigune Schnabel
- Simone Scharbert
- Steffen Roye
- Sybille Ebner
ab sofort erhältlich - bestell deine gedruckten Ausgaben
hier zum Download als pdf und eBook
freiTEXT 2014-15 als eBook
Ein Jahr freiTEXT ist vergangen - es wird Zeit für die große Nachlese. Die Anthologie mit allen Texten aus 52 Wochen freiTEXT ist ab sofort als kostenloser eBook-Download erhältlich.
mit Texten von Thomas Mulitzer, Tobias Roth, Andrea Weiss, Sabine F., Magdalena Ecker, Claudia Kraml, Eva Löchli, Andreas Haider, Madlin Kupko, Dijana Dreznjak, Ingeborg Kraschl, Fabian Bönte, Simone Scharbert, Renate Katzer, Jacqueline Krenka, Karin Seidner, Nico Feiden, Sabine Roidl, Sven Heuchert, Veronika Aschenbrenner, Sarah Krennbauer, Philipp Feman, Matthias Engels, Clemens Schittko, Eva Wimmer, Gerhard Steinlechner, Matthias Dietrich, Christine Gnahn, Eva Weissensteiner, Marie Gamillscheg, Satie Gaia, Lina Mairinger, Jonis Hartmann, Philipp Böhm, Lütfiye Güzel, Kerstin Fischer, André Patten, Katrin Theiner, Daniel Ableev, Marina Büttner und Martin Piekar.
freiTEXT | Katrin Theiner - Teil 2
Landschaft zum Verschwundensein (Auszug 2)
Dies ist Teil 2 - für Teil 1 aus der Vorwoche hier entlang.
Ich hatte es dunkel gelassen. Laute Schritte im Flur. Die schrille Stimme der Tante, die Hinweise abfeuerte: Seit elf Stunden, Sportschau, Herztabletten, Waffe weg, Vorstandstreffen. Männerstimmen um sie herum. Hundegebell. Arminius winselte. Sie gingen ums Haus, durch den Garten, über die Beete. Sie gingen weiter über die Felder zum Waldrand. Ihre Taschenlampen warfen weiße Lichtschleifen zwischen die Bäume. Ich zog die Gardinen zu, machte die Nachttischlampe an, operierte meinen Finger mit Nadeln. Ein Holzsplitter tief unter meinem Nagel. Später Polizei. Die Tante weinte, suchte Fotos von dem Herrn Onkel, den eh jeder kannte. Es klopfte. „Jan-Carl? Die Herren wollen dich sprechen.“ Hatte nix gesehen. Keine Ahnung. War nicht da. In der Schule. Hatte Musik an. In der Nacht sah ich meine Eltern im Traum. Wir saßen auf einer Decke im Freibad. Meine Mutter im Bikini, in einem anderen Bikini als die anderen Mütter. Mein Vater mit Lederjacke und Sonnenbrille, ein Bier in der Hand. Ich war nackt, ein hellblauer Schwimmring um die Hüften. Weißes Eis floss über meinen Bauch. Ich hatte schon früh verstanden, dass wir anders waren. Nicht schlechter, anders. Meine Eltern sahen anders aus, ich sah anders aus, hieß anders. Ich mochte das, mochte nicht die dicken Mütter deranderen Kinder, mochte die Rippen meiner Mutter, die langen Finger, die bunten Nägel, die mir Pommes in den Mund steckten, nachdem sie sie kalt gepustet hatte. Mein Vater setzte mich auf seinen Schoss. Mein Po klebte an seinem Bein. Überall Eis. Ich hab’s getan, Papa. Ich hab’s getan. Er strich mir über den Kopf. Is’ gut Junge. Ich muss nach Weiterstadt. Iss dein Eis.
„Komm runter. Ich kann das nicht sehen“, sagte ich zu Olga, streckte meine Hand zu ihr und griff mit der anderen ihren weißen Stiefel. „Hast Schiss, dass ich falle?“, lachte sie, lehnte sich weiter über die Brüstung des Hochstuhls und schaute mich auffordernd an. „Mann, krieg dich ein“, sagte sie. Sie kletterte runter zu mir, biss mir ins Ohr und inhalierte meinen Rauch. „Und? Wo liegt er?“ „Irgendwo dahinten“, sagte ich und schnippste Glut ins schwarze Dickicht. „Kann man jetzt nicht sehen. Zu dunkel.“ „Wie war das, den Alten zu killen? Geil, oder?“ „Will ich nicht drüber reden.“ “Komm. War geil, oder?“ „Ja, geil. War geil. Du bist geil. Lass uns zu dir gehen.“ „Geht nicht. Mein Alter...“
Der Herr Onkel hatte mir zum sechsten Geburtstag ein Sprengnetz geschenkt. „Ich nehm dich mit zum Frettieren“, sagte er, hielt mir die Maschen, in die ich mir einen Fußball gewünscht hätte, vor die Nase und lachte hustend. „Da wird uns das Ungeziefer nicht entkommen, Carl.“ Ich hatte mich im Dickicht verschanzt, traute mich nicht, die Ohren zuzuhalten. Wie hätte das ausgesehen? Ein Jägerkind, dem das Krepieren der Hasen zu viel war. Ich versuchte, mein Trommelfell zu ewegen, Druck zu verlagern, die Ohren innerlich zu verschließen, schaute knapp an meinem Onkel vorbei, wie er vor dem Bau lungerte und durch die Netzmaschen die zappelnden Tiere an den Ohren hielt. Zuhause war der Geburtstagstisch gedeckt. Folie lag über der Spanplatte in der Garage. Handschuhe und Messer, Skalpelle in Bechern, Flaschen mit Säuren. Der fleischige Hasenkörper umgekrempelt, wie eine alte Socke. Die Pfoten steckten noch im Fell. Die seien noch nichts für mich. Unter dem Tisch der Eimer. Der Eimer für die Innereien, an denen ich mich würde bedienen dürfen. Ich wollte verschwinden, aufgelöst sein. Ich wollte, dass er meinen richtigen Namen sagte. Ich wollte weinen, weg sein, wollte kotzen, die Unterhose gegen eine trockene tauschen, schreien. Versager. Wenigstens töten müsstest du doch können.
Sie kam mit zwei Freundinnen, küsste mich nicht, blieb außerhalb meiner Jacke, die Arme verschränkt mit forderndem Blick.
„Sag’s ihnen, J.C.! Sag ihnen, dass du den alten Wedekind umgelegt hast.“
„Hab ich.“
„Hast du nicht. Mein Alter und die anderen Bullen haben heute Morgen seine Leiche aus dem Wald gezogen. Kopfschuss.“
„Ja, war ich.“
„RAF oder was? Man Olga, der hat dich voll verarscht.“
Die Ellenbogen verschränkt gingen sie lachend weg, schauten sich nicht mehr um.
Halali, der Herr Onkel ist tot. Männer im Haus. Stiefelschritte. Stimmen. Suizid. Gewehrträger stehen Spalier. Dazwischen der helle Sarg aus Fichte. Das Jagdhorn wird geblasen. Es wird salutiert. Die Tante dahinter, wirft Sand, eine Rose. Und ich, ein Freigänger, weil der Wächter tot war. Er und ich, nicht länger verschwunden.
Katrin Theiner
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Katrin Theiner - Teil 1
Landschaft zum Verschwundensein (Auszug 1)
Der Herr Onkel war tot. Den Mund voll brauner Fichtennadeln, den Bart auch, als hätte er einen zu großen Löffel Suppe in sich hineingeschaufelt, bei dem die Nudeln zwischen seinen Lippen wieder rauskamen. Oder als hätte er vor Hunger seine eigenen Bäume gefressen und war an Rinde, Harz und Zapfen erstickt. Die Tannenschonung hatte angefangen ihn zu beerdigen, warf Sand auf seinen muffigen Kompostsarg aus Ästen und Laub, aber bevor der Wald den Grabstein setzen konnte, den letzten Spruch aufgesagt hatte, und der Herr Onkel hätte es verabscheut, das Gefasel um Himmel, usw. usf., hätte geschrien, mit Gott und so hätten nur Arschkriecher was am Hut, und bevor die Bäume hinter der Lichtung an der Grabstätte für immer für Ruhe sorgen konnten, hatte ein Waldarbeiter seine Leiche in moosgrünen Gummistiefeln im Unterholz entdeckt.
Seit er verschwunden war, mit Hut, Stiefeln, Flinte und Korn, hatten mich die hellbraunen Erdklumpen seiner fehlenden Schuhsohlen angeglotzt. Wenn ich abends lautlos reinschlich, den Schlüssel an den Nagel in der Diele hing, stierten sie von der Fußmatte zu mir, als wollten sich mich warnen. Als wären sie dabei gewesen. Aus den Kopfhörern unter meinem Hoodie kam ihr und mein Lied. Dabei ein Schauer wie kriechende Tiere auf meinem Rücken. Sonst hörte ich nichts, kaute schnell den Rauch unter das Kaugummi und blickte auf seinen Dreck am Boden. Als wollte mir der Herr Onkel jetzt noch zeigen, was er von mir hielt. Als wollte er mich daran erinnern, nicht in Freudentränen auszubrechen, die ich unter meiner Kapuze hätte verstecken können oder als Trauertränen würde tarnen müssen. Halt dich zurück, bis man mich gefunden hat, elender Flegel, Sohn eines Verbrechers, und vergiss heute mal, dass du immer alles vorher weißt, sagte mir der pulverige Dreck seiner Füße und zerstaubte in der Rille zwischen Matte und Tür.
Die Tante, nur Tante, ohne Frau davor, trug brav ihre Schürze und kochte weiter die drei Portionen. Sie wollte angerichtet haben, wenn der Herr Onkel nach Hause kam. Eine Portion für sich, die sie nicht anrührte, eine Portion für mich, eine Portion für den Herrn Onkel. Steckrübeneintopf, Hühnerfrikassee, Grünkohl mit Mettendchen, Rouladen, die Arminius aus Mitleid, weil die Tante in seinem Winseln Trauer vermutete, mit Senf und Gurken fressen durfte. Nein, nein, wenn das der Herr Onkel wüsste. Mit erhobenem Haupt streute die Tante Sand auf die Platten vor dem Haus; er hätte es so gewollt, hätte gewollt, dass sie blieb, wer sie war, Haltung bewahrte, Contenance, Contenance, mit gespanntem Haar über den Ohren und straffer Knotenkontur am Hinterkopf, dass sie die Nachbarn über den Zaun grüßte, sich nichts anmerken ließ und man ihren festen Schritt weiter auf dem Gehsteig zur Bushaltestelle hörte.
„Hast’n aufgeknüpft, oder was? Du Freshmaker.“
„Fresse man.“
„Haste, ne? Hast ihm schön das Fell über die Ohren gezogen. Schön mit Messer und Gabel seine fette Wampe zerteilt.“
„Mann Ivo, halt’s Maul. Siehst doch, dass Terror traurig ist. Jetzt, wo der Alte weg ist.“
„...und Olga ihn nicht ranlässt.“
„Mann, fickt euch. Nennt mich nicht so, man. Und kein Wort über Olga. Verpisst euch doch.“
„Mann J.C., Mach dich mal locker, war nicht so gemeint. Warn Witz. Komm. Stunde fängt an.“
Eiszapfen fingen an, die Fenster zu vergittern. Frostiges Unkraut wucherte über die Glasscheiben, verkleinerte den Blick zum Waldrand. Die Tante lief umher durch den toten Waldzoo, den der Herr Onkel im Haus aufgebaut hatte, drehte ihr angelaufenes Eheschmuckstück um die zu groß gewordene Haut ihres Ringfingers, als vermute sie darin einen Kompass, der sie geradewegs zu der letzten Ruhestätte ihres Mannes führen würde und mit der letzten Ruhestätte meinte sie nicht sein Grab. Sie meinte vielmehr einen hölzernen Waldverschlag oder einen Hochstuhl, in dem sie den Herrn Onkel selbst nach Einbruch des Winters und drei Wochen nach seinem Verschwinden sturzbesoffen vermutete. Ihr Gesicht sah gewachst aus, gelblich und blass und traurig, ohne Tränen. Die gab’s nicht. Sie registrierte nicht den Geruch von Rauch in meinen Sachen, mied mein Zimmer, lief unsichtbar durch die unbeheizten Räume, eins geworden mit dem Gedanken, fern der Blicke und wenigstens in ihren eigenen vier Wänden, nicht mehr sein zu müssen als eine aufrechte, absterbende Hülle. Der grüne Wollpullover des Herrn Onkel, den er vor seinem Verschwinden in der Küche abgeworfen hatte, umschlang die Rückenlehne an seinem Platz, zeigte Haltung, die Haltung eines Jägers im Ruhestand, er hielt seinen Rücken gerade, den Rücken eines Kriegsveteranen, eines Waidmanns, eines Präparators, eines Vorstandsvorsitzenden, eines Frühschoppers, eines Schützenkönigs, eines ehrenwerten Bürgers, der sich nie hat unterkriegen lassen, selbst als der eigene Sohn, dieses Pack von einem Mörder, ihm die eigene Brut hinterließ und das Ansehen der Familie beschmutzt hatte. Spuckefarbene Hirschhornknöpfe blitzten mich an. Ich wusste, der Pullover von dem Herrn Onkel würde lange dort hängen bleiben, wie eine Fahne auf Halbmast, die niemand hinablassen würde.
Das Essen der Tante verschlang ich im Akkord. Bloß nicht länger bei ihr sitzen, bloß keinen Verdacht auf mich lenken. Der Blick auf das unberührte Set mit dem Bauernkalender auf dem leeren Platz von dem Herrn Onkel, ließ mich zum ersten Mal denken, ob es in all dem Scheiß nicht vielleicht doch sowas wie einen Gott geben könnte. Denn wie sonst könnte es denn sein, dass ausgerechnet mir so ein Glück, so ein unvorstellbares Glück an Gerechtigkeit passieren konnte, das der Herr Onkel weg war, verreckt war. Er war nicht mehr die gelbgrauen Zahnkronen, die zuerst die Haut der triefenden Fleischkeulen abschälten, um sich dann fest im unteren Gänsegewebe zu verbeißen und es in einzelnen Fasern zerteilt laut schluckend mit Bier hinunterzuspülen. Er war nicht mehr die Tageszeitung, die auf Arminius’ gekrümmtes Hinterteil hinabdonnerte, wenn er versuchte, Krümel unter dem Esstisch aufzulecken. Er war nicht mehr der Schweiß der Tante, wenn sie seinen fetten Arm um ihren Hals schwang, ihn fest im Gürtel unter die Hüfte griff und gegen ihr neues Gelenk gepresst die Treppe hoch ins Schlafzimmer zog. Er war nicht mehr das Lallen, das er wieder und wieder zwischen meine Tapeten warf, meine Mutter sei eine dreckige Nutte gewesen, die einen elenden Terroristen wie meinen Vater nur verdient hätte, und ich, nach einem Dickicht suchend, in das ich mich hätte verkriechen können, wäre längst verreckt, wäre er nicht gewesen, der Herr Onkel. Er war auch nicht mehr im Schuppen zwischen Fell und Holzwolle, Nadeln, Kleber, Fäden und den Messern, mit denen er die Kadaver der frischtoten Tiere aufschälte, sie abbalgte und ausnahm, bis alle Organreste ausgekratzt waren. Er konservierte auch nicht mehr, wirkte nicht mehr dem Fettfraß entgegen, polsterte kein Hautgewebe mehr mit Füllstoff auf und gestaltete keine putzigen Nagetierkörper mehr, in dem er ihre zerteilten Gliedmaßen neu zusammensetzte und sie mit Draht fixierte. Das alles hatte er nun selber nötig. Er war auch nicht mehr das Staubtuch, das die Geweihe putzte, die endlos aufgereihten Totenschädel an der Holzvertäfelung, in der der Bock leise klopft. Ich stellte mir seinen aufgetriebenen Kopf vor, wie er zwischen seinen Trophäen auf einem Holzbrett von der Wand hinabschaut. Hutlos. Das rote Bluthochdruckgesicht mit Schaumstoff ausgestopft, seinen tabakgelbe Schnäuzer, ja den, einfach abrasiert, das schüttere Haar, das früher fuchsrot war, ungekämmt, pomadenlos. Ohne Form. Formlos. Die Tante hatte geschwärmt von ihm, dem Herrn Onkel, hatte gesagt, das Jägergrün und sein rotes Haar, da habe sie nicht wiederstehen können, als sie noch jung war. Meine Trophäe. Er war jetzt meine Trophäe.
Wir waren zu einer Jacke geworden. Zu einem vierarmigen Daunenknäul, in dessen Ärmeln ich ihre zarten Finger hielt. Wir waren ein dickes Winterding an der Schule. Sie und ich. Die große Sensation. Wir waren zu einer Zigarette, zu einem Kaugummi geworden. Zu einem minzigen Stück Gummi, das sie mit ihren spitzen Fingern zwischen meinen Schneidezähnen hervorzog, eine Hälfte abriss, in ihren Mund steckte und die Arme wieder zwischen meinen verschwinden ließ. Ich an Graffiti gelehnt, sie davor, an mir dran, den Reißverschluss meiner Jacke auf ihrem Rücken. In meiner Nase ihr süßes Parfum mit Lolligeruch, ihr Haar an meinem Kinn. Meine neue Welt, mein Versteck, mein Verschwundensein, ein anderes Verschwinden, meine Luft voll von ihr, von ihrem Geruch, den ich auftrinken wollte.
„Was is jetzt?“, saugte Olga gegen mein Hals. Ein Kopfhörer in ihrem, der andere in meinem Ohr. Unser Lied. Wir froren.
„Womit?“
„Deinem Onkel?“
„Nix.“
„Ist er tot?“
„Klar man. Klar ist er tot.“
Ihr Blick zwischen einem dunkel geschminkten Wimpernkreis. Sie küsste mein Kinn, meinen Hals, küsste sich rauf zu meinem Mund, schob ihre Hüfte nah an meine, öffnete mit ihrer Zungenspitze meinen Mund, schmeckte nach Lip Gloss, ihr Kaugummi suchte meins, ich bekam beide Hälften, kaute weiter.
„Woher willst du das wissen? Is doch keine Leiche da.“
„Klar is die Leiche da. Im Wald. Irgendwo. Ich weiß wo.“
„Glaub ich nicht.“
„Glaubst was nicht?“
„Dass du weißt, wo der liegt.“
„Klar weiß ich. Ich war da. War dabei. Zeig ich dir.“
„Wie, dabei?“
„Hab ihn umgelegt.“
„Haste nicht.“
„Hab ich.“
„Will ich sehen.“
Das ist der erste Teil - Wer Teil zwei des Textes sehen will, muss sich auf kommende Woche gedulden.
Katrin Theiner
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at