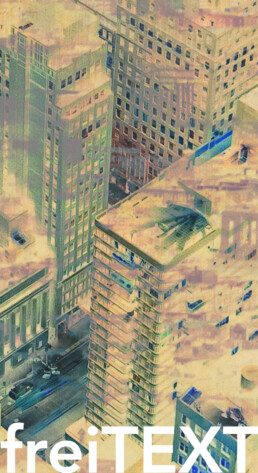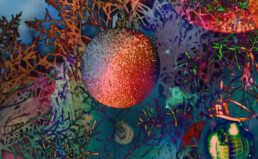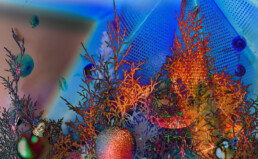freiTEXT | Tabea Baumann
Fünfzehn mal drei
Ich liebe dich
sage ich, und die Abwesenheit einer Antwort sagt mir alles. Ich nehme einen Schluck Tee, und verbrenne mir die Zunge, obwohl er schon seit Stunden in der Tasse ist.
Ich liebe dich
sagt sie, und küsst mich und für einen Moment bin ich König der unendlichen Weiten innerhalb einer Nussschale. Dann geht sie und die Nussschale schließt sich, wird wieder klein, bis ich mich nicht mehr bewegen kann und mir wünsche, eine Krähe würfe mich auf die Straße unter die Reifen eines silbernen Mercedes.
Ich liebe dich
brüllt er, und schlägt noch einmal zu, jede Silbe eingehämmert in die rötlichbräunlichgraue Masse, die einmal ein Gesicht war. Er weint dabei.
Ich liebe dich
tippt sie, und wartet darauf, dass die Ampel wieder grün wird. Sie schickt ein Herz-Emoji und fragt sich dabei, ob es ihrer Freundin auch aufgefallen ist, dass der Whatsapp-Feed nur aus Emojis und der Frage nach dem Abendessen besteht.
Ich liebe dich
flüstere ich, und denke dabei an eine andere.
Ich liebe dich
schneidet sie dem Baum in die Rinde, und verbringt dann den Rest des Tages damit, das Harz vom Messer zu kratzen. In zwei Jahren wird der Baum gefällt sein und ihre Freundin wird den Schlagzeuger geheiratet haben, über den sie sich gemeinsam lustig gemacht haben.
Ich liebe dich
denkst du, sagst es aber nicht, weil in jedem Paralleluniversum eine Version von dir existiert, die mutig ist, aber hier und jetzt gibt es nur dich.
Ich liebe dich
lacht er, und streichelt den Bauch seines Freundes, genau unter dem Nabel, wo seit einigen Wochen die ersten grauen Haare wachsen. Der Bauch ist weich und die Sonne lässt das Silber glitzern, als wäre es kostbar.
Ich liebe dich
keuchst du, und ich schaue an die Decke, die der Vormieter schlecht gestrichen hat und frage mich, warum es heute im Supermarkt keinen Fenchel gab.
Ich liebe dich
sagt der Mann am Nachbartisch zu seiner Tochter, vielleicht ist es aber auch seine Freundin. Sie lächelt ihn abwesend an und schraubt den Salzstreuer auf und zu, auf und zu, auf und zu.
Ich liebe dich
murmelt er, schon fast eingeschlafen, und wirft seinen Arm über dich, und du fühlst dich wie eine Eiche, die langsam vom Efeu erstickt wird. Dem Efeu vor dem Fenster ist das egal, der wächst weiter.
Ich liebe dich
sagt das Mädchen zu ihrer Freundin, die lacht und ihr ein Gänseblümchen in den Mund steckt, den bitteren grünen Stängel voran.
Ich liebe dich
gesteht der junge Mann der Barista, die ihn mitleidig ansieht und ihm seinen Kaffee in die Hand drückt. Er geht, und wirft den Becher vor der Tür in den Müll.
Ich liebe dich
sagt der Engel, und die alte Frau lächelt. Der Engel sieht aus wie ihr Mann, mit Flügeln aus Neonlicht.
Ich liebe dich
sage ich. „Ich dich auch“, sagst du.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Simon Probst
Der Mensch verabschiedet sich aus dem Holozän
Ich forsche an einem Institut für Abschiede von einem alten Planeten. Um einen Eindruck von meiner Arbeit zu geben, erzähle ich am besten eine der Geschichten, die ich sammle: Am Dienstag, dem fünften September 2023, wird ein Sarg aus Eis von Trägern in schwarzer Kleidung, mit Bergschuhen und verspiegelten Brillen gegen die Höhensonne im schönen Sommerhimmel, am österreichischen Großglockner beigesetzt. Symbol für die Pasterze, Österreichs größten Gletscher, der hier zu Grabe getragen wird. Ein katholischer Bischofsvikar und eine evangelische Pfarrerin halten gemeinsam die Zeremonie auf der Franz-Josefs-Höhe ab. Begleitet werden sie von vier Blasmusikern. Die traurige Melodie legt sich wie traumhafte Blumengebilde um das Eis. Im Hintergrund steht schweigend eine Bergkette, schmutziges weißes Haar auf den alten Häuptern. Fast könnte man meinen, sie halten Hüte in den gefalteten Händen.
Da es sich hier um einen Bericht und kein Märchen handelt, liegt in dem fast gläsernen Sarg nicht Schneewittchen. Niemand schlummert darin und wird durch ein Stolpern wieder zum Leben erweckt. Dabei ist hier gutes Stolpergelände. Die Auferstehungschancen, im Märchen stünden sie gut. Doch der Sarg ist leer. Und leer heißt, dass dort im Eis, anders als im Gletscher, überhaupt kein Raum ist, in dem jemand liegen und die Zeit überdauern könnte. Folgerichtig gibt es auch kein Scharnier, keinen Deckel, nur die maschinell geformte Eismasse.
Tatsächlich ist noch niemand gestorben, zumindest nicht hier. Diese Beerdigung besiegelt den Todesfall nicht, eher kündigt sie ihn an. Die stolze Pasterze – man sieht sie hier von der Franz-Josefs-Höhe aus – ist geschrumpft, viele Meter jedes Jahr. Und Gletscher sind nicht für immer Gletscher. Wenn sie eine bestimmte Größe unterschreiten, wenn sie sich nicht mehr bewegen, wenn ihr Eis nicht mehr mit dem Rhythmus der Jahre pulsiert, sich ausdehnt und zusammenzieht, dann sind sie keine Gletscher mehr. So die wissenschaftliche Definition. Sie bestimmt, ob Eis lebt. Die Pasterze ist noch ein Gletscher. Die Beerdigung ist eine vorgezogene. Das Ritual soll aufrütteln, warnen, prophezeien.
Die Vorwegnahme des Abschieds begegnet mir überall. Oft auch unter anderen Vorzeichen. Für meine Mutter ist es das erste Jahr, in dem sie nicht mehr um die alte Erde trauert. Nach einer nicht enden wollenden Periode des Unglaubens, des Aufbegehrens, der Wut und Verzweiflung über die Wandlungen und Verluste in der Natur ist sie jetzt ruhiger. Sie sagt, sie hat getrauert und ihren Abschied genommen. Sie gesteht ein, dass ihr die Idee des Abschieds in diesem regenreichen Jahr leichter fällt. Seine Vorwegnahme ist keine Mahnung, sondern ein Abschließen. Möglicherweise eine Vorbereitung auf die kommende Erde.
Bis vor kurzem lagen die Folgen des menschengemachten Klimawandels scheinbar noch in einer fernen, fantastischen Zukunft. Jetzt liegen manche ihrer Verhängnisse schon in der Vergangenheit. Denken wir, es wäre möglich, mit den fortwährenden Verlusten fertigzuwerden, wenn wir sie in aller Form betrauern? Aber sind wir nicht in einen andauernden Abschied verwickelt und schwanken entsprechend zwischen überwältigenden Gefühlen, unangenehmer Berührung, Überdruss und dem Wunsch, mit dieser Peinlichkeit endlich abzuschließen?
Meine Forschung besteht in der konstanten Beobachtung des Abschiedszustands. Dafür muss ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit schenken und gleichzeitig die ihn begleitenden Gefühle auf Abstand halten. Ich bin ein Archivar der Trauer, angestellt, um die Verluste zu dokumentieren und Berichte über den menschlichen Umgang mit diesen Verlusten zu verfassen. Diese Aufgabe verlangt Ausdauer und verbietet die Verausgabung in einem ekstatischen Moment. Katharsis wäre kontraproduktiv.
Betrachtet man über einen längeren Zeitraum die neuartigen Formeln und Rituale kollektiven Trauerns, stellt man fest: In unserer Kultur gibt es einen überaus ansehnlichen Abschiedskarneval. Kein Zweifel, dass wir uns von den Gletschern und dem polaren Eis verabschieden. Wir halten ihre letzten Reste auf Fotos fest, in Erzählungen, in Archiven. Seit mehr als zehn Jahren wird am 30. November ein internationaler Gedenktag für ausgestorbene Arten und Lebensräume begangen. Im Überfluss Denkmäler, Rituale, Trauergedichte, Verlustverzeichnisse, eine Erinnerungskultur mit dem dazugehörigen Ernst, Pathos und Theater. Während wir mit fast schon obszöner Gefühlsseligkeit der alten Erdordnung Lebewohl winken, wartet die alte und neue Gesellschaftsordnung, ewiger als das Eis, in der guten Stube, wo sie uns zum Leichenschmaus empfängt. Es ist das Wechselspiel, die spezifische Komposition und Mixtur von vollzogenen und nicht vollzogenen Abschieden, das bestimmt, wer wir sind.
Das symbolische Ritual am Großglockner war nicht das erste für einen Gletscher abgehaltene Trauerzeremoniell. Bereits 2019 trauerte Island um den Verlust des mächtigen Okjokull-Gletscher. Hier war es ein tatsächlicher Abschied und kein vorweggenommener. Der Ok-Gletscher hatte seinen Status als Gletscher verloren, hatte im Sterben große Flächen lange bedeckten Steins freigelegt und war zu einer unzusammenhängenden, fleckigen Eisschicht geworden, die manche als den Leichnam des Ok betrachteten – geschrumpfte, leblose Überreste, vom Zerfall entstellt. Aber sie erinnern noch an den Lebenden.
Als Mahnung wurde auf einem ehemals von ewigem Eis bedeckten Felsen eine Bronze-Tafel angebracht, die auf Isländisch und Englisch die folgenden warnenden Worte trägt:
Ein Brief an die Zukunft
Ok ist der erste Gletscher Islands, der seinen Status als Gletscher verliert. In den nächsten 200 Jahren werden ihm all unsere Gletscher folgen. Dieses Mahnmal bezeugt, dass wir wissen, was passiert und was getan werden muss. Nur Du, zukünftiger Leser, weißt, ob wir es auch getan haben.
August 2019
415 ppm
Dem Trauerzug und der Enthüllung der Tafel wohnten über hundert Menschen bei, darunter die damalige isländische Premierministerin Katrín Jakobsdóttir und die ehemalige UN-Menschenrechtskommissarin Mary Robinson. Das ganze hatte den Anschein eines Staatsbegräbnisses. Trotzdem entstanden in der Berichterstattung immer wieder Unsicherheiten, um was für ein Zusammenkommen es sich hier handelte. War das eine künstlerische Performance? Eine symbolpolitische Handlung? Eine neue Form von zugleich wissenschaftlichem und animistischem Totenkult? Eine Erinnerung an zukünftige Tote?
In einem Buch mit dem Titel In den Gletschern der Erinnerung aus dem Jahr 2020 sammeln zwei Autoren literarische Zeugnisse von Gletschern aus den letzten drei Jahrhunderten, darunter Aufzeichnungen von so illustren Persönlichkeiten wie Lord Byron, Mary Shelley, Hans Christian Andersen, Mark Twain, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Max Frisch und Paul Celan. Sie alle waren Gletschern begegnet und hatten über sie geschrieben. Das Buch ist ein poetisches Gletscheralbum und eine merkwürdige Schwelle: Außerhalb des Buchs existiert die eisige Welt noch. Aber nur gerade so. Zukünftige Leser*innen werden In den Gletschern der Erinnerung den Moment markiert finden, da im Verschwinden begriffen war, was sie nicht mehr kennen.
Ich mache meine Arbeit, wie ich jede andere Tätigkeit ausüben würde: akribisch, gewissenhaft und mit Freude an der Entdeckung von kuriosen Begebenheiten. Die Verluste und meine Aufzeichnungen von ihnen sind gefragt. Aber in einem regelmäßigen Rhythmus, alle anderthalb Wochen etwa, werde ich traurig. Dann kann ich mich nur noch langsam bewegen und nicht mehr denken. Ich gehe spazieren und in diesem Jahr lasse ich mich vom Regen trösten. Obwohl das Wetter verrücktspielt. Manchmal schlägt es drei Mal am Tag um. Von Wetterumschwüngen kann nicht die Rede sein, eher von einem Luftdruck-Karussell, einer unberechenbaren atmosphärischen Launenhaftigkeit. Trotzdem: Es beruhigt mich, im Wetter zu sein, seine Bewegungen genau zu verfolgen. Ich kann es kaum aus den Augen lassen.
Wenn ich mich schließlich erschöpft in meine Wohnung zurückziehe, verkrieche ich mich ins Bett und höre Holocene von Bon Iver. Der Song ist nach einer Bar in Portland benannt. Und nach der geologischen Epoche, die wir beenden. Das Lied entstand in einer Winternacht, an Heiligabend, um genau zu sein, auf einem späten Spaziergang. Menschenleere Straßen, meilenweit keine Autos, das Kommen eines Schneesturms in der Luft, Inseln aus Eis auf den Straßen. Plötzlich passt alles zusammen, der Ort, die Zeit des Jahres, existentielle Erleichterung, Demut, das Gefühl, dass die Landschaft, die Stadt, die Luft den Song geschrieben hat. In meinem müden Kopf wiederholt sich immer die eine Stelle: You fucked it friend, it’s on its head, it struck the street. Das bringt es auf den Punkt, fühle ich, obwohl ich gar nicht weiß, was ‚it‘ ist. Bleibt noch etwas zu sagen? Lebewohl Holozän. Es waren gute 11.700 Jahre. Verzeih.
Mit zwei Freunden tausche ich mich in einer Chat-Gruppe über den Tod aus. Sie heißt Don’t bury the Dead. Darin Bücher zum Tod, Ausstellungen zum Tod, Podcasts zum Tod. Einer der Freunde ist überzeugt, dass es falsch ist, seinen Frieden mit dem Tod zu machen. Ich schicke ihm zwei Verse von Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night. / Rage, rage against the dying of the light. Der Freund reagiert mit einem brennenden Herz. Auf Wanderungen schreiben wir die Verse in Gipfelbücher.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jane Stone
Kontakte
Charlotte rauft sich die Haare. Ihr Kinn juckt, wo sich heiße Tränen treffen. Unter ihrer Straßenlaterne beginnt sie, die Schlaglöcher vorm Restaurant zu zählen. American Bar & Grill, est. 1990. Hat drinnen überhaupt jemand gemerkt, dass sie abwesend ist? Schon verzählt. Nochmal von vorne. Der Shot Whiskey gegen die Nervosität und die Zurückweisung brennen gemeinsam. Jeder Augenschlag verdoppelt das Dröhnen in ihrem Schädel. Warum kommt Viktoria nicht nochmal heraus? Mehr wehtun kann sie Charlotte nicht. Wieder verzählt. Es hört nicht auf, Dezember zu sein. In der Hocke zittern ihre Beine. Heute Morgen frisch rasiert für ein schreckliches Kleid. Die Verkäuferin hat es ihr für zu viel Geld aufgedrängt, weil sie ihre unsicherste Kundin hasst und –
Charlotte stößt einen Schrei aus. Etwas schlängelt sich ihre Wirbelsäule hoch, bohrt sich mit einem Stich in ihrem Hinterkopf. Schlagartig steht ihr Körper und läuft mit wackeligen Schritten nach Hause.
Komplette Überforderung. In den ersten Minuten des Menschseins spüre ich jedes Gramm Körpergewicht. Massen an Bewegungen erschlagen mich fast. Allein die Augen umgeben das Prickeln tausender Muskelfasern. Blinzeln nicht vergessen. Wie kann die Nacht hier so grell sein? Man sieht nicht mal die Sterne! Grade prasseln all die körperlichen Instinkte auf mich ein, die ein Mensch zu ignorieren lernt. Das Bedürfnis, fremde Dinge in den Mund stecken. Zu kreischen, bis einem die Luft ausgeht. Zu starren. Zu sabbern. Ich hätte mir die Nase aus dem Gesicht gerieben, wenn ich sie eben nicht ausgeblendet hätte. Ganz tief im Gehirn habe ich mich eingenistet. Dieser wabblige Klumpen triumphiert über die körperliche Hülle.
Am Tag danach wird mir die Schwere meiner so spaßigen Spontanentscheidung bewusst. Unter der Schwerkraft ist alles anstrengender. Die Müdigkeit verschwindet nicht. Der erste Muskelkater schmerzt unaufhörlich. Alles lässt mich daran zweifeln, das für einen Menschen Freude drin ist. Zumindest ein Glück: Es ist Samstag. Dieser träge Körper muss nirgendwo hin. Auf dem Wohnzimmerteppich liegt es sich kratzig. Seit gestern ist das hier meine winzige Wohnung. Eine Ruine aus Staubfäden und dunklen Fusseln finde ich unter der Kommode. Darin lebt eine tote Fliege, die mich bemitleidet. Ohne mein Zutun schlägt das Muskelgedächtnis zu. Handy in meiner Hand. Instagram öffnen. Scrollen bis zum ersten Foto dieser einen blonden Frau. Double tap. Viktoria da. Rotes Herzchen. Viktoria dort. Familienfoto mit Geschwistern, Weihnachten mit hässlichen Pullovern. Grübchen. Warte, was mache ich hier? Die Finger wehren sich, aber mit etwas Nachdruck ist die App gelöscht. Kurz ringe ich mit den Überresten eines Verlangens, dann erkläre ich mich zum Gewinner.
Letzten Juni führte der Chef eine blonde Frau in den Pausenraum, ein höfliches Lächeln in ihrem glühenden Gesicht. Grübchen.
„Ich bin die neue Kollegin, Viktoria. Schön euch alle kennenzulernen. Ich freue mich schon auf gute Zusammenarbeit.“
Charlottes Gedanken rannten ihr davon: Wenn diese Frau hetero ist, werde ich zum schönsten Mann der Welt. Wenn sie nicht an Liebe glaubt, will ich ihre engste Freundin werden. Du bist perfekt. Ich liebe dich.
Fast ließ Charlottes Zunge diesen Eifer in die Welt hinaus. Schnell versteckte sie ihren Mund hinter ihrer Kaffeetasse. Ihr Blick blieb so lange auf Viktoria, wie ihr Schamgefühl es zuließ. Jede Millisekunde genoss sie, kam aus dem Schmunzeln nicht heraus.
Ein Montagmorgen, 7 Uhr. Bequemes Bett. Kein Herzinfarkt oder epileptischer Anfall im Schlaf. Vielleicht sogar ein guter Traum, den ich längst vergessen habe. Jeder Tag überlebt ist ein Erfolg. Ich sollte diesem Körper applaudieren, stattdessen strecke ich meine Hand in Richtung des offenen Fensters. Eine kalte Brise umspielt meine Fingerspitzen. Der frische Geruch der Atmosphäre umarmt mich. Dieser Fetzen Himmel ist blauer als alles, was ich je wahrnehmen durfte. Krähen hallt durch die Straße. Frage und Antwort, hin und her. Letztes Wort in drei tiefen Tönen. Argument beendet. Nur noch ein sporadisches Rauschen von Autos. So fühlt sich wohl der Frühling an. Genau dafür bin ich ein Mensch geworden.
Sonnenstrahlen brauchen acht Minuten, bis sie auf die Erde treffen. Nur eine Kleinigkeit müsste dabei schiefgehen und ich könnte nicht das tiefrote Gewand der Frau wertschätzen, die neben mir sitzt. So viele Gesichter. So viele Orientierungspunkte, an denen wir vorbeifahren. Wie schön Busfahren zur Arbeit sein kann. Die Strecke hat die perfekte Länge, um entspannend zu sein. Der Bus schnurrt unter meinen Füßen. Ich schließe kurz die Augen, sauge das Geräusch ein, bis es verstummt. Nächster Halt. Eine blonde Frau steigt ein. Seit wann fährt Viktoria diese Strecke? Sie hat die Fähigkeit meinem Körper Gedanken zu entwenden und um sich herum kreisen zu lassen. So unangenehm. Den Platz in diesem Kopf brauche ich für mich allein. Ihre Augen blicken in meine. Jede Alarmglocke klingelt. Schnell wende ich mich ab.
Stille im Pausenraum. Nachdem ich die nachlässigen Krümel der Kollegen weggewischt habe, lehne ich an der Theke. Langsam gewöhne ich mich an den Kaffee. Die Tasse wärmt angenehm meine Hand. Der Koffeinkick ist nur ein Bonus. Etwas bringt meine Nase zum Rümpfen.
„Du rauchst wohl immer noch in der Mittagspause.“
Viktoria zieht das Pflaster ab: „Charlotte, gehst du mir mit Absicht aus dem Weg?“
Meine Gegenfrage: „Ist das ein Problem?“
„In letzter Zeit bist du irgendwie… anders.“
Viktoria steht am anderen Ende des Raums, Rücken zum Kühlschrank, in dem immer jemand was vergisst. Ein Schritt Abstand zwischen uns und ihr Blick bohrt dennoch.
„Ich bin eine neue Charlotte. War noch nie glücklicher.“
„Es tut mir leid… wegen dem Korb bei der Weihnachtsfeier“, sprechen Viktorias Schuldgefühle.
So gut es geht verhandle ich für eine Charlotte, die ich nur aus Impulsen kenne:
„Nicht deine Schuld. Um ehrlich zu sein: Als ich dich zum ersten Mal draußen rauchen gesehen habe, war ich schon etwas weniger verliebt.“
Ein Schatten fällt über Viktoria.
„Irgendwie tut es weh, das zu hören. Also war es keine richtige…“
„War nur in die Idee von dir verliebt.“
Eine Idee, die längst zum Wohle der Menschheit begraben wurde. Eine Lücke, in die ich schlüpfen konnte. Viktoria gebührt all mein Dank.
Ihre knappe Antwort: „Dann ist es wohl so.“
Warum klingt sie nicht erleichtert?
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Lina Leonore Morawetz
Am Straßenrand
Einsamkeit ist ein angelsächsisches Konzept. Wenn du in Mexiko City die einzige
im Bus bist und jemand einsteigt, dann wird er sich nicht nur neben dich setzen,
er wird sich an dich anlehnen.
— Lucia Berlin, Albern, wer da weint
Der Fahrer blickt aus der Dunkelheit heraus — es gibt keine Haltestellen. Es gibt nur Handzeichen, die Türen stehen immer offen. Seine Sinne täuschen ihn manchmal, er beugt sich zum Lenkrad, sein schwerer Körper vor dem Fenster. Seine Augen glänzen. Sein Bus steht an der roten Ampel. Diese kleinen Busse sind winzig und riesig, im Rasen wanken sie. Behäbige Dampfer. Und die Fahrer sind immer in Eile, sie müssen fünf Millionen durch die Stadt bringen. Unten Asphalt. Oben die Bäume. Gummibäume, und Stromkabel wie langwieriges Haar. Ein Lenkrad wie ein Lastwagen. Richtung Osten. Richtung Westen. Fünf Millionen Handzeichen. Aber heute ist sein Bus noch leer. Mit glänzenden Augen sucht er den Straßenrand ab.
*
Der Bus steht vor ihm an der roten Ampel. Die Luft war noch frisch. Es wurde eben hell. Vier Pesos, ertastet in der Jackentasche. Er sieht sich um. Direkt vor ihm. Die Luft frisch. Er sieht sich nochmal um. Nur einen Schritt. Warum nicht. Hineinspringen in diese Tür, die sich, immer offen niemals schließen wird, die niemals hält. Es gibt keine Haltestellen, nur Handzeichen. Vier Pesos in der Tasche, ertastet.
In der Jackentasche hält seine Faust an den Münzen fest. Die Luft ist frisch, er atmet tief, füllt seine Lungen mit Vergewisserungen. Es ist nicht mehr Nacht, sagt er sich, die Nacht ist vorbei. Helle Musik von der Tanke. Er klimpert die vier Pesos. Er sieht sich um. Die Tanke ist leer. Das Victoria schon voll. Es duften die Donas nach süßer Erlösung. Schnell. Nur einen Schritt, denkt er. Auf und davon. Für vier Pesos den Boden unter den Füßen verlieren. Für vier Pesos alles hinter mir lassen. Der Motor jault auf. Seine Hand bewegt sich auf den bittersüßen Espresso zu, der vor ihm auf der wackeligen Holzbox hin und her kippt, als würden seine Finger blinzeln und neugierig die Welt erkunden, die Luft noch frisch, es ist bald hell, er richtet sich auf, eine reckende Bewegung als wäre er in einem kleinen Rausch und Wirbel, als wären Leben und Tod eins. Jetzt nicht so lange nachdenken, sagt er sich, die Nacht ist vorbei, ein Schritt aufs Trittbrett, den schmutzigen Wind im Haar, dem Fahrer gewunken, der wusste, vier Pesos in der Jacke. Für vier Pesos auf und davon, ein guter Deal, der Fahrer nickt. Er wird Gas geben, einen Gang hochschalten und die Musik aufdrehen, Cantina und los, nach Osten, nach Westen, den Fahrtwind um die Ohren. Die Türen stehen immer offen und weil die Türen immer offenstehen und fünf Millionen einsteigen und fünf Millionen aussteigen klappert immer irgendwo etwas. Eine Tür, ein Fenster oder sonstwas. Der Fahrer dreht sich in der Kurve zurück in den schlingernden Bus und schaut, weil etwas klappert oder sonstwas und sieht ganz hinten zusammengekauert eine Gestalt sitzen, nach Osten, nach Westen, im Dunkel seiner Gedanken sieht er eine Gestalt verschluckt von Osten, von Westen, der Fahrer nickt nach rechts, nach links, er tritt aufs Gaspedal nach Westen, nach Osten. Es donnern Taxis, Trucks und Pickups nach Westen, nach Osten.
*
Im ersten Sonnenstrahl rasen die Taxis, Trucks und Pickups von Osten nach Westen, Westen nach Osten. Sie dreht den Kopf nach links, nach rechts und in alle Richtungen. In der Ferne stehen am Straßencafé Victoria Frühaufsteher an der Theke. Mühelos bewegen sie sich nacheinander, nebeneinander, aneinander. Sie hat bald ihren Platz zwischen ihnen gefunden. Sie lassen sich auf hölzernen Bänken nieder. Sie stellen mit geübter Handbewegung riesige Becher mit Cappuccino und heißer Schokolade auf wackelige Holzboxen. Bittersüßer Espresso. Unter einem Flachbildfernseher, unter Nachrichtenbildern sitzen sie nacheinander, nebeneinander, aneinander. Straßenstaub. Zucker. Stimmen. Rufe. Schaum. Sonne. Zimt bestreute Donas, Fleisch gefüllte Tortas. Müsste ich nicht—
Hätte ich nicht längst —? denkt sie. Aber links. Die Art, wie er den Becher hielt. Ihr sind die Hände des Mannes links von ihr ins Auge gefallen. Sie findet nicht seine Hände schön, sein Haar. Es war die Art, wie er sein Leben hielt. Sechs Spuren Sonne trugen sich zu Wänden aus Licht, Verblendung, Erleuchtung zusammen. Es war ein Morgen Ende Oktober in Mexiko City. Als hätte sie den Anfang versäumt und trotzdem gewusst, worum es ging.
Es waren nicht seine Hände, nicht der Wind in seinem Haar. Es war die Art wie er sein Leben hielt. Wie sie ihr Leben sah. Es war die Art, wie er sein Leben hielt, als sie ihr Leben sah. Jetzt den Kopf zur Seite neigen, denkt sie. Meine Schulter, eine Schulter. Zwei Augen auf sechs Fahrspuren. Meine Schulter, seine Schulter. Ein einziges Gleichgewicht. Balance. Etwas Weiches. Von Osten, die Sonne. Ein Herzschlag wie die rasenden Autos. Drei Spuren nach Westen. Still! Als wäre es das letzte Bild. Drei nach Osten. Windhauch. Herzschlag. Stromkabel wie silbriges Haar. Der erste Sonnenstrahl. Gesenkte Lieder. Ihre plötzliche Balance bringt sie ein wenig aus dem Gleichgewicht. Aber es gab gar kein Gewicht. Alles schien ohne Hindernis und ohne Zeit.
Zum ersten Mal im Leben wollte sie nichts riskieren. Sie hatte sich niedergesetzt und die Tür weit offen gelassen. Die Tür, durch die sie diese Szene betreten hat. Er blickt auf. Sechs Spuren Sonne, seine Hand hebt sich gegen das Blenden, vielleicht auch seine Stimmung. Etwas hat sich vage verdeutlicht, eine Veränderung in der Bewegung, in der Luft.
Die Regenzeit hat früher als gewöhnlich ausgesetzt. Wo sich normalerweise abends Regenmassen in braunen Bächen über die Straße ausschütten, wirbeln heute morgen Automassen trockenen Staub auf.
Zwischen dem Dämmern ihrer gesenkten Augenlieder und dem Sonnengleißen hat sie für einen Moment das Gleichgewicht verloren, aber beinahe gleichzeitig auch wieder vergessen, dass sie aus der Balance geraten war. Sie hat etwas anderes gesehen.
Einen Windhauch, der haften blieb. Als wäre er ein einfacher Passant gewesen und als wäre ein Teil von ihr aufgestanden, um aus irgendeinem Grund mit versteinertem Lächeln auf den Lippen die Tür zu schließen.
Er hatte den Kopf etwas zur Seite gewandt, als wäre sie zu spät gekommen. Und als auch sie sich zu ihm umschaute, als hätten sie beide den Anfang versäumt, war er verschwunden, gerade als wäre er – wie ein einfacher Passant –
Er muss in die offene Türe eines vorbeifahrenden Busses gesprungen sein. Der Bus wird wie das Leben ganz plötzlich auf ihn zugekommen sein. En passant.
Überreste eines Fiebers, eine innere Regung die bis aufs Äußerste prickelnd erfüllt. Ein verwaister Espressobecher, ein letztes Bild, das niemals hält. Es war früh am Morgen Ende Oktober in Mexiko City. Die Stromkabel glänzen wie silbriges Haar.
*
Stromkabel wie langwieriges Haar. Mit glänzenden Augen tastet er den Straßenrand ab. Seine Augen gleiten über die Fahrbahn, den Rückspiegel. Fast dreihundertsechzig Grad behält er im Blick, nach links, nach rechts. Alle Richtungen bewegen sich rund um ihn wie ein wogender Ozean, ein ganzes Leben, das vor ihm liegt und das er rasend hinter sich lässt. Seine Augen tasten flink und geübt die bewegten Konturen in seinem Sichtfeld ab, wie sie hasten, zu zweit schlendern, laufende Kinder mit Schulrucksäcken und weil sein Überleben davon abhängt, sie zwischen den Autos und Häusern und Bäumen herauszufiltern, vergisst er alle einzelnen Formen sofort wieder. Er sieht Millionen und wenn keiner die Hand hebt, keiner aufspringt, keiner mit den unverkennbar zielgerichteten Schritten auf ihn zuläuft, allein oder in Zweier- oder Dreiergruppen auf ihn zuläuft mit Gepäck und Gesicht, dann vergisst er sie sofort wieder. Ein laufender Schritt, ein Anlauf eher, der sich mit deutlich abzeichnender Erleichterung im Gesicht verlangsamt, sobald die Laufenden eine der winzigen Gesten von ihm wahrgenommen haben: sein minimalistisches Repertoire, das er sich über die Jahre aufgebaut, und dann auf ein Mindestmaß abgeschliffen hat, das Nicken hat er auf einen Bruchteil reduziert, das Winken heruntergefahren auf ein deutliches Luftholen mit seinem ganzen runden Körper, ein Nachvornelehnen, wenn er den Gang schaltet und mit einem mittlerem Donnern herunterbremst. Und jetzt steht er mit laufendem Motor an der roten Ampel und lehnt sich zurück. Manchmal täuschen ihn seine Sinne, das weiß er. Deshalb beugt er sich also doch wieder zum Lenkrad vor, eine kleine Bewegung. Sein Blick streift kurz den Rückspiegel und zieht dann langsam nach rechts hinüber zum Straßenrand und fällt dabei auch auf das Café Victoria.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martina Berscheid
Nach dreißig Jahren
Margret legt die Hand auf die sonnenwarme Fensterbank. Einen Moment lässt sie sie ruhen, wie auf dem Rücken einer Katze. Sie hat nie ein Haustier besessen, der Vermieter erlaubte keine, sie hat das immer bedauert. Heute ist sie erleichtert darüber.
Früher stand Margret oft hier am Fenster des Wohnzimmers. Blickte nach unten auf den Spielplatz. Halb von der Gardine verborgen sah sie den Kindern der anderen Hausbewohner zu, wie sie schaukelten und rutschten. Nur kurz, damit sie Margret nicht bemerkten und sie ihre Unbefangenheit beim Spiel behielten.
Früher glaubte sie, keine eigenen Kinder zu haben, wäre das größte Unglück in ihrem Leben. Da hatte Kurt sie noch nicht verlassen. Sie ihren Job gehabt. Glaubte noch an das Gute im Menschen und dass sich im Leben alles fügen würde.
Sie blinzelt gegen die Sonne, die durch die blanke Scheibe fällt. Schweiß tritt ihr aus. Die Wintersonne bündelt ihre Kraft. Die täuscht. Die Temperatur draußen beträgt vier Grad unter Null.
Unter dem Wintermantel trägt Margret drei Pullover übereinander. Zwei weitere hat sie eingepackt, den Rest verschenkt. Viel kann sie ohnehin nicht mitnehmen.
Dreißig Jahre hat sie in dieser Wohnung gelebt. Erst mit Kurt, später allein. Sie befolgte immer sämtliche Hausregeln, sogar die unsinnigen, putzte den Flur, wenn sie an der Reihe war. Entsorgte den Müll ordentlich, und mit der Miete war sie auch nie in Rückstand.
Sie hat niemandem erzählt, dass das heute ihr letzter Tag hier ist. Nicht mal den besten Freunden. Vor allem denen nicht.
Erst kam die Mieterhöhung. Dann die Kündigung, wegen Verkaufs. Der Vermieter sagte, jeder müsse schauen, wo er bleibt. Er wird eine Menge Geld bekommen für die Wohnung, Altbau, in einer neuerdings beliebten Gegend.
Wenigstens lässt ihr der Vermieter diese halbe Stunde. Zum Abschiednehmen. Sie solle einfach zuziehen und ihm die Schlüssel bringen, er habe sowieso noch nebenan zu tun und schließe dann später ab.
Ihr Nachbar ist vor ein paar Monaten gestorben, dessen Wohnung gehört auch dem Vermieter.
Noch ein letzter Blick. Auf den Spielplatz, die Sträucher dahinter, die im Sommer blühten, die Bänke, wo die Mütter und manchmal auch Väter saßen und erzählten. Die beiden Kastanien, den Rosenbusch, von dem sie manchmal heimlich eine Blüte abschnitt, in eine Vase stellte und jeden Tag mehrmals daran roch, bis die Blätter welk auf den Küchentisch fielen.
Margret kehrt dem Fenster den Rücken. Zieht den Rucksack auf und greift nach der Tasche neben sich. Die macht sich schwer, als wolle sie auch bleiben.
Geht nicht, flüstert Margret in die Stille. In die Leere. Der Wohnung und in ihr drin.
Ihre Schritte hallen auf dem Parkett, das sie regelmäßig pflegte. Sie mochte es, wenn es glänzte und nach Politur roch. Die Abnutzung sieht man dem Boden dennoch an. Die Jahre, die vergangen sind. Er ist wie ein Spiegel ihrer selbst.
Margret schließt die Tür und hat für einen Moment das Gefühl zu fallen. Sie atmet in den Bauch. Bis der Schwindel nachlässt.
Sie klopft an die Nachbartür, wie vereinbart. Bevor der Vermieter öffnen kann, legt sie die Schlüssel auf den Boden, steigt die Treppe nach unten. Schweiß läuft ihr über die Stirn.
Zum letzten Mal öffnet sie die Haustür. Schließt sie leise hinter sich.
Draußen schwappt ihr ein Schwall kalte Luft ins Gesicht. Sie tastet in die Innentasche ihres Mantels. Dort stecken ihr Pass und das Geld, das sie für die Möbel bekam. Viel weniger, als sie wert waren.
Hastig setzt Margret sich in Bewegung. Der Wind schneidet durch die Straßenschluchten, über ihr Gesicht. Sie geht bis zur Kreuzung, überquert sie. Passiert den Dönerladen, wo ihr der nette Angestellte zuwinkt. Sie denkt an die Wohnung, leer und doch so voll von Erinnerungen und Gefühlen, die sie besser auch zurücklässt.
Der Schmerz nährt sich nur davon.
Die Sonne steht tief. Margret wird sich bald einen Schlafplatz suchen müssen.
Sie kann sich nicht vorstellen, wie sie in der Kälte überleben soll. Sie weiß, dass es Einrichtungen gibt. Für Leute wie sie. Sie hätte sich kümmern müssen.
Bis zuletzt hat sie geglaubt, dann gehofft, dass sie doch bleiben kann.
Wie unsäglich dumm.
Die nächsten Tage werden zeigen, ob sie sich das letzte bisschen Stolz erlauben kann.
Das schmiedeeiserne Tor des Friedhofs taucht vor ihr auf. Es steht einen Spalt offen, wie eine Einladung. Margret geht hinein.
Die Sonne verglüht schon, gießt orangefarbenes Licht über die Grabreihen. Sie war lange nicht mehr hier, zuletzt an der Beerdigung einer Freundin.
Eingerahmt von Eichen, lässt sie sich auf einer Bank nieder. In diesem Teil des Friedhofs liegen die Kleinsten, die Totgeborenen. Die Sternenkinder.
Sie holt Decken und den Schlafsack aus dem Rucksack. Wickelt sich darin ein. Die Kälte frisst sich dennoch durch die Stoffschichten, bis auf ihre Haut. Wie Säure.
Sie betrachtet den Grabstein vor ihr, wie sich seine Farbe verdunkelt, bis sie die Inschrift nicht mehr lesen kann.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Suse Schröder
Formtat
Unsere Eltern warten auf Nachricht. Die sind wir ihnen schuldig. Ständig rufen sie an, aber wir gehen nicht ran. Wir wollen nicht die immer gleichen Gespräche führen. Wir beschließen, aus einer Brauselaune heraus, ihnen zu schreiben. Dafür brauchen wir Input, um ihnen glaubwürdig zu erscheinen und uns selbst zu glauben, und Briefpapier. Bis-dann-H holt ihre alte Postmappe und Stifte. Wir greifen zu.
Wir spielen Wetter Befinden Tätigkeit Essen.
Hab‘s-schön-M schreibt: Gewitter Gabelspagetti Gehen Gut.
Viele Grüße-O findet das zu fad, greift aber auf Hab’s-schön-Ms Gs zurück:
Gerölldonner Gähnen Gnoccisgebraten ganzgutsoweit. Gegen das Gähnen hat Bis-dann-H was. „Gähnen kann auf Langeweile und Müdigkeit hinweisen. Erschöpfung sogar. Da rufen deine Eltern doch erst recht an.“
„Wir könnten Fragen stellen.“
„Ja, kurze! Auf die sie Lust haben schriftlich zu antworten.“
Tschüss-K hört gar nicht mehr auf zu nicken, hat aber auch keine Idee für eine mögliche Umsetzung.
„Unsere Eltern sind doch Generation Handy. Die wollen digital und nicht Zettel und Stift. Meine tippen selbst ihre Einkaufszettel ins Phone.“
„Aber über Post freuen sie sich auch, oder?“
„Wenn‘s keine Rechnungen sind, ja!“
„Sollen wir Fragen zu offenen Rechnungen stellen? Vielleicht sind sie dann erleichtert, dass sie keine haben und wollen uns das dann mitteilen.“
„Mhhh…“, meint Bis-dann-H, während Tschüss-K, Viele-Grüße-O und Hab’s-schön-M wie wild zu schreiben anfangen. Alles-Liebe-Ch schaut zu, wartet ab. Beim G hatte er nicht geglänzt, sich viel blaue Tinte über die Schreibhand geschmiert und nicht mal vorlesen wollen.
„Morgensonne Marmorkuchen mittelmäßig Machen“, liest Tschüss-K und merkt beim Vorlesen, dass sie damit nicht punkten wird. Kein*e andere*r hat eines ihrer Wörter. Diese zählen nur, wenn sie für die anderen ansprechend und für die elterliche Post inspirierend sind.
Viele-Grüße-O liest wieder als Letzter. Auf seinem Blatt stehen mehrere Wörter zu jedem Buchstaben.
„Montagswetter Mäuseschwänze Mittagslaune Magnolienschauen.“
„Mensch, Viele-Grüße-O, richtig lyrisch“, sagt Tschüss-K, weil sie das Gefühl hat, die Stimmung etwas anheizen zu müssen, um sich nicht allein defizitär zu fühlen. Die anderen schweigen, kritzeln Kreise, malen Quadrate auf ihre Briefpapierränder.
„P“, sagt Hab’s-schön-M und tobt übers Papier.
„Pfützenregen Pfannkuchen Piktogrammezeichnen platt“, liest sie schreiend vor, nachdem sie den letzten Buchstaben aufs Papier gesetzt hat. „Eierkuchen oder Pfannkuchen?“, fragt Bis-dann-H und Hab’s-schön-M kann sich nicht entscheiden, weil Pfannkuchen so gut passt, sie aber lieber Eierkuchen mag. „Mit den Piktogrammen finde ich stark“, sagt Viele-Grüße-O und Tschüss-K: „Ja, vielleicht schreiben wir gar nicht, sondern zeichnen.“ Für Minuten ist es still. Hier wird gedacht. „Joa“, sagt Alles-Liebe-Ch und kritzelt auf seinem Papier. Mit rotem Kopf zeigt er seine Zeichen-Zeichnungen in die Runde. Wir raten, aber auch nach dem zehnten Versuch schüttelt Alles-Liebe-Ch den Kopf. Eine Chance haben wir reihum noch. Trotz gegenseitiger Beratung lösen wir keines seiner Bilder auf und verlieren die Lust. „Wollen wir fertig werden? Auf mich übt das ganz schönen Druck aus“, sagt Viele-Grüße-O und Bis-dann-H verschwindet wieder in ihrem Zimmer. Wir hören sie kramen. Sie kommt freudestrahlend mit einem Stapel Postkarten zurück, verwischt sie auf der Tischplatte und legt Briefmarken dazu. Für jede*n von uns eine. „Sucht euch das Bild aus, was euch als erstes anspricht“, sagt sie und Tschüss-K muffelt: „Spielen wir Therapie oder was?“ Bis-dann-H ignoriert Tschüss-K’s Kommentar und formuliert ein mögliches Ziel: „Wir schreiben jetzt jede*r für sich, lecken die Briefmarken an, kleben sie auf und ab geht die Post.“ „Einfach so aus der Kalten?“, fragt Alles-Liebe-Ch. Alle nicken instant, weil das jetzt ein Ende finden soll.
Hab’s-schön-M stellt ihren Handywecker: „Auf! Fünf Minuten!“ Und dann schauen wir uns an, grabschen uns einen Stift, greifen eher wahllos jede*r eine Postkarte und kritzeln los. Als Hab’s-schön-Ms Wecker schrillt, haben wir rote Gesichter, eine flache Atmung, beschriebene Postkarten und Durst. Bis-dann-Hs Vorräte sind bereits aufgebraucht. Wir gehen gemeinsam zum Späti, auch weil davor ein Briefkasten steht. Nach und nach werfen wir alle etwas zu feierlich, Alles-Liebe-Ch sogar sehr albern, unsere Post ein. Ob sich unsere Eltern gefreut, uns gar zurückgeschrieben haben, erzählen wir uns ein anderes Mal. „Abgemacht?“, fragt Tschüss-K. Und dann legen wir alle unsere Hände übereinander und sagen unisono: „Abgemacht!“, sehr laut zur eingeschalteten Laterne hinauf und also in die Nacht, erleichtert und froh, dass wir Dinge geregelt kriegen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
24 | Helene Lanschützer
Stille Nacht in c-Moll
Feli sitzt am Badewannenrand mit angezogenen Knien unter ihrem Kleid, das sich darüber dehnt wie ein Zirkuszelt. Vor dem Badezimmerspiegel steht Mama und beugt sich über das Waschbecken, biegt die Wimpern mit einer schwarzen Bürste nach oben, legt rosa Farbe auf, dass die Wangen glänzen, kämmt sich die Haare. Manchmal kämmt Mama auch Felis Haare und flechtet ihr danach einen Zopf, einen Rapunzel-Zopf, der bei den Ohren beginnt und bis über den Rücken reicht. Meistens muss sich Feli aber selbst eine Frisur mit einem von Mamas schwarzen Gummis machen, dann schauen die Strähnen oben wie kleine Hügel heraus und die kürzeren Haare fallen vorne in die Augen.
„Heute ist Weihnachten“, sagt Mama und steckt Feli eine glitzernde Haarspange in die Stirnfransen. „Weihnachten ist der einzige Tag im Jahr, wo alle hoffen, dem Glück zu begegnen.“ Sie klingt nicht glücklich. Aber ihr scheint es besser zu gehen, ihre Wangen leuchten rosa und sie hat Feli eine halbe Frisur gemacht.
Jetzt nimmt sie ein Glasfläschchen aus dem Schrank.
„Was ist das?“
„Ein Duft.“ Sie sprüht sich den Duft auf ihren Hals, auf die Handgelenke und reibt sie an den Innenseiten aneinander.
„Was ist das für ein Duft?“ Feli beugt sich wie Mama eben über das Waschbecken und versucht zu lesen, was auf der Flasche steht, kann die Buchstaben aber nicht zu Wörtern zusammenfügen.
„Das ist Parfum de Noël.“
Parfö de Noäl riecht nach Punsch vom Weihnachtsmarkt und den Zimtsternen, die sie bei Felis Freundin zuhause gebacken haben.
„Ist da Punsch drin?“, fragt sie.
„Aber nein.“ Jetzt zuckt es um Mamas Mundwinkel. Kurz sieht sie glücklich aus. „Es ist ein Duft, der nach Zimt riecht. Nach Zimt und Weihnachten.
Sie nickt. „Parfö de Noäl.“
„Das ist Französisch. Irgendwann fahren wir nach Paris, nur wir beide. Zum Eiffelturm und den Croissants.“ Feli nickt wieder. Letzte Woche wollte Mama mit ihr nach Italien, nachdem sie Nudeln aus der Dose aufgewärmt hat.
„Irgendwann essen wir Spaghetti in Venedig auf dem Markusplatz, nur wir beide.“
Feli freut sich schon, wenn sie es schaffen, eine Reise in den Supermarkt zu machen, in die Gemüseabteilung, meistens landen sie bei den Konserven.
Heute hat Mama aber sogar die Jalousien von ihrem Schlafzimmerfenster aufgezogen und gelüftet, im Zimmer hängt noch der Rauch des Nachbarn, der über ihnen auf dem Balkon seine Zigaretten ausdrückt. Heute lässt Mama die Welt in die Wohnung hinein, weil Weihnachten ist. Sogar das Bett hat sie gemacht, falls auch die Oma ins Zimmer hineinschaut.
Auf dem Küchentisch liegen die Zimtsterne, die Feli von ihrer Freundin mitbekommen hat. „Die können wir zum Tee servieren“, sagt Mama und holt Tassen aus dem Geschirrspüler. Feli setzt sich auf das Sofa. Das Wohnzimmer ist im gleichen Raum wie die Küche, Mama nennt es Allzweckzimmer. Sie streicht über den sonnenblumengelben Stoff, er ist glatt, hat keine Falten und Dellen wie sonst, wenn jemand ganz lange darauf liegt. Mama holt die kleine Holzkrippe aus dem Schrank, der Weihnachtsstern über dem Dachgiebel hat früher geleuchtet, doch die Batterien sind schon lange leer. Feli stellt ihren Playmobil-Weihnachtsbaum daneben. Er ist viel zu klein, aber sie haben keinen größeren Baum. Mama hat darauf vergessen und Feli heute Morgen mit zehn Euro noch losgeschickt. Die Weihnachtsbaumverkäuferin hat gelacht. „Mit zehn Euro bekommst du gerade mal einen Ast“, sagte sie und gab ihr dann einen Ast. Aber ohne die zehn Euro zu nehmen, die Feli ihr mit der rechten Fäustlingshand hinhielt. Der Weihnachtsbaumast liegt jetzt neben den Zimtsternen auf dem Küchentisch, ein paar Nadeln sind schon abgefallen.
„Gleich kommen Oma und Opa“, sagt Mama. „Erzähl ihnen nichts davon, dass ich oft müde bin. Das verstehen sie immer falsch. Und hol deine Blockflöte aus dem Zimmer. Wenn es zu viel wird, dann kannst du ein paar Lieder vorspielen.“
Die Lehrerin in der Schule hat immer von einer Weihnachtsstille gesprochen, wenn sie die Kerzen am Adventkranz angezündet hat. Still ist es auch am Küchentisch, als Opa, Oma und Tante Elisabeth auf der Küchenbank sitzen, von groß nach klein, sie erinnern Feli an die unterschiedlich heruntergebrannten Kerzen am Kranz vom ersten bis zum dritten Advent. Tante Elisabeth ist Omas Schwester und wäre an Weihnachten ganz allein gewesen, deshalb ist sie auch mitgekommen, weil sie hier vielleicht hofft, dem Glück zu begegnen. Oma hat Erbsensuppe mitgebracht, die Mama im gleichen Topf aufwärmt, in dem sie vorher das Teewasser erhitzt hat.
„Die Zimtsterne sind hart“, sagt Oma.
„Die habe ich gebacken.“ Feli kratzt den Glitzer von der Haarspange ab. Er fällt auf das grüne Tischtuch.
„Man kann sie gut in den Tee tunken“, sagt Opa und tunkt die weiße Zuckergussspitze in den Tee.
„Es ist schön, euch wieder einmal zu sehen“, sagt Tante Elisabeth. Feli kann sich nicht erinnern, sie jemals gesehen zu haben.
„Wie geht es euch? Man hört nicht oft etwas von dir.“ Oma sieht Mama an.
„Gut geht es uns“, Mama streicht über Felis Kopf. „Sonst würden wir uns melden.“
„Und die Arbeit? Du bist doch nur zu Hause.“
„Mama, ich bin selbstständig. Da arbeitet man zu Hause“, sagt Mama. Feli hat Mama noch nie das Wort Mama zu einer anderen Frau sagen hören. „Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir nächstes Jahr nach Paris fahren wollen, nur wir beide.“
Feli sagt nichts. Mama nimmt die Hand von ihrem Kopf. Feli duckt sich schnell, bevor die andere Hand darüberstreichen kann, und spielt mit dem durchsichtigen Batterien-Häuschen des Weihnachtssterns, macht den schwarzen Schalter an und aus.
„Was wünschst du dir zu Weihnachten, Felicitas?“, fragt Opa.
„Ein Pony“, antwortet Feli. „Ein Pony mit einer Mähne, die man kämmen kann.“
„Das nächste Mal bringe ich Batterien für den Weihnachtsstern mit“, sagt Opa. Feli weiß, dass es lange dauern kann, bis aus dem nächsten Mal wieder ein dieses Mal wird.
„Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht“, sagt Oma über ihren Kopf hinweg, Mama protestiert, das Gespräch läuft weiter. Feli holt das Jesuskind aus der Krippe und lässt es auf das Dach des Stalls klettern. Die Stimmen werden lauter, bald würde es einen Streit geben, bei dem die Türen und Sätze knallen. Bei dem Oma irgendwann ihre Handtasche nehmen würde und ohne ihren Mantel die Wohnung verlässt und Opa ihr mit dem Mantel hinterhergeht.
„Ich kann es nicht mehr hören“, ruft Mama jetzt und Feli möchte auch nichts mehr hören.
„Was riecht denn hier so?“, fragt Tante Elisabeth auf einmal.
Das ist Parfö de Noäl, will Feli sagen, aber da ruft die Oma: „Jessas, die Suppe!“, und Mama rennt zum Herd, wo die Suppe anbrennt, und stellt ihn aus. Sie greift sich mit Daumen und Zeigefinger an die Nasenwurzel, das macht sie immer, wenn sie erschöpft ist.
„Soll ich etwas auf der Flöte spielen?“, fragt Feli.
„Das ist doch eine gute Idee“, sagt Opa und Feli holt ihr Notenheft, schlägt Stille Nacht auf, weil es das einzige Lied ist, was sie gut kann. Sie presst die fünf Finger der linken Hand auf die oberen Löcher und beginnt auf dem g. Das Lied kann sie auswendig, sie muss gar nicht auf die Noten schauen. Auf einmal wird es still im Raum. Eine Weihnachtsstille, denkt Feli und als sie am Ende des Liedes angekommen ist, fängt sie wieder von vorne an. Sie würde nicht mehr aufhören, Stille Nacht zu spielen, weil es noch nie so weihnachtlich still im Allzweckzimmer gewesen ist. Es gibt keinen Streit, keine lauten Stimmen mehr, nur noch Stille Nacht auf der Blockflöte. Manchmal holt sie kurz Luft, streicht sich die Spucke von den Lippen und macht weiter. Sieben Mal fängt sie von vorne an, bis sie eine Hand an der Schulter spürt. Sie riecht den Weihnachtsduft. „Jetzt ist es genug“, sagt Mama. Und Opa applaudiert.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
20 | Guillermo Millán Arana
Eierpunsch
Obwohl wir in derselben Kleinstadt wohnten, sah ich meinen Großvater nur bei bestimmten Familienfesten. Traf trifft es besser, denn ich sah ihn oft. Ich erinnere mich an einen Herbstabend, als ich mit meinen Eltern auf dem Heimweg von einer Gaststätte war, als in einer Seitenstraße eine Kneipentür vor uns aufging und sein scharfes Lachen zu hören zu war. Durch eines der beschlagenen Sprossenfenster sah ich meinen Großvater mit hochrotem Gesicht in einer Gruppe von Männern stehen. Er packte einen jungen Kerl, aus seinem Schützenverein, denke ich, am Kragen, nahm ihn grob in den Schwitzkasten und verpasste dem verlegenen Burschen mehrere Backpfeifen mit der freien Hand. Die anderen schienen sich zu amüsieren, klatschten, johlten meinem Großvater zu. Ich sah hinauf zu Mama. Sie sagte nichts. Dann stupste sie mich an und wir gingen weiter. Ich weiß nicht, ob meine Mutter wollte, dass ich das sehe.
So munter er in der Gesellschaft seiner Freunde war, setzte mein Opa auf Familienfesten sein Schweigen durch. Dafür musste er nichts unternehmen, oder zumindest nicht aktiv, da er mit seinem Naturell für Ruhe sorgte. Für gewöhnlich apathisch, haftete seinem Ausdruck, vor allem zu Tisch, eine gewisse Verärgerung an, ja fast ein unterdrückter Zorn. Die zuckenden Augenbrauen, die zusammengepressten Lippen, das leicht abgewandte Gesicht, der fliehende Blick, der, wenn man ihn erwischte, nur mit einer Art automatischem Misstrauen entgegnet wurde; das alles vermittelte uns anderen Familienmitgliedern die stille Botschaft, im Grunde unerwünscht zu sein, dass er den Abend lieber allein verbringen wollte.
Auch wenn die Stimmung auf solchen Familienfeiern lebhafter wurde, geschah das nur zu seinen Bedingungen. Zu Weihnachten etwa löste sich das Gemüt meines Großvaters nur, wenn es Eierpunsch gab. Obwohl ich ein kleines Mädchen war, konnte ich ausrechnen, wie sich seine Stimmung veränderte, wenn er trank. Zwei Gläschen waren das goldene Maß, dann überkam Opa eine seltsame Rührseligkeit. Das war uns Kindern unangenehm, denn in der Phase des Abends wurde er auf seine Weise zutraulich: Mein Cousin Tommy bekam zum Spaß einen Tritt in den Hintern, mir fuhr er erst mit sanfter Hand durchs Haar, um mir zur Pointe mit einem Jauchzer an den Zöpfen zu ziehen, und Max, der Sohn meiner Tante Sabine, der laut Mama aus einer flüchtigen Liebesnacht entstanden war, nannte Opa „mein kleiner Bastard“.
Beim sechsten Gläschen wurde er allmählich gemein. Er frotzelte über jede unserer Ideen, fast mit einem Krächzen, begleitet von einem Schwung seines gedrungenen Leibes. Schon damals kam mir seine Ausgelassenheit gezwungen vor, als erlaube ihm der Suff, seine höhnischen Zwischenrufe in die Form eines Lachens zu kleiden. Die Erwachsenen stellten sich für gewöhnlich dumm, vor allem nach dem Essen: Die Frauen wandten sich ab, plauderten am Erwachsenentisch, die Männer gingen zum Kindertisch, um Skat zu spielen und zu rauchen, während wir Kinder Zuflucht vor Opa suchten. Wenn er mir viel Angst machte, suchte ich Mama mit den Augen. Stumm erwiderte sie meinen Blick und schaute dann verlegen auf die Tischdecke. Für Oma war es am schlimmsten. Abends, oft waren wir Kinder noch wach, kam unweigerlich die Zeit, in der sie meinen Großvater ins Bett bringen musste. Später, wenn wir Kinder im Flur spielten, hallte sein Schnarchen als Echo seiner Hänseleien aus dem Schlafzimmer.
Nur durch Zufall erfuhr ich, dass Opa den Eierlikör zubereitete, aus dem Oma dann zu Weihnachten den Eierpunsch machte. (In der Verwandtschaft ging man davon aus, dass nur Oma etwas damit zu tun hatte, und jedes Jahr aufs Neue erntete sie aufrichtiges Lob für den guten Punsch. Wenn ich Eier nur rieche, wird mir übel; trotzdem habe ich diesen Eierpunsch oft und gern getrunken.) Einmal, ich war etwa fünfzehn, fuhren wir unangemeldet zu meinen Großeltern. Heiligabend war noch eine Woche hin. Die Englischlehrerin hatte darauf bestanden, den zweiten Teil von Henry IV aufzuführen, und mein Bruder sollte John Falstaff spielen. Mama hatte schleunigst sein Kostüm zusammenzunähen, für das sie Omas Stoffsammlung durchstöbern wollte. Oma stand zunächst ganz verdutzt in der Tür und ich war mir kurz sicher, dass sie uns nicht reinlassen würde. Aber Mama schob sich murmelnd an ihr vorbei und ging auf den Dachboden. Oma bat mich ins Haus, und deutete verstreut mit dem Kopf zur Küche. Bevor ich eintrat, schien sie zu zögern, aber sie tat nichts. Opa stand hemdsärmlig in der Küche. Auf der Arbeitsfläche vor ihm lagen die Zutaten ausgebreitet: Eier, Rum, Puderzucker, ein Glas Wasser, eine Vanilleschote. Fast eindringlich lud er mich ein, einzutreten. Sorgfältig verrührte er Schritt für Schritt alle Zutaten. Aus der Vanilleschote schnitt er mit geübter Hand das Mark heraus.
Er sprach kaum, murmelte gelegentlich vor sich hin, dass man den Fusel aus dem Supermarkt nicht nehmen dürfe, weil man sonst die heilige Jungfrau beschmutze. Oder auch, dass die ganze Welt im Ei stecke. Aber das wirklich Erstaunliche war, ihn so in etwas vertieft zu sehen, so in sich ruhend. Oft habe ich darüber nachgedacht, ob er an jenem Nachmittag sein wahres Wesen offenbarte. Aber auf der Weihnachtsfeier zeigte er sein übliches Gesicht. Diesmal fiel ihm mein Bruder zum Opfer. Mein Opa, der schon beim siebten Gläschen war, grölte ihm zu, er solle doch Shakespeare rezitieren. Mein Bruder antwortete nur: „Fuck you.“ Großvater brüllte vor Lachen. Als mein Bruder später an ihm vorbeiging, schlug ihm Opa so heftig in den Nacken, dass mein Bruder vornüberfiel und erst einmal liegen blieb. Mama sagte nichts, sie sah Opa nicht einmal an. Wir halfen meinem Bruder auf die Beine und gingen sofort heim. Nach dem Vorfall haben wir nur noch im kleinen Kreis gefeiert.
Opa starb ein paar Jahre nach Oma. Mama, die ihn hin und wieder im Pflegeheim besuchte, sagte uns eines Tages am Esstisch, dass es ihm schlecht gehe. Ich sah sie an und hatte das Gefühl, dass sie sich seinen Tod wünschte, aber ich sagte nichts. Einige Wochen später teilte sie uns mit, dass er gestorben sei. Ich glaubte, Erleichterung in ihrem Gesicht zu sehen, und schwieg. Neulich habe ich zum ersten Mal versucht, mit ihr über Opa zu sprechen. Sie sagte, sie wisse genauso viel über ihn wie ich.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
18 | Chili Tomasson
Die Brücke am Ostufer
Die Kinder spielen Fußball. Sie spielen ohne schreiende Väter neben dem Platz. Sie spielen ohne weiße Markierungen am Spielfeld. Sie spielen mit einem Plastikball auf einer Wiese.
Ich öffne das Fenster in der Küche.
Das Wetter am Wochenende bleibt beständig. Montags fällt die Temperatur unter 20°, aber die Stromleitungen sind intakt.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand. Die Solarpanele wurden staatlich gefördert und vergangenen Sommer auf dem Dach montiert. Die Einfahrt ist mit hellgrauen Steinen gepflastert und eine schmale Mauer trennt sie an beiden Seiten vom Rasen. Das Gras ist kurz geschnitten und jeden Frühling freue ich mich über die ersten Triebe der Stockrosen.
Seitdem die Brücke gesperrt ist, brauche ich jeden Tag mehr als eine Stunde, um in die Arbeit zu kommen. Der Ausbau der Straßen wurde bereits vor Jahren versprochen, aber die Bauarbeiten haben erst vergangenen Mai begonnen. Ich denke, dass es noch mehrere Jahre dauern wird, bis die Umfahrungsstraße fertiggestellt sein wird.
Im Sommer erscheint mir der Berufsverkehr lauter als sonst. Es ist schon hell, wenn ich auf die Hauptstraße einbiege und ich bemerke, wie sich die Hitze allmählich über den Asphalt legt. Die Luft entfaltet sich langsam und schwer. Im Rückspiegel erkenne ich das Ausmaß der äußeren Bezirke. Sie wachsen stetig und orientieren sich an den Büros im Zentrum und den Fabriken im Süden der Stadt.
Im Sommer habe ich, wie alle anderen, die Fenster unten, während ich an der Ampel warte.
Der Regen zieht nach Südosten ab, von Norden her lockern die Wolken allmählich auf. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Temperaturen erreichen 17° bis 22°.
Arbeitszeiterfassung:
Arbeitsbeginn: 09.00
Kaffeepause: 11.15
Arbeit: 11.30
Mittagspause: 13.00
Arbeit: 13.30
Kaffeepause: 16.00
Arbeit: 16.15
Arbeitsende: 18.00
Seit vermehrt über Einbrüche berichtet wurde, versperre ich das Garagentor und die Eingangstür hinter mir, wenn ich zu Hause ankomme. Es verursacht keinen Mehraufwand und verschafft Sicherheit.
Ich weiß, dass alle hören, wenn ich nach Hause komme. Trotzdem rufe ich immer nach ihnen, während ich mir die Schuhe ausziehe.
Vom Küchenfenster aus kann ich den ganzen Garten überblicken. Kommendes Wochenende werde ich den Rasen mähen und die Hecke schneiden. Die Stockrosen haben bereits zu blühen begonnen und die Tage sind lang.
Abends erzähle ich von der Arbeit. Wir sprechen über die Prognosen der bevorstehenden Wahlen. Ich schneide das Gemüse und wasche den Salat. Dann essen wir alle gemeinsam zu Abend.
Kühl, trüb, unbeständig. Im Süden sind leichte Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt hier gegen 2000m Höhe. Ansonsten bleibt es größtenteils trocken. Leichter bis mäßiger Nordwestwind. 13° bis 18°. In 1500m Höhe um 5°.
Bevor ich schlafen gehe, sitze ich noch eine Weile im Wohnzimmer und lese in den Fachmagazinen.
In der darauffolgenden Nacht träume ich erneut:
Vom Ostufer aus sehe ich die Abschussrampen und Raketenfelder. Das Einfamilienhaus steht am Stadtrand.
Die Luftwaffe hat nach eigenen Angaben gestern drei Kampfflugzeuge im Süden des Landes abgeschossen;
oder
Drei Kampfflugzeuge seien mittags in der südlichen Einsatzzone abgeschossen worden.
Die Behörden machten bislang keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Die Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden. Die Streitkräfte wehrten zuletzt weitere Angriffe im Süden ab. Dort spielen die Kinder Fußball. Sie spielen ohne schreiende Väter neben dem Platz. Sie spielen ohne weiße Markierungen am Spielfeld. Sie spielen mit einem Plastikball auf einer Wiese.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
15 | Sonja Grebe
Provinzmond
Klirrend kalt, wolkenlos. Der runde Mond strahlt wie Flutlicht vom Himmel. So stechend hell, dass die Dinge Schatten werfen und sie selbst in scharfer, quarzweißer Klarheit hervortreten, überscharf; ich betrachte entfernte Häuschen durch die Lupe aus gläserner Luft und kann jede Dachpfanne einzeln glitzern sehen. Dunkel schimmern das Gefieder der Krähen, die in der Pappel schlafen, die nassen Steine im Bach, Flaschenscherben an der Regiobus-Haltestelle, Isolatoren an Weidezäunen, Misteln, Hagebutten, die Bugwellen eines Kanalschiffs. Im Weltall-Licht entziffere ich, was mir die Risse und Teerflicken der Landstraße buchstabieren. Das Licht glasiert ausgeblichene Schilder, „Zum Dorfkrug“, „Änderungsschneiderei“, „Schlachterei und Partyservice“, „Spielhalle“, es löscht oder verbläut Farben, es versilbert die Nachtstunden der Füchse, Feldmäuse, Kleinkinder und wem sonst noch mit Uhrzeigern nicht geholfen ist. Alles gleißt still. Unterm Mond wird alles überdeutlich und zugleich unbeschaulich. Der kirschrote Rahmen des leeren Kaugummiautomaten glänzt tollkirschdunkel, die Nietbolzen der Kanalbrücke sind metallische Käferpanzer, der Horizont ist ein Streifen Magnetband. Gartenschaukeln, Bänke, Jägersitze, ein Bauschutt-Container (5 Kubik), Strommasten, Storchennester, die örtliche Motorsirene, der rostige Baukran, freistehende Bäume sind jetzt Skulpturen, rätselhafte Kultobjekte. Die Strahlung ergießt sich in die flächige Weite, sie sickert hinab zu den Knollen und Engerlingen in der Erde, drängt hinein in die Höhlen der Tiere und auch in die Häuser, Boote und Autos der Leute, sie erfasst alles, kennt alles persönlich. Mich genauso. Der Mond sieht mich spazieren gehen. Der Mond sieht mich einen Stein aufheben, von dem ich kurz glaubte, er würde atmen. Da rauscht ein VW Passat – heraldisches Gerät dieser Region – um die Kurve und spuckt Musik. Soweit kein Ereignis. Aber die Musik, die jetzt an mir vorüber schwallt, kommt hier sonst nie vor: 54-46 was my number höre ich Toots & The Maytals singen. Mondweiße Wildschweine würden mich weniger verwundern. „Solche Leute gibts hier?“ Der Mond blinzelt nicht mal. „Wie lange weißt Du schon davon?“, frage ich ihn vorwürfig.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen: