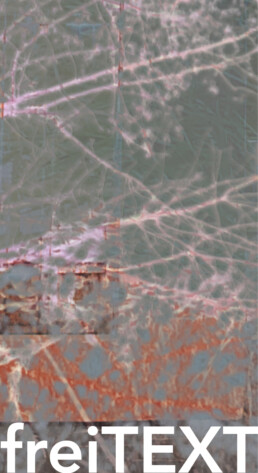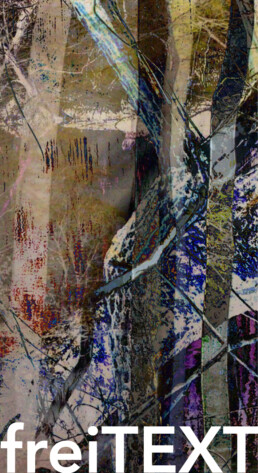freiTEXT | Susanne Schmalwieser
Wir beide haben immer schöne Anziehsachen
Zu diesem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt lebt Claudia in Australien und mit ihr niemand, den sie liebt. Probleme eines unglücklosen Lebens; doch von den Palmen sieht sie meistens nur die langen Schatten; bedrohlich ihr entgegenwachsend. Gedruckt aus der Zeitung entwischt und mit dem Boot über die See gefahren. Süßlich säuselnd in der Brandung, auf dass sie sich ihnen hingibt und dort ertrinkt.
Claudia sitzt auf der anderen Seite der Welt und winkt. Durch einen Bildschirm hindurch, in Georgs Küche hinein. der sitzt da mit seiner Teetasse und ist gespannt, von Claudias Tag zu hören, so wie sie seit Wochen immer von seinem hört. Täglich um neun, ihre Zeit, halb zwei, seine Zeit. Tastendrücken routiniert wie Zähneputzen.
Die Milchflaschen sind um sechzig Cent teurer geworden, sagt Claudia, und das Pfand nicht mehr. Bei uns auch; das erinnert mich an die Jugend, antwortet Georg, als wir donnerstags Pfandflaschen gesammelt haben, fürs Ausgehen am Freitag. ans Münzen-Aufklauben am Bahnhof Mödling und Münzen-Klauen aus der Tasche der Mutter und ans schlechte Gewissen deswegen, den ganzen Abend lang tanzend unter den Lichtern des einen Lokals oder des es anderen. Witzig, antwortet Claudia, dass wir diese Lokalnamen noch kennen, nach all den Jahren, und ich mir heute kaum die Busstation merken kann, über der ich lebe.
„Frühe Demenz?“, fragt Georg. „Ich glaube, Depression“, sagt Claudia.
„Oh“, meint Georg am anderen Ende der sie beheimatenden Kugel. Stille zwischen ihnen. Stille in jedem ihrer Räume; der eine sonnendurchflutet, der andere von Nacht umfangen.
Dann fragt Georg: „Gefällt es dir denn nicht in Australien?“
Gefallen, denkt Claudia. Gefallen hat ihr mit siebzehn mit der Mutter zehn Tage lang in Paris zu sein. Die erste Großstadt, der Bus durch Montmartre hinauf, endlich einmal zu sagen: „ich hab mir den Eiffelturm kleiner und das Moulin Rouge grösser vorgestellt“. Die verbindende Suche nach billigem Wein und gratis Aktivitäten, die Fußschmerzen nach Fußmärschen, um die Metropreise zu vermeiden. Gefallen hat ihr Wien, die ersten Wochen mit den neuen Freundinnen, das tägliche Nudeln-Kochen und -Essen und die Happy Hours in Clubs mit Musik, deren Text keine von ihnen verstanden hat. Der Stand vor der Uni mit den Ein-Euro-Reclamheften, die Stunden im Lesesaal „Altes Buch“, die Regentage im Seminarraum und die geschnorrten Zigaretten. Und gefallen hat ihr Georg. Die Sommer in Kärnten mit ihm und seiner Familie, die Zugfahrten in kurzer Hose und heruntergezogener Sonnenblende vor Beginn der Zeitrechnung ihres selbstbestimmten Lebens.
„Es ist so komisch, daran zu denken“, sagt Claudia, „dass es mir doch so gut gehen soll. Dass es uns gut gehen soll. Wir beide haben gut zu essen. Wir beide haben immer schöne Anziehsachen. Wenn ich nachhause komme, habe ich um niemanden Sorge, als um mich. Also klar, es gefällt mir, ich mach das Beste draus“, sagt Claudia, „aber einmal ein vertrautes Gesicht zu sehen, das wäre schön“, sagt Claudia.
„Das glaub ich dir“, sagt Georg.
„Und eine Person, die mich wirklich liebt.“
„Klar, sicher“, sagt Georg.
„Die mich versteht.“
„Ja, verstehe ich“, sagt Georg.
Auf irgendwessen Seite tropft ein Wasserhahn.
„Bitte besuch mich“, sagt Claudia.
Auf irgendwessen Weltseite: ein Martinshorn.
„Ich hab das Geld nicht, Claudia.“
„Ich borg‘s dir.“
Georg wackelt seine Handflächen dem Bildschirm entgegen.
„Nein, nein, nie. Das könnt ich nicht annehmen, ich hasse es in jemandes Schuld zu stehen.“
„Ich lad dich ein.“
Georg lacht nur.
Durch Claudias Nase wandert eine Träne nach oben, kitzelnd ins Augenlid.
„Da borg ich mir noch lieber von meiner Familie was.“
Dass ich dir nach all den Jahren nicht zumindest etwas ähnliches bin, denkt Claudia, aber sie fragt: „Wirst du‘s machen?“
Georg sagt: „Nein.“
Claudias Blick wandert vom Bildschirm in eine unbestimmte Ferne.
„Es wird alles so viel teurer, Claudia, wir müssen an unsere Zukunft denken.“
„Wir sind doch immer ohne Geld ausgekommen, und miteinander ausgekommen.“
Claudia denkt an die Ferien in Kärnten bei Georgs Familie. Kein See unter ihren runzeligen Fingerspitzen je wieder so blau wie dieser eine erste. Jenseits aller Moden durch die Stadt fahren auf Rädern ohne Gangschaltung. Fremde Wörter in der eigenen Sprache lernen und Zucchininudeln essen. Niemand hat von Claudia Geld gefordert, fürs Wohnen oder Essen, nur den Müll zur Tonne tragen hat sie sollen, zwei oder dreimal in der Woche. Georg hat sie dabei immer begleitet und sich für den Vater entschuldigt, als hätte der Claudia nicht ein erstes Stück Zukunft geschenkt mit einer Extramatratze und einem Extrabesteck. Aber das war vor Beginn der Zeitrechnung ihrer selbstbestimmten Leben, vor jeglicher Zeitrechnung der Schuld.
„Schau dir die Welt an, Georg, andere Leute haben so viel weniger als wir. Wir selber hatten einmal so viel weniger, als wir heute.“
„Eben“, sagt Georg.
„Eben“, sagt Claudia.
Georg zählt: Er hat drei horizontale Linien auf den Händen und zwei vertikale. Gesamt sind das zehn Linien unter zehn Fingern.
Claudia zählt: Der Wasserhahn tropft dreimal, dann pausiert er einen Schlag, dann wieder dreimal. Der erste Tropfen klingt höher, als die weiteren zwei.
Georgs Eltern haben nicht über Geld geredet. Manchmal, wie heute, zuckt Georg, wenn Claudia so tut, als wäre Geld wie alles andere, das Menschen besitzen: Konkret; austauschbar. Als hätte das alles keine Bedeutung mehr: Dass Claudia mehr verdient als er, dass die Eltern nicht über Geld reden wollen, dass er und die Frau im Bildschirm tagelang um den Bahnhof gestreunt sind zum Münzen-Klauben, dass die Milchflaschen jetzt sechzig Cent teurer sind, aber das Pfand nicht mehr. Wäre Georg wie Claudia, glaubt er, wäre er Teil dieser Menschheit, die über die andere nur in Formeln spricht. Angst davor keine Angst mehr haben zu müssen. Luxusprobleme, denkt Georg und schämt sich; wir beide haben doch alles was wir brauchen und dazu auch noch immer schöne Anziehsachen.
Claudia kennt diese Stirn. Die beiden Falten, parallel gelegt zu den dunklen Augenbrauen. Sie weiß, dass ihre Bitten vergebens sind.
„Ich vermisse dich, Georg, wirklich.“
Georg sagt: „Ich dich auch.“
Die Schatten der Palmen sind im Dunkeln verschwunden. Morgen werden sie zurück sein, und Claudia unter ihnen der kleinste Mensch der Welt. Manchmal wird sie Zeitung lesen und manchmal aufs Meer schauen, in der Hoffnung, dass es, wenn schon nicht Georg, dann ein Kopfhaar oder eine Hautschuppe von ihm heranträgt. Dass es zumindest in einer anderen Zustandsform ihn schon einmal berührt hat.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anna Fišerová
T
Es ist früher Abend und ich sitze im Bus, teile mir abgestandene Luft mit schwitzenden Menschen, schaue aus dem Fenster, nervös, weil ich keinesfalls meine Haltestelle verpassen möchte. Die rechte Seite des Busses neigt sich gefährlich nah dem Straßenrand zu, während wir uns auf engen Serpentinen einem Ziel nähern. Ich steige aus, atme Abgase und Wärme ein, vergrabe meine Hände in den Hosentaschen und bewege mich nach vorn, bis mir T in der Dunkelheit entgegenkommt.
Er begrüßt mich, bietet mir dampfenden Tee aus der Thermoskanne an, ich nehme den Becher lächelnd entgegen, probiere einen Schluck und verbrenne mir die Zunge. Mein Gesicht verziehend hole ich Luft und möchte etwas sagen, doch T schüttelt den Kopf und hält mir den Mund zu, seine Finger verströmen dabei einen seltsamen Eigengeruch.
„Psst“, macht er.
Ich nicke.
T nickt auch.
Zusammen durchkreuzen wir die Obstbaumplantage, ziehen unsere Schuhe aus, lassen sie im Gras liegen. Ich muss aufpassen, dass mir T nicht entwischt. Schaue ich einmal weg, ist er bereits auf einen der Bäume gesprungen, bewirft mich mit Birnen und Pflaumen, springt auf meinen Rücken und ich muss ihn von mir runterschütteln wie einen lästigen Käfer. Wir liegen im Gras und meine Unterlippe zuckt, während er mir Apfelstücke in den Mund stopft. Als ich das Kerngehäuse wegwerfen will, setzt T einen strengen Blick auf und schüttelt den Kopf. Hartes Fruchtfleisch knackt zwischen meinen Zähnen, Kerne bleiben in meinen Hals stecken und Worte auch.
Unsere Mägen blubbern und in unseren Mundwinkeln hängen noch Reste vom Obst. Wir halten uns gegenseitig unsere Füße ins Gesicht, sie riechen nach Dreck und Gras und irgendwie nach altem Teppich. Dann stecken wir sie zurück in ausgelatschte Turnschuhe, zwischen meinen Zehen haben sich Erdkrumen verfangen und sich unter meine viel zu langen Zehennägel gegraben.
Wir laufen runter in die Stadt, T tänzelt leichtfüßig auf jedem Geländer, schlägt Räder auf jeder Kante, gefährlich nah über dem Abgrund. Ich beneide ihn um seine Furchtlosigkeit, ich habe immer Angst und T nie, aber er ist umsichtig mit mir. Er verzieht sein Gesicht zu einem hämischen Grinsen, steckt seine Zunge raus, um im selben Moment seine Augen zu verdrehen. Ich hole ihn ein, ziehe an seinem Haar, das sich weich und fettig vom Schweiß anfühlt.
Unsere Schritte hallen durch enge Gassen, kindliches Lachen durchdringt die nächtliche Stille, in der Luft liegt der Geruch von warmen Gebäck.
T kauft mir einen Lebkuchenmann und ich reiße ihm den Kopf ab.
Wir schleichen uns ins Wohnheim, mit großen Augen am Pförtner vorbei, rennen die Treppenstufen hoch, schließen die Tür hinter uns ab und schnappen erschöpft nach Luft.
Ich besuche T zum ersten Mal, sein Zimmer ist klein und mit gelbem Anstrich versehen, es riecht fremd, aber auch nach Marmelade, er bietet mir an diesem Abend zum zweiten Mal Tee an und ich verbrenne mir wieder die Zunge. Auf der sonnengebleichten Tapete stehen Schimpfwörter auf Russisch und von draußen dringt Lärm durch die dünne Wand aus Pappmaschee, dröhnender Bass und grölende Stimmen, vorbeifahrende Autos, das Rauschen einer Autobahn. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, stecke den Kopf in den verschmutzten Himmel.
T macht das Fenster zu und zeigt mir seinen Wintermantel, all seine Mützen und die Löcher in seinen Socken. Wir werden unterbrochen, als etwas in seiner Jackentasche vibriert. „Da muss ich rangehen“, sagt er und es ist der erste Satz, den er an diesem Abend sagt.
Er setzt sich auf den Boden und verschränkt seine Beine, umschließt mit langen Fingern seine Handyhülle. T spricht mit ernstem Blick und seine Stimme ist genauso gekräuselt wie seine Stirn. Aus seinem Mund kommen Worte, die ich nicht verstehe, vereinzelte Fetzen tragen einen vertrauten Klang.
Als er auflegt, setze ich mich neben ihn und er zeigt mir seine Großeltern, swipet Bilder von rechts nach links: бабуся і дідусь im Theater, auf dem Markt, auf dem Sofa und am Strand. „Das ist das Schwarze Meer“, sagt T. „Meine Großeltern haben Angst. Aber sie sagen, dass man sich daran gewöhnen kann. Man gewöhnt sich an die Angst.“
Das ist alles, was ich über sie erfahre, er beginnt, über das Schwarze Meer zu sprechen und hört nicht mehr auf. „Weißt du, es ist wirklich so schwarz, so schwarz, dass es deine Beine und Arme verschlingt.“ Und ich zweifle nicht daran. „Meine Katze ist im Krieg gestorben. Dann habe ich angefangen zu lesen“, endet er kurz angebunden, reicht mir ein T-Shirt und frische Socken. Wir schleichen uns durch den Flur, zu den Bädern, dort putzen wir uns die Zähne, dabei schmiert mir T Zahnpasta ins Gesicht.
Als er die Tür abschließt und das Licht ausmacht, fallen mir die Augen zu, kurz bevor mich meine Träume einholen, erscheint T, so muss er als Kind ausgesehen haben, mit faltigem Gesicht und eigenartig müdem Ausdruck, in schwarze Wellen springend und nach Luft schnappend. Dann taucht er auf und an seinen Schläfen klebt nasses Haar.
Am nächsten Morgen entdecke ich T am anderen Ende des Zimmers und kann nicht widerstehen, ihn eine Weile zu beobachten. Er hat sich mit buckeligem Rücken über sein E-Piano gebeugt und Kopfhörer aufgesetzt, um mich nicht zu wecken. Doch manchmal lacht er laut los, singt mit, gibt schrille Töne von sich, rauft sich entrüstet das Haar, wenn der Ton nicht stimmt. Der Morgen ist kalt und ich liege mit ausgestreckten Gliedmaßen auf seinem Bett, warte darauf, dass er mich bemerkt, warte auf sein erstes Wort, doch er würdigt mich keines Blickes, eingenommen von der lautlosen Musik. Erst als ich aufstehe und mir Hemd und Hose überziehe, hebt er den Blick und sieht mich kurz an. Er wirft mir einen Apfel zu und zieht seine Jacke über, wir sprinten zusammen am Pförtner vorbei, dann bringe ich ihn schweigend zur Schule.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sigune Schnabel
Schuld
Ich bin schuld an dem Kälteeinbruch. Mir fällt es schwer, das zu sagen, aber ich muss der Wahrheit ins Auge sehen. Das pflegte schon Alba zu betonen, als ich noch mit ihr zusammenlebte. Alba war überhaupt sehr viel daran gelegen, den Verursacher zu finden, sei es von fauligen Äpfeln, verlorenen Socken oder zu viel Pfeffer im Essen. In den meisten Fällen war das einfach, denn außer uns beiden wohnte hier keiner. Es gab aber auch die weniger eindeutigen Bereiche. Mit „weniger eindeutig“ meine ich: Alba verspürte mehr Gewissheit als ich, dass der Schuldige bereits feststand, um nicht zu sagen: Es herrschte eine empfindliche Uneinigkeit, die ohne Weiteres nicht beseitigt werden konnte. Jedenfalls nicht, indem wir aufeinander zugingen. „Gespräch“ bedeutete nämlich, dass Alba redete und ich zuhörte. Hielt ich mich nicht an diese Regel, wurde der Zustand kritisch zwischen uns.
Warum also gerade ich für diesen Kälteeinbruch verantwortlich bin und nicht etwa Alba oder das Rotkehlchen vor dem Haus? Die Sache ist einfach, denn es gibt mehrere Indizien, die gegen mich sprechen. Ich werde nicht versuchen, mich zu verteidigen. Die Würfel sind gefallen. Wie sagt man so schön: Der Weise versteht, wenn die Zeit reif ist, Einsicht zu zeigen.
Am Wichtigsten ist die Tatsache, dass erst mit meiner Rückkehr aus Winterfeld der Frost sichtbar wurde; vorher, so hatte mein Nachbar beteuert, war die Wiese vor dem Haus nur vom Regen benetzt. Vielleicht, so könnte man einwenden, handelte es sich bloß um eine Korrelation, einen losen, zufälligen Zusammenhang zwischen den Erscheinungen. Auf Begriffe hat Alba immer großen Wert gelegt. Nie durfte der falsche über die Lippen kommen, besonders, wenn es sich um meine Lippen handelte, denn, da war sie sich sicher, von solchen Begriffen wurden sie wund. Falsche Wörter taten nämlich weh. Nicht nur in den Ohren. Sie hinterließen Verletzungen. Sichtbare. Auch auf der Haut. Alba war eine fürsorgliche Frau. Das sagte sie oft zu mir, weil sie dachte, ich würde es sonst nicht bemerken. Sie traute mir selten zu, dass ich auch ohne ihre Hilfe auf gute Gedanken kam, plausible Annahmen in meinem Kopf bildete. Soll ich ihr etwa verübeln, dass sie mir hin und wieder Hinweise gab?
Was die Temperatur betrifft: Alles spricht dafür, dass ich sie mit nach Hause gebracht habe. Wie das passieren konnte? Ganz einfach: Während der Fahrt fröstelte ich. Und zwar ununterbrochen. Hätte sich die Kälte zwischendurch davongemacht, auf einer Raststätte oder kurz vor der letzten Tankstelle, hätte ich noch argumentieren können, es handele sich um eine neue, mir fremde Kälte. Aber ich weiß, dass die anderen Recht haben. Schließlich hat sie kein einziges Mal von mir abgelassen. Die gesamte Fahrt über streifte sie meine Haut. Berührte mich unter dem Pullover. Gut, da kann sie vielleicht auch nicht so leicht hervorkriechen und sich davonmachen, schließlich trage ich meine Kleidung eng. Auf jeden Fall sprechen die Tatsachen gegen eine Korrelation.
Einen Punkt hätte ich fast vergessen: Ich habe immer einen kühlen Kopf bewahrt. Also versteckt sich die Kälte sogar in meinen Zellen. Alba glaubt das nicht, jedenfalls nicht die Sache mit dem Kopf. Sie meint, der Frost liege bei mir tiefer – im Übrigen ist sie deshalb ausgezogen –, aber auch sie irrt sich. Jedenfalls manchmal. Wichtig ist, sie nicht darauf anzusprechen. Sonst geht es heiß her. Und davon will der Kälteeinbruch nichts wissen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Carolina Reichl
Die Verteilung des Glücks
Du drückst das Gesicht in das Kopfkissen und heulst. Du hast die Nachprüfung nicht geschafft und musst das erste Jahr wiederholen. Ich sitze neben dir und streichle dir über den Rücken.
„Ich wäre gerne wie Katrin“, sagst du. „Ihr gelingt immer alles, ohne dass sie sich dafür anstrengen muss. Das ist unfair.“
Ich nicke. Es ist kein Geheimnis, dass das Glück in unserer Familie ungleich verteilt ist. Während du dich mit Mathe, Pickeln und den dummen Sprüchen deiner Mitschüler quälst, schreibt Katrin gute Noten, sieht gut aus und ist beliebt. Sie hat ein lautes, heiteres Lachen und ist umgeben von Menschen, die genauso lachen. Wenn man Katrin sieht, hat man das Gefühl, leben ist einfach, glücklich sein etwas, das jeder auf die Reihe kriegen sollte.
Ich beneide sie, weil sie nichts zu bedrücken scheint.
*
Unsere Mutter hält Katrin die Zigaretten vors Gesicht.
„Du bist erst vierzehn! Versprich mir, dass du das nie wieder machst!“, brüllt sie. Katrin schaut schuldbewusst zu Boden. Mutter dreht sich zu uns.
„Und ihr, ihr fangt erst gar nicht damit an!“
„Versprochen“, sagen wir im Einklang.
Wir gehen in Katrins Zimmer. Sobald die Tür zu ist, zündet sie sich eine neue Zigarette an. Sie schwört uns, dass sie damit nie aufhören wird. Sie liebt Camel Blue. Schon als Kind fand sie die Verpackung toll, wegen der blauen Farbe und des Kamels. Du nimmst ihr die Packung aus der Hand und liest ihr die Warnhinweise vor.
Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen.
Raucher sterben früher.
„Hast du nicht Angst?“, fragst du.
„Wovor?“
„Dass du auch Krebs bekommst.“
Sie schüttelt den Kopf.
„Daran denk ich nicht.“
Wir sitzen auf deinem Bett und schauen aus dem Fenster. Es dämmert. Wir sehen, wie Katrin das Haus verlässt und sich eine Zigarette anzündet. Sie ist die Erstgeborene und das unangefochtene Lieblingskind unserer Mutter. Sie verzeiht Katrin alles, auch dass sie sie immer wieder beim Rauchen erwischt.
„Es wäre schön, wenn wir noch einen Vater hätten, der könnte dann dich oder mich bevorzugen“, sage ich. Du seufzst.
„Weißt du noch, wie er war?“
Du schweigst. Dann: „Schwer zu sagen. Er war damals schon viel im Krankenhaus.“
Du warst fünf, als er starb, ich vier, Katrin sieben. Sie müsste bestimmt die ein oder andere brauchbare Erinnerung an ihn haben, doch ich traue mich nicht, sie zu fragen.
Sie spricht nie über ihn.
Würde ich sie fragen, ob sie sich an ihn erinnern kann, bevor er krank wurde, würde sie vermutlich mit den Schultern zucken und sagen: „Was bringt das schon?“
*
Katrin sitzt mit großen Augenringen beim Frühstück. Ihre Haare riechen stark nach Rauch. Es wundert mich, dass unsere Mutter nichts dazu sagt.
Ich flüstere ihr zu: „Du stinkst.“
Sie gibt mir einen Tritt.
„Au!“, schreie ich.
„Ist was?“, fragt unsere Mutter. Ich schüttle den Kopf.
Ich frage mich, ob sie nicht merkt, dass Katrin sich in der Nacht regelmäßig rausschleicht oder ob sie es nicht merken will. Auf Katrins Unterarmen sind verwischte Stempelreste und Armbänder von den Klubs zu sehen, an denen sie am Vorabend war. Wir sitzen noch bei Tisch, da setzt Katrin sich ihre Kopfhörer auf. Sie dreht auf die oberste Lautstärke. Ich glaube, Katrin braucht den Lärm. In der Stille wird sie nervös. Erst ein Lärmpegel, der es einem unmöglich macht, sich noch auf irgendwas zu konzentrieren, lässt sie innerlich ruhig werden.
Du klopfst an meine Tür.
„Darf ich reinkommen?“, fragst du. Ich nicke. Du setzt dich auf mein Bett.
„Ich mach mir Sorgen um Katrin.“
Du verstehst nicht, wieso sie sich ständig wegschleicht. Du bist mittlerweile 16, du dürftest am Wochenende fortgehen, aber das machst du nicht. Du magst den Lärm, die grellen Lichter und das Gedränge nicht und am allerwenigsten magst du die Vorstellung, die Kontrolle zu verlieren und am nächsten Tag so verkatert wie Katrin zu sein, dass man nichts anderes machen kann, als im Bett zu liegen, als wäre man krank.
Du zögerst, ehe du hinzufügst: „Man sagt so Sachen über Katrin.“
„Was für Sachen?“
Dass sie am meisten Shots trinken kann und bei Partys als erste kotzt. Dass ihre Brüste geil sind und dass ihre Brüste ohne BH gar nicht so geil sind. Dass jeder auf sie steht und dass sie nichts für was Ernsthaftes ist, weil sie sich am Schulklo fingern lässt.
„Glaubst du, das stimmt?“, fragst du. Wir überlegen hin und her.
Wahrscheinlich nur Gerüchte, sagen wir uns dann.
Irgendwann hört das schon wieder auf.
*
Katrin geht nach Wien studieren und ihre Geschichten erreichen uns noch immer.
Als sie das nächste Mal nach Hause kommt, sprichst du sie darauf an.
„Ist doch egal“, sagt Katrin. Sie macht, worauf sie Lust hat und jeder, der darüber ein schlechtes Wort verliert, ist neidisch. Stolz zeigt sie dir Fotos, mit wem sie gerade schreibt.
„Wie lange willst du noch so weitermachen?“, fragst du. „Hast du nicht das Gefühl, dass es reicht? Willst du dir nicht irgendwann einen Freund suchen?“
„Nein“, sagt Katrin. „Und Kinder will ich auch nicht. Ich bleib lieber allein.“
Du verdrehst die Augen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass man ohne Kinder glücklich wird. Du willst zwei, vielleicht sogar drei.
Sie zündet sich eine Camel an und äschert dir vor die Füße.
„Du machst dich damit nur kaputt“, sagst du.
*
Wir kommen zum Mittagessen. Du bist gerade in deine erste eigene Wohnung gezogen.
„Schön hast du’s“, sagen wir. Du wohnst allein. Es gibt Frittatensuppe und Schnitzel. Nach der Hauptspeise sagst du, dass etwas in dir wächst. Du versuchst wiederzugeben, was die Ärzte gesagt haben. Am Montag wirst du mit der Chemo anfangen. Du weißt es schon länger, du wolltest uns nicht beunruhigen.
Ich frage nach Metastasen.
Du sagst: „Nein.“
Dann: „Doch.“
Ich drücke meine Lippen gegen die Faust, ersticke den Schrei mit offenem Mund. Katrin weint in deinen Armen. Du streichelst ihr über den Rücken. Die ganze Trauer, die eigentlich deinen Körper erschüttern sollte, scheint in Katrins gewichen zu sein. Ich denke: Es hätte sie treffen sollen.
Als Katrin aufgehört hat zu weinen, sehe ich genau, wie sie sich zusammenreißen muss, um sich nicht vor deinen Augen eine Zigarette anzuzünden.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Lisa Gollubich
Hädensa®
Eine Hommage an die Hämorrhoiden
„Zwei Mal Hädensa, bitte“, schallte es durch die Apotheke.
Die Apothekerin schaute mich einen Moment lang an. Auch ihre Kollegin von der anderen Kassa war aufmerksam geworden, und auf meine Bestellung folgte ein Moment der Stille.
„Groß oder klein?“, flüsterte sie, indem sie den Kopf vorreckte.
„Groß“, sagte ich trocken.
Zu Hause legte ich eine Packung in die Medikamentenlade und die andere ins Regal im Badezimmer. Der Applikator und die Packungsbeilage kamen direkt in den Müll, denn wir waren ja schon lange miteinander bekannt.
Meine Frau fragte mich, als sie mittags aufgestanden war:
„Hast du die Hädensa gekauft?“
Ich führte sie ins Badezimmer, wo die Packung wie in der Apotheke hübsch drapiert im Regal lag.
„Die andere ist in der Medikamentenlade, Schatz“, sagte ich.
Am Nachmittag saßen wir beim Kaffee zusammen und sie erzählte vom Nachtdienst auf der proktologischen Station. Weil sie Springerin war, war sie auf keiner Station länger als eine Woche. Sie sagte, sie sei froh darüber. Kaum Zeit genug, um sich über irgendwelche Beschwerden Sorgen zu machen.
Für gewöhnlich ist die Proktologie ein unschöner Bereich. Ich erinnere mich noch genau an einen Besuch beim Proktologen, der mir einmal vor vielen Jahren einen schmerzhaften Polypen ausgetrieben hatte. Die schneeweiße Unterlage färbte sich hinter meinem Rücken plötzlich bedrohlich bräunlich-rot, und erst als ich mich umdrehte, sah ich das Unheil, das der Proktologe nonchalant hinnahm wie ein Kanaltaucher. „Alles in Ordnung, Herr Meier!“
„Nächste Woche bin ich wieder auf der Psychiatrie“, sagte meine Frau dann.
Ich war gewissermaßen ihr Supervisor. Alle aufgetretenen Probleme besprach sie zuerst mit mir. Im Grunde bestand ein Problem immer aus einer Unvorhergesehenheit, die eine Anpassungsleistung erforderte. Darin lag die tagtägliche Anstrengung eines Krankenpflegers.
„Meine Hämorrhoiden sind wieder zu spüren“, sagte sie.
„Das ist die Arbeit, Liebling“, sagte ich.
Wenn meine Frau in mehreren, aufeinanderfolgenden Turni auf dem Klo verschwand, wenn die Klotür ohne Spülung aufging, wenn das Händewaschen ausgiebiger wurde, tja, dann wusste ich, was Sache war.
Und auch ich, in der Sukzession, vernahm dann ein leichtes Jucken am Ausgang der Dinge. Ich konnte es zuerst nicht glauben, war das die Fortsetzung meiner proktologischen Vergangenheit?
„Polypen sind keine Hämorrhoiden, Markus“, sagte meine Frau dann.
„Ich habe keine Polypen mehr, wie kommst du darauf?“, schnauzte ich zurück.
Da erzählte mir meine Frau zum hunderttausendsten Mal, wie sie vor gut dreißig Jahren von ihren Hämorrhoiden erfahren hatte.
„Mama hat gleich gesagt: Wenn’s unaufhörlich kratzt, sind das die Hämorrhoiden, mein Schatz.“
Geradezu stolz war meine Frau auf ihre Hämorrhoiden! Als wäre es eine Auszeichnung, ein Verdienst schlechter Gene oder ungünstigen Lebensstils, Krampfadern im Hintern zu haben!
Am späten Nachmittag zog ich mich zurück, um im Bürozimmer zu lesen. Silvia ging ab und zu vorbei und ich warf ihr durch die offene Tür einen giftigen Blick zu. Ich war froh, als sie sich gegen sechs Uhr für die Arbeit fertig machte.
„Wieder die Proktologie!“, seufzte sie vor dem Gehen ins Büro hinein. „Baba!“
Jetzt war ich mir also volle zwölf Stunden selbst überlassen. Ich ging ins Badezimmer und überprüfte die angebrochene Hädensa. Meine Frau hatte sie offenbar schon verwendet, denn etwa ein Zehntel der Tube war ausgedrückt. Dann warf ich einen Blick in die Medikamentenlade: die zweite Hädensa war unversehrt.
Und es begann, es begann tatsächlich zu jucken. Ich streckte mich, schüttelte das linke, dann das rechte Bein, machte eine Kniebeuge und ging in die Grätsche, aber es juckte, juckte weiter! Was nun? Ach, wenn Silvia doch jetzt da wäre!
Ich nahm mein Handy zur Hand und schrieb eine Nachricht.
Ich liebe dich, mein Schatz!
Der Bildschirm blieb dunkel. Wahrscheinlich hatte sie gerade Dienstübergabe.
Mit Erleichterung blickte ich auf die nächste Woche – aber da lauerte schon das nächste Grauen. Wahrscheinlich würde mich Silvia schon am Montag dazu nötigen, in der Apotheke nach Praxiten zu fragen. Und ein paar Stunden später würde ich selbst das nicht abzuschüttelnde Verlangen haben, eine Beruhigungstablette zu nehmen.
Da ging der Bildschirm an.
Ich dich auch, Bärli! Nächste Woche – leider – wieder – Proktologie!
Mir fiel das Herz in die Hose. Ich ging zur Medikamentenlade, nahm die Hädensa heraus und verschwand auf der Toilette.
Benommen lag ich am Abend auf der Couch im Wohnzimmer und ließ mich von einer Naturdoku berieseln. Ich wusste, dass vor dem Wiedersehen mit Silvia noch die ganze Nacht lag. Und was würde sie dazu sagen, dass ich die Hädensa – auch verwendet hatte?
Vor dem Zubettgehen langte ich noch einmal nach der Tube und drückte ein wenig daran herum, damit es so aussah, als hätte ich sie nicht verwendet. Ich schlief so gut, dass mich erst das Türschloss weckte.
„Guten Morgen ohne Sorgen, Schatz!“, rief Silvia beim Hereinkommen in die Wohnung.
„Warum bist du denn so gut gelaunt?“, fragte ich noch schlaftrunken im Türstock erscheinend.
„Die Hädensa ist echt ein Wunderding! Juckreiz ade!“
Betreten stand ich da, und vernahm ein weiteres Kratzen. Ich empfand es als eine große Ungerechtigkeit, dass die Hädensa bei ihr half, und bei mir aber nicht.
„Oh, was ist denn los?“, fragte Silvia. „Ist irgendetwas Schlimmes passiert?“ Und nach einer kurzen Pause augenzwinkernd: „Hast du etwas angestellt?“
Ich gestand ihr die ganze Hädensa-Misere, sie lachte und sagte:
„Ich kenne da jemanden! Da mache ich gleich einen Termin aus!“
Am Nachmittag, nachdem Silvia ausgeschlafen hatte, machten wir uns auf den Weg zu Dr. Schmolli, einer Heilpraktikerin.
„Eigentümlicher Name: Dr. Schmolli! Wer heißt denn bitte so?, fragte ich meine Frau.
„Alle Heilpraktiker haben ihre Eigentümlichkeit“, sagte sie abwinkend.
„Bist du dir sicher, dass das eine vertrauenswürdige Ärztin ist?“
„Nein, Heilpraktikerin, habe ich dir ja schon gesagt.“
Mit einem Hinterwäldlerbus fuhren wir durch eine von Bäumen gesäumte Villenallee. Die Straße endete bei einem Kreisverkehr, der zum Umkehren gedacht war, und gerade an seiner Hinterseite sah ich schon jemanden winken, eine große, blonde Frau mittleren Alters mit halblangem, gewelltem Haar. Ich fühlte unmittelbar eine große Neugierde.
„Hallo Silvia!“, rief sie uns entgegen. „Wieder die Hypochondrie ausgebrochen? Kein Problem für Dr. Schmolli!“
Meine Frau grüßte sie überschwänglich mit einem Bussi links und rechts. Sie hatte mir nie etwas von einer Freundschaft mit einer Schmolli erzählt. Ich ließ mich von den beiden auf die Terrasse leiten. Bald saßen wir auf gemütlichen Sitzmöbeln und Silvia fachsimpelte über die psychologische Dimension ihrer Arbeit.
„Kann natürlich schon verstehen, dass das auch den Partner belastet“, kommentierte Dr. Schmolli.
„Ist natürlich eine Tabu-Körperzone und ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft“
„Es hat ja schon einmal bei jedem gekratzt“
Daran reihten sich Ausführungen darüber, dass man umso häufiger Medikamente verwendet, je leichter verfügbar sie sind, und sie erzählte von ihrem Ex-Mann, der stets zwei Kisten Bier im Keller stehen hatte – was sie selbst zum Trinken verleitet hatte. „Gott bewahre, das waren Zeiten!“, lachte sie.
„Und was sagen Sie dazu, Markus?“, fragte Dr. Schmolli dann.
Ratlos blickte ich von Gesicht zu Gesicht, und sagte schließlich:
„Wer hat denn behauptet, dass ich ein Hypochonder bin?“
Da faltete sich die Doktorin elegant aus dem Sitzmöbel und verschwand im Haus. Ich warf Silvia einen fragenden Blick zu. Sie blieb still und lächelte erwartungsfroh.
Im nächsten Moment erschien Dr. Schmolli in der Terrassentür, ich sah schon das Türkis der Tube blitzen. Es war eine Hädensa, die sie in der Linken hielt.
„Die ist für Sie, Markus“, sagte Dr. Schmolli beim Überreichen.
Kurze Zeit später fuhren wir schon wieder die Allee hinab. Ich wunderte mich, weshalb wir so eine lange Fahrt in Kauf genommen hatten, nur um eine überall erhältliche Hädensa zu bekommen. Aber ich war zugegeben froh über ein eigenes Exemplar.
Als wir nach Hause kamen, beeilte sich Silvia ins Bad. Sie musste sich fertig machen für den Nachtdienst. Ich ließ die Hädensa in der Jackentasche und setzte mich wieder ins Büro, um zu lesen. Hädensa kann warten, dachte ich mir.
Gegen Abend, meine Frau war längst im Dienst, bemerkte ich wieder ein leichtes Kratzen. Ich ging ins Vorzimmer und nahm die Tube aus meiner Jacke. Ihr Design war mir seit so vielen Jahren im Grunde so vertraut wie meine Frau. Die Farbgebung, die altmodische Schrift mit den ungewöhnlichen horizontalen Strichen über dem Umlaut. Und da fiel es mir erst auf: Da stand HEDENSA. HEDENSA statt HÄDENSA. Ich konnte es nicht glauben. Dr. Schmolli hatte mich getäuscht. Und Silvia hatte es gewusst.
Ich ließ die Tube einfach fallen und stapfte ins Bad. Ich schluckte Luft, als ich den Platz leer vorfand, und mit drei weiteren Schritten stand ich im Wohnzimmer bei der Medikamentenlade – l e e r!
Ich musste mich an Ort und Stelle setzen. Schwindlig war mir. Ich dachte an die Nachtapotheke. Welche hatte heute noch einmal Dienst? Sollte ich es mit der Hedensa versuchen oder wirkt ein Placebo nicht, wenn man Bescheid weiß? Und dann kratzte es wieder, es kratze unsäglich.
Da hörte ich mein Handy piepsen. Einen Moment blieb ich wie zum Trotz sitzen. Dann bewegte ich mich langsam auf allen Vieren ins Büro und langte danach, fast krachte es vom Büchertisch auf den Boden.
Bärli, Bärli, bin doch wieder auf der Psychiatrie! Denkst du bitte ans Praxiten? Bitte,
danke, ganz lieb!
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Lisa Schantl
Mosaike
Ein dunkelweißer Lederball rollt die Gasse hinab und die Burschen stürmen hinterher. Laut hallen ihre Tritte von den lehmverkleideten Wänden wider, laut rufen sie sich auf Arabisch und uns etwas anderes zu. „Bonjour, Monsieur!“, „Ca va, Madame?“ Mein beschauliches Französisch hat gelernt, diese Floskeln mit einem Lächeln zu erwidern, die Mundwinkel gerade so hoch angezogen, dass sie nachbarschaftliche Freundlichkeit, aber keine verstehenwollende Nähe, kein ehrlichgemeintes Amusement zeigen. Zu viele aus Palmblättern gebastelte Kamele, zu viele süßgedorrte Datteln wurden mir schon unter die Nase gehalten, wenn ich auch ein lachendes Auge riskierte.
Der Ball stürmt mit der Meute weiter, prallt ab an Schusterläden und Schmieden, Nähwerkstätten und Tischlereien. Verirrt sich in manchen bunt gefliesten Innenräumen, deren glasierter Schein schon lange nicht mehr von den verklumpten Meißeln, den zerborstenen Fasern, den fehlenden Zähnen ihrer Meister reflektiert wird. Die Blumenmosaike vergehen in sich, schön für sich, schön in einer Welt, in der Schönheit meist nur ein Kaufargument ist. „Come inside, more beautiful inside, I have more“ – der Ball rollt.
Auf seinem Weg schreckt er die streunenden Katzen auf, große und kleine, ein- und zwei- und dreifärbige, manche in Gruppen, manche alleine. Er rollt über ihren Lebensinhalt, die Därme und Innereien, die nicht einmal hier von den generationen-gealterten Fleischern und den traditions-veralteten Köchen verarbeitet werden wollen. Müde sehen die Tiere dem Leder nach, der Katzenelan nur noch eine verblasste Erinnerung, zittrig ihre Glieder, wie die der Pferde und Esel, die zu schwer tragen, westliches Geld und heimische Ernten.
„Why don’t you talk to me? Are you afraid?”, verliere ich den Ball aus den Augen, grölt die aufdringliche Männerstimme mich an. Schweigen wird nicht akzeptiert, wird als Schwäche angesehen. Mein nachbarschaftliches Nicken reicht nur für Straßenkinder und Straßenhunde, darüber hinaus habe ich noch kein Mittel für das Sein gefunden.
„Are you afraid?”
Vom ersten Tag an beunruhigt es mich, dass ich mich immer wieder bei dem Gedanken ertappe, froh zu sein, hier nicht allein das Stadtpflaster betreten zu müssen, einen großgewachsenen, robusten und wortgewandten Mann an meiner Seite zu wissen, mich in seinem Schatten klein machen zu können. Klein und unbedeutend. Der Gedanke ist Stickstoff in meinen Atemwegen, ein Kloß aus heißer Luft, er würde mich verbrennen, würde ich ihn zu Ende denken.
Ist es Angst, die diesen Gedanken zu Tage fördert? Hat der grölende Verkäufer mich enttarnt, mein Schweigen richtig gedeutet, mein leeres Lächeln mehr für mich als für ihn interpretiert?
Manchmal, auf den breiteren Straßen, wenn die handgefertigten Teppiche und die naturgegerbten Lederwaren weiter auseinanderrücken, mache ich mich groß, gestikuliere weit, deute auf dieses und jenes, bestimme den Weg, das Ziel. Gehe mit meinen ausgetretenen Sandalen, meiner luftigen Hose, meinem schulterbedeckenden Überwurf selbstbewusst voran, bewusster als sonst, bewusster als in einem Umfeld, in dem das Bewusstsein auch einmal der Freiheit weichen darf. Bewusst bin ich mir aber auch des wachenden männlichen Auges hinter mir, dass die anderen glotzenden Linsen abwendet, das einschreiten würde, wenn aus Augen Hände, Griffe, Greifhände werden würden.
„Are you afraid?“ – Angst, vielleicht, ja vielleicht wirklich, aber wovor?
Was die Aussage des Käufers provoziert, ist das, was das rollende Leder der Jungs nicht ansteuert. Verhüllt in bunt gefärbten Stoffen, wie die Fliesenmosaike schön und still, ist das Unmännliche hier meist unsichtbar, ist in den Räumen hinter den Mosaikaufgängen, in den Werkstätten fernab der Hauptwege, in den Kooperativen, die Arbeit schaffen und Luft nehmen. Schön und still.
Schön und still sind auch die Mädchen, die den spielenden Jungs zusehen. Ihre Augen tiefbraun oder schimmernd grün, lehnen sie in Treppenaufgängen, an Geländern, sitzen sie am Straßenrand, halten sie die schützende Hand ihrer Mutter beim Einkauf von Getreide und Milch. Mitspielen ist ausgeschlossen, die Teilung ist so stark wie die klammernde Nadel im Hijab der Frauen.
Als Kind war ich gewiss alles andere als schön und still. Immer am Erkunden, immer am Austesten meiner Umgebung waren meine Knie stets dreckig und aufgeschlagen, meine Handflächen voll mit Kieselsteinen, Gräsern und Insekten. Gemeinsam mit meinem gleichaltrigen Nachbar grub ich Löcher im Garten (wir wollten Fische darin züchten – wenig erfolgreich), warf ich Bälle über Häuserdächer, veranstaltete ich Autorennen am Wohnzimmerteppich. Ich nahm aber auch Ballettstunden, spielte Flöte und sah den Margariten im Garten beim Wachsen zu.
Wäre ich Walt Whitman, würde ich nun sagen: I contain multitudes.
Ich bin Vieles, die Summe und Differenz meiner Identitäten.
Am Jemaa el Fna gibt es keine Geschichtenerzählerinnen, hinter den Theken der vornehmen Rooftopbars keine Kellnerinnen, in den Musikläden keine Instrumentenbauerinnen. Das Weibliche hüpft nicht über die dampfenden Gerbertöpfe, es verkauft keine Tagines, es mischt keine Berbertees. Im Öffentlichen ist es schön und still, hinter den Fliesenaufgängen ist es Mutter und Ehefrau, Fürsorgerin und Köchin, Gastgeberin und Bettüberzieherin.
Hier, am Markt in der marokkanischen Stadt bin ich hauptsächlich eine weiße Frau mit einem weißen Mann, der vermutlich reich ist, der ein potentieller Kunde ist. Beim Deckenkauf erwartet man, dass ich aussuche und er bezahlt. Als ich einen größeren Teppich ablehne, meint man, ich solle in einen reicheren Mann investieren.
Hier, am Markt, bin ich nicht Viele. Ich bin eine gerundete Tabula Rasa, definiert von den Reflexionen der Menschen um mich herum, ein Spiegelbild des Erzählens, ein Abbild der bunten Mosaike und der schweigenden Mädchen. Für große Gesten bleibt mir hier kein Raum.
Vielleicht liegt aber ausgerechnet im verwinkelten Souk die Antwort auf die Frage nach der Angst. Hier, inmitten des bunten Trubels, der roten, blauen, grünen Stoffe, der ebenso vielfärbigen Gewürze, der vorbeirauschenden Mopeds, der blökenden Esel. Hier, wo mir alles zu eng wird, werde ich mir selbst zu eng. Von außen begrenzt, habe ich vielleicht Angst, dass die Grenzlinien durch meine Poren in mich eindringen, meinen Blutfluss verzerren, meine Gedanken beschränken könnten? Habe ich Angst, mit jedem Dirham auch eine Besonderheit, meine Eigenheit wegzugeben? Nein – denn bald schon werde ich im Flugzeug sitzen, die Beine angewinkelt, wie es mir gefällt, Yoko Tawada lesend, den Stadtlichtern beim Verschwinden zusehend.
Was mir zu eng wird, bin nicht ich. Was mir zu eng wird, sind die Aussichten auf ein selbstbestimmtes, ja vielleicht sogar freies Leben der Frauen, die mich hinter Besen und aus dunklen Nischen anlächeln, die ein paar wenige Schafe um ihre Lehmhäuser treiben. Ich frage mich, ob es die reicheren unter ihnen besser haben – und was Reichtum als Frau bedeuten mag.
Wovor ich Angst habe, ist, dass ich irgendwann diese Lebensvoraussetzungen akzeptieren könnte.
Am Heimweg vom Souk halten wir bei einer von Frauen geführten Patisserie an. Die kunstvoll gestalteten Pralinen leuchten wie die Sterne der Wüste hinein in die langsam dunkler werdende Gasse. Während mir eine junge Frau, vielleicht gleich alt wie ich, die Kreationen erklärt, verweilt eine andere im Geschäftslokal von mir abgewandt, ihren dunkelgrünen Hijab tief ins Gesicht gezogen, keinen Blick riskierend. Als ich später auf der Dachterrasse unseres Riads in die Schokoladenpraline beiße, stelle ich mir das Gesicht der verhüllten Frau vor. Welche Geschichten beherbergt es, wie sieht ihr Leben aus? Ich weiß zu wenig.
Der Ball rollt. Er läuft von Pass zu Pass, wird hin und her gestoßen zwischen Jungenbeinen, zwischen Jungengelächter, zwischen Jungengeschubse und Jungengegröle. Die Mädchen am Straßenrand sehen mich mit großen Augen an. Nur schwer können sie ihren Blick von mir abwenden, nur schwer kann ich meine Lider schließen. Welche Geschichten würden sie mir erzählen, sprächen wir dieselbe Sprache? Wie würden sie ihr Lebensmosaik gestalten?
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Natalie Celesta
Radulescu: Zwischen Boden und Anna
Wenn der Wecker klingelt, ist es kurz nach fünf. Das hat nichts mit der Arbeit zu tun oder so. Anna arbeitet nämlich nicht. Das ist wegen Instagram und weil die alle um fünf Uhr aufstehen, um Sport zu treiben und gesund zu essen und weil das nach fünf Uhr irgendwie ganz schlecht funktioniert. Anna hat das ausprobiert. Ist gescheitert. Jetzt eben noch einmal von vorne. Sie hat auch ihren Freunden davon erzählt und Can wusste, dass es nicht klappen würde. Jetzt sagt er beim gemeinsamen Mittagessen Sachen wie »War mir gleich klar«. Dabei kommt er sich clever und überlegen vor. »Nein, das stimmt nicht, ich glaube, es liegt an meinem Zeitplan. Wenn ich um fünf Uhr aufstehen würde, wäre das ganz anders.« Damit hat Anna unbewusst eine fiese Wette abgeschlossen. So kam das dann mit dem Wecker um fünf Uhr.
Anna reckt sich, gähnt, sinniert ein bisschen. Sie drückt auf »Schlummern«. Can ist auf der Zielgeraden. Aber dann. Anna rauft sich zusammen, sie schlägt Ihre Kim Possible Decke aus Kindertagen zurück und denkt daran, dass für einen Possible nichts unmöglich ist. Das Bett machen gehört auch dazu. Ihre Mutter findet es bestimmt gut, wenn sie sieht, wie Anna endlich ihr Bett macht. Sie wirft Anna vor, faul zu sein und auch ein bisschen depressiv, obwohl das gar nicht möglich ist, denn depressive Leute treffen sich nicht mit ihren Freunden und Anna hat ja Can und da waren schließlich noch Sabrina und Alex. Das Handy klingelt. Es muss Can sein. Er will wahrscheinlich prüfen, ob sie wach ist. Der kann Anna mal. Eigentlich löst der Wecker das klingelnde Geräusch aus, doch nach einer Weile wird Anna wütend, greift sich das Telefon und will Can die Meinung geigen. Niemand reagiert. Es klingelt.
Annas Mutter muss irgendwo eine alte Sportmatte haben. Die war doch so eine Sportmaus, als sie jung war. Anna hat noch nicht gefrühstückt. In den Motivationsvideos kommt das nach dem Workout und es funktioniert nur für den, der sich an alle Spielregeln hält. Auch Can kennt die Regeln und da wäre es ein viel zu großes Risiko, gleich am ersten Tag aus der Reihe zu tanzen. In der Abstellkammer gibt Anna die Suche nach einer Matte auf. Sie trainiert auf dem Boden. Ein bisschen aufwärmen, Hampelmänner, danach ein paar Sit-ups. So schwer kann das nicht sein. Annas unterer Rücken schmerzt, der Boden bohrt sich hartnäckig bei jedem neuen Sit-up in ihre Knochen. Anna ist dünn und da ist nichts als Haut zwischen Boden und Anna. Nach fünfzehn Minuten gibt sie auf. Nein. Nach fünfzehn Minuten ist sie fertig, denn ein kurzes Training ist besser als gar keines. Genauso wird sie es Can erzählen. Der denkt, er wäre etwas Besseres, weil er in einem Fitnessstudio angemeldet ist und dort auch regelmäßig hingeht. Anna findet, da gehen nur Prolls hin, die Frauen in Clubs mit ihren Muskeln beeindrucken wollen und das ist irgendwie peinlich und auch nicht mehr zeitgemäß, daher braucht sich Can gar nicht so wichtig vorzukommen.
Das Essen besteht aus Haferflocken, die Anna in Hafermilch eingeweicht und dann in die Mikrowelle geschoben hat. Zum Schluss sollen Bananen und Nüsse drüber. Annas Mutter ist aufgewacht und macht sich ihr eigenes Frühstück zurecht. Sie nimmt Annas Essen aus der Mikrowelle, verzieht ihr Gesicht zu einer angeekelten Grimasse und fragt Anna, ob sie nicht lieber ein Brot mit Käse und Salat möchte. Sie würde ihr eins zubereiten. Ihre Mutter stört immer zur falschen Zeit. Ihre Mutter glaubt, sie hätte den tollsten Job. Ihre Mutter wirft Anna vor, dass sie das Studium abgebrochen hat und jetzt auf einer langen Warteliste steht. Ihre Mutter sagt Anna, sie soll nicht in Schlabberhosen rausgehen. Ihre Mutter steht in der Küche und will ihr Käsebrot machen.
Anna reißt die Schüssel mit den lauwarmen Haferflocken an sich und stürmt auf den Balkon, wo sie ganz ohne Bananen und Nüsse ihr absolut nicht schmackhaftes Frühstück verzehrt. Jetzt kann sie Can erzählen, welche Opfer ihr neuer Lebensstil fordert. So haben die Geschichten der ganz Großen doch auch angefangen. Sänger, Schauspieler oder Chefs von irgendwelchen Konzernen erzählen den Pressemenschen ständig, wie schwer der Anfang war. Vielleicht mussten die auch beschissenes Frühstück essen und »Ich war obdachlos und habe gedealt« ist nur eine geschickt gewählte Metapher dafür.
Anna fühlt sich schlapp. Sie ist es nicht gewohnt, so früh aufzustehen, aber sie möchte nicht daran erinnert werden. Mit bunten Finelinern verfasst sie ein persönliches Manifest für den heutigen Tag und dazu eine lange Liste mit Dingen, die es zu erledigen gilt. »Du siehst müde aus Spätzchen.« Annas Mutter ist unnötigerweise auf den Balkon gegangen, um eine Sofadecke in der Luft zusammenzufalten und die dunklen Schattierungen unter Annas Augen eingehend zu mustern. Auf Annas Liste steht nun »Mama aus dem Weg gehen«. Sie kreist den Stichpunkt rot ein, weil rot eine alarmierende Farbe ist. Anna stellt sich vor, wie sie einen großen roten Kreis um den Körper ihrer Mutter zieht.
Wenn Can jetzt wüsste, dass Anna in den Park geht, würde er bestimmt Augen machen. Anna hängt sonst eher in der Stadt herum oder zu Hause, weil zu Hause Bildschirme warten und in der Stadt Menschen, die sich wie auf Bildschirmen bewegen und denen Anna zusehen kann, beim Herumstehen oder Beeilen. Auf einer Parkbank bekommt sie Gesellschaft von einem älteren Mann. Er gibt sich keine Mühe, unauffällig zu sein, während er versucht, einen Blick auf die bescheidenen Anfänge von Annas Kunstwerk zu erhaschen. »Studieren Sie hier?«, fragt er. Anna lügt sich ein Ja aus dem Ärmel. »Ach und sie studieren dann Kunst?« Jetzt sitzt Anna in der Falle. Sie weiß nicht, welche kunstbezogenen Studiengänge es hier gibt und wie glaubhaft die Lüge sein muss, um von dem Alten in Ruhe gelassen zu werden. »Nein Jura, das hier mach ich nur so zum Spaß.« Das findet der Alte ganz reizend und holt tief Luft. Wenn ältere Menschen tief Luft holen, wollen sie immer ihre Lebensgeschichte erzählen, denkt sich Anna. Sie hat das schon ein paar Mal erlebt. Meistens möchte sie aufstehen und gehen, doch aus schlechtem Gewissen bleibt sie trotzdem sitzen, obwohl ihr nach Zuhören absolut nicht zumute ist.
Der Alte hat Salvador Dalí einmal persönlich getroffen. In Figueres, als er schon echt im Eimer war und im Rollstuhl durch die Gänge seines Museums geschoben wurde, um den Besuchern zu beweisen, dass es ihn wirklich gibt, so richtig zum Anfassen. Also nur theoretisch. Vermutlich wartet der Alte schon lange darauf, diese Geschichte endlich einem Fremden zu erzählen. Anna zeigt sich beeindruckt. Dabei sieht sie sich seine Schlupflider genau an. Wenn man das macht, denken andere, man würde ihnen in die Augen sehen und gebannt zuhören, dabei bemitleidet Anna den Mann für seine Krähenfüße und die getrocknete Tränenflüssigkeit in den Augenwinkeln. Irgendwann wird auch Anna so alt sein. Übers Altwerden stellt sich Anna viele Fragen. Zum Beispiel weiß sie dann nicht mehr, wie sie das mit dem Sex machen soll. Sie müsste Ihre Sexualität in einen Sack stecken und erst im nächsten Leben wieder auspacken. Also falls die Buddhisten recht behalten mit dieser Wiedergeburt. Über Buddhisten hätte der Alte bestimmt auch etwas zu sagen. Die Alten wissen zu allem etwas zu sagen. Er spricht immer noch von Dalí. Langsam reicht es auch. War der nicht geisteskrank? Etwas über geisteskranke Künstler zu lernen, ist jetzt ganz schlecht für Anna. Sie erhebt sich von der Bank und bittet um Entschuldigung.
In etwa zwei Stunden ist sie mit Can verabredet. Ihm wird sie erzählen, wie erfolgreich ihr Morgen war und wie sie sogar Muße zum Malen gefunden hat. Menschen mit gesundem Lebensstil haben nämlich Hobbys. Und zwar echte, also nicht Serien suchten oder irgendetwas anderes, bei dem man sein Gesicht an einen Bildschirm heftet. Als Kind konnte Anna viele Komplimente für ihre Pferdezeichnungen ernten. Seither geht es mit der Kunst nur noch bergab. Einmal, vor wenigen Monaten, wurde Anna auf eine Vernissage eingeladen. Dort hat sie es sich zur Aufgabe gemacht bei jedem Werk die Augen weit aufzureißen, intensiv auf die Bilderklärung zu starren und sich anschließend auf die Lippen zu beißen und bejahend zu nicken. Seither benutzt Anna das Wort „Vernissage“ so oft wie möglich. Französisches Vokabular zu verwenden ist generell eine gute Idee, findet Anna. Denn Can war nie auf einer Vernissage und Französisch spricht er auch nicht.
Ein dicker Junge mit großen, dunkelbraunen Can-Augen tritt ihr gegen das Bein, während sie nach einer geeigneten Stelle zum Malen sucht. Wenn Anna als Kind so dick gewesen wäre, hätte ihre Mutter sie auf Diät gesetzt. Sie wartet noch auf eine Entschuldigung des Jungen für den Tritt. Es kommt keine. »Lieber krieg ich keine Kinder.« Anna nuschelt in ihren Schal und ein paar Teenager werfen ihr amüsierte Blicke zu. Endlich findet sie einen Platz am Teich, wo das Wasser dreckig ist und die Enten sich gegenseitig besteigen, wenn keiner hinsieht. Irgendwann würde Anna sie erwischen, ein Foto vom Gesichtsausdruck des Erpels schießen und es später an eine dieser Webseiten schicken, die manchmal Rankings für die lustigsten Tierbilder machen. Ihr Kunstwerk muss dringend fertig werden, denn ohne Bild hat sie keinen handfesten Beweis für ihren produktiven Vormittag. Bisher finden sich lediglich ein gelber Hintergrund und eine undefinierbare Form, die vielleicht als Kopf durchgehen würde auf ihrer Leinwand. Sie verpasst dem Kopf einen Schnabel, zwei unrealistisch tief sitzende Augen und einen Smoking. Dalí würde das gut finden. Es ist Viertel nach zwölf.
»Wo bleibst du?« Cans Ungeduld zeigt sich in seiner Whatsapp-Nachricht. Er kann es nicht ausstehen, wenn Menschen unzuverlässig sind. Insbesondere, wenn Anna unzuverlässig ist, obwohl er selbst zugibt, dass er sich von ihr nicht viel zu erwarten hat. Gedankenversunken starrt Anna auf den Teich und setzt aus den verschwommenen Wortfransen in ihrem Kopf eine Antwort zusammen. Sie ruft ihn an. Hört ihn auf der anderen Leitung schimpfen. Was Can kann, kann Anna auch.
»Ganz ehrlich, ich hab Besseres zu tun! Ich hab heute schon Sport gemacht und total ekliges Frühstück gegessen. Außerdem hab ich mich mit einem netten alten Mann im Park unterhalten, da kann ich doch wegen dir nicht einfach unhöflich verschwinden. Ich musste mich mit einem nervigen kleinen Kind rumschlagen. Und ich hab mich weitergebildet. Über Dalí. Gemalt hab ich auch. Es ist richtig gut geworden, aber von so was hast du keine Ahnung!«
Anna legt auf, ehe Can ausreichend Luft holen kann. Der kann Anna mal. Sie packt ihre Malsachen zusammen und macht sich auf den Heimweg. Auf dem Sofa zieht sie in Gedanken rote Kreise um ihre Mutter, die nun um sie herum schleicht und Fragen zu ihrem Parkausflug stellt. Die kann Anna mal. Anna schläft.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jürgen Artmann
Fliegende Hirsche
Ich erinnere mich an das Drachenfest. Es fand immer an jedem zweiten Sonntag im Oktober auf den Wiesen in der Talaue statt. Ganze Scharen von Kindern ließen zusammen mit ihren Eltern Drachen steigen.
Heute wandere ich durch das Elsass und sehe einen Hirschkäfer auf dem Waldweg sitzen. Ein imposantes Insekt. Hirschkäfer heißt im Französischen cerf-volant – fliegender Hirsch. Aber auch der Flugdrache heißt im Französischen cerf-volant. Während deutsche Kinder also Drachen steigen lassen, lassen französische Kinder Hirsche fliegen.
Meine Söhne kommen mir sofort in den Sinn. Als beide noch klein und süß waren. Und das Drachenfest in meinem damaligen Wohnort. Ich denke an sie auf meinem Wanderweg, auf dem ein kleiner fliegender Hirsch sitzt. Oder ist es ein Miniatur-Drache? Furchterregend genug sieht er aus, und urplötzlich hebt er ab. Dabei brummt er in einer so tiefen Frequenz, als ob er ein kleiner Hubschrauber mit Rotorschaden bei der Notlandung wäre. Ich kann erahnen, wie anstrengend dieser Fluchtflug für ihn sein muss. Er fliegt auf Augenhöhe an mir vorbei und ich bin froh, dass er kein Feuer speit.
Wir wandern zu dritt im Schatten des Waldes. Chemin facile – die leichte Strecke, stand auf dem Schild. Es geht über Stock, nein, eigentlich sind es herausstehende Wurzeln, und über Stein. Aimée hat Wanderstöcke dabei, mit denen sie sich abstützen kann. Ich muss manchmal die Hände zu Hilfe nehmen. Kraxle mehr als zu wandern. Ich möchte nicht den schwierigen Weg sehen. Ich wollte nur wandern, nicht klettern.
Mit welcher Freude haben wir Drachen steigen lassen, meine Söhne, meine Frau und ich.
Siebenundzwanzig Kilometer durch Elsässer Weinberge zu wandern wäre kein Problem gewesen. Aber dieser leichte Weg hat es in sich. Aimée spricht seit zwölf Kilometern kein Wort mehr. Sie hat Probleme mit dem linken Fuß. Sie versucht, beim Wandern zu meditieren und die Schmerzen damit zu verdrängen. Immer wieder reist ein wenig die Distanz zu ihr ab und wir warten auf sie. Sie beißt auf die Zähne, will und kann nicht aufgeben. Als Trevor und ich stehen bleiben und uns nach ihr umdrehen, überquert zwischen uns eine Blindschleiche den Weg.
„Habt ihr die kleine Schlange gesehen?“, fragt Aimée.
„Das war keine Schlange“, sage ich. Es war eine Blindschleiche aus der Familie der Schleichen. Und das sind wiederum Reptilien, bei denen die Beine verkümmert sind. So wie gefühlt bei mir nach siebenundzwanzig Kilometern. Wir haben nur noch zwei Kilometer vor uns bis zu unserem Ziel, einer Herberge in einem kleinen Weindorf im Elsass. Aber lieber würde ich jetzt wie ein fliegender Hirsch durch die Lüfte schweben, statt ins Dorf abzusteigen.
Trevor gibt mir recht. Eine Blindschleiche ist keine Schlange und sie ist auch nicht blind. Ich bin es, der manchmal blind ist, für die Schönheit der Natur. Die Schuppen der Blindschleiche blenden ihre Betrachter. Sie ist also eher eine blendende Schleiche. Verblendet auch mich und macht mir Hoffnung auf eine erholsame Wanderung, bevor ich siebenundzwanzig Kilometer Kraxeln in den verkümmerten Beinen spüre.
Aimée sagt, sie habe gerade kein Netz, aber sie würde das später googlen. Sie ist beeindruckt, was wir im Bio-Unterricht in der deutschen Schule gelernt haben. In ihrer französischen Schule hätten sie das nicht erfahren. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das aus der Schule weiß. Trevor und ich kommen einfach vom Land. Da gab es massenhaft Blindschleichen.
Wir kommen an einer der vielen Burgruinen vorbei. Leider hatte es hier im Mittelalter gebrannt, steht auf einem Schild. Vermutlich war ein feuerspeiender Drache der Auslöser gewesen, phantasiere ich. Ich wünsche es mir fast, irgendetwas Spannendes muss doch hier im Wald passiert sein.
Ich wäre jetzt gern ein fliegender Hirsch und würde es auch hinnehmen, wenn sich mein Fluggeräusch erschöpft und laut anhören würde.
Später sonnt sich die Blindschleiche auf einem Felsvorsprung, als der Hirschkäfer neben ihr landet.
„Hast du die großen Zweibeiner auch gesehen?“, fragt er die Schleiche.
„Ja“, antwortet sie. „Aber sie stören mich nicht. Sie lassen sich einfach blenden und ziehen irgendwann weiter.“
Die beiden grinsen sich an. Ein kleiner Wind kommt auf. Sie vertreiben sich die Zeit und lassen einen kleinen Papierdrachen steigen.
Das Leben wiederholt sich, nur aus anderer Perspektive. Fliegende Hirsche? Als Kind in Deutschland habe ich Drachen steigen lassen. Nach Jahren der Pause wieder als Vater. Als meine Söhne Kinder waren. Blindschleichen habe ich gejagt. In meiner Kindheit gab es sie noch zahlreich, aber sie scheinen heute fast verschwunden.
Ich stelle mir vor, ich fange einen echten Hirsch mit einem Lasso am Geweih. Ein kräftiges Tier. Doch als ein starker Wind aufkommt, ja fast ein Sturm, hebt er ab, schwebt über mir. Ich brauche meine ganze Kraft, ihn zu halten.
Ich google das Drachenfest in der Talaue. Meine Söhne sind längst erwachsen, doch ich werde sie fragen, ob sie wieder Hirsche mit mir fliegen lassen wollen. Am nächsten zweiten Sonntag im Oktober.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Laura Kind
Freibad.
Ich erinnere die Sommer in unserer Stadt als einen langen Freibadbesuch. Und ich erinnere Lena, die in jedem dieser Sommer auftaucht, bis die Erinnerung nur noch ein Landschaftsportrait ist, von einer Liegewiese und einem Pool, aber keine Lena weit und breit zu sehen ist. Wenn ich es recht bedenke, war Lena eine Saisonfreundin. So wie die Eisdielen in der Fußgängerzone im September ihre Schaufenster beklebten, und erst im Mai wieder öffneten, bestand unsere Freundschaft aus langen Tagen im Freibad und Limo auf einem Parkplatz.
Das Freibad liegt oben auf dem Hügel, auf der einen Seite an Wiesen angrenzend, auf der anderen Seite die Hochhaussiedlung, in der auch Lena wohnte. Die Leute sagen, dass es hier ständig regnet, aber so ganz stimmen kann das nicht, denn sonst hätte ich nicht all diese Erinnerungen an das Freibad, in dem ich meine Sommer verbrachte, in dem ich schwimmen lernte, in dem ich meinen ersten Kuss bekam und einen allergischen Schock von einer Biene, weshalb ich diese kleinen Fläschchen mit mir herumtrage, deren Beipackzettel ich nie richtig durchgelesen habe. Wenn es also nicht regnete, wie die Leute behaupten, schmorte die Stadt in ihrem eigenen Saft. Ich saß in der Schule, wir hatten Deutsch, Bio oder Physik, und unsere Schweißperlen tropften zu Boden, wo sie direkt wieder verdampften. Nach der Schule packten wir unsere Taschen, quetschten uns in den Bus zum Freibad und wurden allesamt an der Endhaltestelle hinausgepresst. Wir strömten durch die Pforten des Freibads, Schülerströme, die kurz um einen Kiosk und ein Kassenhäuschen mäanderten, um schließlich in dem Schwimmbecken zu münden, wo sich der Strom perlend in Lachen und Schreien auflöste.
Es war der Sommer, bevor Lena aus meinen Erinnerungen verschwand. Ich saß am Beckenrand und tauchte die Füße ins Wasser, bis die halbe Stunde rum war, die das Eis in meinem Bauch brauchte, um nicht mehr den Kreislauf zu belasten. Das Licht und die Wellen marmorierten die Wasseroberfläche und ich streckte die Hand aus, um meine Oberschenkel mit Poolwasser zu kühlen. Die Wassertropfen blieben dort kurz als Perlen sitzen, bevor die Sonne sie wieder aufklaubte. Lena und ich waren schon eine Weile hier, denn in der Schule gab es hitzefrei und nach einer Stunde Englisch und einer Stunde Physik durften wir gehen. Die Sonne stand hoch und es war so heiß, dass einem ganz schummrig wurde. Lena sprang immer wieder neben mir ins Wasser und kletterte wieder hinaus. Dabei schrie sie jedes Mal auf. Lena hatte etwas Lautes an sich, das man nicht so leicht ignorieren konnte. Sie war nicht sonderlich beliebt und auch nicht gut in der Schule, obwohl sie oft zuhause blieb um zu lernen, wie sie sagte. Sie war schon einmal sitzengeblieben und die Lehrer baten ihre Mutter regelmäßig zum Gespräch, zu dem sie nicht kam, weil Lena die Briefe im Mülleimer verschwinden ließ. „Wird schon klappen“, hat sie schulterzuckend gesagt, als ich sie einmal danach fragte. Lena sprach selten mit den anderen aus der Klasse, sondern stellte sich in der Pause zu den Rauchern aus der Oberstufe vor die Schule. Und auch mit mir sprach sie selten in der Schule, so als ob unsere Freundschaft nur im Freibad und nach der Schule stattfinden dürfte.
Ich hatte nun schon lang genug am Beckenrand gewartet, stand auf und lief zur Leiter. Der Boden brannte unter den Fußsohlen. Ich stieg die Leiter Schritt für Schritt hinunter und wunderte mich, dass meine Haut nicht im Kontakt mit dem kalten Wasser zischte, wie eine heiße Pfanne, auf die man Wasser laufen lässt, damit sie schneller abkühlt. Als das Wasser meinen Bauch erreichte, blieb ich schaudernd stehen. „Jetzt stell dich nicht so an!“ Lena stand neben mir an der Leiter und lachte. „Es ist aber kalt!“ – „Meine Güte!“ Ich spürte, wie sich meine Hände von den Griffen der Leiter lösten und ich das Gleichgewicht verlor. Ich fiel rückwärts ins Wasser und tauchte unter. Als ich wieder auftauchte, schwamm Lena neben mir. „Komm, und jetzt Wettschwimmen!“
Nach einer Weile fing es schrecklich an zu regnen. Wir schwammen gerade an den Rand, als das erste Donnergrollen heranrollte. Kurz darauf brach der Himmel auf und wir nahmen jetzt erst die Nässe wahr, die sich anders anfühlte als die im Schwimmbecken. „Komm mit!“, rief Lena und wir packten unsere durchweichten Handtücher und Taschen und liefen los. Ich war noch nie zuvor bei Lena gewesen, was mich nicht störte. Wir hatten ein großes Haus und meine Eltern hatten es gern, wenn wir Gäste bekamen.
Hereingespült von dem Unwetter, hinterließen wir kleine Seen im Wohnungsflur. Lena legte den Finger auf die Lippen. „Kann sein, dass Alexandra schläft.“ Lenas Mutter arbeitete im Krankenhaus. Nach einer langen Nachtschicht lag sie auf dem Sofa, so als könnte sie sich nicht dazu entschließen, wirklich ins Bett zum Schlafen zu gehen, und harrte in einem Zwischenzustand aus, aus dem sie leicht wieder aufschreckte. Als sie uns jetzt bemerkte, richtete sie sich auf und strich sich den Schlaf aus Augen und Mundwinkeln. „Möchtet ihr etwas essen? Ich kann Pommes holen!“, schlug sie vor und ich war froh, denn zu den Pommes sind wir bei dem Unwetter im Freibad nicht mehr gekommen. „Ach, ihr seid ja ganz nass!“ Ihr Blick irrte zum geöffneten Fenster und zu der Wasserlache auf dem Fensterbrett. „Ach herrje. Ich mach das gleich weg.“
Als es aufhörte zu regnen, liefen Lena und ich zum Büdchen und kauften Currywurst, Pommes und Fanta. In die Pfützen war das Blau des Himmels gefallen und ich fühlte mich unbesiegbar, wie ich Hand in Hand mit Lena hineinsprang, das Wasser aufspritzte und das Blau zerbarst. Ich bekam eine Hose und ein T-Shirt von Lena und wartete mit ihr und Alexandra vor dem Fernseher, bis meine Mutter mich abholte. Lenas Hose war mir viel zu groß und ich war froh, dass ich mich setzen konnte, damit ich sie nicht mit der Hand halten musste. Das T-Shirt war am Bauch etwas kürzer und es waren kleine Strasssteine draufgeklebt. An einigen Stellen waren dort, wo Strasssteine sein sollten, dunkelgraue Punkte. Ich weiß nicht mehr genau, was im Fernsehen lief, aber ich erinnere noch, dass wir oft lachten, und dass Lena die Titelmelodien jeder Serie mitsingen konnte.
Als meine Mutter mich abends abholte, machte Alexandra ihr die Tür auf. Meine Mutter lächelte und bedankte sich, blieb dann im Flur stehen, und betastete ihre Kette, als müsste sie kontrollieren, dass sie noch an ihrem Platz war. Alexandra bot Getränke an. Ich sah meiner Mutter dabei zu, wie ihre Zunge nach einer Antwort tastete, aber nichts, was Alexandra ihr anbot, schmeckte ihr. „Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser?“ Die Minuten danach saßen Lena und ich in dem Zimmer, das sie sich mit ihrem kleinen Bruder teilte und sprachen über Lenas Freund, den sie bald küssen wollte. Ihr Freund, das heißt, der Junge, mit dem sie manchmal am Hoftor lehnte, ging auf die Realschule und war zwei Jahre älter als wir. Man sah Lena ihr Alter nicht an, weil sie sich schminkte und Buffalos trug, die sie größer wirken ließen.
Lenas Wohnung war hellhörig. In diesem Moment kam mir bei den dünnen Wänden die Stille aus dem Wohnzimmer aufdringlich laut vor, genau wie Lenas Stimme, wie sie von ihrem Freund erzählte. Nach einer Weile steckte meine Mutter den Kopf zur Tür herein: „Julia, kommst du? Wir wollen jetzt gehen.“ Und dann zu Alexandra gewandt: „Hat mich sehr gefreut, Sie mal kennengelernt zu haben. Und vielen Dank für das Wasser. Tschüss Lena.“ Alexandra stand dort im Flur und lächelte so, als dachte sie, dass sich meine Mutter tatsächlich über die Bekanntschaft gefreut hätte. Ich sah Lena an und folgte ihrem Blick, der an den eigenen Fußspitzen klebte. Auf der Rückfahrt im Auto sprach ich kein Wort mit meiner Mutter.
Ich war noch einmal bei Lena zuhause. Ins Freibad gingen wir immer noch, aber selten allein. Es wurde erst eine größere, dann eine andere Gruppe, mit der ich ins Freibad ging, bis wir irgendwann gar nicht mehr gingen.
Letztens wurde mir bei Instagram Lenas Account angezeigt. Er ist nicht privat, ich kann ihre Bilder sehen, ohne ihr eine Follower-Anfrage stellen zu müssen, die ich mich nie getraut hätte abzusenden. Ihre Haare sind jetzt dunkel gefärbt. Auf einem der Bilder hält sie zwei Kinder an der Hand. Vorne sieht man den ausgestreckten Arm und die Gesichtshälfte eines Mannes. Im Hintergrund leuchtet ein Strand weiß und türkisblau.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stefanie Adamitz
Unter der Haut
Ein Unfall ist wie durch ein unsichtbares Tuch gleiten, sagte Susa.
Jedes Mal wieder.
Du siehst es nicht, aber wenn es sich auf deinen Körper presst,
erschrickst du so sehr, dass es dir vorkommt, als sei es aus Blei,
als seien Nägel draufgesteppt,
so sehr schmerzt es auf der Haut, so sehr drückt es dir auf Leib und Gemüt.
Du bist so verletzt und wund in dem Moment,
wo du nichtsahnend den Weg lang spazierst und wieder
verwirrt und verwickelt
in einem solchen Tuch gelandet bist.
Gestürzt sind sie erst, als es wieder schön war,
als sie so entspannt waren wie seit Monaten nicht mehr.
Den Blick auf die Felder, den Kanal.
Keine Autos, nur ein Dorf,
so schön.
Die fremde Frau hatte ihre Hand gehalten, bis der Krankenwagen kam,
Engel hat sie sie genannt.
Auf französisch alle Körperteile benennen, die wehtun.
Ellbogen heißt coude lernt sie, auch was Fuß und Speiche und reingesteckt heißen.
Tausendmal hat sie‘s ihrem Kind gesagt, tausendmal, doch sie flucht nicht,
sie hofft nur, dass es dort, im anderen Krankenwagen bei ihm,
ihrem zarten kleinen Kind,
keine Überraschungen geben wird.
Jedes dieser Tücher wird weicher, während du hindurchschreitest.
Aus Blei wird blau, es färbt dein Gesicht, deine Knie.
Aus spitz wird stumpf, du schläfst nicht, du weißt noch nicht, wie es weitergeht.
Aus dem Schreck kämpfst du dich stoisch durch jeden Tag
die Fortschritte in der Ferne sichtend.
Fast durchsichtig sind die Tücher dann,
du denkst vielleicht, du bist längst durchgeschritten,
und du denkst, das, was dich noch hält, sind nur noch
die letzten Tuchreste auf deiner Haut.
Sie heilen, sie beide, und sie fahren weiter,
dahin, wo alles anders ist.
Die blauen Flecken sind fast verschwunden,
die Wunden im Gesicht und am Fuß
nur noch rote frische Haut, die in der Sonne glänzt.
Die Leute starren nicht mehr,
beinahe sieht sie wieder aus wie irgendein Mensch.
Da fängt das Beben an, das sie nicht zuordnen kann.
Ihr Körper hält sie nicht mehr, aufgebracht und müde, will sie schlafen, aber rennt durch die Wohnung.
Susa sagt, die Tücher wandern weiter,
unter die Haut,
sie müssen einmal durch dich durch.
Du schaust sie fragend an.
Du verstehst nicht.
Sie sagt, der bleierne Schlag und seine blaue Erinnerung,
der Durchmarsch ins Mark und der Weg dort hinaus,
das ist der ganze Weg und er muss gegangen werden.
Tuchteilchen unter ihrer Haut, sie treiben und triezen.
Inkognito, mit fremdem Namen,
reisen sie in ihr versteckt.
Außen normal und im Innern der Schreck.
Sie sprechen nicht, sie sind nicht aussprechbar.
Niemand sieht sie, doch sie spürt sie wandern,
sie spürt sie klopfen.
Einmal durch dich durch, komplett,
hat Susa gesagt. Und,
dass sie sie jetzt sehen kann,
sie sitzen in deinem Psoas und trinken Kaffee.
Morgen gehst du zu ihnen, sagt Susa.
Sagst danke und tschüss
und jagst sie hinaus.
Dann hält sie dich fest, so fest,
dass heute und morgen wieder wie Wege erscheinen,
ihr Herzschlag, der hilft, durch Tage zu gleiten.
Verwirrt und verwickelt
vor und hinter und in deiner Haut.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at