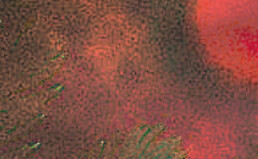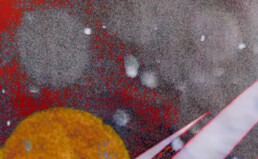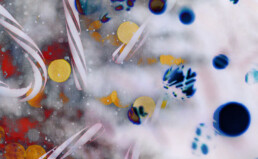freiTEXT | Jürgen Artmann
Fliegende Hirsche
Ich erinnere mich an das Drachenfest. Es fand immer an jedem zweiten Sonntag im Oktober auf den Wiesen in der Talaue statt. Ganze Scharen von Kindern ließen zusammen mit ihren Eltern Drachen steigen.
Heute wandere ich durch das Elsass und sehe einen Hirschkäfer auf dem Waldweg sitzen. Ein imposantes Insekt. Hirschkäfer heißt im Französischen cerf-volant – fliegender Hirsch. Aber auch der Flugdrache heißt im Französischen cerf-volant. Während deutsche Kinder also Drachen steigen lassen, lassen französische Kinder Hirsche fliegen.
Meine Söhne kommen mir sofort in den Sinn. Als beide noch klein und süß waren. Und das Drachenfest in meinem damaligen Wohnort. Ich denke an sie auf meinem Wanderweg, auf dem ein kleiner fliegender Hirsch sitzt. Oder ist es ein Miniatur-Drache? Furchterregend genug sieht er aus, und urplötzlich hebt er ab. Dabei brummt er in einer so tiefen Frequenz, als ob er ein kleiner Hubschrauber mit Rotorschaden bei der Notlandung wäre. Ich kann erahnen, wie anstrengend dieser Fluchtflug für ihn sein muss. Er fliegt auf Augenhöhe an mir vorbei und ich bin froh, dass er kein Feuer speit.
Wir wandern zu dritt im Schatten des Waldes. Chemin facile – die leichte Strecke, stand auf dem Schild. Es geht über Stock, nein, eigentlich sind es herausstehende Wurzeln, und über Stein. Aimée hat Wanderstöcke dabei, mit denen sie sich abstützen kann. Ich muss manchmal die Hände zu Hilfe nehmen. Kraxle mehr als zu wandern. Ich möchte nicht den schwierigen Weg sehen. Ich wollte nur wandern, nicht klettern.
Mit welcher Freude haben wir Drachen steigen lassen, meine Söhne, meine Frau und ich.
Siebenundzwanzig Kilometer durch Elsässer Weinberge zu wandern wäre kein Problem gewesen. Aber dieser leichte Weg hat es in sich. Aimée spricht seit zwölf Kilometern kein Wort mehr. Sie hat Probleme mit dem linken Fuß. Sie versucht, beim Wandern zu meditieren und die Schmerzen damit zu verdrängen. Immer wieder reist ein wenig die Distanz zu ihr ab und wir warten auf sie. Sie beißt auf die Zähne, will und kann nicht aufgeben. Als Trevor und ich stehen bleiben und uns nach ihr umdrehen, überquert zwischen uns eine Blindschleiche den Weg.
„Habt ihr die kleine Schlange gesehen?“, fragt Aimée.
„Das war keine Schlange“, sage ich. Es war eine Blindschleiche aus der Familie der Schleichen. Und das sind wiederum Reptilien, bei denen die Beine verkümmert sind. So wie gefühlt bei mir nach siebenundzwanzig Kilometern. Wir haben nur noch zwei Kilometer vor uns bis zu unserem Ziel, einer Herberge in einem kleinen Weindorf im Elsass. Aber lieber würde ich jetzt wie ein fliegender Hirsch durch die Lüfte schweben, statt ins Dorf abzusteigen.
Trevor gibt mir recht. Eine Blindschleiche ist keine Schlange und sie ist auch nicht blind. Ich bin es, der manchmal blind ist, für die Schönheit der Natur. Die Schuppen der Blindschleiche blenden ihre Betrachter. Sie ist also eher eine blendende Schleiche. Verblendet auch mich und macht mir Hoffnung auf eine erholsame Wanderung, bevor ich siebenundzwanzig Kilometer Kraxeln in den verkümmerten Beinen spüre.
Aimée sagt, sie habe gerade kein Netz, aber sie würde das später googlen. Sie ist beeindruckt, was wir im Bio-Unterricht in der deutschen Schule gelernt haben. In ihrer französischen Schule hätten sie das nicht erfahren. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das aus der Schule weiß. Trevor und ich kommen einfach vom Land. Da gab es massenhaft Blindschleichen.
Wir kommen an einer der vielen Burgruinen vorbei. Leider hatte es hier im Mittelalter gebrannt, steht auf einem Schild. Vermutlich war ein feuerspeiender Drache der Auslöser gewesen, phantasiere ich. Ich wünsche es mir fast, irgendetwas Spannendes muss doch hier im Wald passiert sein.
Ich wäre jetzt gern ein fliegender Hirsch und würde es auch hinnehmen, wenn sich mein Fluggeräusch erschöpft und laut anhören würde.
Später sonnt sich die Blindschleiche auf einem Felsvorsprung, als der Hirschkäfer neben ihr landet.
„Hast du die großen Zweibeiner auch gesehen?“, fragt er die Schleiche.
„Ja“, antwortet sie. „Aber sie stören mich nicht. Sie lassen sich einfach blenden und ziehen irgendwann weiter.“
Die beiden grinsen sich an. Ein kleiner Wind kommt auf. Sie vertreiben sich die Zeit und lassen einen kleinen Papierdrachen steigen.
Das Leben wiederholt sich, nur aus anderer Perspektive. Fliegende Hirsche? Als Kind in Deutschland habe ich Drachen steigen lassen. Nach Jahren der Pause wieder als Vater. Als meine Söhne Kinder waren. Blindschleichen habe ich gejagt. In meiner Kindheit gab es sie noch zahlreich, aber sie scheinen heute fast verschwunden.
Ich stelle mir vor, ich fange einen echten Hirsch mit einem Lasso am Geweih. Ein kräftiges Tier. Doch als ein starker Wind aufkommt, ja fast ein Sturm, hebt er ab, schwebt über mir. Ich brauche meine ganze Kraft, ihn zu halten.
Ich google das Drachenfest in der Talaue. Meine Söhne sind längst erwachsen, doch ich werde sie fragen, ob sie wieder Hirsche mit mir fliegen lassen wollen. Am nächsten zweiten Sonntag im Oktober.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Laura Kind
Freibad.
Ich erinnere die Sommer in unserer Stadt als einen langen Freibadbesuch. Und ich erinnere Lena, die in jedem dieser Sommer auftaucht, bis die Erinnerung nur noch ein Landschaftsportrait ist, von einer Liegewiese und einem Pool, aber keine Lena weit und breit zu sehen ist. Wenn ich es recht bedenke, war Lena eine Saisonfreundin. So wie die Eisdielen in der Fußgängerzone im September ihre Schaufenster beklebten, und erst im Mai wieder öffneten, bestand unsere Freundschaft aus langen Tagen im Freibad und Limo auf einem Parkplatz.
Das Freibad liegt oben auf dem Hügel, auf der einen Seite an Wiesen angrenzend, auf der anderen Seite die Hochhaussiedlung, in der auch Lena wohnte. Die Leute sagen, dass es hier ständig regnet, aber so ganz stimmen kann das nicht, denn sonst hätte ich nicht all diese Erinnerungen an das Freibad, in dem ich meine Sommer verbrachte, in dem ich schwimmen lernte, in dem ich meinen ersten Kuss bekam und einen allergischen Schock von einer Biene, weshalb ich diese kleinen Fläschchen mit mir herumtrage, deren Beipackzettel ich nie richtig durchgelesen habe. Wenn es also nicht regnete, wie die Leute behaupten, schmorte die Stadt in ihrem eigenen Saft. Ich saß in der Schule, wir hatten Deutsch, Bio oder Physik, und unsere Schweißperlen tropften zu Boden, wo sie direkt wieder verdampften. Nach der Schule packten wir unsere Taschen, quetschten uns in den Bus zum Freibad und wurden allesamt an der Endhaltestelle hinausgepresst. Wir strömten durch die Pforten des Freibads, Schülerströme, die kurz um einen Kiosk und ein Kassenhäuschen mäanderten, um schließlich in dem Schwimmbecken zu münden, wo sich der Strom perlend in Lachen und Schreien auflöste.
Es war der Sommer, bevor Lena aus meinen Erinnerungen verschwand. Ich saß am Beckenrand und tauchte die Füße ins Wasser, bis die halbe Stunde rum war, die das Eis in meinem Bauch brauchte, um nicht mehr den Kreislauf zu belasten. Das Licht und die Wellen marmorierten die Wasseroberfläche und ich streckte die Hand aus, um meine Oberschenkel mit Poolwasser zu kühlen. Die Wassertropfen blieben dort kurz als Perlen sitzen, bevor die Sonne sie wieder aufklaubte. Lena und ich waren schon eine Weile hier, denn in der Schule gab es hitzefrei und nach einer Stunde Englisch und einer Stunde Physik durften wir gehen. Die Sonne stand hoch und es war so heiß, dass einem ganz schummrig wurde. Lena sprang immer wieder neben mir ins Wasser und kletterte wieder hinaus. Dabei schrie sie jedes Mal auf. Lena hatte etwas Lautes an sich, das man nicht so leicht ignorieren konnte. Sie war nicht sonderlich beliebt und auch nicht gut in der Schule, obwohl sie oft zuhause blieb um zu lernen, wie sie sagte. Sie war schon einmal sitzengeblieben und die Lehrer baten ihre Mutter regelmäßig zum Gespräch, zu dem sie nicht kam, weil Lena die Briefe im Mülleimer verschwinden ließ. „Wird schon klappen“, hat sie schulterzuckend gesagt, als ich sie einmal danach fragte. Lena sprach selten mit den anderen aus der Klasse, sondern stellte sich in der Pause zu den Rauchern aus der Oberstufe vor die Schule. Und auch mit mir sprach sie selten in der Schule, so als ob unsere Freundschaft nur im Freibad und nach der Schule stattfinden dürfte.
Ich hatte nun schon lang genug am Beckenrand gewartet, stand auf und lief zur Leiter. Der Boden brannte unter den Fußsohlen. Ich stieg die Leiter Schritt für Schritt hinunter und wunderte mich, dass meine Haut nicht im Kontakt mit dem kalten Wasser zischte, wie eine heiße Pfanne, auf die man Wasser laufen lässt, damit sie schneller abkühlt. Als das Wasser meinen Bauch erreichte, blieb ich schaudernd stehen. „Jetzt stell dich nicht so an!“ Lena stand neben mir an der Leiter und lachte. „Es ist aber kalt!“ – „Meine Güte!“ Ich spürte, wie sich meine Hände von den Griffen der Leiter lösten und ich das Gleichgewicht verlor. Ich fiel rückwärts ins Wasser und tauchte unter. Als ich wieder auftauchte, schwamm Lena neben mir. „Komm, und jetzt Wettschwimmen!“
Nach einer Weile fing es schrecklich an zu regnen. Wir schwammen gerade an den Rand, als das erste Donnergrollen heranrollte. Kurz darauf brach der Himmel auf und wir nahmen jetzt erst die Nässe wahr, die sich anders anfühlte als die im Schwimmbecken. „Komm mit!“, rief Lena und wir packten unsere durchweichten Handtücher und Taschen und liefen los. Ich war noch nie zuvor bei Lena gewesen, was mich nicht störte. Wir hatten ein großes Haus und meine Eltern hatten es gern, wenn wir Gäste bekamen.
Hereingespült von dem Unwetter, hinterließen wir kleine Seen im Wohnungsflur. Lena legte den Finger auf die Lippen. „Kann sein, dass Alexandra schläft.“ Lenas Mutter arbeitete im Krankenhaus. Nach einer langen Nachtschicht lag sie auf dem Sofa, so als könnte sie sich nicht dazu entschließen, wirklich ins Bett zum Schlafen zu gehen, und harrte in einem Zwischenzustand aus, aus dem sie leicht wieder aufschreckte. Als sie uns jetzt bemerkte, richtete sie sich auf und strich sich den Schlaf aus Augen und Mundwinkeln. „Möchtet ihr etwas essen? Ich kann Pommes holen!“, schlug sie vor und ich war froh, denn zu den Pommes sind wir bei dem Unwetter im Freibad nicht mehr gekommen. „Ach, ihr seid ja ganz nass!“ Ihr Blick irrte zum geöffneten Fenster und zu der Wasserlache auf dem Fensterbrett. „Ach herrje. Ich mach das gleich weg.“
Als es aufhörte zu regnen, liefen Lena und ich zum Büdchen und kauften Currywurst, Pommes und Fanta. In die Pfützen war das Blau des Himmels gefallen und ich fühlte mich unbesiegbar, wie ich Hand in Hand mit Lena hineinsprang, das Wasser aufspritzte und das Blau zerbarst. Ich bekam eine Hose und ein T-Shirt von Lena und wartete mit ihr und Alexandra vor dem Fernseher, bis meine Mutter mich abholte. Lenas Hose war mir viel zu groß und ich war froh, dass ich mich setzen konnte, damit ich sie nicht mit der Hand halten musste. Das T-Shirt war am Bauch etwas kürzer und es waren kleine Strasssteine draufgeklebt. An einigen Stellen waren dort, wo Strasssteine sein sollten, dunkelgraue Punkte. Ich weiß nicht mehr genau, was im Fernsehen lief, aber ich erinnere noch, dass wir oft lachten, und dass Lena die Titelmelodien jeder Serie mitsingen konnte.
Als meine Mutter mich abends abholte, machte Alexandra ihr die Tür auf. Meine Mutter lächelte und bedankte sich, blieb dann im Flur stehen, und betastete ihre Kette, als müsste sie kontrollieren, dass sie noch an ihrem Platz war. Alexandra bot Getränke an. Ich sah meiner Mutter dabei zu, wie ihre Zunge nach einer Antwort tastete, aber nichts, was Alexandra ihr anbot, schmeckte ihr. „Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser?“ Die Minuten danach saßen Lena und ich in dem Zimmer, das sie sich mit ihrem kleinen Bruder teilte und sprachen über Lenas Freund, den sie bald küssen wollte. Ihr Freund, das heißt, der Junge, mit dem sie manchmal am Hoftor lehnte, ging auf die Realschule und war zwei Jahre älter als wir. Man sah Lena ihr Alter nicht an, weil sie sich schminkte und Buffalos trug, die sie größer wirken ließen.
Lenas Wohnung war hellhörig. In diesem Moment kam mir bei den dünnen Wänden die Stille aus dem Wohnzimmer aufdringlich laut vor, genau wie Lenas Stimme, wie sie von ihrem Freund erzählte. Nach einer Weile steckte meine Mutter den Kopf zur Tür herein: „Julia, kommst du? Wir wollen jetzt gehen.“ Und dann zu Alexandra gewandt: „Hat mich sehr gefreut, Sie mal kennengelernt zu haben. Und vielen Dank für das Wasser. Tschüss Lena.“ Alexandra stand dort im Flur und lächelte so, als dachte sie, dass sich meine Mutter tatsächlich über die Bekanntschaft gefreut hätte. Ich sah Lena an und folgte ihrem Blick, der an den eigenen Fußspitzen klebte. Auf der Rückfahrt im Auto sprach ich kein Wort mit meiner Mutter.
Ich war noch einmal bei Lena zuhause. Ins Freibad gingen wir immer noch, aber selten allein. Es wurde erst eine größere, dann eine andere Gruppe, mit der ich ins Freibad ging, bis wir irgendwann gar nicht mehr gingen.
Letztens wurde mir bei Instagram Lenas Account angezeigt. Er ist nicht privat, ich kann ihre Bilder sehen, ohne ihr eine Follower-Anfrage stellen zu müssen, die ich mich nie getraut hätte abzusenden. Ihre Haare sind jetzt dunkel gefärbt. Auf einem der Bilder hält sie zwei Kinder an der Hand. Vorne sieht man den ausgestreckten Arm und die Gesichtshälfte eines Mannes. Im Hintergrund leuchtet ein Strand weiß und türkisblau.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stefanie Adamitz
Unter der Haut
Ein Unfall ist wie durch ein unsichtbares Tuch gleiten, sagte Susa.
Jedes Mal wieder.
Du siehst es nicht, aber wenn es sich auf deinen Körper presst,
erschrickst du so sehr, dass es dir vorkommt, als sei es aus Blei,
als seien Nägel draufgesteppt,
so sehr schmerzt es auf der Haut, so sehr drückt es dir auf Leib und Gemüt.
Du bist so verletzt und wund in dem Moment,
wo du nichtsahnend den Weg lang spazierst und wieder
verwirrt und verwickelt
in einem solchen Tuch gelandet bist.
Gestürzt sind sie erst, als es wieder schön war,
als sie so entspannt waren wie seit Monaten nicht mehr.
Den Blick auf die Felder, den Kanal.
Keine Autos, nur ein Dorf,
so schön.
Die fremde Frau hatte ihre Hand gehalten, bis der Krankenwagen kam,
Engel hat sie sie genannt.
Auf französisch alle Körperteile benennen, die wehtun.
Ellbogen heißt coude lernt sie, auch was Fuß und Speiche und reingesteckt heißen.
Tausendmal hat sie‘s ihrem Kind gesagt, tausendmal, doch sie flucht nicht,
sie hofft nur, dass es dort, im anderen Krankenwagen bei ihm,
ihrem zarten kleinen Kind,
keine Überraschungen geben wird.
Jedes dieser Tücher wird weicher, während du hindurchschreitest.
Aus Blei wird blau, es färbt dein Gesicht, deine Knie.
Aus spitz wird stumpf, du schläfst nicht, du weißt noch nicht, wie es weitergeht.
Aus dem Schreck kämpfst du dich stoisch durch jeden Tag
die Fortschritte in der Ferne sichtend.
Fast durchsichtig sind die Tücher dann,
du denkst vielleicht, du bist längst durchgeschritten,
und du denkst, das, was dich noch hält, sind nur noch
die letzten Tuchreste auf deiner Haut.
Sie heilen, sie beide, und sie fahren weiter,
dahin, wo alles anders ist.
Die blauen Flecken sind fast verschwunden,
die Wunden im Gesicht und am Fuß
nur noch rote frische Haut, die in der Sonne glänzt.
Die Leute starren nicht mehr,
beinahe sieht sie wieder aus wie irgendein Mensch.
Da fängt das Beben an, das sie nicht zuordnen kann.
Ihr Körper hält sie nicht mehr, aufgebracht und müde, will sie schlafen, aber rennt durch die Wohnung.
Susa sagt, die Tücher wandern weiter,
unter die Haut,
sie müssen einmal durch dich durch.
Du schaust sie fragend an.
Du verstehst nicht.
Sie sagt, der bleierne Schlag und seine blaue Erinnerung,
der Durchmarsch ins Mark und der Weg dort hinaus,
das ist der ganze Weg und er muss gegangen werden.
Tuchteilchen unter ihrer Haut, sie treiben und triezen.
Inkognito, mit fremdem Namen,
reisen sie in ihr versteckt.
Außen normal und im Innern der Schreck.
Sie sprechen nicht, sie sind nicht aussprechbar.
Niemand sieht sie, doch sie spürt sie wandern,
sie spürt sie klopfen.
Einmal durch dich durch, komplett,
hat Susa gesagt. Und,
dass sie sie jetzt sehen kann,
sie sitzen in deinem Psoas und trinken Kaffee.
Morgen gehst du zu ihnen, sagt Susa.
Sagst danke und tschüss
und jagst sie hinaus.
Dann hält sie dich fest, so fest,
dass heute und morgen wieder wie Wege erscheinen,
ihr Herzschlag, der hilft, durch Tage zu gleiten.
Verwirrt und verwickelt
vor und hinter und in deiner Haut.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Cornelia Koepsell
Grenzdebil im Literaturbetrieb
Früher war alles besser. Das war ein Standardsatz, so eine Art Glaubensbekenntnis in meiner Kindheit, über den ich mich immer sehr ärgerte. Ich war so richtig sauer und riss mir vor Wut Löcher in die Hosen. Heute kriegt man dafür einen Designerpreis, damals bekam man eine gescheuert.
Da der Satz recht häufig fiel, hatte ich eine ärgerliche Kindheit. Heute sage ich die vier Worte Früher-war-alles-besser zwar nicht laut. Aber ich denke sie manchmal. Heimlich. Im Verborgenen denken, heißt konkret, ich veröffentliche den Satz nicht auf Facebook.
Trotzdem wohnt meinen Gedanken der seltsame Trieb inne, so ein inneres Drängen und Sehnen, sich irgendwie zu manifestieren, so dass auch andere sie mitkriegen. Meine Hirnströme neigen zu Geschwätzigkeit.
Um das zu verhindern, versuche ich heimlich im Bett zu denken, mit der Decke über dem Kopf und da brummele ich ganz leise ins Kissen, so dass nur nicht schwerhörige Milben mich verstehen können.
Früher-war-alles-besser.
So strohdumm, wie er sich anhört, ist der Satz garnicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo er zutrifft. Im Literaturbetrieb. Manchmal versuche ich in dieses Biotop meine Nase zu stecken. Entweder kriege ich dann eins auf eben diese oder ersatzweise eins auf die Schnauze oder ich ziehe mein Riechorgan freiwillig ganz schnell wieder heraus und schlurfe zurück ins Büro, wo ich mit ein paar ziemlich langweiligen Tätigkeiten mein Geld verdiene.
Aber immerhin kriege ich welches. Nette kleine Euros statt was auf die Nase. So viel, dass ich mir eine Mietwohnung leisten kann und einen gebrauchten japanischen Kleinwagen. Letzterer ist ausgesprochen wichtig für mein Wohlbefinden, da ich ein libidinöses Verhältnis zu meinem Auto unterhalte. Irgendwen muss man ja lieben.
Falls man sich früher entspannen wollte, ging man spazieren. Heute muss es mindestens ein Halbmarathon sein.
Wenn man früher einen Job hatte, mit dem man so einigermaßen sein Geld verdiente, war alles gut. Heute muss es auch noch Spaß machen, man soll glücklich sein, ausgefüllt, ein Dauergrinsen als Gesichtsmaske tragen, weil man so schön ausgebeutet wird und sich nebenbei zum Wohle der Firma ständig selbst optimieren. Da rutscht einem doch der Mittelfinger aus der geballten Faust.
Neulich erzählte ich auf einer Party jemandem, der einigermaßen vernünftig aussah, wie langweilig mein Job sei und wie bekloppt meine Chefin. Neben mir stand so eine Gisela, bei der zu Hause sich Psycho-Ratgeber und Esoterik Schwulst bis unter die Decke stapeln. Die Lektüre dieses modernen Glaubensbekenntnisses hat ihr die letzten verbliebenen grauen Zellen aus der Hirnschale gedrückt. Gisela ist esoterisch so durchgeglüht, dass sie im Dunkeln leuchtet. Sie erklärte mir, ungefragt natürlich:
„Wenn du deine Arbeit so hasst, musst du kündigen.“
„Wie soll ich dann meine Miete bezahlen?“ fragte ich.
„Das wird sich finden“, meinte sie.
Wenn ich auf die Giselas dieser Welt höre, meinen Job kündige und mich selbst verwirkliche, was nebenbei bemerkt in meinem Fall bedeutet täglich zehn bis zwölf Stunden zu schlafen und das Folterwerkzeug Wecker aus dem Schlafzimmer zu verbannen, und wenn der Vermieter, ein aggressiver Frühaufsteher, mich irgendwann aus einer meiner wohlverdienten Tiefschlafphasen klingelt und mich fragt, wann ich zu zahlen gedenke, ich sei um Monate im Rückstand und ich ihm erkläre, das werde sich finden, dann werde ich sehr schnell einen neuen festen Wohnsitz im Bezirkskrankenhaus haben. Dort kann ich meine Selbstfindung unter dem Einfluss von Psychopharmaka fortsetzen und sogar sechzehn Stunden täglich schlafen.
Meinen Aufenthalt dort könnte ich verlängern, indem ich behaupte unter einem Burnout zu leiden, weil der Vermieter mich so bedränge und weil die Welt so schlecht sei. Letzteres wird sich nicht so schnell ändern.
Besagte Gisela von der Party wird mir bestimmt nicht mit ein paar Euros aushelfen, nachdem ich ihren Rat befolgte, gekündigt habe und das mit der Miete sich nicht so schnell gefunden hat. Natürlich weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Das hatte mir besagte Gisela noch mit auf meinen verschlungenen Lebensweg gegeben.
Aber ich bin vom Thema, dem Literaturbetrieb abgekommen. Früher, als alles besser war, da sahen die Biografien von Schriftstellern in etwa so aus.
„Er – in Ausnahmefällen war es auch eine sie – also er arbeitete als Hausmeister, Totenwäscher, Taxifahrer, Kellner, Almhirt und Weichensteller. Der Titel seines ersten Erfolgsromans lautete: Die-Angst-der-Leiche-vor-dem-Waschen.“
Eine Schriftsteller-Biografie von heute geht etwa so:
„Sie studierte acht Semester am Leipziger Literaturinstitut. Diverse mäandernde Preise entdeckten sie als geeignete Trägerin. Sie debütierte mit dem Lyrik-Band Ich-und-mein-Handy.“
Verstehen Sie mich jetzt? Wenn nicht – auch egal. Dieses immer von allen verstanden werden wollen, wonach so viele Menschen insbesondere weiblichen Geschlechts sich andauernd sehnen, ist sowieso unerträglicher Ballast.
Früher gab es den Geniekult. Deshalb haben so wenig Frauen geschrieben, weil sich das Genie nicht mit ihrem Körperbau vertrug. Der war eher geschaffen für Haushalt und Altenpflege und Kaffeekochen und verstanden-werden-wollen.“
Insofern ist heute alles besser. Frauen dürfen auch mal genial sein, solange sie jung genug sind, um am Leipziger Literaturinstitut zu studieren und Eltern ihr eigen nennen, die genug Geld haben, um sie auch anschließend zu unterstützen, damit sie sich mit siebenhundert-bis-tausend-Euro-Stipendien monatlich durchs Leben fretten können.
Ansonsten müssen sie eben doch Verkäuferin werden und sich ein Beispiel an ihren Schriftsteller-Vorfahren nehmen.
Ob sie jemals Geld verdienen mit dem Schreiben, so viel, dass sie sich mit hoffentlich lange intakten Zähnen knapp über dem Hartz-Vier-Niveau festbeißen können, ob ihnen das gelingt, hat ja nichts damit zu tun, wie gut sie sind, sondern ist das Ergebnis von König Zufall, durch den sie irgendeinen aktuell bescheuerten Mainstream treffen oder ob sie in der Lage sind, ausreichend verschwurbelt zu schreiben, um weitere Literaturpreise und Stipendien auf einem hart umkämpften Markt an sich zu reißen, vergeben von Literatur-Juristen, die auch nicht besser sind als ihre Kollegen in der schwarzen Robe am Amts- oder Landgericht.
Wer ihre Sprache nicht spricht, wird aussortiert. Das war früher so. Das ist heute so. Wer sagt denn, dass alle Werte den Bach runtergehen?
Vielleicht sollte ich also den Satz Früher-war-alles-besser kreativ umschreiben und sagen: Heute-ist-alles-anders.
Ja – ich weiß, das klingt nicht sehr intelligent, aber ich habe nie behauptet, Eigentümerin eines hohen IQ zu sein.
Beim letzten Intelligenztest, dem ich mich spaßeshalber unterzogen habe, war ich grenzdebil.
Ja – Mann – das ist doch was, worauf ich stolz sein kann.
Wenn schon erfolglos unterwegs im Literaturbetrieb, dann wenigstens grenzdebil. Deshalb liebe ich auch kurze oder Ein-Wort-Sätze. Die verstehen ich und meinesgleichen nämlich gut.
Mein Lieblingssatz, seit ich ungefähr zehn bin, das ist der Klassiker:
Ich Tarzan – Du Jane.
Geniale vier Worte plus Bindestrich. Wenn man den verstanden hat, darüber meditiert, ich meine so richtig tief innen-drinnen, dann kann man alle Liebesromane aus dem Bücherregal in die Tonne hauen, so richtig Platz schaffen, das nennt sich „Simplify your life“.
Letzteres ist ein Buchtitel, geschrieben von einem, dem seine Hochbegabung die deutschen Wörter aus dem Hirn gelöscht hat.
Deshalb muss man erst Englisch lernen, bevor man sein Leben simplifyen – ich meine: vereinfachen kann.
Das finde ich kompliziert. Kann aber auch an der Grenzdebilität liegen.
Wenn man sowas Tolles hat, braucht man sowieso nicht solche Bücher lesen und spart sich haufenweise Geld.
Das Leben wird von alleine einfach. Es gibt Leute, die meditieren stundenlang im Lotussitz oder auf Knien wie arme kleine Sünder, machen sich die Gelenke kaputt mit dem Ziel wenigstens einmal am Tag den Kopf leer zu kriegen.
Als Grenzdebiler bekommt man das geschenkt von Gott Vater oder Gott Mutter oder dem Jesuskind.
Es hat so viele Vorteile. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Strengt auch zu sehr an.
Ein Kumpel von mir, der beim IQ Test noch schlechter abschnitt als ich – ja das geht –, er klärte mich auf:
„Unsere Synapsen sind nicht testfähig“, sagte er „Weil die Erfinder der Fragebögen sie nicht haben und deshalb nicht abfragen können.“
„Dann sind wir Aliens?“ fragte ich.
„Wir nicht“, erklärte er. „Die Anderen.“
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Margit Marenich
„Ein doppelter Haselnuss-Hagel-Macchiato mit extra viel Drama“
Sie rennt ins Gewitter raus und du denkst nur: „Verdammt! Wie ist das nur so schnell so schief gegangen?“. Gerade mit ihr.
„Warte Hannah! Du hast nicht mal deine Jacke!“, sie bleibt stehen und dreht sich zu dir um. Du siehst ihren pinken BH unter dem durchnässten Oberteil. Pink, mit Strass.
„Ich weiß, was du willst.“, schluchzt sie nur und hält dir ihr Handy ins Gesicht. Da ist eine wirklich lange Message am Bildschirm. „Jasmin hat mir gerade alles über dich geschrieben. Alles!“
Diese …! Wieso kann sie ihr Maul nicht halten? Was in ihrer Wohnung passiert ist, geht niemanden sonst was an.
Jetzt mischen sich Hagelkörner unter die schneller fallenden Regentropfen und bleiben in Hannahs offenen Haaren hängen. Mit nassen Augen sieht sie dich an, als wolle sie dich erschlagen.
Du musst das noch hinbiegen, sie irgendwie rumkriegen. Sechs Wochen hast du in das hier investiert.
Ihr ihre Jacke um die Schultern zu legen, findet sie sicher romantisch. Du hebst die Arme. Bevor du sie berührst, reißt sie sie dir weg. Ihr pinker BH verschwindet hinter dem Reißverschluss.
„Du dachtest du kaufst mir einen Kaffee und Cookies und dann was? Was, Jahn?“. Sie hält das Handy wie einen Stein zum Werfen. „Was dachtest du, was ich mache?“
Mit einem Schnauben denkst du an alles was über sie erzählt wird. Die Fotos. Echt alle in der Schule haben die gesehen. Da hat sie sich nicht so geziert.
Ihre Augen funkeln immer mehr. Deine Augen huschen zu ihrem Wurfarm. Zurück. Sie weint jetzt. Ihr Arm fällt schlaff herunter. Mit einem Stich denkst du an das Gerede. Echt alle in der Schule reden über sie.
„Sorry, Hannah.“, hörst du dich nuscheln. Du findest ein Taschentuch in der Hosentasche und hältst es ihr hin. Sie hört einen Moment auf zu schluchzen, als sie es nimmt.
Fuck! Das sollte das Wochenende sein, in dem alles in Ordnung kommt. Eltern und Geschwister erst am Montag zurück. Das heißeste Mädchen bei dir oben. Stattdessen stehst du im Regen und alle Leute starren dich an. Mit kaum verstecktem Lachen oder einem „Wird das arme Mädchen gerade belästigt?“ - Blick. Handys auf dich gerichtet.
Dabei wäre es so einfach. Wenn du sie nur rumkriegen könntest.
„Hannah - “.
„Sex löst gar nichts.“. Sie lehnt sich plötzlich zu dir rüber. Ihre Augen glitzern rötlich. Und flüstert mit erstickter Stimme in dein Ohr, „Ich habs versucht.“
Damit rennt sie zur Bushaltestelle.
Der Alte mit dem Hund, der gerade vorbeikommt, grinst dich an. „Passiert allen mal.“
Ohne zu überlegen rennst du ins Shopping Center zurück. Auf dem trockenen Boden machen deine nassen Schuhe dieses nervende Geräusch.
Auf deinem Handy sind neue Messages. Eine von Jasmin. Von. Jasmin.
Du willst den Mistkübel neben dir treten.
Ein paar andere in der Klasse wollten Details über Hannah. „Über das echte Zeug.“. Du kannst jetzt schon hören, was sie am Montag über dich sagen werden.
Dieser Samstag ist noch schlimmer als der vor sechs Wochen.
Es war alles so perfekt. Hannah hat deine Einladung angenommen. Du warst mit ihr extra in diesem Coffeeshop. Damit er alles sehen kann.
Vor einem der Shops stehen zwei Jungs, die Finger verschlungen, die sich aneinander lehnen. Mit einem Stich im Magen siehst du weg. Die sind sogar jünger als du, denkst du nur und gehst schneller.
Als du zum Coffeeshop zurückkommst, sind die Teller und Tassen schon abgeräumt. Du kannst nicht anders und siehst zum Tresen hin.
Dieselbe Barista, die du gar nicht kennst, steht noch da. Das erste heute, das gut läuft. Sie lächelt dich an und du denkst, dass du mit ihr flirten kannst.
„Einen Kaffee vielleicht? Lemon-Strawberry-Cheesecake ist heut im Angebot.“.
Bei ihr zu landen kannst du kübeln. Aber ein heißes Getränk wäre nicht schlecht. In der Wärme sind die Hagelkörner in deinen Haaren geschmolzen. Du spürst Wasser über deine Kopfhaut rinnen.
Hey. Er ist ohnehin nicht da.
„Einen Haselnuss-Latte-Macchiato zum Mitnehmen, bitte.“
„Sofort.“, die Barista dreht sich zur Seite. „Hi Noah - du bist 10 Minuten zu früh.“
No! Fuck.
„Ich mach das hier, Ayla. Das Übliche, Jahn?“. Noah wartet nicht auf deine Antwort, sondern misst das Kaffeepulver, während das Mädchen zu den Kunden an den Tischen geht.
Das ist das erste Mal seit sechs Wochen, dass du ihm gegenüberstehst.
Er sieht dich an. Deine nassen Haare. „Nicht gut gelaufen, hm?“.
Du hörst dich irgendwas schreien. Im Spiegel hinter dem Tresen drehen sich alle Köpfe. Fast packst du ihn am Kragen. „Du und deine Schwester- “.
„Jasmin ist Hannahs beste Freundin. Sie musste sie warnen.“
Er hält dir den Kaffee hin. Was hält dich eigentlich davon ab, ihm das Zeug in die Fresse zu schütten?
Dein Blick fällt auf die winzige Narbe auf seiner Unterlippe, die vor sechs Wochen noch nicht da war. Dann nimmst du einfach nur den Becher und rennst weg. Zurück ins Gewitter. Bevor du fünf Schritte aus dem Shopping Center raus bist, landen schon vier Hagelkörner im Blätter-Muster auf dem Milchschaum und du bleibst stehen.
In diesem Moment hasst du absolut alles auf der Welt. Am meisten ihn, immer besser. Er hat einfach alles. So einfach.
Es ist erst sechs Wochen her, dass dir das nichts ausgemacht hat. Dass du an Samstagen mit ihm Games gezockt und Spaß gehabt hast. Bevor…
Dein Becher landet neben dem Mülleimer und der Regen wäscht den letzten Kaffee weg, den du je von ihm kriegen wirst.
„Du hättest auch einfach nach einem Deckel fragen können.“
„Was?“
Noah steht mit einem Schirm hinter dir und hält ihn dir hin. „Willst du meinen Reserve-Hoodie? Ist im Spind.“
Das war’s! „Ich will deinen verdammten Schirm nicht.“
„Ist deiner. Du hast ihn vor sechs Wochen vergessen.“
Vor sechs Wochen.
Als er alles kaputt gemacht hat. Mit dem Kuss. Wegen dem du ihm die Lippe blutig geschlagen hast. Nicht weil es eklig war. Weil es gut war. Deine Schultern verkrampfen sich.
Nie ist irgendwas ein Problem für Noah. Auch nicht für die Jungs vor dem Shop vorhin.
„Warum ist das alles kein Problem für dich?“. Endlich, nach sechs Wochen, siehst du ihm in die Augen. „Was ist dein Geheimnis?“, denkst du nur.
„Nichts. Ich hatte es eben satt. So richtig.“. Er hält dir immer noch den Schirm hin. „Wie lange kannst du noch, so wie jetzt?“.
Deine Füße zucken beide nach Rechts. Richtung Ausgang. Richtung Bus. Wieso läufst du nicht?
Einen Moment lang schwanken Noahs Augen nach unten. Bevor… „Und ich mag dich.“
Das war’s jetzt. Irgendwas weder Lachen noch Keuchen bleibt dir im Hals stecken. Du nimmst den Schirm und versuchst dich zu räuspern. Nochmal. Was ist das? Hättest du nur noch den heißen Kaffee.
„Gehen wir zurück.“, sagt Noah nur. „Ich hab auch Ersatz-Sneakers im Spind.“
Das sollte das Wochenende werden, in dem alles wieder in Ordnung kommt. Vielleicht kommt wenigstens eines heute ins Reine.
Während du den Macchiato ohne Hagelkörner trinkst, hört es draußen auf zu regnen. Alles scheint ruhig. Wie sonst auch immer, wenn du hier warst. Oder bei ihm in der Wohnung.
„Schade, dass wir aufgehört haben.“, du denkst an die letzte Gamingsession. So nah am gewinnen.
Noah lächelt hinter dem Tresen.
Du verschluckst dich an deinem Kaffee, als dich sein Blick trifft.
Margit Marenich, geborene Wienerin. Lebt und arbeitet immer noch da. Schreibsprachen Deutsch und Englisch. Begeistert vom Lesen, Zeichnen und Reisen. Studium der Komparatistik führte indirekt zum Schreiben und nach Frankreich.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leonie Groihofer
Leben geben
Sie versucht, sich noch länger unter Wasser zu halten, den Druck unzähliger Kubikmeter als warme Masse auf ihrem Körper zu spüren, aber sie kennt den Auftrieb, er hat schon eingesetzt, angesetzt, er lässt sie nicht mehr los. Treibt Miriam unaufhaltsam Richtung Oberfläche. Dann ist sie wach. Kurz benommen, weil der Druck noch immer da ist, weil sie sich den Druck für einen Moment nicht erklären kann. Für einen Moment nur, dann steht sie auf, deckt den Tisch samstagmorgendlich, stellt auch die Erdbeermarmelade hin, obwohl sie ihr zu süß ist. Über der An-Taste des Radios zögert sie. Radiohören wäre Schonfrist. Schonfristen kann sie sich nicht leisten. Das Radio bleibt aus, dafür kostet sie die Erdbeermarmelade, wider besseren Wissens, in einer kindischen Hoffnung, sie würde ihr vielleicht doch schmecken, weil Markus sie so gerne isst. Eigentlich, denkt sie, müsste ich ausnutzen, dass Markus nicht da ist, und sie überlegt tatsächlich eine ganze Weile, welche Dinge es gibt, die sie tun könnte, jetzt, während Markus weg ist, ohne jedoch ernsthaft auf etwas zu kommen, bis ihr einfällt, dass Markus ja nicht einfach so weg ist, dass es einen Grund gibt, warum Markus weg ist, dass Markus ja genau darum weg ist, damit sie Dinge tun kann, die sie nicht tun kann, wenn er da ist. Nachdenken. Eine Entscheidung treffen.
Sie lässt sich Zeit, wäscht das Brotmesser mit der Hand, trocknet es sorgfältig ab. Sie hat sich vorgestellt, sie würde sich an ihren Schreibtisch setzen, oder auf die Couch im Wohnzimmer, mit einem Block auf den Knien, Pro und Contra auflisten. Sie hat sich vorgestellt, sie würde noch einmal alle Artikel lesen, alle Informationsseiten durchgehen. Sie hat sich vorgestellt, sie würde sich vorstellen, wie ihre Großmutter entschieden hätte. Oder ihre Urgroßmutter. Sie hat keine Lust.
Sie hat keine Lust, das ist ihr mit einem Mal vollkommen klar, als sie sich auf das Sofa gesetzt hat. Am liebsten würde sie Markus anrufen, er solle nach Hause kommen und sie würden sich ein gemütliches Wochenende machen. Aber das geht nicht, natürlich geht das nicht, das würde er ihr auch genau so sagen, froh sollte sie sein, dass er ihrem Wunsch nachgekommen ist, dass er sie so gut verstanden hat. Und jetzt muss ich mich selber verstehen, denkt Miriam. Sie schaut an sich herab, schaut an ihrem Körper herab, dem vertrauten, dem selbstverständlichen, dem gegenüber man mit den Jahren des Erwachsenseins eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt, bis sich das Alter bemerkbar zu machen beginnt. Aber dazu muss es nicht kommen. Nicht so schnell jedenfalls.
Ich sollte nackt sein, denkt Miriam plötzlich, zögert trotzdem einen Moment, bevor sie dann doch ein Kleidungsstück nach dem anderen abstreift, zuletzt die Socken. Sie legt sich auf den Rücken, den Kopf leicht an der Sofalehne abgestützt, sodass sie sich selbst betrachten kann. Die etwas zu langen Zehennägel. Die rasierten Unterschenkel. Die ausladenden Oberschenkel. Das zusammengestutzte Schamhaar. Den im Liegen perfekt flachen Bauch. Die unförmig zur Seite hängenden Brüste. Sie erinnert sich an eine Meditationsübung aus ihrer Yoga-Phase: Sie macht die Augen zu und wandert von oben nach unten, fängt beim Scheitel an, spürt ihre Wangenknochen unter der Haut, ihre angespannten Schultern, ihren Brustkorb, der sich hebt und senkt, das unangenehm vertraute Kreuz, die Kraft in ihren Beinen, spürt auch die Hände, leicht schwitzig, da, schon fangen sie zu kribbeln an, als würden sie sich genieren vor dieser Leibesvisitation.
Über diesen ihren Körper hat sie zu entscheiden.
Eine plötzliche Unruhe packt sie, vielleicht sollte sie Laufen gehen, sich bewegen, „den Kopf frei kriegen“, wie man so sagt. Sie will aufstehen, aber etwas lässt sie zögern. Seit gestern erfüllt sie eine seltsame Ehrfurcht, eine seltsame Scheu gegenüber ihrem Körper, als wollte sie ihn beschützen, in Watte packen, konservieren.
Morgen Abend kommt Markus nach Hause. Die kleine Digitaluhr auf dem Couchtisch, die auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur anzeigt, macht Tick. Tick. Tick. Tick. Tick. Tick. Tick. Tick.
Hast erfasst Miriam. Sie streift ihren Trainingsanzug über, schlüpft in ihre Laufschuhe, ist erleichtert, als endlich die Haustür hinter ihr ins Schloss fällt. Ihre Schritte sind schwerer als sonst, hallen in den Schläfen wider. Die Gedanken kommen von allein, aber es sind die falschen, die schon oft gedachten. Dass sie naiv waren, alle miteinander, dass sie das nicht kommen gesehen haben. Dass sie sich vielleicht eingeredet haben, sie würden die SULV hier nicht einführen, nicht rechtzeitig jedenfalls, in der abergläubischen Hoffnung, dass es gerade deswegen doch passieren würde. Wie sie am Ende alle überrascht waren, wie schnell es gegangen war. Zehn Jahre nach Einführung in den USA, wenige Monate nach dem Beschluss in Deutschland, wurde die Etablierung eines Systems zur Staatlich Unterstützten Lebensverlängerung in Österreich verkündet, bei einer schnöden Pressekonferenz, deren Livestream sie alle viel zu spät einschalteten, weil sie nicht geglaubt hatten, dass es tatsächlich passieren würde. Und dann die Unsicherheit, ob es sie noch betreffen würde oder nicht. Bei welchem Jahrgang sie die Grenze setzen würden. Und später das Gefühl, sie hätte noch ewig hin, bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag, bis zu der Entscheidung. Und zwischendrin Markus, der etwas in ihr Leben brachte, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Alles Ausreden. Sie weiß, sie hätte viel früher beginnen sollen, sich ernsthaft Gedanken zu machen. Spätestens, als die Einladungen zur Untersuchung bei ihren Freundinnen eintrudelten. Als manche ein riesiges Geheimnis daraus machten und andere über kaum etwas Anderes mehr sprechen konnten. Miriam hatte mitdiskutiert, Meinungen gehabt, Fakten aufzählen können. Trotzdem hatte es sich immer fern angefühlt. Als ob es sie nicht beträfe. Man kann das sowieso nicht rein rational entscheiden, hat Miriam gesagt. Man muss sowieso das Ergebnis der Untersuchung abwarten, hat Miriam gesagt. Im Grunde gibt es eh nur eine vernünftige Entscheidung, hat Miriam gesagt.
Sie bleibt stehen. Zu abrupt, das Keuchen atmet weiter. Sie hat sich gefreut, gestern. Als ihr der Arzt das Untersuchungsergebnis mitgeteilt hat, hat sie sich gefreut. Mit einer aufflammenden, ungekünstelten Freude hat sie sich gefreut, wie früher als Kind, wenn die Wohnzimmertür aufging und sie den erleuchteten Christbaum zum ersten Mal sah. Und auch der Arzt hat gelächelt, als fände auch er, dass es eine gute Nachricht sei, die er ihr überbracht hat. Eine gute Nachricht, die tausend Türen in Miriams Kopf aufgerissen hat, durch die seit gestern der Wind bläst, ein unaufhörlicher, einer, der undichte Fenster zum Raunen und Bäume zum Wanken bringt. Und ein Satz wirbelt jetzt wie ein weißes Blatt Papier durch diesen Wind, bis es an Miriams Frontallappen kleben bleibt wie an einer Windschutzscheibe. Ich wollte immer schon schwanger werden.
Und in diesem Augenblick weiß Miriam, dass das stimmt. Dass es stimmt, spätestens seit jenen Tagen, als sie mit Andrea oder Flora oder Isabelle spielte, nachspielte, was sie im Fernsehen gesehen oder sich von den Erwachsenen abgeschaut hatten, als sie spielten, dass sie toughe Frauen waren, die ihre unsichtbaren Männer an ausrangierten Telefonen zur Schnecke machten, spielten, dass sie Auto fuhren und einkauften und Urlaub machten und sich mit Freundinnen über Erwachsenendinge stritten. Als sie spielten, dass sie schwanger waren und Babies bekamen.
Miriam zwingt sich, weiterzulaufen. Einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Den Sturm in ihrem Kopf leise zu halten. Zu ordnen, was jetzt also klar ist. Seit heute weiß ich, dass ich schon immer schwanger werden wollte. Und seit gestern weiß ich sicher, dass ich schwanger werden kann.
Für die weitere Familienplanung sprechen der SULV-Expert:innenrat sowie der Gesundheitsminister eine ausdrückliche Empfehlung an alle Frauen bzw. Menschen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen aus, vor Beantragung der Staatlich Unterstützten Lebensverlängerung (SULV) einen kostenlosen Fertilitätstest in einer Spezialambulanz durchführen zu lassen. 90% der Frauen, die SULV beantragen, nehmen dieses Angebot in Anspruch. Bitte beachten Sie, dass der Antrag auf SULV vor der Vollendung des 25. Lebensjahres abgeschlossen sein muss und vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin in Ihrer nächstgelegenen Ambulanz.
ministerium-fuer-soziales.at
Damit bin ich noch keinen Schritt weitergekommen, denkt Miriam. Sie hat es plötzlich eilig, nach Hause zu kommen. Sich an den Computer zu setzen, noch einmal alle Empfehlungen, alle Berichte zu lesen. Obwohl das nur Zeitschinden wäre. Weil sie alles, was sie wissen muss, längst weiß. Weil sie weiß, dass alle, Markus, ihre Mutter, ihr Chef, Isabelle, ihr zur Sterilisation raten würden, wenn sie sie fragen würde. Es ist das Vernünftigste, sagt Miriam sich. Sie läuft jetzt langsamer, fühlt sich auf einmal schlapp, erschöpfter als gewöhnlich. Erreicht das Haus wie eine Rettungsboje. Nimmt den Lift hinauf in die Wohnung anstatt wie sonst die Stiegen.
FAQ
Was bedeutet „demographiesteuerndes Anreizsystem“?
Die SULV (individuelle Lebensverlängerung) stellt unsere Gesellschaft vor große Veränderungen. Ein großer Teil der Bevölkerung wird viel länger gesund leben und erwerbstätig sein können. Um einen funktionierenden Sozialstaat aufrecht zu erhalten, gibt es daher einige Anpassungen bezüglich der Anspruchsberechtigten für staatliche Leistungen. Weiterführende Informationen finden Sie unter Familienbeihilfe NEU bei SULV , SULV und Pension .
ministerium-fuer-soziales.at
Sie sollte noch einkaufen gehen, irgendetwas kochen, das Markus nicht gerne isst, Karottensuppe zum Beispiel, und danach vielleicht die Fertigmohnnudeln, denen er so erstaunlich viel Verachtung entgegen bringen kann. Markus, der sich schon entschieden hat. Bei ihm gab es nicht viel zu überlegen, hat er gemeint, seinen Wehrdienst hatte er bereits absolviert, alle Voraussetzungen erfüllt, da war es keine Frage, ob er den Antrag stellen würde oder nicht. Markus, der seit über einem Jahr einmal im Monat zur Apotheke trabt und seine SULV-Ration abholt. Der das nie vergisst, niemals nervig findet. Markus, der für die nächsten 30 oder 50 Jahre keine Falten, keine Glatze, keine grauen Haare bekommen wird, keine Altersweitsichtigkeit, der sich die nächsten 150 Jahre nicht mit altersbedingten Krankheiten wie Diabetes oder Demenz auseinandersetzen wird müssen, dessen Krebsrisiko nur langsam ansteigen wird.
Das alles kann Miriam auch haben, wenn sie will. Ihren Ausweis in der Apotheke mit merkwürdigem, aber unleugbarem Stolz vorzeigen. Sich gut fühlen, beruhigt fühlen, bestärkt fühlen, wenn sie vor dem Frühstück die zwei Pillen schluckt. 200, 300 Jahre leben, statt 80 oder 90. Reisen, Bücher lesen, Sprachen lernen, nachdenken. Ja, auch arbeiten, viel arbeiten, um genügend Vermögen für die lange Zeit als Pensionistin anzusparen, aber sie wird Sabbatjahre nehmen können, vielleicht eines alle 15, 20 Jahre. Wahnsinnig, die dazu Nein sagt. Sie sieht ein Paradies vor sich wie ein unberührtes Wochenende. Das köstliche Gefühl, Zeit zu haben. Und Markus. Wenn ich es nicht mache, dann müssten wir uns trennen, denkt Miriam auf einmal, verbietet sich den Gedanken noch im selben Moment, weiß, dass er wahr ist, lässt den Zweifel trotzdem zu, und auch den nächsten Gedanken. Beziehungen sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Sie muss sich alleine entscheiden.
Es fühlt sich seltsam an, im Supermarkt durch die Regalreihen zu gehen, sie ist unaufmerksam, nimmt die falsche Butter, die, die Markus immer leicht ranzig findet. Als sie in der Tiefkühlabteilung steht, packt sie so etwas wie Aufmüpfigkeit, sie will etwas Neues probieren, greift schon nach den Nougatknödeln, als ihr der Mut entweicht wie Luft aus einem Fahrradschlauch. Sie hat den absurden Gedanken, es wäre zu riskant, diese Nougatknödel zu essen, sie könnte davon einen anaphylaktischen Schock bekommen und keine Luft mehr bekommen und ersticken und dann wäre alles umsonst, besonders all die Gedanken, die sie sich heute schon gemacht hat. Miriam nimmt doch die gewohnten Mohnnudeln, nicht ohne ein Gefühl von Niederlage. Sie kennt sich. Sie ist noch nie aufmüpfig gewesen. Sie wird keine von denen sein, die die SULV in Anspruch nehmen und trotzdem ein Kind zur Welt bringen. So, wie es noch immer ein paar Frauen machen. Trotz all der Warnungen von Ärzten, das während Schwangerschaft und Stillzeit notwendige Aussetzen der Medikation könnte die lebensverlängernde Wirkung der Therapie erheblich beinträchtigen. Trotz der finanziellen Nachteile, des erloschenen Anspruchs auf Familienbeihilfe für Mütter mit SULV. Trotz der in jeder Zeitungskolumne vertretenen Meinung, es sei moralisch falsch, beides zu wollen: ein Kind und 200 zusätzliche Lebensjahre.
FAQ
Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen der SULV und einer etwaigen Familienplanung?
Die lebensverlängernde Therapie muss für die Dauer der Schwangerschaft und Stillzeit ausgesetzt werden. Schwangerschaft und Geburt stellen eine weitreichende körperliche Belastung dar, die nach Ansicht von Expert:innen1 die Wirkung der SULV dauerhaft beeinträchtigen könnte. Frauen mit SULV wird dringend dazu geraten, sich vorbeugend einer Sterilisation zu unterziehen.
ministerium-fuer-soziales.at
An der Kassa hat sie das Gefühl, dass noch irgendetwas fehlt in ihrem Einkaufswagen. Irgendetwas Tröstliches. Sie will schon zu den Schokoriegeln für Spätentschlossene greifen, aber etwas hält sie zurück. Marietta. Mariettas insistierende Stimme, die ihr Vorträge hält über Kakaobauernfamilien, die sich zugrunde schuften, über Palmölplantagen, für die der Regenwald dran glauben muss. Marietta, für die Miriam eine scheue Bewunderung empfindet, eine mit schlechtem Gewissen durchsetzte, eine Zuneigung, die sich immer mehr vollzusaugen scheint mit schlechtem Gewissen. Sie denkt daran, wie sie mehr und mehr Zeit verstreichen lässt, bevor sie auf Mariettas Nachrichten antwortet. Wie sie sich am liebsten Ausreden einfallen lassen würde, wenn Marietta vorschlägt, einen Kaffee trinken oder gemeinsam zu diesem Konzert oder jenem Vortrag zu gehen, und dann doch mitkommt. Wie sie ihr aufgefallen sind, die zarten Fältchen um Mariettas blassblaue Augen. Wie sie Mariettas Stimme jetzt deutlich hört, mit nordwestdeutschem Einschlag, diese Stimme, die sich sicher ist, dass Miriam ihr zustimmen wird, wenn sie sagt, dass es ungerecht sei, dass gesunde Menschen in Österreich lebensverlängernde Medikamente bekommen, während anderswo die Lebenserwartung bei gut 50 Jahren liegt. Und natürlich stimmt Miriam ihr zu, auch jetzt, wo Marietta gar nicht da ist, sondern vielleicht gerade in Portugal oder den Niederlanden oder zuhause in ihrer WG, natürlich ist es ungerecht. Aber, denkt Miriam, es ist nun einmal so. Und meine Entscheidung dafür oder dagegen ändert nichts an der Situation einer Somalierin oder Nigerianerin. Und je länger ich arbeiten kann, desto mehr kann ich spenden, denkt Miriam, denkt es wie einen Satz, der nicht von ihr selbst stammt, wie etwas, das man eben so sagt, das man eben so gehört hat, das sich eben so gehört. An den sich die üblichen Sätze anschließen, die Miriam in Diskussionen mit Freundinnen selbst schon oft gesagt, oft gehört hat. Dass es Ausgleichsmaßnahmen gebe. Dass sie der SULV die migrationsfreundlichste Politik verdanken, die in der EU je geführt wurde. Dass das doch nicht nichts sei.
Sie erschrickt. Also hat sie sich schon entschieden? Der Augenblick fällt ihr ein, der kurze, gestern, als der Arzt schon zum Lächeln angesetzt hat, bevor er ihr den ausgedruckten Befund in die Hand gedrückt hat. Der kurze Augenblick, in dem sie gehofft hat, er würde ihr etwas Anderes sagen. Es würde das passieren, was sie sich in manchen Nächten kurz vor dem Einschlafen ausgemalt hat, nur dann, kurz vor dem Einschlafen, um sich vormachen zu können, sie hätte es gar nicht gedacht, nur geträumt, gehört, gelesen. Dass sie der Arzt nach der Untersuchung anschauen würde, mit diesem prüfenden Blick, den man aus Filmen oder Fernsehserien kennt, und dann sagen würde: „Aber Frau Pichler, Sie sind doch schon schwanger!“ Doch der Augenblick ist verstrichen, der Arzt hat ihr den Zettel in die Hand gedrückt, ihr diese und jene Zahl darauf erklärt und am Ende die Worte ausgesprochen: „Es spricht nichts dagegen, dass Sie ein Kind austragen können.“
Es spricht etwas dagegen, dass sie ein Kind austrägt.
Sie trägt ihre Einkaufstaschen nach Hause. Es fühlt sich an, als hätte sie zu schleppen. Sie braucht eine Pause.
Liebe am See, irgendeine alte Folge. Sie merkt zu spät, dass es die ist, in der Saskia Robert endlich sagt, dass sie schwanger ist, nachdem es die Zuschauer schon geschlagene drei Folgen gewusst haben, ja sogar schon vor Saskia geahnt hatten, wegen der Schwindelanfälle, die sie seit Folge 2643 geplagt hatten.
Was hat sie denn vor in diesen 200 Extra-Jahren? Was wäre denn anders als jetzt?
100 Jahre „Liebe am See“ schauen.
Sie drückt auf Stopp. Legt ihre Hände über beide Augen.
Erlaubt sich, aus der untersten Lade im Küchenkasten die Tafel Schokolade hervorzuholen, zwei Stück abzubrechen, in den Mund zu schieben.
Natürlich könnte sie etwas anfangen mit diesem Leben. Mit dieser ganzen Zeit. Allein schon das Gefühl, Zeit zu haben. Sie könnte doch noch ihren Doktor machen. Markus verlassen. Andere Männer lieben. Markus zurückerobern. Sich mehr Fehler erlauben, vielleicht.
Dann ist das Leben vorbei, sagt Markus manchmal, wenn sie übers Kinderkriegen reden, und Miriam weiß, er meint die Jugend. Das Nur-für-sich-selbst-da-sein-Müssen. Das Sich-jederzeit-neu-entscheiden-Können. Das Noch-immer-nicht-hundert-Prozent-erwachsen-sein-Müssen.
Miriam streckt sich, spürt ihre vom Sitzen steifen Glieder. Fühlt sich plötzlich wahnsinnig alt in diesem ihrem, immer schon ihrem Körper. Wundert sich, dass er seit 24 Jahren ohne Pause funktioniert. Seltsam, dass unsere Herzen nicht öfter zu schlagen aufhören.
Ich bin jung, ich bin jung, ich bin jung.
Jung, das waren sie, als sie einer dem anderen nackt gegenüber standen. Ein Risiko eingingen. Sagten „Ich will dich“ ohne sicher sein zu können, dass der andere „Ich dich auch“ antworten würde. Jung. Zerbrechlich. Verletzlich. Hungrig, wach, neugierig. Rührend, zum Weinen rührend schön. Wann ist man jünger, als wenn man ein Kind bekommt?
Irgendwann wird Markus sich auch ein Kind wünschen, denkt Miriam. Und dann wird er sich eine Frau suchen, die noch kann.
Beziehungen sind nicht für die Ewigkeit gemacht, Miriam.
Sie zwingt sich, das Andere zu sehen. Das zweite Studium, das sie sich in ein paar Jahren leisten könnte. Zeitlich und finanziell, muss sie hinzufügen. Vielleicht doch noch in die Forschung gehen, vielleicht doch noch ins Ausland, vielleicht noch einmal ein Jahr nichts machen. Das köstliche Gefühl, Zeit zu haben. Zu lernen. Immer mehr von dieser immer noch so unbegreifbaren Welt verstehen können. Den Dingen auf den Grund gehen können.
Nicht können. Niemals können. Unergründlicher Grund. 200 Jahre Serien schauen. Habe ich denn Träume?
Ja, Miriam.
Sie sieht das Kind nicht, sie spürt es. Zeugen, heranwachsen fühlen, gebären. Küssen. Lieben. Das Leben dafür geben.
Das ganz normale Opfer, das jede bringen muss.
Und dann denkt sie kurz, sie müsse verrückt geworden sein, weil sie da auf einmal etwas spürt, in ihrem Bauch, ganz weit unten, und erst als es hochzusteigen beginnt, hinauf in die Magengegend, weiß sie, es ist nur die Wut.
Es ist immer besser, die Wahl zu haben, hat Isabelle gesagt, als sie Miriam erzählt hat, dass bei der Untersuchung herausgekommen war, dass es bei ihr ohnehin schwierig wäre. Ein zurechtgelegter Satz, den man mit gut geölter Stimme ausspricht, der so dick in Vaseline eingecremt ist, dass unmöglich festzustellen ist, ob man ihn ernst meint oder nur nachplappert, einer, der er von selber herausflutscht, weil ihn jede sagen könnte, ein Satz, der eigentlich schon gesagt ist.
Es ist immer besser, die Wahl zu haben, es ist besser, die Wahl zu haben als nicht, es ist besser, die Wahl.
In England zum Beispiel, da ist Sterilisation Pflicht, für Männer und für Frauen, die Lebensverlängerung in Anspruch nehmen wollen. Hier in Österreich könnte Miriam vielleicht beides haben, ein Kind und, wenn nicht 300, vielleicht 250 Jahre leben, aber eben nur vielleicht, eben nur so, dass einem nie jemand etwas darüber erzählt oder sich bei jeder Gelegenheit in schwammige Umwege flüchtet, eben nur so, dass man niemandem etwas darüber erzählen darf. Dann besser ehrlich sein, so ehrlich wie Marietta, wissen, was das Richtige ist und gerade deswegen das Richtige tun. Darwin konnte dem Leben keinen Sinn geben, hat Marietta gesagt, wohl aber dem Tod. Platz machen für das, was nach uns kommt.
Marietta wird Platz machen, wird viel früher Platz machen als Andrea oder Isabelle, als Markus. Und sie, Miriam, wird zusehen. Wird vielleicht noch leben, wenn Marietta schon 100 Jahre tot ist. Wird sich unmöglich noch wirklich, noch ehrlich an sie erinnern können. Oder?
Ich bin zu feig, denkt Miriam. Nicht mutig genug, um so zu sein wie Marietta. Und noch etwas denkt sie, ganz leise, sodass sie so tun kann, als hätte sie es überhört: Für Marietta reicht ein Leben.
Für Miriam nicht?
Im Zimmer ist es dämmrig geworden. Wenn Markus sich noch nicht entschieden hätte. Wenn sie gemeinsam entscheiden würden. Der Geruch von Markus‘ T-Shirt, wenn sie ihre Nase an seiner Schulter verbirgt. Markus‘ Kopf in ihrem Schoß, Küsse auf seine Schläfe, seine Augen, seinen Mund. Markus‘ Hände, Markus‘ Zeigefinger, von den Augen bis zur Nasenspitze. Markus umarmen. Markus‘ Arme.
Wie oft wird es noch einen Markus für sie geben?
Bringt nicht auch Markus ein Opfer, so oder so?
Miriam hat es nie zugegeben, aber sie hat die laute Kritik der Feminist*innen an der SULV-Regelung nicht ganz verstanden. Hat die Argumente der Politik einleuchtend gefunden. Die offenkundige Notwendigkeit demographischer Steuerung. Die medizinischen Nachteile für Mütter. Die Gefahr, am Ende gar keine zeugungsfähigen Männer mehr zu haben, wenn sie sich wie in England auch sterilisieren lassen müssten.
Jetzt glaubt sie zu verstehen.
19-Jährige ohne Gebärmutter, die sich nach ein paar Bier für die SULV anmelden und es nie bereuen werden.
Sie, mit Gebärmutter, die eine Funktion ihres Körpers abschalten lassen soll.
Und Markus. Aber Markus. Markus, den sie trotzdem und unabhängig davon und mit voller Berechtigung liebt, den sie jetzt liebt, in der Gegenwart, dem einzigen, was real ist. Morgen ist schon Schimäre. Ein Kind ist schon Schimäre.
Draußen ist es fast Nacht. Sie hat Hunger. Sie hat noch gar nichts gekocht.
Der Schlüssel dreht sich im Schloss.
Da bist du, sagt Markus. Ich hab‘ mir gedacht, ich steh‘ dir bei.
Sie kann es ihm nicht verübeln.
Er ist zu früh.
Er weiß schon, was er tut.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
23 | Christoph Laible
Weihnachten ist nicht später
Karl ist ganz aufgeregt, als Papa die Haustür öffnet.
„Papa!“, ruft Karl.
„Später“, sagt Papa.
Er schleppt die Einkaufsackerl ins Haus. Auf der Stirn eine tiefe Falte.
Karl klopft gegen die Küchentür und Papa öffnet sie. Es riecht nach Blaukraut und Knödeln.
„Papa!“, ruft Karl.
„Später“, sagt Papa und rührt in den Töpfen, aus denen es dampft und zischt. Die Falte auf der Stirn noch tiefer.
Karl klopft gegen die Küchentür, aber Papa öffnet nicht. Also geht er hinein.
„Papa!“, ruft Karl.
„Später.“ Er schiebt drei Bleche mit Keksen in den Ofen. Die Falte auf seiner Stirn kommt Karl nun unendlich tief vor.
„Es ist schon dreimal später!“ Karl stampft auf den Boden.
„Was ist denn so wichtig?“ Papa seufzt.
Vor dem Fenster liegt ein Vöglein.
„Oje“, sagt Papa.
Papa holt einen Schuhkarton und sie bringen das Vöglein ins Warme. Sie decken es mit einer Serviette zu und warten, aber das Vöglein rührt sich nicht. Als Karl weint, macht das Vöglein: „Piep.“
Papa holt eine Pinzette und gibt ihm Brotkrümel. Das Vöglein frisst. Bald riecht Karl Verbranntes.
„Die Kekse!“, ruft Karl.
„Später. Lass es erst fressen“, sagt Papa. Die Falte auf seiner Stirn ist verschwunden.
.
Christoph Laible
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
22 | Sarafina-Abena Yamoah
Schnee im Kopf
Wir sind die bauchige Schneekugel, die kaputt geht, Glassplitter wie Eiskristalle, aber schneien tut es ja nur da, wo die Wärme fehlt, wo Minusgrade an der Tagesordnung sind und bei uns schneit es in unsere Köpfe hinein, egal ob Winter oder Sommer, im Winter fällt es nur auf, weil da die Welt hinter dem Glas genauso aussieht wie hier drin
Manchmal erschreckt man sich, wenn man jemanden sieht, der einem zu sehr ähnelt und wer in der Glaskugel sitzt, sollte auch besser nicht mit Schneekugeln werfen Eiskristalle zeigen nämlich in alle Richtungen und können sich auch in angefrorene Herzen bohren, sie nutzen dafür die gleichen Widerhaken, die dafür sorgen, dass geliebte Menschen in unseren Gedanken so lange überwintern dürfen, wie es ihnen gefällt
So viel Winterschlaf kann doch kein Mensch halten, aber du bist schon so lange zwischen meine Schädelplatten gepresst wie die gelbroten Rosenblätter, die ich zum Abschluss bekam, die irgendwann anfingen das Buch mit Schimmel zu befallen, aber du bist so trocken, als hätte ich dich falsch herum an meine Wand im Kinderzimmer aufgehängt, darauf gewartet, dass du sorgsam vor meinen Augen stirbst
Aber hier lebt es sich wie unter einer Schneekugel und wem sag ich das, du selbst hast hartnäckig an ihrer Zerstörung gearbeitet, aber wie wir zueinanderstehen, blieb stets ein Kippbild, als würde jemand durch ein Kaleidoskop blicken: wir sind beide doppelt gebrochen und können einander deswegen nur spiegeln
Und die Eiskristalle tun ihr Übriges: Wenn es sich ausgeschneit hat, ist noch niemand bereit für den Frühling, jedes Jahr dieselbe Prozedur, dieselbe Tortur dieses Einsehen, dass der Kopf nicht mit den Blumen von draußen auftaut, dass es dort kalt und windig bleibt, wo Eiskristalle und braunmatschiger Schnee den Ton angeben; auch eine Schneekugel, deren Glaskuppel zerbrochen ist, bleibt eine Schneekugel.
.
Sarafina-Abena Yamoah
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
19 | Marlene Schulz
Kompa, Frau Mirjami und Herr Ernst
Ich bin Kompa und eine Katze. Mein Herr, er hört auf den Namen Ernst, nennt mich so. Seine Frau, Mirjami, hat den Namen für mich ausgesucht, als sie noch in unserem Haus wohnte. Sie fand mich auf dem Kompost als meine Augen noch geschlossen waren – daher mein Name – und fütterte mich.
Ja, Sie haben recht, ich habe eine schwierige Kindheit hinter mir, aber ich habe es geschafft, wie Sie sehen.
Herr Ernst redet sehr viel – er unterrichtet in der Schule – und Frau Mirjami hatte eines Tages genug davon. Jetzt redet Herr Ernst mit sich und seinen wechselnden Besuchen. Manchmal setzt er sich neben meinen Schlafplatz, wenn ich ruhe, und beginnt zu sprechen. Das ist mir äußerst unrecht und mir bleibt nichts anderes übrig, als aufzustehen und meine Ruhestätte zu wechseln.
Herr Ernst redet wirklich sehr viel an einem Tag und auch noch, wenn es dunkel wird. Er gibt sich bei einem Thema, das er begonnen hat, selbst Stichworte für das nächste, das er direkt anschließt. Seine Besuchsmenschen, ich habe das mehrfach beobachtet, sind auf der Lauer und warten auf eine Pausierung in Herrn Ernsts Gespreche, um auch etwas sagen zu können, aber den wenigsten gelingt das. Sie müssten unhöflich sein und ihre Worte über seine legen, aber die meisten wollen das nicht. Herr Ernst hat zu allem etwas zu sagen.
Er ist vielseitig begabt. Er wäre gerne ein ruhmreicher Maler. Handwerklich begabt ist er durchaus, auch an seinem Fahrrad kann er Kleinigkeiten selbst reparieren und bei der letzten Wahl hat er sich für eine Partei aufstellen lassen, die wie eine Farbe heißt, und wurde zu meiner großen Überraschung gewählt. Ich hätte ihn, das sage ich nur Ihnen, nicht gewählt. Herr Ernst hat zu zu vielen Dingen eine Meinung. Dennoch: Ich bin überzeugt, dass sein Wissen zwar breit ist wie ein Ozean, dafür aber nur tief wie eine Pfütze.
Ich habe beobachtet, wie er das mit dem Sprechen regelmäßig mit seinen Besuchsmenschen macht. An einer Stelle ihres Redebeitrages gibt er ihnen recht, nickt sogar auffällig stark, und setzt dann seine Referate an.
Was Herr Ernst nicht macht, ist kochen. Das hat er an ungefähr 260 Tagen im Jahr Frau Mirjami überlassen und weitere 105 Tage waren sie zum Essen ins Restaurant oder zu anderen Menschen in deren Wohnung oder Haus gegangen. Für einen konservativen Menschen stellt das keine Ungewöhnlichkeit dar, aber Herr Ernst möchte gerne ein fortschrittlich denkender, emanzipierter Mann sein. Sie könnten Frau Mirjami befragen, was diese dazu sagt, oder es sich selbst zusammenreimen. Für so klug halte ich Sie.
Herr Ernst hat durchaus liebens- und lobenswerte Seiten. Er reinigt den Ort meiner Hinterlassenschaften regelmäßig, gut, gelegentlich dürfte es gründlicher und häufiger sein, aber ich möchte nicht kleinlich sein. Für meine Mahlzeiten sorgt er ebenfalls, bürstet mein Fell, was eine Wohltat ist, vor allem, wenn ich haare, und er nimmt mich sogar mit auf Reisen. Er besitzt ein Haus in den Bergen. Wir fahren drei bis vier Mal im Jahr dort hin. Eine mehrstündige Fahrt ist von Nöten, die er abends zuvor mit Nahrungsentzug für mich ankündigt. Er möchte, dass ich die Fahrt möglichst gut ertrage und keine Übelkeit aufkommt. Mir wäre es lieber, er würde nicht so viel herumüberliegen, stattdessen etwas zügiger fahren und Zeiten hohen Verkehrsaufkommens meiden. Das nimmt er sich zwar jedes Mal vor, sagt so etwas wie: Morgen fahren wir noch vor Anbruch des Tages los, aber dann muss er noch dringend Dinge erledigen, die schon seit Wochen, gar Monaten liegen und es wird – so bin ich es von ihm gewohnt – doch Mittag, bis wir loskommen.
In den Ferien liest mir Herr Ernst häufig aus den Büchern vor, die er liebt. Sachbücher über Bienenzucht oder Hühnerhaltung – die soll ja jetzt wieder zunehmen – auch Ausstellungskataloge, Bildbände, Kunstkritiken zu berühmter Malprominenz, Reisebücher sind auch dabei. Und dann sagt er so etwas wie: Ach, Kompa, schau dir diese Landschaften an und stell dir vor, wie ich sie male. Er verspricht dann, mir auch ein Plätzchen darin einzuräumen. Bis jetzt hat Herr Ernst sein Versprechen noch nicht halten können.
Das Fahrradfahren liebt er ebenso und ich bin sehr beglückt, dass er mich auf diesen Fahrten nicht mitnimmt. Frau Mirjami hat einmal mit ihm zusammen die Alpen auf dem Zweirad überquert. Kurz danach zog sie aus und weg. Ihr neuer Wohnort entzieht sich meiner Kenntnis. Glauben Sie mir: Zu meinem großen Bedauern.
Herr Ernst spricht noch mehr, wenn er am Abend beginnt zu trinken. Ich habe beobachtet, dass er bei einer bestimmten Menge mehr redet. Wenn diese Menge noch größer wird und er beispielsweise für einen Entleerungsgang den Raum verlässt, kommt er deutlich ins Schwanken. Nimmt er dann noch mehr alkoholisches Getränk zu sich, wird er stumm, seine Haltung am Tisch wirkt labil, sein Kopf fällt zur Brust und er beginnt zu weinen. Er weint einige Zeit für und vor sich hin bis sein Kopf auf den Tisch fällt, er die Arme darunter überkreuzt und beginnt mit offenem Mund zu schlafen. In solchen Momenten schwanke ich, ob ich wirklich bei Herrn Ernst bleiben mag. Sein Selbstmitleid kann abstoßend sein.
.
Marlene Schulz
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
18 | Carolina Reichl
Die Wunschlosen
Du sagst, es ist spät. Ich schaue auf die Uhr, die du mir vor Jahren geschenkt hast, auf der Innenseite hast du mir was eingravieren lassen. Numquam retro. Niemals zurück.
Es ist nachts, zwei Uhr einundzwanzig. Meine Augen sind ausgetrocknet, zu lange habe ich auf den Bildschirm geschaut. Fünf Stunden, 39 Minuten, um genau zu sein.
Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, darauf zu achten, wie viel Zeit ich für was brauche. Sechs Stunden Schlaf, 43 Minuten im Bad (morgens und abends zusammen), zehn Stunden in der Arbeit. Die restliche Zeit kümmere ich mich um deinen Kater Morli, in der Hoffnung, dass er sich irgendwann von mir berühren lässt, und gehe zu deinem Grab. Mindestens zweimal die Woche pflege ich es. Die Leute sollen schon von der Ferne sehen, dass dein Grab am schönsten ist, damit sie merken, dass du wichtig bist.
Ansonsten habe ich keine Hobbys, ich mache den Haushalt und bereite meine Patientengespräche vor.
Ich bin effizient.
Wenn ich mich entspanne, fühle ich mich faul.
Nur wenn ich nach Hotels schaue, kann es passieren, dass ich mich für Stunden verliere. Ich plane eine Weltreise, darunter ein zweiwöchiger Aufenthalt in Peru. Ich recherchiere nach den besten Unterkünften, Ausflügen, Lokaltipps und Reiserouten, bis ich so erschöpft bin, dass ich nicht mehr kann. Ich schließe den Laptop, ich bin voller Adrenalin. Ich stelle mir vor, wie das wohl sein wird. Peru, Island, Litauen, Japan, Indonesien, Australien, Hawaii, L.A., New York. Wissend, dass keiner von diesen Urlauben jemals für mich stattfinden wird.
Aber warum, du würdest doch gerne verreisen, sagst du. Es hätte nichts geändert, wenn du bei mir geblieben wärst.
Mein Handy vibriert.
Unsere ältere Schwester Katrin schreibt, ob ich nächsten Samstag zu ihr komme.
Wegen Weihnachten.
Ich seufze.
Schön wieder ein Jahr vergangen.
Katrin hält den Gedanken nicht aus, dass ich den 24. Dezember alleine verbringe oder so wie vor zwei Jahren den ganzen Tag an deinem Grab stehe. Zu groß das schlechte Gewissen. Beim Weihnachtsfest selbst will sie mich aber nicht dabei haben, nicht dass ich die Stimmung runterziehe, ich soll am Vormittag kommen.
„Till ist mit den Kindern einen Baum aussuchen“, sagt sie. Sie öffnet einen Prosecco. Wie eine Sanduhr bei einem Saunadurchgang markiert die Flasche unser gemeinsames Zeitfenster, das anzeigt, wie lange ich noch durchhalten muss, bis ich wieder verschwinden kann.
Ich schenke ihr eine Orchidee, Pralinen und ein Buch, das sie vermutlich niemals lesen wird. Sie sagt, das wäre nicht nötig gewesen. Es ist nicht leicht, jemanden zu beschenken, der schon alles hat.
„Für dich“, sagt sie und hält mir einen Reisegutschein entgegen. Letztes Jahr Wizz Air, dieses Jahr Tui. Ich bedanke mich, doch ich greife ihn nicht an.
„Freust du dich nicht?“, fragt sie.
„Doch. Ich kann ihn nur nicht annehmen.“
„Warum nicht?“
„Du weißt doch, dass ich Morli nicht alleine lassen kann.“
„Er kann bei mir bleiben.“
„Die Kinder würden ihn stressen. Außerdem muss ich auf meine Patienten schauen. Mir wäre nicht wohl dabei, ein Wochenende nicht erreichbar zu sein.“
„Du arbeitest zu viel.“
Sie hat recht, meinst du. Ich schüttle den Kopf.
„Wann warst du das letzte Mal auf Urlaub?“
Ich zucke mit den Schultern, als wüsste ich es nicht. Es sind drei Jahre, elf Monate und zwei Tage, seitdem du tot bist.
„Hast du kein Fernweh?“
„Ich glaub, ich brauch das Reisen nicht mehr“, sage ich.
„Blödsinn!“, ruft Katrin. „Mit ihr wolltest du noch eine Weltreise machen! Du warst immer so gern unterwegs und jetzt dreht sich alles nur noch um deine Psychopraxis!“
Katrin hält nichts von Psychotherapie. Sie glaubt, dass das Geldabzocke ist, dass die Leute nur an ihren Profit denken, wenn sie sich am Leid der anderen bereichern. Sie findet, mit seinen Problemen muss jeder selbst fertig werden; es bringt nichts, seine Sorgen immer wieder durchzukauen. Man muss weitermachen, sich auf das Gute konzentrieren, dann wird das schon.
„Und sonst?“, fragt Katrin. „Hast du irgendwas vor? Irgendwelche Pläne für die Feiertage?“
Ich schüttle den Kopf.
„Ich bin wunschlos.“
„Aber glücklich bist du nicht.“
Katrin trinkt den Prosecco aus und spricht mit ernster Stimme weiter: „Ich mach mir Sorgen um dich.“
Sie will wissen, was mich hier hält.
Ob es wegen dir ist?
Warum ich nicht loslassen kann?
Ihre Lippen bewegen sich weiter, aber ich höre nichts. Ich sehe deinen ausgetrockneten Mund, Katrin, wie sie dir den Speichel weg tupft. Ich sehe mich dir winken, euch sagen, ich hätte einen Notfall, einer Patientin geht es nicht gut. Ich verlasse das Krankenhaus, steige in ein Taxi und fahre zum Flughafen, ohne Gepäck buche ich dort den nächstbesten Flug, es geht nach Athen. Ich steige in den Flieger, ich komme an, ich lasse mich in einen Klub bringen, ich trinke, bis ich nicht mehr gerade stehen kann. Ich unterhalte mich, ich lache, ich tanze, ich mache alles, was du nicht mehr machen kannst. Ich habe Spaß, ich denke nicht an dich.
„Geht’s dir gut?“, fragt Katrin.
Mein Gesicht ist nass und salzig. Meine Haut glüht. Ich dachte, ich würde um dich trauern und dann würde es mir besser gehen, doch stattdessen bekomme ich jedes Jahr einen neuen Reisegutschein, den ich verfallen lasse und anstatt dem Rauschen der Wellen höre ich immer wieder die dröhnende Partymusik des Klubs und Katrin, die mich am nächsten Morgen anruft und sagt, du wärst friedlich eingeschlafen.
„Was ist?“
Ich kann nicht antworten, nicht denken, ich habe das Gefühl zu zerfallen, ich falle –
„Du warst sicher zehn Minuten weg.“
Katrin sagt, dass ich zu viel alleine bin und mehr auf mich schauen muss. Sie hätte mich mehrmals gerüttelt und meinen Namen geschrien, ich wäre am Boden gelegen und nicht ansprechbar gewesen.
Ich soll mir die Feiertage nehmen und mich entspannen, meinst du.
Ihr übertreibt.
Nach den Feiertagen gehe ich wie gewohnt zur Arbeit.
Numquam retro.
.
Carolina Reichl
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: