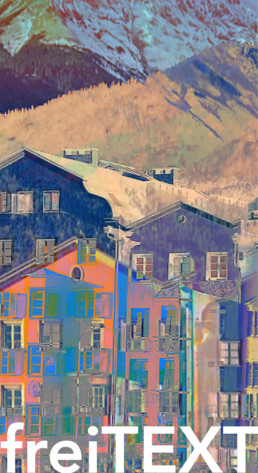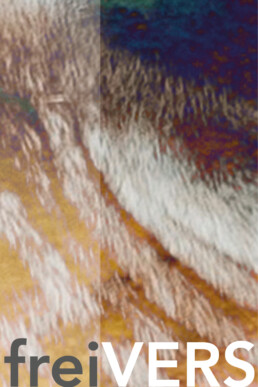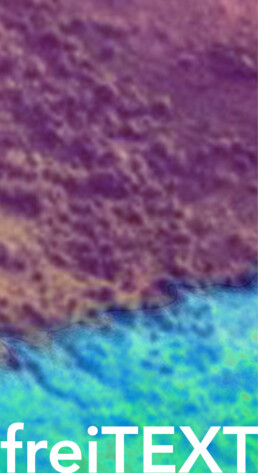freiVERS | Avy Gdańsk
30. November 2025freiVERS,Avy GdańskLiteratur,Lyrik
aus Männern werden Nymphensittiche
mit roten Bäckchen, angeblich, wenn
sie mich sehen: deine Beobachtung
befriedigt den Prinzen in mir, dem
deine Heimat unablässig schmeichelt
doch sollte man einem Land
keinen Glauben schenken, wenn
es einen zu verwandeln sucht: meins
erzählt nur Märchen über dich, weiß
und weiß nichts: hier
sieht man nur deine Haut und
deinen Halbmond, dem auch ich
mit spitzen Hörnern begegne – meine
agnostischen Instinkte schlagen, meine
mystischen schmiegen sich an; ich
löse dich immer noch aus Worten, mit
denen ich dich überzogen habe und schlüpfe
in deine Djellaba – einmal werde ich
alles von dir, du alles
von mir tragen, bis
dahin versöhne ich dich mit dem Schnee
und finde heraus, wie man böse Zungen
entgiftet
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martin Ködelpeter
28. November 2025Prosa,Martin KödelpeterLiteratur,freiTEXT
gespenster
1 die gladiolen sind frisch geschnitten. sie stehen aufrecht in einer gläsernen, nach oben schmal zulaufenden vase. durch das helle glas kann man im wasser einzelne luftbläschen erkennen. sie sitzen auf den stielen und auf den schwertförmig in die höhe strebenden blättern. einige bläschen haben sich auch am glas gesammelt. knapp oberhalb des vasenrands, etwa auf halber höhe der gewächse, spreizen sich die ersten blüten von ihren stängeln ab. ihre form ist die komplizierteste. eine frau berührt mit ihrem zeigefinger vorsichtig eines der gelben fruchtblätter. die kinder, die sich im halbkreis um sie versammelt haben, nicken. sie wissen, dass das geheimnis darin besteht, nur das zu malen, was man tatsächlich sieht. nachdem die kinder mit ihrer arbeit begonnen haben und die pinsel ihren weg durch die bereitgestellten farbkästen suchen, verändert sich das klima im raum. die angestrengte, wie ein boot schwankende stille, die kleinen, über das raue aquarellpapier streichenden fäuste, die gleichgültigkeit der gladiolen in ihrer vase, all dies ist plötzlich kaum mehr zu ertragen.
2 das misstrauen gegenüber den worten, bis in die haarspitzen ist es dir gewachsen, tropft auf die schuhe, hinterlässt überall seine spuren. schon bald sickert es in die druckerpatronen, die dir von ihren haken im elektronikgeschäft unverhohlen ins gesicht lachen.
3 und wieder: der alte traum, in die wälder zu gehen, eine höhle zu graben, abseits der rahmen menschlicher proportion. im schatten der eichen findest du dich zwischen zweigen verstreut. beschämt, nicht zerbrechen zu können, wenn ein tier auf dich tritt.
4 die flügel sind zerbrochen. schmutz bedeckt das nasse gesicht. unmöglich, den jungen vogel zu orten, der dir aus der dunkelheit ein lied über sein porzellanenes federkleid singt.
5 und sicher, es ist reizvoll, die gewalt abzuwägen, das scharnier an der tür durch die augen des entschlossenen räubers zu sehen. und die gewalt, die deine finger bewohnt und die auch das eisen bewohnt, das du auf deinen fingern geschickt zu balancieren vermagst, schreibt seine kerben in den asphalt breiter straßen, fügt seine spuren behutsam in die kiefer und augenhöhlen blauviolett schimmernder nachmittage.
6 du trägst die steine in deinen händen. die steine tragen die namen der väter. die väter tragen keine steine. sie sind tot. an einem bach bleibst du stehen. du legst die steine ins wasser, drückst sie hinab wie den kopf eines kindes, drückst sie hinein in den boden des bachs. schon bald beginnen die steine zu schluchzen. du hältst sie fest. du hältst die steine wie seifenstücke, deren schäumende leiber nur darauf warten, deinem griff zu entgleiten, nach oben zu flitschen und dir die namen der väter mit felsiger tinte ins angstvoll verzerrte antlitz zu schreiben.
7 es sind die zähne, die vergessen, die stunden zu addieren, der kiefer, der über das knirschen der wochen in verwirrung gerät.
8 und jeden tag kommt ein neuer tag und rüttelt an den ästen der träume, rüttelt das nachtobst aus dir, das du aufliest und mühsam zerkleinerst, das du, gebeugt über das schneidebrett, zurück in den körper zu stopfen beginnst. und auch die kerne und stiele und auch die schalen und die zu boden gefallenen teile stopfst du zurück in den körper, alles stopfst du zurück und leckst schließlich sogar den saft von der klinge des messers. leckst mit der zunge die zähne, die den dunklen geschmack noch einen moment festzuhalten verstehen.
9 das foto zeigt dich auf einer breiten allee. der ort ist dir unbekannt. nichts wirkt vertraut. ist es überhaupt eine allee? jemand scheint das negativ mit einer chemischen lösung bearbeitet zu haben. jede dunkelheit, jeder kontrast - weggeätzt. du blinzelst, suchst im grauweißen rauschen nach einem bekannten detail. doch da ist nichts. nur du und dein im grellen licht beinahe transparent gewordener schatten.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Marlies Blauth
23. November 2025freiVERS,Marlies BlauthLiteratur,Lyrik
mein Haus
besitzt viele Windungen
Korridore
führen durch die Jahrzehnte
am Ende haben wir
manchmal Neues gebaut
einen Ruheraum
eine Kleiderkammer
einen Gedanken –
jetzt
breitet sich Halbleere aus
staubige Spuren
lebendiges Erbe
jemand fragt
ob du hier
überhaupt noch wohnst
mein Nein
hat einen Bittergeschmack
den ich nicht aussprechen will
das Herz sortiert
trübe Bilder aus
ohne dich
gäbe es auf der Südseite
keine Sonnenblumen!
zu manchen Zeiten hast du
mir Wörter geschenkt
glanzvolle
helle
erleuchten seitdem
jedes Zimmer
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tamàs Török
21. November 2025Prosa,Tamàs TörökLiteratur,freiTEXT
Hitze
Sobald die Tür zum kühlen Treppenhaus hinter mir ins Schloss fällt, wird mir jedes Mal aufs Neue klar, wieso die Sonne eine Gottheit war.
Der Winkel, in dem ihr Licht auf die Speckbacherstraße in Innsbruck fällt, ändert sich und meine Winterdepression wird zur Atemnot zwischen glühendem Asphalt. Ich senke den Blick vor ihrem Glanz und suche Zuflucht in den Schatten.
Egal hinter wie vielen Fachbegriffen und Zahlen man sie auch zu verstecken versucht, das subjektive Empfinden ihrer mich beinahe in die Knie zwingenden Macht bleibt dieselbe.
So, wie ich sie bei meinen Winterspaziergängen suche, wie eine in die kalte Dunkelheit jenseits des wärmenden Lagerfeuers verbannte Motte, beginnt der Sommer für mich an jenem Tag, an dem ich die Straßenseite wechsle, um vor ihr zu fliehen. Es ist zur selben Zeit, in der das üppige Jeansblau des Frühlingshimmels dem ausgewaschenen Look des Sommers weicht, in dem unser weißes Inferno so lautlos wütet.
Die mich umgebenden Hausfronten sind ausdruckslos wie die Dünen von Arrakis, hinter deren gesenkten Rolllädenlidern die Bewohner sich wie fiebrige Gedanken wälzen.
Eine Biene klammert sich an eine gefallene Blüte auf dem sengenden Fußgängerweg, nuckelt noch im Todeskampf am Blütenstaub.
Ein Moped surrt an mir vorbei und ich denke an eine Mücke aus Metall.
Soll ich über den Zebrastreifen sandwalken wie Timothée?
Sirenen heulen in der Ferne, die nie verstummt sind, die drückende Stille war also bloß Einbildung, meine Entrückung ein Placebo. Alles ist wie immer. Die Krankenwagen kommen immer näher mit ihrer sterbenden Fracht, zerbröseln meinen Kopf im Vorbeifahren in einer Explosion aus Schall. Sobald sie um die Ecke biegen, werde ich ganz von allein wieder ganz.
Zivilisten hupen, weil es an den Ampeln staut und auf jedes Hupen antworten zwei, drei weitere kniggegerechte Revolverschüsse im gezähmten Westen.
Die Minuten rinnen an den Kirchtürmen herab, wie Harz an Baumstämmen und ihr Klingeln vermischt sich mit dem Krächzen von auf Regenrinnen harrenden Raben.
Worauf sie harren? Auf frisches Aas.
Und sie warten nicht umsonst, denn in den Menschenbrüsten pocht es vor Wut und Einsamkeit, die Herzen im Rippenkäfig gefangene Berserker, denen jeder Grund recht und einer zu viel ist. Denn die Gefühle herrschen wieder im zivilisierten Durcheinander, das Denken wurde vom Lagerfeuer verbannt.
Was sonst so leicht fällt, ist plötzlich schwer. Nicht pöbeln, zuschlagen, nachtreten und draufspucken, nachdem die zittrige, auf ihren Rollator gestützte Pensionistin mit den Muschelpralinen und der Kochrumflasche im Korb sich an der Kassa vordrängelt, eine größere Herausforderung, als sich Leser von Proust und Woolf eingestehen möchten.
Andererseits verschlingen das Weltgeschehen und die wirtschaftliche Lage schon seit Jahren die schimmligen Madeleines im Panikraum der Selbstbeherrschung.
Was mal wirklich schön wäre, wäre eine Pause. Von allem.
Einfach mal Siesta machen und die Welt Welt sein lassen.
Wie viel einfacher doch alles wäre, wenn wir weniger erwarten könnten. Zuerst von uns selbst und dann allmählich von all den anderen, anstatt durch das Vakuum der Hitze zu rasen, nur um auszubrennen und zu verglühen, wie durch die Einsamkeit des Weltraums stürzende Sterne.
Wir schwitzen schließlich alle und der Herbst kommt früh genug.
An zu Tuendem wird es uns niemals mangeln. Das Leben ist unerschöpflich, aber ich bin es nicht.
Cut. Stop.
Aus die Maus.
So wie damals im Kindergarten, als ich mit vom Mittagessen prallem Bauch mürrisch wurde, ist es höchste Zeit für ein Nickerchen auf meinem Rorschachtest aus Schweiß und Leinen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Ale Leyler
16. November 2025freiVERS,Ale LeylerLiteratur,Lyrik
belladonna
du hattest wichtiges zu tun.
musstest bei papa schlafen, der die ganze nacht nur geheult hat.
der wind schlich unter die decke.
die socken halfen nichts.
die dicksten socken schenkte dir die grossmutter, die zweimal starb.
ich habe nicht gewusst, dass ein mensch zweimal sterben kann,
aber bei ihr habe ich es gesehen & geglaubt.
vater hat nach ihrem tod geweint & mutter nicht,
mutter war eine starke frau, der wind hat ihr nichts ausgemacht,
auch dann nicht, als winkelried sich nach der beerdigung umbrachte.
er schluckte eine unmenge gift, genug um einen stier zu töten,
& nicht einmal einen abschiedsbrief liess er da zur erklärung.
bei der beerdigung wurden dinge vorgelesen, die halb blieben,
halb wahr, halb richtig, halb omi. winkelried war nicht da.
niemand konnte sagen: ja, so war es. auch dann nicht,
als die bäume mitten im winter blühten & im frühling starben.
mutter hat den hunden den essig von der schnauze geleckt, damit sie mit dem heulen aufhören.
wir taten kein auge zu. papa konnte nicht. dabei wäre heute,
als ich im bett lag & in den himmel starrte, ein guter tag gewesen,
um die wichtigen dinge zu erledigen: socken flicken,
die schubladen ausräumen, den hund zum einschläfern bringen.
ohnehin stapeln sich die briefe, um die wir uns kümmern sollten.
ich wollte dir eine gasse machen, doch dann hat der blitz eingeschlagen.
ich eilte zu dir durch strauch & unkraut, ich war zu spät,
der baum war gespalten, feuer brannten, die leute waren verängstigt,
wenn bloss nicht nochmals, wenn bloss nicht.
immer in eile aber nie pünktlich, sagte mutter.
wo der blitz einschlug, sind pfützen aus essig, die die hunde auflecken.
wir sehen & riechen uns in den pfützen.
als wir am see entlang gehen, an den hühnerställen vorbei,
nennst du beiläufig die namen der blumen & gräser.
wer nennt mir die blumen, frage ich mich,
wenn du nicht mehr bist? mir steigen tränen in die augen,
ich versuche an anderes zu denken,
die hühner wegzuscheuchen mit ihrem todesblick.
am ende des sees grollt der donner.
ich wollte dir eine gasse machen, eilte zu dir,
ich war immer in eile, die ganzen jahre lang,
war freundlich, wenn mir der donner grollte,
hörte zu, als mir nach sprechen war,
blieb auf dem weg, versprach auf dem weg zu bleiben,
weinte mit der belladonna, weinte um die bäume,
die im frühling starben.
ich war zu spät. oma war gestorben.
der hund roch essig, frass dein bild im essig,
& verschluckte dich wie ein gespenst.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Patricia Malcher
14. November 2025Prosa,Patricia MalcherLiteratur,freiTEXT
Rundungsfehler
„Es muss weitergehen.“
Martin nickt, versteht, was ich meine, während ihm Tränen über die Wangen laufen.
Dabei bin ich es doch, die weinen sollte. Der man erklären müsste, was da in den letzten Tagen passiert ist. Mit ihr, mit mir, mit unserer Familie.
„Ich bin nicht die Erste, der das passiert ist“, sage ich.
Wieder nickt Martin, aber diesmal kommt er auf mich zu, umrundet meinen Schreibtisch, auf dem Stapel von Schülerheften liegen, die seit zwei Wochen darauf warten, von mir korrigiert zu werden.
Ermittle den Umfang des Kreises.
Berechne den Durchmesser.
Bestimme den Flächeninhalt.
Ich spüre Martins Atem im Nacken und zwei Arme, die mich umfangen. Ich schüttle sie ab, mache mich frei von der Wärme meines Mannes.
„Ich muss arbeiten“, sage ich, drehe mich von ihm weg. „Siehst du nicht, was hier alles liegengeblieben ist?“
Hinter meinem Rücken höre ich, wie er in seine Hosentasche greift. Kurze Zeit später ertönt bereits sein Schnäuzen.
Ich balle die Fäuste und lege sie auf der Tischplatte ab. Mein Blick wandert zur Uhr.
„Du musst los“, sage ich, obwohl er noch Zeit hat und vor der verschlossenen Kindergartentür wird warten müssen, wenn er jetzt schon aufbricht.
Ich klappe ein Heft zu, nachdem ich einen Fehler mit rotem Stift angestrichen und die entsprechende Stelle in der Rechnung markiert habe.
Martin geht in den Flur, zieht Jacke und Schuhe an und greift zum Schlüssel.
Als die Tür ins Schloss fällt, lege ich den Stift zur Seite und atme aus. Mein Körper sackt zusammen, meine Gesichtsmuskeln erschlaffen.
Ich habe zwanzig Minuten, bis Florian hereingerauscht kommt, mir vom Buddeln in der Sandkiste erzählt, von Playmobil-Welten und vom Streit mit Benni, eigentlich sein Freund, aber hin und wieder eben doch gemein und doof.
Ich schaue an mir hinunter. Mit der Hand befühle ich die leere Rundung meines Bauches. Eine Gewohnheit, die schwer abzulegen ist. Auch nach zwei Wochen kommt es noch zu Übersprunghandlungen. Unangemessen und wenig hilfreich. Und trotzdem hoffe ich auf eine Reaktion.
Mir wird übel und wie in den letzten Tagen auch beginnt mein Kopf zu schmerzen. Es sticht und hämmert hinter meiner Stirn. Ich verstehe nicht. Eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten.
Wir waren allein, sie und ich. Alles war in Ordnung. Gut. Vital. Bis die Ordnung mir von einem Moment zum anderen zwischen den Beinen hinaustropfte.
Ich merke, wie mein Unterleib bei der Erinnerung krampft, als wolle er halten, was nicht zu halten gewesen war.
Der Kopf, der Bauch, die Muskeln.
Ich greife nach dem nächsten Heft, schlage es auf.
Das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser beträgt gerundet Drei, lese ich in krakeliger Schrift und spüre die Wut wie feuriges Sodbrennen im Hals.
„Pi“, sage ich laut und schlage mit der flachen Hand auf den Tisch. „Pi“, zische ich und sehe, wie meine Spucke die Seite trifft und die blaue Tinte des Schülers zu verwässern beginnt.
Mit Schwung gebe ich dem Stapel neben mir einen Stoß. Er kommt ins Wanken und Heft um Heft rutscht über die Tischkante zu Boden.
Ich schließe die Augen, zittere.
„Wir sind drei“, hat Martin Florian versichert, als ich im Krankenhaus lag, „auch wenn Mama für ein paar Tage nicht bei uns ist.“
Eine Lüge, die beruhigen sollte. Auf ihre Kosten.
Ich lege meinen Kopf ab und merke, dass ich weine. Träne um Träne entweicht meinem Körper, wie eine Nachkommastelle nach der anderen. Der Schmerz in meinem Kopf schwindet und blockiert stattdessen meine Brust. Das Atmen fällt mir schwer und doch habe ich Gewissheit.
Auch wenn sie es nicht über das Komma hinaus geschafft hat, wird sie da sein. Tag für Tag, bis tief in die Unendlichkeit hinein.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Georg Großmann
9. November 2025freiVERS,Georg GroßmannLiteratur,Lyrik
wenn man nachts das wasser einfangen geht
das lehmhaus birgt beinahe jedes
grundelement
feuer in seinem gussofenherz
luft, die durch fenster und türen ...
erde, aus der es gebaut
nur wasser fließt keines
in seinen adern
läuft aus keinen trauten hähnen
läuft vielmehr draußen herum wie
ein wildes tier -
man muss es einfangen
gehen, mit klirrendem
kübel, hangabwärts
wie über eine kellertreppe
in einen keller unter sternen
und wolken
wo das finstere teichfass lagert
wo die quelle im ökoton
verwahrt
zwei steinerne stufen
der schein der laterne
muss es auffangen gehen
mit klirrendem kübel
muss geduldig sein
muss dem plätschern lauschen
das zuerst tief, dann immer
höher, bis es zu zwitschern
beginnt
muss es zum richtigen zeitpunkt ...
—
zu mitternacht
wenn die mondhostie auf den
gewässern schwimmt
erwacht der hastrman
am lehmigen teichgrund
rührt im wasserdunkel um
schwer wie ein welsleib
er sieht mich verschwommen
auf den steinernen stufen
sitzend das wasser
auffangen
ich sehe ihn nicht
neben mir
leuchtet das schnitzkürbishaus
augen und mund durch
die baumschwarze luft
im hintergrund bellen die
dörfer
eulen, geschnäbelte
geister
chiffrieren die stille der nacht
ich sitze und lausche
—
ich zähme das wasser
im kübel ist ein teich
gewachsen
ein kegelstumpfförmiges zwergengewässer
das ich am henkel
den hügel hinauf
durch den zirpenden garten
ins hexenhaus schleppe
die schöpfkelle gräbt
eine lache heraus
ich trinke
ein bach füllt das bett
meines körpers
der kübelteich spiegelt
den raum
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tom Scheinpflug
7. November 2025freiTEXT,Prosa,Tom ScheinpflugUncategorized,Literatur
Ram on
Es wird ein Samstag gewesen sein, denn jeden Samstag saßen Al und ich im Keller vom Ship&Mitre, um uns unter anderen Gescheiterten zu betrinken, bis das Zittern der zum Schaffen geschafften Hände endlich nachließ. Nicht dass Al und ich uns dafür verabredet hätten. Wir kannten uns vor jenem Abend nicht und für mich war er bisher eher Teil des schnapsfleckigen, nach vergälltem Leben stinkenden Interieurs der Kellerkneipe als deren Kundschaft. Zu jener Zeit verbrachte ich meine nüchternen Stunden damit, tagsüber in einem Lebensmittelgeschäft in der Warwick Street auszuhelfen, um abends das verdiente Geld an abgewetzten Roulettetischen mit bösartiger Gleichgültigkeit an die Bank zu verschenken. Diese Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber war mir seit jeher ein treuer Begleiter, ein Schatten neben mir. Ich ließ mich lieber treiben und nahm hin, was kam. Wahrscheinlich fiel es mir deshalb so leicht, mich seit ungezählten Jahren in einem anhaltenden Rauschzustand zu ertränken, ohne je Schuld darüber zu empfinden. Diese Abende waren nun mal alles, was blieb.
An einem dieser Abende trieb es mich zu Al, hier scherzhaft als „Uncle Albert“ bekannt, dessen zweifelhafter und doch liebevoll-nachsichtiger Ruf in jener Kneipe mir bereits vor unserem ersten und einzigen Wortwechsel sein tägliches Kommen und Bleiben versicherte. Er war ein wirrer und unsteter Mensch, der früher als Mittelklasseboxer seine Alkoholexzesse in Löchern wie diesem finanzierte, den die erfolglosen Jahre aber zahm und stumpf haben werden lassen, sodass ihm von seinem ohnehin schon bescheidenen Lokalruhm nur eine mickrige monatliche Versehrten-Abfindung des Kensington Boxing Clubs und eine scharf nach rechts zerschlagene, weinrote Rosazea geblieben waren.
Ich erinnere mich noch an das staubige Licht im Keller, das seine grobschlächtige Rechte matt schimmern ließ, während sich die massige Faust um ein schäumendes Pint schloss. Ich hatte soeben eine schon nicht mehr verschmerzbare Menge Pfund verloren, war allerdings bereits zu betrunken, um mir über mein Unglück ernsthafte Sorgen zu machen. Mein selig schwimmender Blick verlor sich im goldenen Brausen eines heimischen Ozeans und ich hätte nicht sagen können, wie lange ich so dasaß: den müden, verbrauchten Körper mühsam auf einem Hocker haltend, von den weniger besorgten als sichtlich angewiderten Mienen der Mitspielenden unberührt und den eigenen Blick rettungslos ertrunken im gewürgten Bierglas von „Uncle Albert“.
An diesem Abend stürmte es heftig. Ein grausamer Windzug jagte über die kahle Rundung meines Hinterkopfes und ließ mich aus dem Bann aufschrecken, nachdem er ein Kellerfenster samt Rahmung aus der Fassung gesprengt hatte und den düsteren Raum durchflutete. Als ich meinen Blick löste und aufschaute, bemerkte ich, dass Al diesen erwiderte. Er blickte mit seinen zusammengerückten Säuferaugen streng in mein Gesicht, als prüfe er mich. Worauf wusste ich nicht. Die geblähten, mit den rötlichen Pusteln vergangener Leben befleckten Wangen rahmten seinen Blick und gaben ihm, trotz des unübersehbaren Verfalls seiner Züge, das würdige Aussehen einer antiken Anemoi-Darstellung. Gerade als ich spürte, wie mich die Kraft verließ, seinem Richterblick standzuhalten, hob er schwerfällig seine Linke und winkte mich mit einer abfälligen Bewegung zu sich. Ohne zu wissen warum, erhob ich mich und trottete langsam, aber entschieden auf den Tisch in der dunklen Ecke des Raumes zu.
„Du bist hier öfter, als dir guttut“, sprach der alte Al, als ich stumm Platz genommen hatte. Seine Stimme hatte eine raue Klangfarbe, aber seine Worte klangen nicht wertend oder gar beschämend: es waren von zwischenmenschlichen Banden vollkommen losgelöste Worte, ohne Anklage oder Mitgefühl, gefühllose Tatsachen, steinern und unbeweglich wie prähistorische Monolithen. Ich hatte das Gefühl der Wind, dem der Kneipenbesitzer trotz wütend gebellten Befehlen nicht Herr zu werden schien, spielte nun eine fürchterliche Kantate. „Wo sollte ich sonst sein?“, gab ich mit verwaschener Stimme zurück, die Augen wagte ich nicht vom vernarbten Tisch zu heben. „Da draußen natürlich“, sprachs aus der Ecke und ich hatte das Gefühl die denkbar schlechteste Antwort gegeben zu haben. Die schlichte Bestimmtheit seiner Rede irritierte und erregte mich. „Heutzutage weht ein anderer Wind. Nie zuvor war es so leicht abzusaufen“, setzte er nach. Ich nickte stumm, doch verstand nicht, was er meinte. Mir fiel auf, dass er mich beim Sprechen nicht anschaute. Auch sein Blick kämpfte nun einen hoffnungslosen Kampf am Grund seines Glases. Eine Weile verharrte er in dieser Stellung, ohne meine Verwirrung zu lösen. Dann hob er erneut an:
„Dort draußen gibt es stählerne Inseln, in denen Männer wie du und ich noch einen Wert haben. Den Wert eines Zahnrädchens in einem Getriebe, zugegeben, aber ein Wert doch!“ beschwor er, plötzlich stürmisch aufbrausend, wobei er mir feine Tropfen wie Nieselregen entgegenspuckte. „Familienbande eingeschworener Schatzjäger im Kampf gegen die Gezeiten und auf der Suche nach dem schwarzen Gold. Ein lohnendes Geschäft für manche Tagelöhner. Aber für Männer wie uns …“, er pausierte, versuchte den versprengten Atem in tiefen Zügen wieder einzusaugen, „für Männer wie uns, können diese Inseln weitaus mehr sein.“ In atemloser Spannung wartete ich. Worauf, wusste ich nicht. „Hände über dem Wasser, Köpfe über dem Horizont.“, hauchte er endlich und mir war, als hätte er uns beide damit erlöst. Ich erhob mich und wankte schwerfällig, aber bestimmt zur Kellertreppe.
Sturzbetrunken stolperte ich aus der schweren Vordertüre hinaus auf die menschenleere Gasse. Noch bevor sie wieder zufiel, hatte der Wind, der außerhalb des Kellers kreischend durch die schiefen Häuserschluchten fegte, bereits alle Geräusche aus dem Innern verschluckt. In meinen Ohren pfiff es unangenehm und ich spürte den Drang, wieder hineingehen zu wollen – nur raus aus diesem Wind. Nur wusste ich, dass das nun nicht mehr möglich war. Nie wieder würde ich das Ship&Mitre betreten. Ich zog den Kragen meines zerschlissenen Regenmantels bis an die Schläfen hoch und ließ mich einem unbestimmten Ziel entgegentreiben.
Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wie lange ich durch die winddurchflutete Nacht irrte. Es müssen wohl mehrere Stunden gewesen sein, denn als ich, noch taumelnd und von schieferschwarzen Möwen mit geteertem Gefieder träumend, zu mir kam, stand ich an den Docks, auf dem St. Nicholas Place. Schwer atmend starrte ich in das graue Treiben des Hafenbeckens hinein und dachte an „Uncle Albert“. Seine letzten Worte waren unauslöschlich in meine trunkene Seele eingebrannt.
Da spürte ich es: Der Wind, der, seit ich mich meines Bewusstseins wieder ermächtigt hatte, unbarmherzig vom Nordatlantik her blies, musste sich gedreht haben, denn ich spürte, wie er sich nun an meinem gekrümmten Rücken brach und über meine durchnässten und heftig zitternden Schultern hinweg aufs offene Meer flüchtete. Unwillkürlich hob ich den Blick und erkannte weit über mir auf dem Dach des Royal Liver Buildings, dem stürmischen Tosen in heroischer Haltung trotzend, die bronzenen Schwingen von sich streckend den Stadtpatron, dessen gebieterischer Blick dem Wind aufs Meer hinaus folgte. „Hände über dem Wasser, Köpfe über dem Horizont“, hörte ich es aus einer dunklen Ecke meines Bewusstseins sprechen und wusste doch – diese Stimme gehörte mir.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Jan-Eike Hornauer
19. Oktober 2025freiVERS,Jan-Eike HornauerLiteratur,Lyrik
Glaubensbekenntnis
Teutonischer Locus amoenus,
Naturkirche, heiliger Wald:
Nur Du stehst für alles, was schön is’,
Du Eden in Irdengestalt.
In Dir bloß zu wandeln heißt: leben.
Dich spüren und riechen befreit!
Dich sehen meint: himmlisch vergehen …
und in Dir: nur Zauber, kein Leid.
Das ist, was wir sagen, im Grunde.
Doch achten wir faktisch Dich nicht.
Wir schlagen Dir Wunde um Wunde,
auf Geld statt Erlösung erpicht.
Wir nutzen und schaffen Dich ab,
wir dulden Dich – wenn! – als Plantage.
Naturwald? Ach, papperlapapp:
Den wollen nur Loser in Rage.
Gewinner, die sehen Gewinn.
Die Losung heißt immer: Verwerte!
Es steckt in Dir zählbar was drin,
Du treuer, Du teurer Gefährte.
Kultürlich Dich loben, oh Wald,
dies werden wir gründlich für immer.
Natürlich wird unsre Gewalt
an Dir dieweil schlimmer und schlimmer.
Als Großkathedrale im Geist
bist Du für uns nicht zu ersetzen.
Doch irrst Du Dich sehr, wenn Du meinst,
dies hieße, Dich anders zu schätzen.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Miriam Bußkamp
17. Oktober 2025Prosa,Miriam BußkampLiteratur,freiTEXT
Filterzelle
Mittwoch
Ich fahre auf das vielleicht schönste Licht zu, das der Himmel hervorbringen kann. Alles ist wie durch einen Pastellfilter getaucht, nichts Grelles liegt mehr in der Luft. Stattdessen ist der Horizont in der Entfernung schüchtern gerötet, streicht auf eine makabere Weise zärtlich über die Wipfel der riesigen Nadelbäume, die die Interstate zu beiden Seiten säumen. Es ist ein tückischer Nebeneffekt von Luftverschmutzung, dass die erhöhte Partikeldichte uns nicht abschreckt, sondern das Licht in so schönen Tönen streut, dass wir uns daran nicht satt sehen können. Nur ein paar Meilen östlich von hier machen sich ganze Vororte darauf gefasst, jederzeit eine Evakuierungsmeldung zu erhalten. Es ist seltsam, in diese Richtung zu fahren, in die Richtung der Waldbrände. Ich habe jedoch keine Wahl. Hier im Süden der Stadt liegt der einzige Baumarkt, bei dem ich noch eine Filterzelle zur Abholung vorbestellen konnte. Eine Filterzelle, wie sie in Klimaanlagen verbaut werden: ein Viereck aus grauer Pappe mit weißen Paneelen aus Vlies. Schöner wäre einer der kleinen, dekorativen oder unscheinbaren Luftfilter gewesen, wie man sie sich normalerweise in die Wohnung stellen würde. Die sind aber nirgends mehr zu bekommen. Die hässlichen Filterzellen sind ebenfalls knapp geworden, seit die Lokalzeitung gestern eine Bastelanleitung veröffentlicht hat, wie man aus ihnen einen provisorischen Luftfilter bauen kann. Aber ich hatte Glück. Eine der letzten vorrätigen Filterzellen hat es online in meinen Warenkorb geschafft. Ich hole die Filterzelle ab, weil der Versand zu lange dauern würde.
Wieder zuhause lässt sich die Filterzelle mit Gaffer-Tape problemlos an unseren eckigen Ventilator anbringen. Wir klemmen den Ventilator sonst morgens und abends in unsere Schiebefenster, um kühle Luft in unsere Wohnung zu leiten. Jetzt bekommt er die Aufgabe, die Luft im Raum durch die Filterzelle zu ziehen und gereinigt wieder in Umlauf zu bringen. Wir beobachten die Nachrichten zu den Bränden und der Rauchentwicklung und schalten unseren selbstgebauten Luftfilter ein, als die Werte der Luftqualität am Abend im violetten Bereich gemeldet werden, very unhealthy.
Dann schauen wir uns an, wie am Morgen Caleb Ewan die elfte Etappe der Tour de France gewonnen hat. Neun Stunden Zeitverschiebung, der Atlantik und die gesamte Breite des nordamerikanischen Kontinents trennen uns von Châtelaillon-Plage. Wir bekommen den malerischen Küstenort erstmal aus der Vogelperspektive zu sehen und ich frage mich, ob die Strecken von einer französischen Tourismusbehörde ausgewählt werden. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, dort ein paar Tage meine Zehen in den Sand zu graben, ganz ohne das Bedürfnis, hundertsiebzig Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Ganz ohne die Anstrengung, die den Fahrern schon bald im Gesicht steht und sie durch die Etappe begleitet.
Es ist heute keine kleine Ausreißer-Gruppe, die ins Ziel einfährt. Es ist ein Pulk von gut dreißig, der sich geschlossen der Zielgerade von Poitiers nähert und in dem jeder Fahrer auf den perfekten Moment für einen Vorstoß wartet. Ich habe mich noch immer nicht an den Anblick der Menschenmenge gewöhnt, von der sie am Etappenende angefeuert werden. Dicht an dicht stehen die Zuschauer entlang der Banden. Es ist lange her, dass ich zuletzt eng bei anderen Menschen gestanden bin.
Donnerstag
Es wird nicht richtig hell heute. Wo sonst blauer Himmel zu sehen ist, erstreckt sich ein orange getöntes Grau. Die Sonne schafft es nicht, die Rauchdecke zu durchdringen, während der Rauch selbst keine Schwierigkeiten hat, überall hin einen Weg zu finden. Wir riechen ihn im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, überall. Es reicht nicht, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir leben in einem alten Haus und wenn wir die Fenster schließen, trifft verzogenes Holz auf verzogenes Holz. Wir tragen zusammen, was wir an Tüchern und Lappen haben und dichten die Rahmen ab so gut wir können. Dann lassen wir den Luftfilter eine Weile in allen Räumen laufen.
Der Tag zieht sich. Nach einem halben Jahr im Lockdown bin ich übersättigt an Geschichten. Ich kann keine Romane mehr lesen, keine Serien mehr schauen, keine Podcasts mehr hören. Sie machen mir keinen Spaß mehr, weil sich mein Leben nicht mehr an ihnen reiben kann. Mein Leben steht auf Pause.
Stattdessen verfolge ich die Nachrichten rund um die Ausbreitung der Brände, die Prognosen und die Evakuierungen. In den letzten Monaten ist es zur Routine geworden, täglich die R-Werte für Oregon, die USA und Deutschland zu beobachten. Jetzt ist es der LQI, der Luftqualitätsindex, den ich zuerst checke und der heute noch schlechter ist als gestern.
Die Brände fressen sich immer weiter in die Wälder.
Der Rauch wird bleiben, bis der Wind sich dreht.
Nach mehr als 100 Tagen durchgehender Proteste für Black Lives Matter, geht heute niemand in Portland auf die Straßen.
Präsident Trump verkündet, dass die Waldbrände nicht im Klimawandel, sondern allein in schlechtem Forstmanagement begründet sind. Dieser bullshit hat die gleiche Farbe wie unser neuer LQI: braun, hazardous.
In Etappe zwölf fährt Marc Hirschi dem Peloton schon früh davon. Nach dem letzten Aufstieg der Etappe lässt er alle hinter sich und fährt die letzten dreißig Kilometer im Alleingang. Mir fällt vor allem der Kontrast zwischen den trockenen, abgeernteten Feldern in der Ebene und den üppigen Wäldern in der Höhe auf. Ich frage mich, wie schnell sich dort ein Feuer ausbreiten würde. Die Bäume auf dem Bildschirm sehen saftig aus, aber ich weiß, dass der Schein trügen kann. Schließlich kommen mir auch beim Wandern hier in Oregon die immergrünen Wälder vor wie ein ewiges Paradies. Die Nadeln reihen sich dicht an dicht um die feinen Zweige, die wiederum von starken Ästen gehalten werden. Moose schlängeln sich auf der Schattenseite die Rinde entlang. Hohe Farne aus sattem Grün bedecken den Boden. Ich liebe es, dass die Sommer hier heiß und trocken sind. Ich habe mich daran schneller gewöhnt als die Bäume, denen ich den Wassermangel nicht ansehen kann und die den Bränden trotzdem nichts entgegenzusetzen haben. Der kleinste Funkenflug sorgt für neue Brandherde.
Freitag
Portland ist heute offiziell die Stadt mit der schlechtesten jemals gemessenen Luftqualität. Weltweit. Die bisher verwendete LQI-Skala kann den aktuellen Wert nicht abbilden. Sie endet bei 500, aber wir liegen heute bei 504.
Ich fühle mich eingesperrt. Spaziergänge waren in den letzten Monaten fast der einzige Anlass, das Haus zu verlassen. Nun sitzen wir im Wohnzimmer wie zwei Heuschrecken unter einem umgestülpten Marmeladenglas. Wie lange dauert es eigentlich, bis die Luft in einer Wohnung so verbraucht ist, dass sie zu wenig Sauerstoff enthält? Ich widerstehe dem Drang, Google zu fragen. Stattdessen checke ich das Wetter, schaue, ob die Meteorologen zuversichtlich sind, dass wir bald wieder auflandigen Wind bekommen. Fehlanzeige. Enttäuscht lege ich das Handy zur Seite. Ich muss raus. Wenn Spaziergänge draußen nicht möglich sind, dann muss ich eben in einem Gebäude spazieren gehen.
In der Mall ist nicht viel los. Warum sollte es auch? Ich habe gehofft, dass sie mir Schutz vor dem Rauch bieten würde, aber durch meine Stoffmaske schmecke ich noch immer eine Note in der Luft. Lange sollte ich nicht bleiben.
Ich komme mir komisch vor, an den schlecht besuchten Geschäften vorbei zu schlendern, mir Dinge anzusehen, für die ich selbst dann keine Verwendung hätte, wenn keine Pandemie und keine Waldbrandkrise wäre. Trotzdem spüre ich die Verheißung, dass ich mit neuen Dingen auch neue, gute Gefühle nach Hause nehmen könnte. Ich gehe in ein Kosmetikgeschäft und schaue mir Lippenstifte an, wie ich sie gerne trage, aber es nur noch selten tue. Am Ende verschmiert die Farbe doch nur in der Maske.
Der Smalltalk mit der Verkäuferin wird schnell persönlich. Ihr Onkel lebe unweit von hier in der Kleinstadt Molalla und ignoriere die Aufforderung zur Evakuierung seitens der Sicherheitsbehörden, erzählt sie. „Er bleibt, weil auf Facebook geteilt wurde, dass die Antifa die Feuer gelegt hat, um danach die evakuierten Häuser zu plündern. Ich weiß nicht, wie ich ihn davon überzeugen kann, dass das eine Lüge ist.“
Ich stelle mir vor, wie es wäre, den ganzen Tag in diesem fensterlosen, verrauchten Laden zu stehen und mir Sorgen zu machen, weil sich jemand in meiner Familie bei einer akuten Gefahrenlage lieber an Verschwörungstheorien hält als an die Warnungen der Behörden.
Die Verkäuferin hält meinen Blick, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. „That‘s so fucked up“, ringe ich mir schließlich ab, „ich hoffe, dein Onkel bringt sich bald in Sicherheit.“
Sie seufzt mit hängenden Schultern, die mir die gesamte Rückfahrt vor Augen bleiben.
Bei der Tour de France trennen heute sieben Bergabschnitte die Fahrer von Puy Mary und deshalb zeigt die Zusammenfassung vor allem Bilder, in denen die definierten Wadenmuskeln der Fahrer langsam, aber kraftvoll gegen die Steigung um die Pedalachse kreisen. Zum Angriff erheben die Fahrer sich dann aus dem Sattel und die Fahrräder unter ihnen schwanken. Unser Luftfilter surrt im Takt dazu. Die körperliche Verausgabung hat ihren Reiz. Das Gefühl der Erschöpfung und Zufriedenheit, nachdem man alles gegeben hat, die Ruhe, wenn Atem und Puls sich verlangsamen. Der Stolz, eine Herausforderung gemeistert zu haben. Ich beneide sie. Unsere Herausforderung ist passiv, ein Aussitzen. Wir können unsere Kräfte nicht einteilen, weil wir nicht wissen, wie lange wir sie brauchen werden. Dreißig Kilometer und fünfzehn Prozent Steigung klingen leichter zu bewältigen als bis ein Impfstoff da ist oder bis sich das Wetter ändert.
Samstag
Die Nachrichten in Deutschland berichten abermals über die schlechten Luftqualitätswerte. Wir wachen auf zu verschiedenen Textnachrichten von Freunden und Familie. Wir telefonieren viel und erzählen das Wenige, das es aus dem Marmeladenglas zu berichten gibt.
Als ich den Müll rausbringe, friere ich. In der Rauchdecke ist es nicht nur dunkler, sondern auch kälter. Ohne sie würde die Sonne uns noch immer sommerliche Temperaturen bescheren. Der Geruch von Lagerfeuer dringt mir in die Nase, stärker als zuvor. Ich denke an die zerstörten Wandergebiete, die dieser Rauch bedeutet; Häuser, die bis auf den Grund herunterbrennen, ausgelöschte Leben. Acht Menschen sind den Bränden in Oregon schon zum Opfer gefallen und wer weiß, wieviele Tiere ihnen in der Wildnis und auf den Farmen nicht entkommen konnten. Dieser Geruch ist nicht nur Douglasfichten und Farne, er ist auch Fotoalben, Fernseher, Plastikstühle. Haut, Fell und Knochen. Und er überlagert alles. Den faulenden Müll rieche ich nicht, als ich den Deckel der Bio-Tonne hebe.
Zurück im Wohnzimmer kommt mir die gefilterte Luft dagegen frisch vor, obwohl es dieselbe ist, die schon seit über drei Tagen in diesem Raum zirkuliert. Die Zeltburgen der Obdachlosen, deren Kuppeln seit Beginn der Pandemie zahlreicher geworden sind, kommen mir in den Sinn. Die hastig eingerichtete Notunterkunft auf dem Messegelände wird vor allem von Menschen aus dem südlichen Oregon genutzt, die vor den Feuern hierher geflüchtet sind.
Fast stündlich suchen wir nach Updates, wie schnell sich die Feuer ausweiten und wie sich die höchste Evakuierungsstufe an diesen immer neuen Grenzen des Gefahrenraums entlang hangelt. Satellitenbilder zeigen im Zeitraffer, wie Glutfelder, größer als Ortschaften, mit dem Wind größer werden; wie sie erst kleine Rauchwirbel über die angrenzenden Gebiete schicken, bis diese immer weiter werden und schließlich zu einer Decke. Einer Decke aus Rauch, die sich über die gesamte Westküste legt, bis man gar nicht mehr weiß, wo der Rauch des einen Feuers aufhört und der eines anderen anfängt.
Drei Kilometer vor dem Etappenziel in Lyon startet Søren Kragh Andersen den Angriff, der den Sieg entscheiden wird. Er fährt, fährt sich frei und hat genug Kraftreserven, um das Tempo bis zum Schluß alleine durchzuhalten; hat sogar noch genug Kraft, hinter der Ziellinie die Arme in die Luft zu strecken und seine Leistung zu feiern. Meine Beine kribbeln, wollen rennen, schnell, bis sie nicht mehr können. Ich kann nicht mehr sitzen und gehe stattdessen im Raum auf und ab. Der Jubel. Selbst von der reduzierten Zahl des Pandemiepublikums klingt er enorm. Mein Blick fällt aus dem Fenster, hinter dem der Rauch die Aussicht auf die leere Straße trübt.
Sonntag
Wir sind früh wach. Wir tragen den Luftfilter ins Wohnzimmer und schalten ihn ein, dann starten wir den Live-Stream für die fünfzehnte Etappe der Tour de France. Während wir frühstücken, bestreiten die Fahrer die zweite Bergwertung, eine schattige Strecke. Fokussiert rasen sie danach waghalsig die Landstraße herunter. Fast spüre ich den Wind im schweißnassen Nacken, wie die müden Beine sich erholen, während am Rand Zuschauer, Bäume, Höfe vorbeiziehen. Die Abfahrt ist schneller vorbei, als den Fahrern vermutlich lieb ist, denn ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Am Bildschirmrand wird eine Grafik mit dem Anstieg zum Grand Colombier angezeigt. 17,4 Kilometer, mit Steigungen von bis zu zwölf Prozent. Es gibt keinen Schatten mehr, die Serpentinen liegen offen in der erbarmungslosen Sonne. Am Ende kämpft sich Tadej Pogačar knapp vor Primož Roglič ins Ziel.
Wieder prüfen wir, wie sich die Brände entwickelt haben. Sie sind ein kleines Stückchen weiter in Richtung der Vororte Portlands gewandert. Ich stelle mir die Einsatzkräfte vor, die der Hitze und dem Rauch in schwerer Schutzkleidung und mit wenig Pausen ausgesetzt sind, die an ihre Grenzen gehen, um diese Übermacht in allerkleinsten Schritten einzudämmen. Das Feuer müsste die halbe Stadt verschlingen, um uns zu erreichen. Für unseren Stadtteil gibt es keine Warnungen. Ich weiß das. Trotzdem bestehe ich darauf, eine go bag zu packen. Unsere Ausweise, wichtige Dokumente, ein Handyladegerät, Taschenlampe, der Schmuck meiner Großmutter, alles wandert in einen Rucksack, der nun neben der Tür steht. Auch wenn ich weiß, dass es sinnlos ist, tut es gut, irgendwas zu machen, einem Impuls zu folgen, nicht nur zu warten. Es fühlt sich an wie ein Vorsprung vor einer Situation, die nicht wahrscheinlich ist und trotzdem bedrohlich aus den Nachrichten zu uns kommt: dass Menschen im Ernstfall zu spät losfahren, dass sie im Stau stehen und nicht vorankommen, während die Brände sie einholen.
Das Packen ist schnell erledigt. Dann liegt der Tag wieder weit vor uns, konzentriert auf den Luftfilter in unserem Wohnzimmer. Ich setze meine Kopfhörer auf, weil ich eine Pause von seinem Brummen brauche und checke wieder, ob sich der Wind bald drehen soll. Noch sehen die Meteorologen keine Anzeichen dafür. Nun befrage ich doch das Internet, wie lange es bei minimaler Zufuhr dauert, bis der Sauerstoffgehalt in einer Wohnung zu niedrig ist.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at