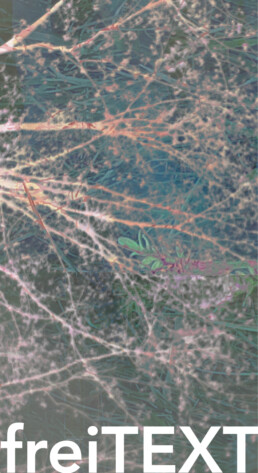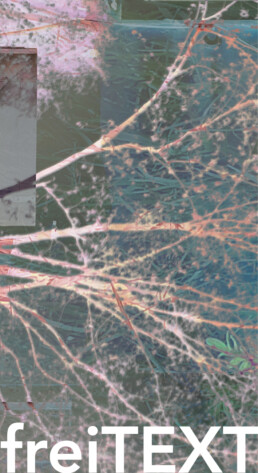freiTEXT | Kerstin Kugler
Der Schrank
Meine Freundin und ich hatten das Jahr damit vergeudet, unseren Spaß zu haben. Wir tranken und rauchten bis in die tiefe Nacht, schafften es morgens mit Mühe aus dem Bett, strichen alle Seminare, die vor elf Uhr liefen, blieben in Bars hängen, bis man uns zur Sperrstunde rausschmiss, und schlossen Wetten ab, wer mehr Erfolg bei den Männern hatte. Ich sah uns als conquistadores, Sex war unsere Waffe, keine Intimität, die den anderen näherbrachte. Wir waren beide liiert, sie ernsthafter als ich, und Anfang des Wintersemesters zog sie, für mich völlig unerwartet, zu ihrem Freund.
Unsere Wohnung lag am Matzleinsdorferplatz, einer trostlosen Gegend, die die kühle Oktobersonne nicht verschönte. Die Aussichten, jemanden für ihr Zimmer zu finden, standen mit jedem Tag, der uns dem Winter näherbrachte, schlechter. Drei Termine zur Wohnungsbesichtigung verstrichen, ohne dass sich ein Interessent finden ließ.
Am vierten Termin, meine Freundin war schon ausgezogen, trafen wir uns an der Straßenbahnhaltestelle. Ein junger Mann wartete am Bordstein sitzend unter einer hohen Plakatwand, auf der ein Paar mit glänzenden Augen die Weihnachtsangebote in einer Geschäftsstraße bewunderte. Seine einzelnen Merkmale waren in ausreichendem Maß präsentabel – ein leicht ungepflegtes Äußeres, das zu einem Studenten passte, der sich etwas gehen ließ – aber in seiner Gesamtheit sah er verkommen aus.
Als er uns näherkommen sah, richtete er sich auf, um uns zu begrüßen. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass meine Freundin ebenso vor einer Berührung zurückschreckte wie ich. Wie drei Touristen in einer Führung hielten wir Abstand, als wir zur Straßenecke gingen, wo das Wohnhaus stand.
„Dein Zimmer geht auf die Straße“, sagte ich und zeigte auf ein geschlossenes Fenster im ersten Stock.
Meine Freundin sah mich schief an. Sie nannte den Preis, ihre Stimme klang verächtlich. Sie schien sicher, dass er sich die Miete nicht leisten konnte, doch er nickte, alle Kosten waren im Inserat aufgelistet gewesen.
Das Haus sah stillos, aber anständig aus. Viele der Menschen, die hier lebten, würden nie ausziehen und waren auf ganz fundamentale Weise auf ihre Wohngegend, die so häufig Missfallen fand, stolz.
„Möchtest du es besichtigen?“
Er nickte und meine Freundin ging voran. Sie besaß noch ihren Schlüssel und in gewisser Weise war sie es, um die sich das Geschäft drehte, also übernahm sie die Führung. Er hielt sich zwischen meiner Freundin und mir. Als sich im Mezzanin unsere Blicke kreuzten, überkam mich eine solche Abscheu, dass ich sofort wegsah. Ich achtete darauf, an seiner Seite zu gehen, sodass weiterer Blickkontakt unwahrscheinlich war, und redete fast ununterbrochen. Ich zählte die Vorzüge der Wohnung auf, pries die Zug- und Straßenbahnverbindungen, die Nähe zum Zentrum und den verschiedenen Universitäten. Er nahm meinen Wortschwall schweigend zur Kenntnis. Im zu hellen Stiegenhaus klackten die Absätze seiner ungeputzten Stiefel wie zur Untermalung meiner nervösen Schwärmerei.
Meine Freundin sperrte die Tür auf. Wir traten hinter ihr in den Vorraum und die plötzliche Enge erzeugte in mir ein schweißtreibendes Unbehagen.
„Wie im Inserat beschrieben“, sagte meine Freundin und deutete nach rechts auf eine weiß angestrichene Tür. Er betrat das Zimmer, während wir uns höflich zurückhielten. Wieder fing ich den Blick meiner Freundin auf, sah die Andeutung eines Kopfschüttelns. Doch ihr Auszug hatte einen Keil in unsere Freundschaft getrieben. Sie befand sich auf dem Weg in die Häuslichkeit, ich blieb als einsame conquistadora zurück, die Wohnung mein Schiff, das mich über die Weltmeere trieb. Ich brach unseren Blickkontakt ab und betrat hinter ihm sein zukünftiges Zimmer.
Sein Blick hing an einem Schrank, das einzige Möbelstück, das meine Freundin bei ihrem Auszug zurückgelassen hatte. Auf seine Frage antwortete sie mit kalter Großzügigkeit, dass er ihn haben konnte. Nur ich, die ich meine Freundin besser kannte, spürte ihre Erleichterung. Sie hatte für den Schrank keine Verwendung mehr und hatte gehofft, ihn dem nächsten Mieter überlassen zu können.
Es waren unmögliche Momente, zu dritt in unserer kleinen Wohnung, im verlassenen Raum stehend. Ich betrachtete meine Freundin, die mit einer gespielt einladenden Geste die Tür zur Küche öffnete, und hasste sie mit einer Klarheit, die mir Angst machte.
Die Küche, wie das Zimmer, das es zu vermieten galt, gingen auf die Straße hinaus. Badezimmer und Toilette – eng, dunkel, aufs Notwendigste beschränkt – gingen vom Vorraum ab. Nur mein Zimmer, Schwan unter Enten, hatte Blick auf den Innenhof, der wie alles hier grau, kahl und unansehnlich war, dafür aber die Stille eines Fegefeuers verströmte.
Es ließ sich nicht länger hinauszögern, brachte auch nichts. Ich schloss für einen Augenblick die Augen, während auf der Straße die üblichen Verkehrsgeräusche ertönten. Ein Auto hupte und eine Straßenbahn bimmelte. Das Schiff trieb mich vielleicht ans Ende der Welt, brachte mich möglicherweise zu einem Abgrund, von dem es kein Zurück gab, doch es galt, neue Kontinente zu erforschen, ungeahnte Reichtümer zu entdecken. Eine conquistadora brauchte vor allen Dingen Mut. Mut war das Wichtigste, das Einzige, das zählte, und es wurde mir klar, dass er meiner Freundin fehlte. Mein Hass schlug in Verachtung um, ich öffnete die Augen, ließ Küche und den Argwohn meiner Freundin hinter mir, und zwang mich, meinem neuen Zimmernachbarn voll ins Gesicht zu sehen: „Ich kann den Liftschlüssel besorgen, falls du schwere Möbel hast.“
Er ließ mich wissen, dass das nicht nötig sei. Das einzig Schwere sei der Schrank, und der stand ja schon im Zimmer. Seine Augen, von denen ich später nicht sagen konnte, welche Farbe sie waren, trafen sich mit meinen. Ich musste meinen Blick sofort abwenden. Er hatte eine auf abstoßende Art verführerische Präsenz. Ich rettete mich auf die andere Seite des Vorraums, betrachtete den umständlichen Abschied meiner Freundin, der von schlechtem Gewissen zeugte, mit der gleichen Ungeduld, mit der man in die Hölle fuhr. Mein Schicksal kam mir besiegelt vor, nun sollte es endlich beginnen.
Gleich nachdem die Tür hinter meiner Freundin ins Schloss gefallen war, überkam mich ein Schauder. Ich hatte – aus Wut, aus Hass, einem selbstzerstörerischen Trieb folgend – mein eigenes Grab geschaufelt, jetzt musste ich mich hineinlegen. Ich bereute alles und wäre am liebsten zu meiner Freundin ins Stiegenhaus geflüchtet, doch mein Stolz hielt mich zurück.
Der Typ begab sich, ohne mich eines Blickes zu würdigen, in das Zimmer, das jetzt ihm gehörte, und schloss hinter sich die Tür. Ich blieb einen Augenblick ratlos im Vorraum stehen: mein Herz raste, mein Atem ging schnell und flach, mir standen die Haare zu Berg. Die unangenehme Präsenz meines neuen Zimmernachbarn stieg wie die feuchte Novemberkälte vom grässlichen Linoleumboden auf, kroch unter dem Spalt hervor, sickerte durch das Holz der Tür. Ein absurder Drang wollte mich dazu bewegen, die Hand auf seine Zimmertür zu legen. Stattdessen rettete ich mich in mein eigenes Zimmer und schloss die Tür fest hinter mir. Nach einem Augenblick des Überlegens drehte ich den klobigen Metallschlüssel, den ich noch nie verwendet hatte, im Schloss um. Erst nachdem ich den Türgriff überprüft hatte und mit dem Ergebnis zufrieden war – eingeschlossen, abgesichert – durchquerte ich mein Zimmer und ließ mich vor dem Schreibtisch in einen Stuhl sinken. Durch die Wand, die mein Zimmer von dem meines Zimmernachbarn trennte, hörte ich das Klacken seiner Stiefel, die von Wand zu Fenster schritten, ein paar Augenblicke am Fenster verweilten, dann den Rückweg zur Wand antraten. Ich konnte das Quietschen der Schranktür hören, die Scharniere müssten geölt werden, das metallische Klappern, mit dem Kleiderbügel aneinanderstießen – meine Freundin musste sie im Schrank vergessen haben oder vielleicht wollte sie sie auch nicht mehr – dann erklang ein so heftiges Poltern aus dem Schrankboden, dass ich vor Schreck zusammenfuhr. Mit fahrigen Händen öffnete ich wahllos das erste Buch, das vor mir lag, doch meine Ohren lauschten auf weitere Geräusche von jenseits der Wand.
Doch im Zimmer meines Nachbarn war es still geworden: kein Knarzen von Holz, kein Klappern, nichts. Eine Stimme in meinem Kopf sagte: „Du hast kein zweites Quietschen der Scharniere gehört. Der Schrank muss also noch offenstehen.“ Doch was tat er im Schrank? Er hing nichts darin auf, denn die Kleiderbügel wurden nicht beiseitegeschoben oder von der Stange geholt. Es waren auch keine Stiefelschritte zu hören, kein Verharren vor dem Fenster.
Das Buch vor mir aufgeschlagen, meine Nerven völlig durcheinandergeraten, kreisten meine Gedanken nur um eine Frage: Was tat er in dem Zimmer, vor dem geöffneten Schrank?
Später, der kurze Nachmittag war von der sich ausbreitenden Dunkelheit verschluckt worden, das Buch lag noch an der gleichen Stelle aufgeschlagen und ich war in eine Art Dämmerzustand verfallen, schreckte mich das Quietschen der Scharniere und das Geräusch seiner Stiefel hoch. Er bewegte sich vom Schrank weg und auf die Tür zu. In Windeseile schnellte ich von meinem Stuhl und lief auf Zehenspitzen zu meiner Zimmertür. Das Ohr ans kalte Holz gepresst, meine Augen auf die Wand gerichtet, als wäre ich in der Lage, durch sie hindurchzusehen, verfolgte ich die Geräusche meines Zimmernachbarn: Er öffnete die Tür, betrat den engen Vorraum, verließ die Wohnung. Ich stieß den Atem, den ich angehalten hatte, aus und richtete mich vor Erleichterung zitternd auf. Doch bevor ich Gelegenheit hatte, mich für mein kindisches Benehmen zu schämen, kam mir ein neuer Gedanke: Wie sollte ich, wenn ich selbst meine Wohnung verließ, bei meiner Rückkehr wissen, ob mein Zimmernachbar zuhause war oder nicht? Eine solche mögliche Unkenntnis flößte mir neues Grauen ein. Es wurde mir klar, dass mein einziger Schutz die Gewissheit über seinen jeweiligen Standort war. Die Möglichkeit, ihm unvorbereitet im Vorraum oder in der Küche zu begegnen – der Gedanke, er könne, während ich mich auf der Toilette oder im Badezimmer befand, die Wohnung betreten – füllte mich mit übermächtigem Gräuel. Es war schlichtweg keine Möglichkeit, mit der ich leben konnte.
Ich eilte mit hastigen Schritten aus dem Zimmer, suchte unter den spärlichen Putzutensilien jenen Eimer, der mir am geeignetsten erschien, versorgte mich mit Proviant, Wasser und den notwendigsten Hygieneartikeln, und brachte meinen Vorrat in mein Zimmer zurück. Noch bevor ich alles verstaut hatte, schloss ich die Tür ab und überprüfte die Klinke. Erst dann ließ ich mich in mein Bett fallen. Erschöpft schlief ich ein.
Lautes Poltern ließ mich aufschrecken. In meinem Zimmer war es vollkommen dunkel. Desorientiert stellte ich die Uhrzeit fest: drei Uhr morgens. Das Poltern hörte nicht auf. In unregelmäßigen Abständen, einem Rhythmus folgend, den ich nicht entziffern konnte, dröhnten Geräusche aus meinem Nachbarszimmer, von genau der Stelle, an der der verlassene Schrank meiner Freundin stand.
Ich wagte es kaum zu atmen oder mich zu bewegen. Zitternd kauerte ich unter meiner Decke, meine Beine angezogen. Meine Hände umklammerten meine Knie, ich rollte mich noch stärker zusammen. Das Herz in meiner Brust drohte vor Angst zu zerspringen. Als das Klopfen und Hämmern lauter wurde, ließ ich meine Knie los, um die Hände über die Ohren zu pressen. Meine Augen huschten durch mein dunkles Zimmer, blieben an der Wand hängen. Irgendwann hörte das Poltern ebenso schlagartig auf, wie es begonnen hatte.
Vielleicht war ich wieder eingenickt, vielleicht war ich einfach in einen Dämmerzustand verfallen. Als ich wieder zu mir kam, stellte ich fest, dass graues Licht durch die Spalten meines Vorhangs strömte. Ich sammelte den kläglichen Mut, den ich noch besaß, und schob meine Beine unter der Decke hervor. Bevor ich die Vorhänge öffnete, ging ich zur Tür, um die Klinke zu überprüfen. Auf halbem Weg von Tür zu Fenster ging das Poltern von nebenan wieder los. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, ich blieb wie festgenagelt stehen. Alle meine Sinne waren auf sein Zimmer gerichtet. Was tat er? Die Geräusche kamen wie zuvor aus dem Schrank. Nahm er ihn auseinander, zerlegte er ihn in seine Einzelteile? Wie zur Antwort ertönte das Quietschen der Scharniere, als er die Schranktür schloss.
Unschlüssig blieb ich mitten im Raum stehen. Jenseits der Wand schien es mein Zimmernachbar mir gleichzutun. Es waren weder die Absätze seiner Stiefel noch das Knarzen der Bodenbretter zu hören. Wieder verging eine unbestimmte Zeit. Das nächste Geräusch, das mich aus meiner Erstarrung riss, war seine Zimmertür. Er machte sie ohne großen Lärm auf und ließ sie hinter sich ins Schloss fallen, doch für meine überempfindlichen Sinne glich es einem Kanonenschuss. Sofort riss ich die Vorhänge auf, trank gierig von dem Wasser, das ich ins Zimmer gebracht hatte, aß mit zitternden Händen einige Löffel Marmelade, und verrichtete in dem zu diesem Zweck in die Zimmerecke gestellten Eimer meine Notdurft. Mein Blick glitt über den dürftigen Proviant, den ich am Vortag aus der Küche geholt hatte: zwei halbvolle Marmeladegläser, ein paar Äpfel, ein Glas Honig. Ich aß selten zuhause, kochte fast nie – meine Vorräte würden nicht lange anhalten.
Ich beschloss, Essen aus dem Gasthaus an der Ecke zu bestellen, von dem meine Freundin und ich manchmal Bier geholt hatten, doch bevor es geliefert wurde, kehrte mein Zimmernachbar in die Wohnung zurück. Er schloss die Eingangstür mit einem Klick, der mir in den Ohren hallte, verharrte im Vorraum und betrat dann sein Zimmer. Wenig später klopfte es an die Wohnungstür: das Lieferservice des Gasthauses, das mit meiner Bestellung vor der Tür auf Bezahlung wartete. Ich hielt den Atem an. Im Zimmer nebenan verstummten alle Geräusche. Wie ich schien mein Zimmernachbar darauf zu warten, dass der Besucher wieder verschwand.
Mein Magen zog sich vor Hunger schmerzhaft zusammen, doch es erschien mir vollkommen unmöglich, das Zimmer zu verlassen und die Bestellung entgegenzunehmen. Ein nun schon vertrautes Gefühl der Lähmung überfiel mich und ich verharrte bewegungslos auf meinem Bett sitzend. Irgendwann erlosch das Klopfen, Schritte ertönten aus dem Stiegenhaus, meine Bestellung wurde ins Gasthaus zurückgebracht. Im Zimmer nebenan klackten die Stiefel meines Zimmernachbarn, er konnte mit seinem Tun fortfahren. Um das nagende Hungergefühl zu besänftigen, rollte ich mich zu einem engen Ball und zog die Bettdecke fest um meine Schultern. Ich schlief ein.
Die Tage verstrichen, mein Dämmerzustand vertiefte sich. Die Geräusche meines Zimmernachbarn bestimmten meinen Rhythmus. Sein Klopfen beherrschte mein Wachen, seine Stille begleitete meinen Schlaf. Der Schrank wurde für uns beide zur Drehscheibe unseres Daseins: Für meinen Zimmernachbarn war er das Zentrum seiner geheimnisvollen Tätigkeit, für mich Ursprung meines Gräuels.
Ich verließ mein Zimmer nur, wenn ich die Wohnungstür hinter meinem Zimmernachbarn ins Schloss fallen hörte. Dann versetzte es mich in einen fieberhaften Zustand. Ich stürzte wie ein Raubtier über das, was ich in der Küche fand: in Schrankritzen festsitzende Reiskörner, trockene Haferflocken, eine vergessene Dose Tomaten. Die Vorräte wurden geringer, dann versickerten sie ganz.
Ich begann zu zittern, obwohl die Heizung auf höchster Stufe eingestellt war. Ich verkroch mich in meinem Bett. Ich saugte an Knöpfen, die ich von Blusen riss, kaute am Leder eines Gürtels. In meinem Magen wütete ein Feuer, das sich manchmal beruhigen ließ, manchmal nicht.
Es war ein kalter Morgen Anfang Januar, als mir klar wurde, dass mein Schiff angekommen war: Von dieser Reise gab es keine Rückkehr, keine eroberten Reichtümer und Schätze. Hier sollte ich verenden. Der Gedanke kam als Erleichterung. Er ließ die ungeheure Nähe meines Zimmernachbarn fast erträglich erscheinen. Meine Augen suchten ihr Gegenüber im Spiegel, der mich an eine eitlere, fröhlichere Zeit erinnerte. Ich konnte die Gestalt nicht erkennen, die mir daraus entgegenblickte: ihr ausgezehrtes Gesicht, ihre furchtsamen Augen – ein Hase, der sich vorm Fuchs versteckte. Wo war der Mut der conquistadora, wo ihr Spaß an der Jagd, ihr Stolz?
Meine Hand drehte den Schlüssel im Schloss und drückte die Klinke hinunter. Meine Schritte waren langsam, feierlich: eine Zeremonie, die mich zu meinem Ende führte. Meine Hand auf seiner Tür glich einer Liebkosung. Meine Finger strichen übers Holz, schlossen sich um den kalten Stahl. Ich betrat sein Zimmer mit Ehrfurcht.
Wie lange war ich im Raum gestanden, bevor ich merkte, dass er verlassen war? Meine Augen huschten durchs Zimmer. Die Vorhänge waren geschlossen, es lag ein animalischer Geruch in der Luft. Hohe, klägliche Geräusche hallten von den Wänden. Erst später wurde mir bewusst, dass ich es war, die diese Töne ausstieß. Ich trat zum Schrank, öffnete die Tür. Halb erwartete ich, dass mein Zimmernachbar am Schrankboden kauerte und mich anspringen würde. Doch statt einer menschlichen Gestalt fand ich nichts anderes als einen großen, unbedeckten Metalltopf. Vor Hunger und Unbehagen beinahe ohnmächtig gewann meine Neugierde überhand. Ich beugte mich vor, lugte hinein: eine klebrige, dickflüssige, dunkle Masse, die nach nichts roch und mich auf perverse Weise anzog. Ich tunkte einen Finger in den Topf und steckte ihn in den Mund. Gierig lutschte ich daran, tippte ihn wiederholt in den Brei, bevor mich die Erkenntnis dessen, was ich machte, überrollte. Ich sprang vom Schrankboden auf, riss die Wohnungstür auf, stürmte die Treppe hinunter und stolperte in den verschneiten, frostbedeckten Innenhof. Gierig sog ich die kalte Luft in meine Lungen. Zeit verstrich, ein Bewohner aus dem Erdgeschoss fand mich und führte mich in seine warme Wohnung, gab mir zu essen. Auf seine Fragen schüttelte ich beharrlich den Kopf. Meine Wohnung gab ich noch am selben Tag auf und betrat sie nie wieder.
Was nach meiner überhasteten Flucht aus Topf oder Schrank wurde, weiß ich nicht, obwohl mich die Gedanken daran noch jahrelang aus dem Schlaf rissen. Erst später, als die Anforderungen der Gegenwart und die Pläne für die Zukunft den Schatten der Vergangenheit vertrieben, verblassten meine Erinnerungen, bis sie mir lachhaft erschienen: Nie war mir jemand so nahegekommen wie mein Zimmernachbar, und nun wusste ich nicht einmal mehr, ob es ihn jemals überhaupt gegeben hatte.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Mario Schemmerl
Sehen
Draußen herrscht bestes Spiegelwetter. Entlang des Fugengummis taut Nachtschweiß vor sich hin. Zwei Männer absolvieren die letzten Schritte ihrer morgendlichen Gartenrunde. Vor wenigen Minuten flanierten sie an jener Frau vorüber, die wie gewöhnlich auf der Ablegefläche ihres Rollators sitzend, mehr über die Seerosen sah als in das Wasser hinein. Einer der Männer ist ein Greis, der jüngere befindet sich im Enkelsalter. Wie ihnen das ungleiche Paar aus der Spiegelung der Terassentür näher kommt, blickt der alte Mann im Kreuz. Unterdessen verläuft im Hintergrund das Wetter, die Wiese und der Asphaltweg zu einem Aquarell.
Leicht nervös, aber nicht unbehaglich nervös, gesellt sich eine zweite Welt zu ihnen. Herr Adam kann sich sein Lachen nicht verkneifen, als er sagt: „Du bist alt“. Von Gesicht zu Gesicht, gleich einem Stein über Wasser, gleitet sein Blick über die Spiegelfläche. Augenblicklich fühlt Herr Adam wie es ist nach dem tauglichsten Stein zu suchen. Horcht in das Knirschen hinein, das es beim Wühlen nach einem würdigen Wurfgeschoß macht. Für einen Moment gelingt es ihm, die Knabengefühle zu halten. Der Name des Sees bleibt ein Geist, aber den schwingenden Wurf empfindet er vom Becken bis zum Zeigefinger. Ein paar beruhigende Sprünge bleibt der Stein über Wasser.
Mit der empörenden Botschaft, er, Herr Adam, sei der alte Mann, trifft ihn ein entsetzlicher Schlag. Er starrt auf die direkt vor ihm stehenden Person, die er noch nie zuvor gesehen hat. Der weißhaarige Greis ist ein Unbekannter, ein zwischen den Spiegeln Geborener. Kurz flammt eine ihm die Wangen errötende Wut auf. Doch auch sie zerbröckelt und geht im Vergessen unter. Seine Gegenwart schirmt sich in einem ihm bleibenden Kern ab und legt die Orientierung in Trümmer. Um Selbstsicherheit bemüht, hebt er sein Kinn. Instinktiv hantelt er mit der abrupten Anmeldung von Gebrechlichkeit nach Halt und findet eine junge Hand. Die Beziehung zu diesem Burschen kann er nicht zuordnen, doch die Gewissheit, die nächsten Schritte nicht alleine suchen zu müssen, erleichtert die Lage.
Die Spiegelung zeigt ein heilloses Durcheinander. Schnaufend reißt er die Augen auf. Die Erinnerung an den Spaziergang treiben wie Wellen, die ein hüpfender Stein hinterließ, auseinander. Herr Adam drückt an die Scheibe und verliert sich in der Maske des Unbekannten. Mit verblüffender Geschwindigkeit, wie die Fingertapser, die die Reinigungsdame mit Fensterputzmittel verschwinden lassen wird, verschwindet auch Herr Adam immer mehr aus dem Garten. Verlustig geworden, fährt er sich über das Gesicht bis ins schüttere Haar hinauf. Auf der anderen Seite der Tür offenbart sich ihm ein bekannt anmutender Fleck. Jemand stellt einen Saft, blasser als seine Wangen, auf den Tisch ab. Rückt einen Sessel hinaus und deutet darauf. Der junge Mann führt ihn bis zu diesem Platz. Herr Adam beginnt sich zu setzen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Olivia Mettang
Urlaub vom Alten
Er öffnet seinen Geldbeutel. So öffnet er auch seinen Gürtel, kurz bevor es bei ihm und Frauchen zur Sache geht, denkt Marie. Ganz langsam, als ob gleich was von großer Bedeutung passiert.
„Gib mir hundert, nicht fünfzig“, sagt sie.
Ihr Vater zieht zwei Scheine hervor. Marie nimmt das Geld wortlos aus seiner Hand, da ist Widerstand zwischen seinen Fingern. Nicht mal hundert Öcken kann er springen lassen, alter weißer Geizkragen. Sie verschwindet durch den Flur in ihr Zimmer am Ende des Gangs. Natürlich, am Ende des Gangs. Das einzige Zimmer mit Teppichboden, wieder hat er an ihr gespart. Sie wirft sich aufs Bett und rollt die Scheine um die Zeigefinger. Hundert Euro. Shit. Was man damit alles machen kann. Neue Sneakers kaufen. Sich zum Mond schießen. Enten füttern, kleinen Kindern Schnaps besorgen. Sie dreht den Schlüssel zu ihrem Zimmer, greift unters Bett und zieht die Schachtel Lucky Strike hervor. Auf die hat sie jetzt Lust, extra strong, damit es kratzt in der Lunge. Sie zündet sich eine an und raucht, das Fenster lässt sie zu. Wenn sie nachher von ihrem cosy Wohnzimmer zurück in den Flur kommen, wird ihnen der kalte Rauch entgegenschlagen.
Später klopft ihr Vater an die Tür. Abendessen. Frauchen hat Spaghetti Bolognese gekocht. Kohlenhydrate mit Zucker und totem Tier. Wenn Frauchen so weitermacht, wird sie bald platzen. Hätte sich dann ja richtig gelohnt mit dem Fremdgehen und der Scheidung, denkt Marie.
„Marie, komm, es wird kalt“, sagt ihr Vater ruhig durch die Tür.
Sie bleibt stumm, reinkommen kann er eh nicht. Sie weiß, dass er vor der Tür steht und wartet, und da kann er stehen bleiben bis morgen früh, wenn er will. Sie öffnet ihm nicht, sie antwortet ihm nicht, sie braucht ihn nicht. Den fürsorglichen Vater kann er dann in drei Monaten für sein neues Kind spielen. Sie rollt sich auf den Rücken, im Zimmer ist fast kein Licht mehr, dieses Scheißzimmer, in dem nur ein Bett steht, ein Schrank und ein Schreibtisch. Natürlich, ein Schreibtisch. Damit sie auch brav ihre Hausaufgaben macht. Sie raucht noch eine Kippe bis zur Hälfte und drückt sie im Teppich aus.
In der Schule schlägt sie mit zwei Packungen Kippen auf. Sie erzählt es den anderen schon nach der ersten Stunde. Im Park hinter der Schule gibt es ein Versteck, das rechts zu den Zuggleisen abfällt, links von Büschen umgeben ist. Die Oberstufenschüler pissen hier manchmal hin, wenn es ihnen zu weit ist zurück ins Schulgebäude. Sie sitzen im Kreis auf ihren Jacken. Schon verdammt kalt für Juni. Marie hält das Gesicht in die warme Luft aus den Mündern der anderen. Gustav ist der schnellste, aber die Kippen sind abgezählt, acht für jeden. Josefine ist noch bei der ersten, sie erzählt von ihrem neuen Pferd, das sie am Nachmittag „einreiten“ will. Sie zeigt ein Foto auf ihrem Smartphone, das Pferd ist grau mit weisser Mähne. Leon hat einen Arm um Josefine gelegt, aber die merkt das gar nicht und quatscht immer weiter. Das neue Pferd braucht noch einen Namen, und sie selbst neue Reitschuhe. Kleine Bonze, denkt Marie, und wundert sich darüber, weil sie Josefine eigentlich mag.
„Nenn es doch Princess, das Pferd”, schlägt sie vor. Sie hofft, dass das nicht zynisch klingt.
Als die Schulglocke läutet, sind sie immer noch bei der ersten Packung Kippen.
„Lasst lieber zurückgehen“, sagt Hannah, süße brave Hannah mit dem Pferdeschwanz. Leon und Josefine wollen auch in den Unterricht, aber Gustav sagt, dass er bleibt. Sie raucht noch drei Kippen mit Gustav, dabei sagen sie fast nichts. Das ist angenehm. Über ihnen im Baum ist ein Vogelnest, vielleicht Meisen, jedenfalls fliegen Vogelmutter und Vogelvater unermüdlich in der Gegend herum um Futter zu sammeln. Einmal kommen sie sogar bis auf Augenhöhe um zu sehen, ob nicht ein paar Chips oder Pizzakrümel für sie abfallen. Gustav nimmt Maries Hand, und sie erschrickt, weil sie denkt, dass Gustav jetzt was starten will. Sie ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie nichts mit Gustav starten will. Aber Gustav hält nur ihre Hand, mit den Fingerkuppen auf ihren Knöcheln, und drückt seinen Daumen in ihre Handinnenfläche.
Sie geht alleine zur U-Bahn, ihr ist schwindelig und ziemlich übel, aber gut übel, leicht im Kopf und in den Beinen. Sie hat noch fünfundachtzig Euro. Vielleicht wird sie zu ihrer Mutter fahren. Sie muss sich setzen, muss sich an der Haltestelle hinsetzen, neben eine Frau mit einem Baby, das vom Teufel besessen ist, zumindest sieht es so aus. Es sieht sie aus fiesen blassen Augen an und wenn es könnte, würde es sie anspucken. Marie starrt hinunter auf das Baby, du kannst mir nichts, du kleiner böser Wicht. Sie hält seinem Blick stand, bis die Bahn einfährt. Sie fährt bis ins Zentrum, das dauert fast dreißig Minuten. Es ist sicher fünf Monate her, dass sie das letzte Mal alleine hier war, damals ist sie bis zwei Uhr morgens bei irgendwelchen Pennern auf der Parkbank gehockt. Die Penner haben sie schweigend akzeptiert, keiner wollte mit ihr reden, sie wollten in Ruhe ihre Bierdosen kippen und in das Laternenlicht glotzen.
Marie rechnet damit, dass ihre Mutter nicht zu Hause ist, irgendwo unterwegs, arbeiten oder beim Psychiater, und sie die Wohnung ein, zwei Stunden für sich hat. Sie holt sich den Ersatzschlüssel, der unsichtbar an einem Haken an der Innenseite der Kellertüre hängt. Die Wohnung riecht nach Rauch und Haarschaum, der ihrer Mutter immer durch die Finger flutscht und dann auf dem Fußboden festtrocknet. Marie ruft nicht Mama oder Jemand zuhause, natürlich nicht, sie geht direkt ins Schlafzimmer und sieht nach. Wenn sie da ist, ist sie hier, um sich die Augen aus dem Kopf zu heulen, das Häufchen Elend. Sie ist nicht da. Marie geht zurück ins Wohnzimmer, das gleichzeitig die Küche ist. Sie setzt sich auf das kleine Sofa, das ihre Mutter neu gekauft haben muss. Vielleicht wurde es ihr auch geschenkt, von einer ihrer Freundinnen, die jetzt pausenlos um sie herumwuseln. Jedenfalls ist es hässlich, genau wie der Rest der Einrichtung. Marie fragt sich, wie man für ein kleines hartes braunes Sofa überhaupt Geld ausgeben kann. Sie steht auf und geht zurück ins Schlafzimmer, nicht mal drei Schritte, die Wohnung ist wirklich winzig. Im Schrank oben links hat ihre Mutter eine Box mit Kleingeld und ein paar losen Scheinen, Marie greift hinein. Ihre Mutter wird überhaupt nicht merken, dass da ein paar Handvoll Geld fehlen. Sie lässt das Geld in ihre Jackentaschen fallen, müssten so um die zwanzig Euro sein. Für zwanzig Euro bekommt man jede Menge Schminke bei dm, oder eben zwei Packungen Kippen und einen Döner. Sie hat Hunger, und da im Kühlschrank nichts steht außer einem Bier und einer Tüte Milch verlässt sie die Wohnung früher als geplant. Kurz bevor sie die Tür zuzieht geht sie nochmal hinein, um ihrer Mutter die zweite Packung Luckys dazulassen.
Der Dönertyp ist richtig nett zu ihr. Schenkt ihr einen Ayran und versucht ein bisschen zu flirten, obwohl er locker zehn Jahre älter ist als sie. Marie lächelt zurück, sie weiß, dass sie älter aussieht als sie ist. Sie würde gerne noch ein bisschen in der Dönerbude sitzen bleiben und versucht langsam zu essen. Als sie fertig ist kauft sie noch einen Börek mit Spinat. „Hunger, ha?“, sagt der Dönertyp grinsend und packt den Börek in den Ofen. „Nimm noch mal Ayran, Kleine.“ Marie nimmt sich einen Ayran aus dem Kühlschrank, der hinten völlig vereist ist. Außer ihr ist niemand in der Dönerbude, aber es hätten auch nicht viel mehr Leute Platz gehabt. Marie wischt mit dem Ellenbogen ein Stück Tomate vom Bistrotisch. Draußen leuchtet der Asphalt in der Sonne, obwohl es schon fast acht Uhr ist. Zwei Männer kommen herein, sie begrüßen den Dönertyp mit Handschlag und unterhalten sich, vermutlich auf Türkisch. Schöne Sache, so eine Dönerbude zu haben, denkt Marie. Muss Spaß machen, den ganzen Tag mit Leuten zu quatschen, Ayran zu verschenken und ab und zu den Kühlschrank abzutauen. Sie guckt zu den Typen rüber, die jetzt in der offenen Tür stehen, jeder einen Yufka in der Hand, und mit dem Dönertyp Witze reißen. Wenn er lacht, sieht er jünger aus. Er öffnet den Ofen und schiebt ihr den Börek über die Theke ohne hinzusehen.
Als die Männer gegangen sind steht Marie auf.
„Alles gut?“, fragt der Dönertyp, „hat geschmeckt?“
„Ja“, sagt Marie.
„Weil ich ess nie Döner. Hab vergessen, wie schmeckt.“
Marie findet, dass seine Wimpern ziemlich lang sind für einen Mann.
„Ich weiß“, sagt sie, „Döner ist gar kein türkisches Essen.“
„Ja, genau. Kein türkisches Essen. Aber wir essen viel Fleisch. Viel Schaf, uh“, der Dönertyp sucht das Wort mit den Fingern, „so kleine Schaf.“
Sein Deutsch hört sich extra-nett an, weil er ein kleines bisschen lispelt.
„Seit wann bist du in Deutschland?“, fragt Marie, sie will mehr wissen.
„Vielleicht zwei Jahre. Bisschen länger. Hier ist besser, weil ich kann in Dönerbude arbeiten und mit schöne Frauen reden.“
Er zwinkert ihr zu.
„In der Türkei gibt’s doch auch schöne Frauen“, sagt Marie.
„Klar, klar. Aber ich komm gar nicht aus Türkei. Ich komm aus Zypern.“
„Ist das nicht griechisch“, sagt Marie, aber der Dönertyp wedelt mit der Hand.
„Neee, ist auch türkisch. In Nordteil ist türkisch. Gibt’s nix dort, nur Armee und kaputte Häuser und paar Hotels für Touristen.“
Marie öffnet ihren Browser und googelt Zypern. Türkisenes Wasser, hellbraune Steine.
„Ich war noch nie dort“, sagt Marie und der Dönertyp sagt, das macht nichts.
Marie bleibt in der Dönerbude. Der Dönertyp heißt Ali und wohnt mit seiner ganzen Familie in Stuttgart. Seine Eltern heißen Yusuf und Elif, seine Geschwister Olcay, Ahmet und Meryem. Ali redet von ihnen, als würde Marie sie längst alle kennen. Auf Zypern war er beim Militär, das war gar nicht sein Ding, weil sie bei fünfundvierzig Grad auf den Truppenübungsplatz Kniebeugen machen mussten. Irgendein Arschloch hat ihm außerdem in der Kaserne bei einem Streit eine Rippe gebrochen, die dann nie ganz verheilt ist. Jetzt kippt er beim Gehen ein bisschen nach links, er kommt hinter dem Tresen vor um es vorzuführen. Die Dönerbude gehört seinem Onkel, und so richtig sein Ding ist das auch nicht, Döner verkaufen. Lieber würde er beim Fernsehen arbeiten. Und er hat auch schon versucht zu wechseln, hat sich für eine Ausbildung zum Kameramann beworben.
„Aber gibt keine Arbeit, weil Leute denken ich bin Türke. Aber ich hab europäische Pass. Ich kann überall arbeiten, in ganze EU!“
Ali ist ein bisschen laut geworden. Marie versteht ihn. Sie hat das Bedürfnis, Ali auch was aus ihrem Leben zu erzählen. Sie wartet, dass er nachfragt, aber er fragt nicht.
„Mein Vater hat meine Mutter geschlagen“, sagt sie, und es fühlt sich ein bisschen falsch an, das zu sagen, vor allem, weil es nicht stimmt. Tatsächlich hat sie ziemlich lange nicht gewusst, was eigentlich Sache war. Es gab es einen Streit in der Küche, und danach wurde nicht mehr gesprochen. Dann stand irgendwann ein Möbelwagen vor dem Haus, als sie von der Schule zurückkam. Als er ging hat ihr Vater die Wohnungstür ganz leise geschlossen, und ihre Mutter hat ein paar Pillen eingeworfen und sich schlafen gelegt. Sie selbst ist feiern gegangen und hatte nach sieben Berentzen-Apfel Shots eine kleine Fummelei mit Nico aus der Zehnten.
Niemand hat niemanden geschlagen, sie reden ja nicht mal miteinander. Aber sie hat Lust die Geschichte so zu erzählen, darum tut sie es.
„Er hat sie geschlagen, bis sie nur noch auf dem Bett herumlag und nicht mehr aufstehen konnte“, sagt sie.
Ali sieht sie aufmerksam an, er zwinkert nicht einmal. Also setzt Marie noch einen drauf.
„Mich hat er auch geschlagen. Ins Gesicht.“ Das ist nicht ganz gelogen, es entspricht metaphorisch gesehen der Wahrheit.
Ali will wissen, was eine Ohrfeige ist, und Marie demonstriert es an sich selbst. Ali nickt voller Mitgefühl. Er sagt, dass Eltern, die ihre Kinder schlagen, keinen Respekt vor dem Leben haben. Marie stimmt ihm zu. Sie sagt: „Manchmal würde ich gerne abhauen, in ein anders Land, weißt du, so wie du das gemacht hast.“
Ihr Vater hat ihr am Nachmittag eine SMS geschrieben. Sie hat die SMS nur überflogen, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ihr Vater ihr diesen Monat kein Taschengeld geben wird. Alter Choleriker. Die Zahnbürste von Frauchen ist ihr aus Versehen ins Klo gefallen heute Morgen, der Zahnputzbecher stand so wacklig, dass er umfallen musste. Soll sie etwa ins Klo greifen und das Ding wieder rausholen? Ist ja nicht ihre Schuld, dass Frauchen ihren bescheuerten Becher nicht richtig hinstellen kann.
„Wie lange dauert es nach Zypern?“, will Marie wissen.
„Mit Flugzeug paar Stunden“, sagt Ali. „Mit dem Schiff dauert länger.“
„Kannst du mir ein Ticket kaufen?“, fragt Marie. Ali sieht sie an, als wäre sie verrückt.
„Ich hab auch keine Geld, Kleine. Denkst du in Dönerbude man wird reich, oder was?“
Er lacht. Marie zieht die zwei Scheine aus ihrer Hosentasche und legt sie auf den Tresen. Ein fünfziger und ein zwanziger. Dann greift sie in ihre Jackentaschen und holt das Kleingeld heraus. Sie hat sie noch nicht gezählt, aber es muss ziemlich viel sein.
„Ich hab Geld“, sagt Marie, während sie zwei Euro Münzen stapelt, „ich hab nur keine Kreditkarte.“
Ali schweigt kurz. „Warum willst du nach Zypern?“, fragt er dann und widerholt: „Gibt nix dort außer Armee und kaputte Häuser.“
„Ich will mal Urlaub machen“, sagt Marie, „Urlaub von meinem Alten.“
„Okay“, sagt Ali, „aber machst du Urlaub lieber woanders, oder? Italien? Spanien?“
Marie schüttelt den Kopf.
„Nee. Zypern ist gut. Auf Zypern kommt keiner.“
Sie öffnet wieder den Browser. Die günstigste Verbindung ist nächsten Dienstag um zehn Uhr morgens, vierundachtzig Euro, sechseinhalb Stunden Reisezeit. Sie schiebt Ali ihr Handy hin und hundertzwei Euro.
„Kannst du mir den buchen“, sagt sie. „Bitte.“
Ali zieht seine Kreditkarte aus dem Geldbeutel.
„Kannst du selber buchen“, sagt er, „aber mach schnell, bevor ich anders überlege.“
Marie tippt ihre Daten ein, zuletzt die Kreditkartennummer. Sie klickt Kaufen, ihr Magen hüpft. Wenige Sekunden später blinkt die Buchungsbestätigung in ihrem Emailpostfach auf. Als sie den Kopf hebt, hat Ali das Geld schon weggeräumt. Er steckt die Kreditkarte zurück in seinen Geldbeutel, holt zwei kleine Schnapsgläser aus einer Schublade und nimmt eine Flasche mit blauem Schraubverschluss aus dem Kühlschrank.
„Raki“, sagt er, „zum Feiern. Weil du Urlaub machst von deinem Alten.“
Marie trinkt ihren Raki, wie man ihn trinken muss, schnell und ohne nachzudenken. Kann sein, dass man die meisten Dinge im Leben so angehen sollte. Draußen ist es jetzt dunkel. Sie würde gerne länger in der Dönerbude sitzen bleiben, aber Ali möchte Schluss machen. Also nimmt sie ihre Jacke vom Stuhl und verabschiedet sich von ihm. Er nickt ihr zu. Sie hätte ihn gerne umarmt. Draußen hat es höchstens fünfzehn Grad. Verdammt kalt für Juni. Sie steckt ihre Hände tief in die Jackentasche und macht sich auf den Weg nach Hause.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leonard Merkes
Alles ganz normal
Ich nehme das Buch in beide Hände, lege es auf den Teppich und beuge mich darüber. Mein Zeigefinger bewegt sich von Zeile zu Zeile, immer an den Buchstaben entlang. Meine Lehrerin sagt immer, dass ich das nicht brauche. „Nur mit den Augen“, sagt sie. Aber ich traue ihr nicht. Die Wörter, die ich noch nicht kenne, murmele ich vor mich hin, damit ich mich später besser an sie erinnern kann. Sie würde seufzen, wenn sie mich jetzt sähe. Mir ist das egal. Ich bin acht Jahre alt. Ich lese flüssig und schnell.
In dem Buch vor meinen Knien gibt es viele Bilder. Ich blättere kreuz und quer darin, lese etwas über Masern, Mumps, Röteln und die Anwendung von Wadenwickeln. Die Seiten sind aus dickem, matt glänzendem Papier. Es ist ein Ratgeber über Kinderkrankheiten, den Mama und Papa im Bücherregal im Wohnzimmer aufbewahren. Sie holen ihn hervor, wenn es mir schlecht geht, aber sie nicht richtig sagen können warum.
In einem grün umrandeten Infokästchen im Kapitel über Babys steht, dass der menschliche Körper bei der Geburt zu 95 Prozent aus Wasser besteht, dieser Anteil sich aber im Laufe des Erwachsenwerdens um 25 Prozent reduziert. Warum erfahre ich nicht.
Bekommt der Körper beim Wachsen undichte Stellen? Ich überlege, ob es bei allen möglichen Gelegenheiten aus mir heraustropft. Beim Fußball, beim Einkaufen, wenn ich wütend bin. Vielleicht habe ich ja schon 10 Prozent Wasser verloren. Ich gehe in die Küche und fülle ein großes Glas bis zum Rand. Ich trinke es in einem Zug. Nachher ist mir schlecht, aber ich bin irgendwie beruhigt. Ich fühle mich bei 80 Prozent.
Am Abend steht Papa vor mir, er beugt sich zu mir herab. Sein Gesicht ist ganz nah bei meinem. Er schreit mich an und schüttelt mich. Mama drückt sich gegen die Wand und ruft „Stopp“, aber er hört sie nicht. Etwas muss ihn verärgert haben, aber das ist in diesem Moment nicht wichtig. Ich glaube er hat es sogar vergessen. Die Spuke läuft ihm übers Kinn. Ich würde sie ihm abwischen, aber das traue ich mich nicht. Um mich herum ist so viel Lärm.
Der Blick aus dem Fenster zeigt ein Großstadtpanorama. Leuchtreklame, Bürogebäude, das Dach des Fußballstadions. In der Ferne vier, fünf Hügel. Die Sonne verschwindet hinter der Müllverbrennungsanlage. In der Dämmerung jagen zwei Spatzen einander, stürzen hinunter Richtung Straße. Auf dem Fensterbrett Erdnussschalen und in der Bierflasche ein paar Kippen. Vor dem Café auf der anderen Straßenseite stehen Teenager, trinken Glühwein und lachen. Wind aus allen Richtungen. Die Teenager rücken näher zusammen. Neben dem Café hält ein Bus, dann die Straßenbahn. Ein Streufahrzeug kriecht durch die Straßen. Sirenen, Lichter. Er öffnet die Wohnungstür, atmen.
Später ist es im Flur wie auf dem Bach hinterm Haus, der seit einigen Tagen gefroren ist, aber jetzt zu tauen anfängt. Vorsichtig drücke ich die Kufen ins Eis. Ich bewege mich lautlos. Auf dem Weg zum Badezimmer drehe ich eine Pirouette, drehe mich im Kreis, immer um die eigene Achse, immer schneller werde ich.
„Was machst du da? Komm geh ins Bett!“ Mama steht im Flur, ein paar Schritte von mir entfernt. Zwischen uns gibt es eine Stelle, da bricht schon das Eis. Deswegen gehe ich lieber nicht näher heran. Sie wünscht mir noch eine gute Nacht und geht dann ins Schlafzimmer zurück. Ich krieche mit Schlittschuhen an den Füßen ins Bett.
Bevor ich einschlafe, frage ich mich, ob der Körper noch immer Wasser verliert, auch wenn man schon erwachsen ist. Ich will nicht weniger werden, sage ich laut vor mich hin und halte die Tränen zurück.
Seine Hand greift nach dem Fahrschein, der ihm ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn zuschiebt, bevor er sich wieder dem Bildschirm zuwendet und zu tippen beginnt. Das Kuppeldach, die Fassade. Der ganze Bahnhof ist aus Glas. Er schlendert an Donut Shops vorbei, an Nagelstudios, an einem Media-Markt. Ein Mann verkauft in einem winzigen Laden Handyhüllen zum halben Preis. Sein Zug geht erst in einer halben Stunde. Er öffnet das Dosenbier, das er im Supermarkt gekauft hat. Es spritzt beim Öffnen und er hält es weit von seinem Körper entfernt. Durch das Kuppeldach kann man schon den Mond sehen. Er trinkt in kleinen Schlucken, trotzdem läuft ihm Bier übers Kinn. Er wischt es am Jackenärmel ab. Als er auf die Uhr schaut, sind es nur noch ein paar Minuten bis zur Abfahrt und er hastet über die Rolltreppen zum Gleis, das unterirdisch liegt.
Ich springe vom Fünfmeterbrett, die Arme eng an den Körper gepresst. Das letzte, was ich sehe sind meine Füße, wie ich sie zwinge einen Schritt in die Luft zu tun. Danach schließe ich die Augen und halte mir die Nase zu. Fast senkrecht tauche ich ins Wasser ein. Ich bin überrascht, dass es kaum weh tut. Ich schwimme nicht sofort zum Beckenrand, ich schaue mir die Welt von unten an, solange bis ich nicht mehr kann und Luft holen muss.
Er stolpert durch den Gang, schiebt sich am Schaffner vorbei, streift die schwammige Brust, den Bauch, der sich unter der Weste spannt. Er ist unsicher wohin, auf welchen Platz, ob im richtigen Abteil, bleibt stehen, wartet, schaut ins Gepäckfach, nach unten. Vor seinen Augen dunkelblauer Teppichboden, übersät mit schwarzen Quadraten, in unterschiedlichen Abständen, ohne Ordnung.
Ich bin allein. Durch einen Schlauch fließt glasklare Flüssigkeit in meinen rechten Arm. Ich sitze aufrecht im Krankenhausbett. Der Leopard mit dem weichen Fell muss mir beim Schlafen aus dem Bett gefallen sein, ich spüre seine Schnurrbarthaare nicht an meinen nackten Beinen. Ich drehe mich um, ich schaue unters Bett. Außer einem alten Müsliriegel ist da nichts. Mein Arm tut weh. Ich dachte es wäre angenehm, wenn sie etwas in dich hineinfließen lassen, was dich wieder gesund macht, wie der Arzt es gesagt hat. Die Krankenschwester trägt mein Frühstück herein. Ein Becher Joghurt und ein paar Cornflakes, in Plastik verpackt. „Bei wie viel Prozent bin ich jetzt“, frage ich und hebe meinen Arm, aber die Krankenschwester versteht meine Frage nicht und zupft die Vorhänge am Fenster zurecht.
Den Leoparden finden wir nicht. Keiner hat ihn gesehen. Ich sage ok, weil ich fühle, dass ich eigentlich zu groß für ein Stofftier bin. Sechs Jahre bin ich schon. Zum Geburtstag habe ich endlich ein Fahrrad bekommen. Es ist gelb, auf dem Rahmen sind schwarze Punkte drauf. Ein bisschen so, wie beim Leoparden, der einfach verschwunden ist. Nächste Woche will ich nicht mehr mit Stützrädern fahren.
Schnee, der wie Asche leere Felder überzieht, auf Hochhausbalkone und Autobahnbrücken fällt. Ein paar Kilometer weiter wieder geschmolzen ist. Nur noch ein paar Gestalten vor ihm. Versunken in ihren Sitzen, die Hälse geknickt, die Münder schlagen gegen das Glas. Ein Taubheitsgefühl in den Knochen. Seine Tasche liegt neben ihm, die Tasche mit den Sachen, den Klamotten und dem Handyladekabel. In der Zugtoilette schwappt Urin und Erbrochenes.
Papa ist auf dem Stuhl zusammengesackt. Er schluchzt. An der Wand hängt die Landkarte mit Ländern, die es so gar nicht mehr gibt. Jugoslawien Rhodesien, Deutsche Demokratische Republik. Er stammelt, dass er nicht mehr kann. Ich schlinge meine Arme um ihn und flüstere: Aber ich, ich bin noch bei mindestens 89 Prozent.
Wo bist du jetzt? Kannst du das nochmal sagen? Die Verbindung ist so schlecht. Zu beiden Seiten durchziehen Fabriktürme die Landschaft, stehen in Gruppen zu dritt oder viert. Dazwischen Silos, groß wie Einfamilienhäuser. Was? Nein, du brauchst mich nicht abzuholen. Überall Flutlichtstrahler, wie Tiefseefische im schwarzen Wasser. Seegras wiegt sich vor dem Fenster. Atmen, schon mal an die Tür treten. Noch zehn Minuten, kurz nach Mitternacht. Von hier an nur noch Vororte.
Mein nackter Körper spiegelt sich in der Milchglasscheibe des Badezimmerfensters. Ich hasse euch. Ich hasse euch sosehr. Ich gehe weg von hier, noch heute mache ich das. Ich balle meine Hände zu Fäusten, ich reiße den Heizlüfter aus der Wand. Aber die Gestalt im Milchglas bewegt sich nicht, sie verschwimmt mit der Fassade des Nachbarhauses und dem Baum, der davorsteht.
Unter ihm Zigarettenkippen und gefrorenes Laub. Fahrradständer links und rechts an der grauverschmierten Plakatwand. Zwei Fahrräder parken in einigem Abstand voneinander. Bei einem fehlt das Vorderrad. Die Sporttasche zieht an seinem Schultergelenk. Vor ihm das Haus, das Dorf. Sonst nichts. Er schlägt einen Bogen über den Platz. Nur ein Snackautomat steht im Weg.
Die Wut ist so groß. Viel größer als du und ich. Sie macht mir Angst. Ich weiß nicht wohin mit ihr, ich halte die Luft an. Mir wird schwindelig. Tage später meldet sie sich zurück, sie steckt irgendwo im hinteren Teil meines Kopfes und beschimpft mich. Ich schlage den Kopf gegen die Wand, ganz fest. Ich hoffe, dass die Wut von der Erschütterung Angst kriegt und ganz weit weggeht.
Über ihm Starkstrommasten. Er klettert durch das Gleisbett, schlägt sich durch eine Böschung, ein Brennnesselfeld, bis er zu einem Schotterweg gelangt. Schrebergärten im Mondlicht, dicht an dicht an die Gleise gedrückt. Die einzelnen Parzellen durch Maschendrahtzäune voneinander getrennt. Er legt den Kopf in den Nacken. Eine Deutschlandfahne zappelt im Wind.
Im Sommer sind wir in Südfrankreich in einem Ferienhaus, das direkt am Meer ist. Am zweiten Tag wirft Papa Mama einen Spüllappen ins Gesicht. Wasser spritzt mir auf die Zehennägel. „Du dumme Sau“, er hat Schaum vor dem Mund. Mama weicht zurück und schreit ihn an. „So lasse ich mich von dir nicht behandeln“. Ich gehe zwischen Pinien auf und ab. Das Meer ist ruhig und der Himmel ganz klar.
Streusalz unter den Sneakern, knirscht wie Sand zwischen den Zähnen. Vorbei am Wohnblock, wo man die Sozialhilfeempfänger untergebracht hat, die Obdachlosen, die Verrückten. Er zündet sich eine Zigarette an. Fernsehlicht in der oberen Etage. Flackert auf und erlischt. Im Gehen den Rauch durch die Nase blasen, durch den Mund atmen. Wie es ist, wenn die Luft an den Fingerknöcheln zieht.
„Geht niemals zu weit rein, wenn ihr im Fluss baden wollt“, sagt meine Lehrerin immer zu uns, „die Strömung reißt euch sonst mit, auch wenn ihr schon gut schwimmen könnt.
Auf dem Weg zum Bäcker bleibe ich bei einer Pfütze stehen. Mir fällt ein, dass man auch in Pfützen wie diese hier ertrinken kann, wenn man nicht aufpasst, weil man gestolpert ist und hineinfällt und mit dem Gesicht im Wasser liegen bleibt, weil man nicht mehr aufstehen kann. Auch wenn Arme und Beine gar nicht im Wasser sind. Das habe ich in einem Film gesehen.
Auf dem Rückweg fällt mir ein, dass ich Mamas Mohnbrötchen vergessen habe. Zu Hause schüttelt sie nur den Kopf. Ich habe nicht aufgepasst, es tut mir leid, dass ich dich vergessen habe, denke ich. Dass mich der Pfützentod abgelenkt hat, erzähle ich nicht. Meine Socken sind ganz nass.
Ein schmales Geländer trennt ihn vom Wasser. Er spuckt über die Metallstreben hinweg auf einen umgekippten Einkaufswagen. Ein Bach, der im Zickzack durch den Ort führt. Windet sich neben dem Vereinsheim, dem Schießstand, dem Grundschulgebäude. Nicht mal knietief ist die trübe Masse. Brodelnd und schäumend ergießt sie sich in den Fluss am Ortsrand. Im Sommer, zwischen Geröll und Plastiktüten, schwimmen winzige Fische in Schwärmen, nutzen Wasserläufer Oberflächenspannung.
Ich zertrümmere meinen Tischtennisschläger an der Kellerwand, ich ramme die Spitze des Füllers, den Papa mir gegeben hat ins Notizheft. Bis die Spitze stumpf und verbogen ist, dauert es nicht lang.
„Du bist ganz erschöpft, du gehst heute nicht zum Spielen raus“, sagt Mama später zu mir. „Komm, lege dich ein bisschen hin. Wir schauen einen Film im Bett“.
Er geht entlang der Hinterhoffassaden. Einer dieser Schleichwege, die vom Bach Richtung Hauptstraße führen. Wenn einem hier einer entgegenkommt, muss man sich zwangsläufig an die Betonwand drücken, mit den Schulterblättern am Graffiti schaben. Im Hinterhof der Metzgerei hört er einen Hund bellen. In seinem Kopf kriechen Erinnerungen Richtung Frontallappen wie durch einen Lüftungsschacht. Fast alle Fassaden sind mit Efeu bedeckt. Bloß nicht zu schnell hintereinander atmen. Er überquert die Hauptstraße bei der zweiten Ampel, die ihm entgegenkommt. Der Teer ist noch frisch. Körnig, durchlässig, er glitzert im Bogenlampenlicht. Wie wenig es jetzt zählt, was man in der Zeit gemacht hat, seitdem man von hier fort gegangen ist.
Bei den Partys von Mama und Papa tanze ich zu „Lady Marmelade“ und singe „voulez vous coucher avec moi“, auch als mir jemand erklärt, was dieser Satz bedeutet. Die Erwachsenen schauen zu mir herüber, kichern und lachen. Diese Art von Aufmerksamkeit gefällt mir. Ich tanze um die schönste Freundin meiner Mutter herum.
Einen ganzen Vormittag lang bin ich bei einer Frau, die ein Zimmer voller Spielsachen hat. Ich klettere in einer Burg herum, die eine Rutsche hat und verstecke mich hinter einem Bären, der doppelt so groß ist wie ich. Die Frau stellt mir Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten muss.
Das lenkt beim Spielen ab. Ich nehme ein Gewehr aus Holz in die Hand. Ich weiß nicht, wann welche Antwort die richtige ist. Wild schieße ich in die Luft. Der Schweiß läuft mir über die Stirn.
Ich frage, ob sie ein Glas Wasser für mich hat. Das mit den Prozenten behalte ich für mich.
Regelmäßig stelle ich mir meine eigene Beerdigung vor. Eine Menschentraube steht um das Grab herum. Mama, Papa, Menschen aus dem Dorf, die ich nur vom Sehen kenne.
Von unten beobachte ich sie, ich kann durch den Sarg hindurchsehen. Alle weinen bitterlich. Sie schluchzen „Warum?“ und fühlen sich schuldig an meinem Tod. Das sehe ich genau.
In der Mitte des Dorfes gibt es einen Platz mit Kopfsteinpflaster, einer Eisdiele, einer Kirche, einer Bank. Im Dunkeln werfen nur die Bogenlampen einen Schatten. Einmal im Jahr Schützenfest, Kirmes. Im Viervierteltakt über den Platz. Die Arme zittern, der Mund trocken. Die Tasche trommelt gegen die Kniekehlen. Er plustert sich auf. Schauen, ob man noch atmen kann in diesem Dorf.
Einmal packt mich Papa in eine Wolldecke, setzt mich in den Bollerwagen, zieht mich durch den Kies beim Parkplatz am Fußballplatz bis zu unserem Haus. Es ist windig und sehr kalt, aber trocken. Ich bin stolz, wir haben gewonnen. Später verbrenne ich mich an der Suppe, die Mama gemacht hatte. Am Abend ist die Zunge immer noch ganz rot und geschwollen, aber das ist wegen des Fiebers und der Lungenentzündung, die ich bekomme.
Sogar Papa bleibt so lange zu Hause, bis ich wieder in die Schule kann.
Hab dir Suppe warm gemacht, falls du noch Hunger hast. Er denkt: Arschloch. Schaut wieder vom Handy auf, atmet. Noch diese Straße und dann die nächste rechts und dann ist da schon das Haus. Er wirft sich die Tasche über die Schulter. Er spürt das Gewicht der Tasche. An den Sehnen und Muskeln, wie sie sich dehnen. Wie sie fast reißen. Ein Schmerz. Den wegatmen, den Schmerz. Langsam. Die Häuser sehen alle gleich aus. Noch eine Zigarette anzünden im Licht der Bogenlampe. Kein Geschmack im Mund, nur ein bisschen Rauch. Da vorne ist schon die Villa, da band sich der Arzt einen Strick um den Hals. Im Vorgarten steht das Gras jetzt bis zu den Hüften. Eine Katze schaut ihn an, gelbe Monde im Gebüsch.
Schatten erst wieder im Licht der Bogenlampen.
Mama liegt den ganzen Tag im Bett. Ich weiß nicht warum, aber ich entschuldige mich. „Sorry, tut mir leid, wirklich“. Aber sie dreht sich bloß weg. Eine Weile bleibe ich im Türrahmen stehen und starre auf das Glas neben dem Bett. Dort schwimmen Fliegen im Rotweinrest, Rücken an Rücken, alle Viere von sich gestreckt.
In wenigen Schritten am Park vorbei. Er kann die Bäume zählen. Sechs Stück. Wie eine Schlägertruppe um die Schaukel, die Wippe und die Parkbank. Er leckt sich über die aufgesprungenen Lippen, läuft ein bisschen durchs Gras, feucht. Er spuckt aus, so viel Wasser im Mund. Er tropft über den Asphalt. Wie schwer ihm das Atmen fällt. Sich Kiemen wachsen lassen.
Papa drückt mein Gesicht in die Kissen. Ich wehre mich mit Händen und Füßen. Dann nimmt er mich in den Schwitzkasten. „Noch ein, zwei Jahre und ich bin stärker als du“, ächze ich unter dem Druck und weiß noch im selben Moment, dass das nicht stimmt.
Scheinwerferlicht, ein Auto fährt an ihm vorbei. Er blinzelt, blind fühlt er sich, biegt trotzdem nach rechts. Die Straße ist schnurgerade, ein langer Korridor. Da durch gehen. Der Himmel auf die Häuser gelegt, wie eine Schieferplatte. An den Mülltonnen vorbei, die vor jedem Haus stehen. Die letzten Meter Kraul. Luft anhalten, da rein schwimmen.
Ich schließe den Koffer mit den silbern glänzenden Schnappverschlüssen und dem Bild eines Hasen mit großen Schlappohren darauf. Er ist vollgepackt mit allerhand Klamotten, Gummibären und einer großen Flasche Wasser. Ich schleppe ihn bis zum Ortsrand, bis ein Traktor neben mir hält. Ein Mann beugt sich aus dem Führerhaus und fragt mich, wohin ich denn wolle, so ganz allein. Obwohl ich es mir anders vorgenommen habe, weine ich. Mit dem Traktor werde ich bis zur Haustür gebracht. An der Türschwelle nimmt Mama mich in Empfang. Sie hält mich so fest, dass ich kaum noch atmen kann und knutscht mich ab. „Lass das“, sage ich. Ihre Küsse bedecken meinen ganzen Kopf. Dann geht sie in die Hocke und schaut mich an. Sie nimmt mein Gesicht in die Hände und wiegt es nach links und nach rechts. „Mein Kind“, sagt sie und sonst sagt sie nichts.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Malte Grotendorst
Sich selbst als Content begreifen
Eine gekürzte Version dieses Textes erschien – zusammen mit weiteren Texten zum Thema – in der mosaik37.
Manchmal schaue ich mir die Bilder auf meinem Instagram-Profil an und hoffe, dass das, was ich dort sehe, möglichst auch dem entspricht, wie Menschen mich analog wahrnehmen: Der relatable Typ im bunten Wollsweater mit der cuten Katze auf dem Arm, oder mit Seidenhemd bei 35 Grad in der U-Bahn, beim Versuch, die Kamera gleichzeitig zu ignorieren und mit ihr zu interagieren. Meine Identität kommt mir dann vor wie eine Projektion oder eigentlich sogar eine Hoffnung: Das Selbst ist nicht einfach nur irgendwie da, sondern ich will es gestalten. Die verschiedenen Bilder von mir stehen nicht nur für das, was ich sein will, sondern sie sind das, was ich bin. The filter is the face.
Im Essay “Fear of Content” schreibt Rob Horning, dass wir online ständig Gefahr laufen, uns selbst zu Content zu machen: “The self is a content farm.” Wenn ich auf Instagram poste, dann werde ich literally Content; aber ich glaube, auch analog—oder, um diese Trennung einfach mal aufzugeben: generell kann man die eigene Identität als Content betrachten, als etwas, das produziert und gestaltet wird.
Die Mechanismen, die auf Social Media so obvious sind, funktionieren auch anderswo: Mein Selbst wird produziert, von mir und von anderen; also von den Umständen, in denen ich lebe. Es entwickelt sich mit der Zeit und ändert sich je nach Kontext: Auf Instagram bin ich anders als auf Twitter; in der Schlange, um Snacks zu kaufen, anders als in der Schlange vorm Club. Wie aller Content folgt dabei auch der Content, der meine Identität ist, den Konventionen bestimmter Genres. Das bekannteste Genre ist dabei das des wirklichen Selbst, der authentischen Identität: “When I am trying to be true to myself, I turn ‘myself’ into a genre, with readily recognizable and repeatable tropes. I can never be authentic, only authentically generic”, sagt Horning.
Ich glaube allerdings, dass das Selbst kein original content ist, also zumindest nicht im Sinne von etwas noch nie Dagewesenem. Es ist eher eine Mischung aus bekannten Mustern und Eigenschaften, das Ergebnis von Inspirationen: das sind die Genres, denen ich folge und die mich beeinflussen.
Zu einem Genre zu gehören, das klingt nach Enge, nach Dingen, die erlaubt sind und solchen, die man nicht tun sollte: “‘Man muss’, ‘man darf nicht’ - das sagt ‘Genre’, das Wort ‘Genre’, die Figur, die Stimme oder das Gesetz des Genres” (Jacques Derrida). Aber dieses basic Verständnis von Genre, schreibt Derrida, ist eigentlich nur die Hälfte dessen, was Genres sind: Das Gesetz des Genres, das mir Vorschriften macht und Grenzen setzt, kann immer nur zusammen mit einem Gegen-Gesetz existieren, das die gesetzten Vorschriften und Grenzen wieder überschreitet. Das Muster kann es nur dann geben, wenn man es manchmal reproduziert und manchmal nicht, schon alleine deshalb, damit man es von allem anderen unterscheiden kann.
Genres generieren keinen verlässlichen Output, sie operieren nicht durch copy & paste. Der Modus des Genres, zumindest wenn man es wie Derrida versteht, besteht im Wiedererkennen und Verfremden, in Wiederholung und Veränderung. Genres sind keine Maschinen und Fliessbänder, sondern Meme-Templates, die sich mit jedem Zitat verändern, die niemals wirklich greifbar sind. Genres sind nicht authentisch, sondern inkohärent, fluide und random.
Content ist ein schwieriger Begriff. Content, oder das deutsche Äquivalent Inhalte, steht eigentlich für einen völlig entleerten ästhetischen Ausdruck: “Content on the internet is pure form”, schreibt Horning. Content, in diesem Sinne verstanden, dient nur einem äusseren Zweck, nämlich einer quantitativen Maximierung von views, interactions oder conversions. Aber Content kann sich diesem Zweck auch ganz oder zumindest zum Teil entziehen: Dann, wenn er eine Qualität (und die kann natürlich immer nur subjektiv sein) als ästhetischer Ausdruck annimmt, die über die quantitative Maximierung hinausgeht, sie ignoriert oder sogar unterläuft. Diese Art von Content, für den vielleicht das Label Post-Content besser passen würde, findet sich in Memes, hyperironischen Tweets oder eigentlich jeder Art von Beitrag, die die komplett kommerzialisierte Struktur dieser Plattformen der Gegenwart zwar mangels Alternativen nutzt, aber ihre Motivation der quantitativen Maximierung nicht teilt.
Content bedeutet, die Möglichkeiten für ästhetischen Ausdruck zu multiplizieren. Ich kann Identitäten erschaffen und verwerfen, ich kann sie spalten und verschmelzen. Alles ist irgendwie immer veränderbar und fluide. Content ist allerdings nie absolut. Die Möglichkeiten sind nie unbegrenzt, weil Identitäten immer von aussen bedingt sind. Hannah Arendt schreibt: “Was immer menschliches Leben berührt, was immer in es eingeht, verwandelt sich sofort in eine Bedingung menschlicher Existenz. Darum sind Menschen, was auch immer sie tun oder lassen, stets bedingte Wesen.” Bedingtheiten sind ein fact of nature, sie kommen irgendwie über uns, aber nicht nur: “Die Menschen leben also nicht nur unter den Bedingungen, die gleichsam die Mitgift ihrer irdischen Existenz überhaupt darstellen, sondern darüber hinaus unter selbstgeschaffenen Bedingungen, die ungeachtet ihres menschlichen Ursprungs die gleiche bedingende Kraft besitzen wie die bedingenden Dinge der Natur.” Bedingtheiten entstehen auch durch mein Handeln, durch das Handeln anderer und das, was wir zusammen tun.
In Weltentwerfen schreibt Friedrich von Borries über das Verhältnis von Entwerfen und Unterwerfen in der Gestaltung: “Alles, was gestaltet ist, unterwirft uns unter seine Bedingungen. Gleichzeitig befreit uns das Gestaltete aus dem Zustand der Unterwerfung, der Unterworfenheit.” Von Borries spricht über Design und genau deswegen passt es, glaube ich: Content erlaubt uns das Design unseres Selbst, auch ausserhalb spätkapitalistischer Vorstellungen von Maximierung und Optimierung. Wenn ich Identität als Content betrachte, dann wird sie eben zum Gegenstand von Gestaltung, durch mich und durch andere. Content befreit nicht aus allen Bedingtheiten, aber weil er so random ist und weil er so fluide ist, schafft das Entwerfen des Selbst als Content oder in Content Möglichkeiten, die Bedingtheiten, die für mich und andere gelten, zu verändern, und mich (mehr oder weniger) aus ihnen zu lösen. Natürlich schafft auch Content, wie alles Gestaltete, neue Bedingtheiten. Aber auch sie sind flüchtig und random.
Die Möglichkeiten, sich aus einer Bedingtheit zu lösen, sind immer umso grösser, je privilegierter jemand ist. Marginalisierungen sind Bedingtheiten, denen man sich nie ganz entziehen kann. Doch Identitäten als Content zu betrachten, macht es möglich—glaube ich, denn ich kann nur von aussen darauf schauen—Orte zu schaffen, an denen die Marginalisierungen an Schwerkraft verlieren.
Im Manifest Glitch Feminism schreibt Legacy Russell über das emanzipatorische Potenzial, das das Internet für queere Körper und Identitäten—auch AFK (away from keyboard)—hat. Als queere Schwarze femme Person, sagt Russell, erinnert die Welt sie ständig an diese Identitäten. Die Chatroom-Persona LuvPunk12 dagegen kann in ihrer Performance das Konzept weiblich verwandeln, das Konzept Mann erkunden und das Konzept Frau erweitern. Auf diese Weise Content zu produzieren, heisst für Russell, neue Identitäten zu schaffen, indem man verschiedene Körperlichkeiten anlegt und wieder ablegt.
Die Paradigmen des Content sind die Tools der Emanzipation: Die Story (oder der Snap) betonen die randomness, die Content ausmacht. Ich kann etwas posten und spätestens nach vierundzwanzig Stunden ist es weg. Ich kann etwas sein oder darstellen, so lange ich will und auch einfach wieder damit aufhören. Ich muss mich nicht für das Eine oder das Andere entscheiden.
Durch Filter kann ich das, was ich darstelle, fast beliebig ändern. Alles ist veränderlich, nichts ist endgültig. Es gibt keinen Kern, kein eigentliches Ich, das ich darstellen muss: Jede Identität ist ein Filter.
Lip-Syncing zeigt, dass Content immer über den Bezug zum Anderen funktioniert, in dem man sich nicht verliert, sondern das Material für die eigenen Identitäten findet: “We are not empty signifiers, however, we are not dead-end hyperlinks” (Russell).
Es ist allerdings etwas ironisch, dass die tatsächliche Ideologie des Content relativ oft trotzdem eine des “be yourself” ist. Auf Tinder suchen die meisten entweder nach echten [insert cisgender identity] oder, wenn die Postmoderne etwas stärker gehittet hat (also auf OkCupid), nach authentischen Begegnungen. Jede Instagram-Ad verspricht mir eine authentische Erfahrung. Ein Anspruch von Authentizität ist so ein basic Element von Content, dass man darüber eigentlich nichts mehr schreiben muss.
Der schlechte Ruf von Content kommt auch daher, dass er diesem Anspruch extrem offensichtlich nie gerecht werden kann. Dahinter steht die Vorstellung, es gäbe ein echtes Ich, eine Essenz, die der Content ausdrücken und darstellen soll. Daher kommt die Enttäuschung, wenn er obviously an dieser Aufgabe scheitert: “Everything that is turned into content is extruded from the self and ceases to be a part of it; from this view it is all inauthentic, merely useful, so much signaling” (Horning). Aber Content ist eben kein fehlerhafter Ausdruck einer echten Identität. Die Identität ist halt Content.
Content, der versucht etwas auszudrücken, was nicht da ist (weil es im Content selbst sein müsste), ist tatsächlich leer. Deswegen bringt das Genre des authentischen Selbst eben nur eine entleerte Art von Content hervor, etwas, das “authentically generic” (Horning) ist. Ich glaube, es ist gerade diese Leere, die Menschen dazu bringt, Content zu hassen. Sie versuchen noch authentischeren Content zu produzieren und entleeren ihn dabei noch mehr. Es geht immer so weiter.
Authentizität will absolut sein, nur sie selbst, sie bewegt sich deshalb ins Totalitäre. Content ist relativ, er funktioniert nur über das Zitat, also prinzipiell den Bezug zum anderen. Er ist random, was nicht heisst, dass er irrelevant ist, aber er ist eher low-stakes: Das Leben als Content ist etwas anderes, als das Leben als Kunst zu sehen. Identität als Content zu betrachten, heisst, so eine Art entspannten, wavy Ästhetizismus zu embracen, der die Zeichen- und Formhaftigkeit der Welt erst einmal appreciatet und schaut, was man—abseits irgendwelcher spätkapitalistischen Optimierungs- und Maximierungsvorstellungen—damit machen könnte. Im Prinzip bedeutet es, Mallarmé so zu interpretieren, dass alles auf der Welt existiert, um Content zu werden.
Bei Mallarmé steht allerdings: “Alles auf der Welt existiert, um in einem Buch zu enden” (“Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre”). Wenn man Identität als Content betrachtet, dann sieht man die Welt genauso ästhetisch, aber nicht so endgültig. Content ist, weil er random und fluide ist, immer veränderlich; gleichzeitig ist er immer auf anderes bezogen und kann niemals komplett losgelöst existieren: er definiert sich über ein dialektisches Verhältnis von Veränderlichkeiten und Bedingtheiten, also die widersprüchlichen Gesetze des Genres, der Regel und ihrer Überschreitung.
Content ist letztendlich ein Spiel, aber eines, das man aufrichtig und ernsthaft spielen kann. Ich habe jetzt lange versucht, nicht das Wort “subversiv” zu gebrauchen. Ich mag das Wort nicht, weil ich das Konzept von Subversität als relativ schlicht empfinde. Aber der Gedanke, dass es ein subversiver Akt ist, Identität als Content zu produzieren, drängt sich schon irgendwie auf. Es bedeutet aber gerade nicht, Leuten mit Wasserpistolen ins Gesicht zu spritzen für die Revolution oder so. Content ist komplexer, er ist manchmal dagegen und manchmal affirmierend und meistens beides. Identität als Content zu sehen, heisst, das Gute oder das Schöne—oder was immer man sehen und darstellen möchte—eher über das ironische Zitat zu erreichen als über die Illusion, einsam vor einem reinen, leeren Blatt sitzen zu können, das darauf wartet, beschrieben zu werden.
Leben als Content: Das heisst das Veränderliche im Bedingten zu erkennen, bis hin zu dessen Überwindung.
Quellen:
Hannah Arendt. Vita activa oder Vom tätigen Leben. Stuttgart, Kohlhammer, 1960.
Jacques Derrida. Gestade. Herausgegeben von Peter Engelmann, Wien, Passagen Verlag, 1994.
Rob Horning. “Fear of Content.” dis magazine. http://dismagazine.com/disillusioned/78747/fear-ofcontent-rob-horning-2/.
Russell Legacy. Glitch Feminism. A Manifesto. Verso, 2020.
Friedrich von Borries. Weltentwerfen. Eine politische Designtheorie. Berlin, Suhrkamp, 2019.
freiTEXT | Marcel Pollex
Die perfekte Montage
So trafen sich Vater und Sohn – deren Beziehung schon immer distanziert gewesen war, sie interessierten sich nicht für das Leben des Anderen, hatten einander nichts zu erzählen, und machten sich gegenseitig dafür verantwortlich, dass ihr Leben nicht so war, wie es hätte sein können – zufällig in einem Baumarkt, den der Sohn aus einer Notwendigkeit heraus hatte aufsuchen müssen, in der vergangenen Nacht war ihm im Schlafzimmer ein Regalbrett von der Wand gefallen, das er da so hingepfuscht hatte, er wäre beinahe im Schlaf von einem Buch erschlagen wurden, wegen seiner handwerklichen Unfähigkeit, während sein Vater aus reinem Vergnügen dem Baumarkt einen Besuch abgestattet hatte – er hatte nichts zu reparieren, alle Regalbretter waren sicher montiert und alle Möbel fest verschraubt – er genoss das Flanieren durch die hohen Gänge, kannte alle Dinge und ihre Verwendung und die unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die beiden erkundigten sich nicht nach dem Wohlbefinden des Anderen, der Sohn fragte seinen Vater nicht nach der Gartenarbeit und der Langeweile der Pension, und der Vater fragte seinen Sohn nicht nach seiner aktuellen Freundin oder seinem unverständlichen Job. Weil er nichts Besseres anzustellen wusste, fragte der Sohn seinen Vater, ob der ihn bezüglich der Montage des Regalbrettes beraten könne, das ihm in der Nacht von der Wand gefallen war und ihn beinahe erschlagen hatte, und der Vater erklärte seinem Sohn darauf das Handwerk und damit die Welt, was die Dinge zusammenhält, führte ihn durch die Gänge, zeigte ihm Holz und Metall, erzählte, wie man die Dinge zusammführt, sprach von der perfekten Montage. Zum Abschied gaben sie einander die Hand, und der Vater klopfte seinem Sohn auf die Schulter. Nicht gänzlich ohne Stolz brachte der Sohn noch am gleichen Tag das Regalbrett an die Wand, und als er in der Nacht davon erschlagen wurde, erwachte zur gleichen Zeit sein Vater aus dem Schlaf, der raus auf die Terrasse ging und in die Dunkelheit starrte, darüber nachdachte, am nächsten Tag die Eiche zu fällen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Peter Zemla
Der Schrank
Entschuldigen Sie, dass ich flüstere. Aber sie ist gerade an meiner Schulter eingeschlafen. Sie atmet so gleichmäßig und tief, dass ich sicher auf Ihr Verständnis zählen kann, wenn ich diesen Zustand nicht unnötig gefährde. Zwangsläufig dringt meine Stimme durch die geschlossene Schranktür nur gedämpft nach außen. Wenn ich, was ich zu sagen habe, nun auch noch in reduzierter Lautstärke vorbringe, muss das für Ihre Aufnahmebereitschaft eine besondere Anstrengung bedeuten. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie eine solche Anstrengung auf sich nehmen. Nicht jeder würde für einen in den Schrank Zurückgezogenen solches tun. Es wäre nur allzu verständlich, wenn der draußen Stehende, der sein Ohr gegen die Schranktür presst, abwinkt und dann eben nicht sagt und davongeht. Sie gehören nicht zu diesem Schlag Mensch. Sie haben Verständnis.
Was mich zu dieser Annahme veranlasst, mögen Sie sich fragen. Ich weiß, dass Sie wissen, dass ich das Schlüsselloch in der Schranktür mit einem Papiertaschentuch ausgestopft habe. Ich kann Sie nicht sehen, nicht einmal Fragmente von Ihnen. Wie also soll ich jemanden einschätzen, den ich noch nie gesehen habe? Ich versichere Ihnen, dass es weitaus verlässlichere Beurteilungskriterien gibt als die vom Augensinn gelieferten Daten.
Möglicherweise ist das ein Grund, warum ich mich in den Schrank zurückgezogen habe. Möglicherweise habe ich geahnt, mehr intuitiv gespürt als gewusst jedenfalls, als ich in den Schrank hineingegangen bin, als ich mich dem Schrank anvertraut habe, dass im Schrank andere Voraussetzungen herrschen als außerhalb des Schrankes. Dass, was ich im Schrank vorfinden werde, mir gemäß sein wird. Dass ich gewissermaßen aufleben kann im Schrank, was mir außerhalb des Schrankes nicht möglich gewesen ist.
Und dabei, das möchte ich betonen, habe ich nicht ansatzweise daran gedacht, als ich mich entschlossen habe, in den Schrank zu gehen, im Schrank jemanden vorzufinden. Wenn man sich entscheidet, in den Schrank zu gehen, damit Sie mich richtig verstehen: nicht den Schrank zu öffnen und etwas im Schrank Verwahrtes herauszuholen, sondern sich selbst im Schrank zu verwahren, rechnet man nicht mit dergleichen. Zum einen ist man mit der eigenen Entscheidung, einer weitreichenden, wie Sie sich vorstellen können, vollumfänglich beschäftigt. Zum anderen ist es ja schon abwegig genug, sich selbst in den Schrank zu begeben, wie abwegig erscheint es da erst, dass bereits vor einem jemand diesen Schritt getan haben soll. Das will einem nicht in den Kopf. Und weil es nicht Inhalt des Kopfes gewesen ist, dieser Gedanke ein gänzlich ungedachter gewesen ist, verstehen Sie, hat er zwangsläufig keinerlei Rolle gespielt.
Wichtig ist einzig die Abschätzung gewesen, ob es zu wagen sei, ob ich es mir zutrauen darf, in den Schrank zu gehen. Natürlich habe ich mir gesagt, du kannst es versuchsweise wagen. Du kannst in den Schrank gehen, dort verbleiben und dann den Schrank wieder verlassen. Du kannst, wer sollte dich daran hindern, habe ich mir gesagt, so naiv bin ich gewesen, Urlaub im Schrank machen und, wenn der Urlaub beendet ist, zurückkehren in die Gewöhnlichkeit. Das Risiko ist ein überschaubares, habe ich mir gesagt. Es wäre folglich nur leichtes Gepäck vonnöten, habe ich mir gesagt. Noch andere Dinge habe ich mir gesagt, Beruhigendes, den Puls und den Strudel im Hirn gleichermaßen Bändigendes.
Doch als ich dann hineingegangen bin, als ich die Schranktür hinter mir zugezogen habe, ist mir unverzüglich klar gewesen, dass ich dergleichen nicht gebraucht hätte. Alle Versicherungen und Absicherungen sind unnötig gewesen. Im Schrank, als ich mich an die Rückwand gekauert habe, als ich zwischen den Wintermänteln und unter den Herbst- und Winterjacken mich niedergelassen habe, die Schals und Mützen und Handschuhe beiseite geschoben habe und es mir zwischen all der für die kälteren Jahreszeiten weggeräumten Garderobe bequem gemacht habe, hat Frieden geherrscht. Ruhe hat geherrscht, eine allgemeine, vielleicht von den Mänteln und Jacken und Mützen ausgehende Dämpfung. Eine Ruhe, wie ich sie mir im Vorfeld meines Rückzuges in einer ungefähren und abstrakten Ausformung vorgestellt und ausgemalt und unter Umständen sogar ersehnt, wie ich sie aber tatsächlich vorzufinden nicht zu hoffen gewagt habe.
Die Chance, eine Ruhe, etwas in diese Richtung Tendierendes, im Kellerschrank zu finden, sollte höher sein, habe ich gedacht, als im Schlafzimmerschrank. Ginge ich in den Schlafzimmerschrank, müsste ich damit rechnen, dass meine Frau jederzeit die Tür des Schlafzimmerschrankes aufreißt, nicht um mich zu suchen, aber um etwas aus dem Schlafzimmerschrank zu holen, ein Handtuch, ein T-Shirt, eine Hose, und vorbei wäre es mit der Ruhe, habe ich gedacht. Nein: Ich habe das nicht gedacht, all das habe ich nicht wirklich gedacht. Ich habe nicht so weit gedacht, aber unbewusst habe ich dergleichen wohl erwogen. Weshalb ich mich für den Kellerschrank entschieden habe, als es soweit gewesen ist, in den Schrank zu gehen.
Als ich drin gesessen bin, nach zwei, drei Minuten bereits, habe ich gewusst, dass diese Wahl die richtige gewesen ist. Überhaupt habe ich mit einem Mal gewusst, dass alles das Richtige ist. Obwohl zugegebenermaßen nicht die beste Luft herrscht im Schrank, habe ich aufgeatmet. Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich das getan. Ich habe gewissermaßen die Ruhe eingesaugt in meine Lungen und bin selbst ganz ruhig geworden. Eine Zeitlang habe ich noch an der Schranktür gehorcht. Ich habe geglaubt, entfernt Schritte zu hören, die tapsigen Schritte meiner Frau, die polternden Schritte meiner Tochter. Ganz weit entfernt habe ich geglaubt, jemanden, meine Frau, meine Tochter, eine von beiden, etwas rufen zu hören, was ich aber nicht habe verstehen können. Wahrscheinlich hat es sich um eine Bagatelle gehandelt, um eine Zwecklosigkeit, um ein Rufen, das nur um des Rufens willen gerufen wird. Bald schon habe ich nicht mehr gehorcht. Selbst wenn jemand, meine Frau, meine Tochter, noch gerufen hätte, hätte ich es nicht mehr gehört.
Spätestens nach meinem ersten Tag im Schrank habe ich nichts mehr gehört, was außerhalb des Schrankes vor sich gegangen ist. Irgendwann habe ich mir eingebildet, die Haustür zu hören, den Schlüssel sich drehen zu hören im Haustürschloss, was aber eine akustische Unmöglichkeit ist. Alles, was von außen hereindringen könnte zu mir, wird durch die im Schrank herrschende Leere atomisiert, verströmt in der Leere. Man könnte sagen: Es wird nichtig. Denn so paradox es auch klingen mag: Obwohl der Schrank mit Mänteln und Jacken, mit Mützen und Schals gefüllt ist, herrscht in ihm eine Leere, die ich zuvor nicht für möglich gehalten hätte und die als eine vollkommene bezeichnet zu werden verdient. Nach drei, vier Tagen im Schrank ist mir klar geworden, dass seine vollkommene Leere das Besondere des Schrankes ausmacht. Die vollkommene Leere ist es, die den Schrank wertvoll werden lässt. Wenn ich etwas herauspule aus meiner Nase, meinen Ohren, etwas aus den Winkeln meiner Augen herausschabe, ich weiß nicht was, etwas eben, dann hört es, unmittelbar nachdem ich es aus mir herausgepult habe, auf, etwas zu sein. Alles im Schrank hört auf, etwas zu sein. Wie tröstlich diese Erkenntnis gewesen ist, immer noch ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Umso überraschter bin ich gewesen, einen Moment lang bin ich natürlich zuerst erschrocken gewesen, dann überrascht, als ich eine Hand nach mir greifen gefühlt habe. Dass es sich nicht um eine von meinen gehandelt hat, ist für mich außer Frage gestanden. Aber wer hat sich außer mir noch im Schrank befunden? Ist es überhaupt möglich, habe ich mich gefragt, dass die Leere des Schrankes, jemanden, der nicht ich bin, zulässt? Ich habe dieser Frage nicht auf den Grund gehen können, denn die Hand, eine zarte, eine schmeichelnde Hand, hat mir über die Brauen, durchs Haar gestrichen, ist die Konturen meines Gesichts nachgefahren. Ich hätte Ich muss doch bitten sagen können. Schluss damit hätte ich sagen können. Ich hätte die Hand packen und von mir weisen können als etwas Widriges, dem Inneren des Schrankes Zuwiderlaufendes und Zuwiderhandelndes, aber ich bin dazu nicht in der Lage gewesen. Die Hand hat mir etwas in den Mund gesteckt, einen Drops mit Himbeergeschmack. Vielleicht hat sie ihn in einer der Mantel- oder Jackentaschen gefunden, vielleicht ist er darin vom Besuch des Weihnachtsmarktes übrig geblieben. Wie dem auch sei: Der Drops hat, ich gebe es zu, herrlich geschmeckt.
Natürlich ist die Hand nicht nur Hand allein gewesen. Natürlich hat, was einen Körper darüber hinaus ausmacht, zur Hand gehört, wie ich, im gleichen Maße wie die Hand mich tastend erkundet hat, tastend erkundet habe. Am Ende unserer Erkundungen haben wir uns umschlungen gehalten. Ich hätte fragen können, wie lange sie, es handelt sich, ich muss das nicht weiter erläutern, um eine sie, bereits im Schrank hockt, was sie bewegt hat, in den Schrank zu gehen, ob sie die Bedingungslosigkeit des Schrankes in der gleichen Weise wie ich empfindet. Aber das ist überhaupt nicht nötig gewesen. Alles, was gesagt werden kann, ist hinfällig geworden, verstehen Sie? Alles jemals Gesagte, alles, was zu sagen sich noch aufdrängen könnte, ist im Schrank nicht länger von Belang.
Hallo? Hören Sie mich?
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martin Brandstätter
Tims Rückgrat
Tom und ich waren beste Freunde. Wir hatten einfach so viel gemeinsam. Wir liebten beide Star Wars, The Rolling Stones – vor allem Gimme Shelter – und wir gingen gerne raus ins Freie. Draußen kann man so zwanglos miteinander reden; man kann die Umgebung wahrnehmen und genießen und unsere Schrittgeschwindigkeit war aus irgendeinem Grund immer im Einklang und genau richtig. Es war einfach perfekt. Auf solchen Runden redeten wir allerdings nicht nur über schöne Sachen, sondern auch über traurige.
Tom und ich lernten uns kennen, als wir beide circa 6 Jahre alt waren; er lief aufgebracht aus seinem Haus – das Haus seines Vaters – und da rannte er einfach in mich hinein. Die Wucht, mit der er mich rammte, war so groß, dass ich sie paradoxerweise nicht spürte. Nach einer kleinen Schnupperstunde hatten wir das Gefühl, dass wir uns öfter sehen mussten. Wir verstan-den uns irgendwie auf Anhieb und das lag nicht nur daran, dass wir beide jeweils ein Star Wars T-Shirt anhatten – bei ihm war Han Solo drauf und ich hatte Chewy. Und so schlossen wir einen stillen Vertrag miteinander ab; jedes Mal, wenn es ihm schlecht ging, konnte er zu mir kommen und wir würden entweder spielen, reden, spazieren gehen oder alles auf einmal tun.
Tom wohnte in einem kleinen Städtchen, dessen größte Attraktion eine kleine Brücke über einem Bahngleis war, denn sonst gab es nur Traktoren und Trägheit in dem Ort. Die Brücke war immer unser Spot zum Zurückziehen, wenn er gerade nicht zu Hause bei seinen Eltern sein wollte. Seine Mutter war eine einfache Hausfrau und sein Vater arbeitete hart als Maurer in einer ortsansässigen Baufirma. In den zehn Jahren, die ich Tom jetzt schon kenne, merkte man, wie sich der Rücken seines Vaters verformte und seine Gedanken abstumpften. Umso mehr musste sich seine Mutter bemühen, die Familie auf ihren Schultern zu tragen.
Toms häufigstes Gesprächsthema – neben Star Wars und den Rolling Stones – war sein Vater. Er muss ein sehr strenger Mensch gewesen sein, aber Tom fand immer Entschuldigungen für das Verhalten seines Vaters. »Alles hat irgendwie einen Grund«, sagte er meistens, um eine Rechtfertigung zu geben. Ich versuchte immer ihn davon zu überzeugen, dass das Verhalten seines Vaters nicht in Ordnung sei, aber er antwortete immer darauf: »Du hast ihn noch nie getroffen; du kennst ihn gar nicht!«
Tom hatte recht. Ich kannte ihn wirklich nicht, aber trotzdem machte es die Verhaltensweise des Erwachsenen nicht besser. Es war für mich unverzeihlich. Manchmal wenn wir uns in solche Streitereien hineinsteigerten, standen wir einfach stillschweigend auf der Brücke und beobachteten die Züge, die unter uns hindurch fuhren. Er schaute den Zügen mit einer gewissen Faszination, die ich nicht immer teilen konnte, hinterher, aber ich tat trotzdem so als würde ich die selbe Bewunderung haben wie er, da er ja mein Freund war.
Tom und ich gingen an einem sonnigen Sonntag eine kleine Runde durch die Landschaft. Nach-dem er aus dem Haus seines Vaters gestürmt war, konnte ich nicht nein sagen zu ihm. Irgendwie verhielt er sich aber anders als sonst. Er wollte nicht wirklich reden; er starrte nur zu Boden. Als wir auf der Brücke ankamen, fragte ich, was los sei, aber er schloss nur die Augen und verharrte so eine lange Zeit. Ich war derweil etwas hilflos, da ich ihn noch nie so erlebt hatte und ich nicht wusste, was los war.
Tom entschloss sich irgendwann seine Augen zu öffnen und er zog sein Hemd hoch und drehte sich mit dem Rücken zu mir. Eine große, längliche Wunde zog sich quer über seinen Rücken. Sie war noch ziemlich frisch. Ich war sprachlos und er sagte nur: »Mama hat auch eine.«
Tom und ich hörten den 12Uhr-Zug näher kommen. Tom setzte sich auf die steinerne Brüstung und ich sagte nur: »Pass bloß auf. Du könntest fallen.« Und er antwortete darauf: »Alles hat irgendwie einen Grund.« Als ich diese Worte hörte, packte mich ein seltsames Verlangen. Ich spürte, wie ich jegliche Kontrolle über meinen Körper verlor. Der Zug kam näher. Ich näherte mich Tom. Der Zug kam näher. Ich stand hinter Tom. Der Zug kam näher. Ich fasste Toms Wunde an. Der Zug kam näher. Ich schubste Tom.
Tom wurde vom Zug erfasst. Langsam kehrte mein Wille über meinen Körper wieder zurück, doch ich spürte mein Rückgrat brennen. Und die Sonne schien, als wäre nichts passiert und ich stand da und hörte den Zug nicht mehr. Ich wurde zum Mörder. Ich hatte doch keinerlei Grund ihn zu töten. Ich musste ein Psychopath sein. Ich musste mich stellen; ich darf nicht frei auf der Straße herumlaufen. Einen langen Sprint legte ich hin, um die Polizeistation des Städtchens so schnell wie möglich zu erreichen. Ich musste mich einfach stellen; es gab keinen anderen Aus-weg.
Als ich dort ankam, suchte ich den erstbesten Polizeibeamten um meine Tat zu gestehen. Dieser stand vor einem Getränkeautomaten und ich schrie ihn von der Seite an: »Ich habe meinen Freund ermordet; Sie müssen mich festnehmen; ich hatte keinen Grund das zu tun; vielleicht bin ich krank oder so; helfen Sie mir verdammt nochmal! Ich muss bestraft werden! Hören Sie mir überhaupt zu!?«
Der Beamte schmiss sein Geld in den Automaten, wählte ein Getränk, wartete auf das Getränk, nahm das Getränk, trank etwas von dem Getränk und drehte mir den Rücken zu, ohne mir auch nur eine Sekunde seiner Zeit zu schenken. Mir fiel auf, dass gar keiner mich beachtete, obwohl vier Leute in diesem Gang standen. Ich verstand nicht, was vor sich ging. Dann sah ich einen Polizisten aus einem Zimmer kommen, der an mir vorbeiging und eine Tür direkt neben mir öffnete und sagte: »Walter, wir haben schon wieder einen Springer. Mittlerweile der fünfte in diesem Jahr. Komm, wir müssen rausfahren!«
Die beiden Beamten verließen das Zimmer und gingen an mir vorbei und aus der Polizeistation hinaus. Keiner von beiden hatte mich mit einem Blick gewürdigt, noch hatte mich irgendwer gehört.
Jeder kehrte dieser Stadt den Rücken zu. Und anscheinend taten das alle auch mit mir.
Und erst da realisierte ich, dass ich nicht echt war.
Ich hatte keinen wirklichen Körper.
Ich war nur Toms Freund. Meine Existenz war an seine gebunden, aber trotzdem lebte ich weiter. Und jetzt verstand ich auch, warum wir uns damals getroffen hatten.
Tom ist tot und Tim muss damit leben.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stephanie Mehnert
Die Klinge zu sein, und auch die Wunde
Ich will einen Kokon aus Spinnenseide.
Diesen Satz schreibe ich auf meinen Block und als ich den Punkt setze, bricht die Bleistiftmine. Mein Blick fällt auf den kleinen Bilderrahmen, den du aufs Regal gestellt hast, als du eingezogen bist.
How you love yourself is how you teach others to love you.
Aus dem Nebenzimmer höre ich dich leise summen, während du packst. Eigentlich ist es mehr ein Zwitschern, als wärst du ein Vogel, der aus dem Käfig entkommen ist. Einer von diesen Wellensittichen, die immer Butschi heißen und in Wassergläsern ertrinken können.
Mein Daumen bearbeitet das Ende des Druckbleistifts, tack, tack, tack, bis sich endlich die Mine aus dem vorderen Ende herausschiebt. Scharf und dunkel kratzt sie Wörter aufs Papier:
Ich bin ein leeres Gefäß. Man kann mich befüllen, dann bin ich glücklich bis zum Überfließen, und das macht mir Angst.
Vielleicht liegt hier das Problem, denke ich, während ich deinem albernen Gezirpe lausche und dem Geraschel deiner Händekrallen. Es mögen auch deine Flügelspitzen sein, die am Schrankholz hängen bleiben. Butschi, denke ich verächtlich.
Es ist seltsam, das Universum hinter meiner Stirn. Manchmal denke ich, da ist gar kein Körper an meinen Schädel angewachsen, bloß eine Art Maschine, die alles am Laufen hält. Und dann bestehe ich wieder nur aus Gefühlen, die mich wie Flutwellen vor sich herschieben. Wie soll man es mit so jemandem aushalten?
In meiner Welt gibt es keine Farben. Alles ist schwarz oder weiß, gut oder schlecht. In mir drinnen wäre Raum für einen ganzen Regenbogen, so viel freie Fläche. Wie eine Leinwand, die mit den Jahren immer staubiger wird, mottenzerfressen und gelb, weil niemand kommt, um sie zu bemalen.
Du klackerst im Badezimmer herum, und ich stelle mir vor, wie es da aussehen wird, wenn du weg bist. Denke an die Kreise im Staub auf der gläsernen Ablage, die mich so lange an dein Fehlen erinnern werden, bis ich mich dazu durchringen kann, sie fortzuwischen. Rasierer, Langhaarschneider, Nasenhaarschere, Männerduschgel, Barthaare im Waschbecken und nie wieder den Klodeckel herunterklappen müssen.
»Soll ich dir von meinem Küchenzeug noch was dalassen?«
Du kommst lächelnd zu mir geschlendert, als hättest du gerade gefragt, was ich zu Abend essen möchte. Wie ein Wellensittich siehst du nicht gerade aus, eher wie ein borstiger, fetter Eber. Du solltest sowieso nicht so viel fressen. Hauptsache du nimmst diesen verfluchten Wecker mit, dessen unermüdliches Ticken einem die Stunden aus dem Fleisch hobelt. Vielleicht hätte ich ihn an deiner Stelle rauswerfen sollen.
»Ne«, sage ich. »Nimm alles mit.«
Spinnenfäden sind das festeste Gewebe der Welt. Bezogen auf ihre Masse sind sie viermal so belastbar wie Stahl. Ich bin überhaupt nicht belastbar, deshalb brauche ich den Kokon, eine antibiotische Wohnhöhle. Vielleicht mische ich der Seide Pheromone zu, um den nächsten Mann anzulocken. Und dann mache ich, dass er mich liebt. Wie oft kann ein Mensch eigentlich verlassen werden, bevor er zerbricht?
Ich betrachte die feinen Narbenlinien auf meinen Unterarmen, sie überlappen sich, Mikadostäbchen im Sturm. In der Küche ziehst du ein Messer aus dem Holzblock, und das Geräusch, das die Klinge beim Darüberstreichen macht, lässt alle Härchen auf meiner Haut strammstehen. Ich spüre, wie der Druck steigt.
Manche Spinnenweibchen fressen ihre Partner, schreibe ich. Man nennt es sexuellen Kannibalismus. Meine Mutter, ich denke, die war so eine. Vielleicht auch eine Gottesanbeterin, so fromm, wie sie immer getan hat.
Ihre Männchen waren allesamt kleiner als sie, nicht körperlich, aber im Geiste.
Der Biss meiner Mutter bestand aus giftigem Spott, den sie präzise und absolut unvorhersehbar injizierte. Sie traf immer genau, den wunden Punkt.
Manche Männer hat das sehr zornig gemacht. Einmal trat einer meinen Puppenwagen durch den Raum, und ich weiß noch, wie er auf meine Hand stieg, als ich den Stoffbären aufheben wollte, der darin gelegen hatte.
Es gab auch andere Exemplare. Einer leckte gern über meine Hände, die Arme hinauf. Wenn er mein Zimmer verließ, nachdem er mich ausgehöhlt und mit seinem Bieratem angehaucht hatte, war mein Gesicht klebrig von seiner Zunge. Er war der Erste, die, die folgten, waren noch schlimmer.
Damals hatte ich mir vorgestellt, dass irgendwo ein Vater nichts davon ahnte, was zwischen den Schenkeln seiner Tochter vor sich ging. Ich stellte mir vor, mein Vater wäre wie Käpt‘n Iglo: Immer auf den Weltmeeren unterwegs, in jedem Hafen eine Frau, und keine Ahnung von meiner Existenz. Manchmal frage ich mich, ob diese Typen sich alles geholt haben, was einmal in mir gelebt haben muss, oder, ob ich schon immer so war.
Eine Spinne balanciert in ihrem Netz wie eine Seiltänzerin. Von Balance verstehe ich nichts, ich schätze, dafür braucht man so etwas wie ein Gespür für die Mitte, aber ich lebe in Extremen. Einmal habe ich ein Bild von Spinnennetzen gesehen, deren Erbauerinnen die NASA unter Drogen gesetzt hatte. Irgendwie hat mich das getröstet, dass die Spinnen auch nichts auf die Reihe bekommen, wenn sie high sind.
Den Bleistift lege ich weg und unterdrücke das drängende Verlangen, mir wehzutun. Ich kneife mir in die Ellenbeuge, so fest ich kann, dann mache ich ein Selfie mit dem Smartphone, wie jeden Tag um diese Zeit. Poste es bei instagram, #egoshooter. Denke an meine Mutter, denke an die Urne, die irgendwo auf dieser Wiese verscharrt liegt und bei der ich niemals Blumen ablegen würde. Frage mich, warum ich dennoch immer wieder hingehe, mit nichts als Fragen im Kopf. Frage mich, wozu ich an diesem Text schreibe, den ich doch nie jemandem zeigen werde. Frage mich, wie ich je so etwas wie eine Beziehung hinbekommen soll, wenn ich diesen Teil von mir unter Verschluss halte, während all das Unaussprechliche langsam vor sich hin fermentiert. Da wächst kein Gras drüber, niemals, das ist schlimmer als Tschernobyl. Aber ich strahle, und das kann ich gut. So gut, dass es jedes Mal ein Schock ist, wenn die Wahrheit hervorbricht und ich erkenne, dass ich doch wie sie geworden bin. Als wäre sie in mich gefahren, nach ihrem Tod, wie ein übermächtiger Dämon, und ich selbst bin der hilflose Exorzist.
»Um halb acht kommt Adam und holt mich ab.«
Du lässt dich neben mir aufs Sofa sinken. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät. Wenn du jetzt deinen Arm um mich legen und mir sagen würdest, dass du ohne mich nicht leben kannst, würde ich dich nicht wegstoßen, diesmal nicht, ich schwöre.
»Okay«, sage ich leise.
»Wirklich alles okay?«
»Ja, klar. Hast du alles?«
»Glaub schon. Ruf an, wenn was ist, ja?«
Du legst eine Hand auf mein Knie, wo sie mir ein Loch in die Haut sengt.
Auf dem Fensterbrett tickt höhnisch der Reisewecker, eine Fliege zieht ihre Kreise, setzt sich auf deiner Hand ab, die auf meinem Bein brennt, erhebt sich erneut, kreist weiter, klatscht gegen die Fensterscheibe, einmal, zweimal.
»Ja«, sage ich.
Du nimmst die Hand weg und starrst auf den Boden. Tick, tick, tick. Der Wecker steht noch immer da, stört mich, dich stört er nicht. Sobald du weg bist, werfe ich das verdammte Ding auf die Straße!
Gestern lag eine tote Amsel unten. Irgendein Raubtier hatte ihr die Schädeldecke aufgebissen, eine Katze vielleicht, oder einfach nur eine Ratte. Ich hockte mich neben sie und zog die Flügel weit auseinander. Wie ordentlich die Federn da gespreizt in Reih und Glied schimmerten, als wäre nichts geschehen. Meine Wunden liegen auch alle innen. Von außen sieht man nichts, mein Gefieder besteht aus klugen Worten und einem niedrigen BMI. Innere Leere geht gut als Tiefe durch, ich liebe schnell und intensiv. Der Schaden ist anfangs unsichtbar.
Es klingelt. Du gehst hin. Adam kommt herein und hebt die Hand zum Gruß in meine Richtung. Er schlägt dir auf die Schulter, dass deine Speckbrust wabbelt, Digger nennt er dich, was ich immer noch absolut passend finde.
Du schulterst die Taschen und schnaufst, als befände sich darin ein ganzes Leben.
»Mach‘s gut«, sagst du leise.
»Ja, mach‘s besser«, sage ich.
Die Tür fällt hinter dir ins Schloss und es ist still.
Das Loch in meinem Brustkorb expandiert, ich bin ein Ballon oder eine Supernova. Ich stürze zum Fenster, greife den verfluchten Wecker, reiße am Fenstergriff und schleudere das tickende Ding in hohem Bogen auf die Straße, wo es auf dem Dach eines parkenden Autos eine Delle hinterlässt, bevor es in seine Einzelteile zerspringt. Und dann schreie ich. Ich schreie allen Schmerz hinaus, allen Stolz und alle Einsamkeit. Ich schreie und schreie, während mir Tränen über die Wangen laufen und sich zu einem See auf dem Fensterbrett sammeln, als flösse das Leben salzig aus mir hinaus. Die Welt ist längst verschwommen, ein einziges Grau in Grau. Für einen Moment sehe ich mich da unten liegen, die Arme weit gespreizt, meine Bluse ein Farbklecks auf dem Asphalt. Ob du wohl die Amsel in mir sähest, frage ich mich. Eine kleine, schwarze Feder schwebt hinein, ein Boot im Tränenmeer.
Aus weiter Ferne höre ich die Wohnungstür ins Schloss fallen, aber ich verstehe nicht. Und dann spüre ich es: Dein warmer Bauch stärkt meinen Rücken und deine Flügelarme sind mein Zelt.
»Ich bin da«, sagst du nur.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Aigner
#7Leben
Im 7. aufgewachsen. Im 7. derzeit befindlich. Im 7. hab ich vor zu sterben.
-
Die letzte ra(s)tlose Hoffnung - mein infantiles Orakel. Befindlich an jener Kreuzung, an der sich Jenny Steiner und Hermann zum ersten Mal unter dem Ahorn, auf dem eine Seidenraupe ein Mittagsschläfchen hielt, geküsst haben. Dort klebt diese bösartig-grimassierte Säuglingstotenmaske unscheinbar an der Hausmauer und starrt mit seinen klitzekleinen, leeren Augen auf mich herab. Leise flüstert es. Immer das, was ich hören will.
-
Ausgelassen „Dracula Rock“ singend - die peinigenden Volksschulstunden überlebt - hüpfen Bettina und ich die Burggasse entlang nach Hause. Fast überfährt uns ein Auto, zu vertieft sind wir in eine hochliterarische Spekulation über das „Phantom der Schule“ von T. Brezina. Der Sokratische Dialog wird pausiert, um uns beim Lollipop mit rosanen Beverly Hills Kaugummis (da sind Sticker drinnen von Donna, Dillan, Brenda, usw.), Kaugummi- und Colaschleckern, sowie einem bunten Gummigetierzoo einzudecken. Im Anschluss folgt eine diskursive Charakter-Gegenüberstellung der weiblichen Mitglieder der Knickerbocker Bande: Also wer ist cooler? Lilo oder Poppi?
-
Angeciderd landen wir in der herzlichen Spelunke Zipp in der Burggasse. Einsame Seelen und AlternativstudentInnen sorgen für mehlige Melancholie und heilige Heimeligkeit. Spärlich beleuchtet von Musik aus meiner Teenagedirtbag-Zeit. Gerade Halt auf den Barhockern gefunden, fallen wir zungentechnisch übereinander her. Un(un)terbrochen von Unterhaltungsepisoden. Zärtlichst beschreibst du deine angedachte sexuelle Vorgehensweise, die uns zu mir nach Hause manövrieren soll. Nein! Ich will dieses nostalgische Rumknutschspektakel auf keinen Fall einem koital-bewusstseinserweiternden-orgiastisch-ekstatischen Intimverkehrsaufkommen opfern. Zu genussvoll erscheint mir das lechzende Warten auf eine geschlechtliche Zusammenführung in den kommenden Tagen. Du bestimmst wann.
-
„Love reign o´er me“ dröhnt es hippie-manisch aus den Junggesellinnen-Lautsprechern in der Neubaugasse. Deine Türnummer merke ich mir einfach nicht. Eine Platte nach der anderen schallt, wir trinken Rotwein, rauchen vegan und
reden, reden, reden über die Musik, die Bands, die Bücher, meine Träume, deine Pläne. Penny und Ruby. Magische Stunden. Zeit um aufzubrechen, ins Konzerthaus. Ein paar Plätze weiter von Pete Townshend werden wir orchestral von „Quadrophenia“ verschlungen.
-
Falafeldürüm oder Hühnerdöhner? Der Berlindöner in der Zieglergasse war genau eine Woche ein Geheimtipp. Danach strömten die Maßen von nah und fern auf Pilgerfahrten zu der heiligen Stätte des Lammfleisches. In der andächtigen Warteschlange bereite ich mich auf den hochkonzentrativen Bestellakt vor: Nächste! Ich muss schnell reagieren, Meinen Mann im Auge behalten, auf seine Fragen blitzschnell und präzise antworten: Mit alles? Scharf? Lieblingsfarbe? Zum Mitnehmen?
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at