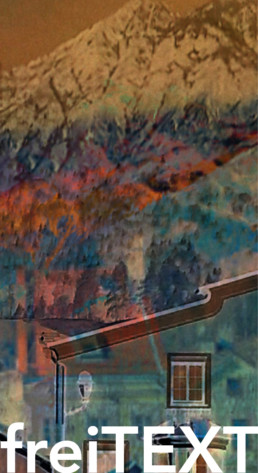freiTEXT | Cornelia Koepsell
Grenzdebil im Literaturbetrieb
Früher war alles besser. Das war ein Standardsatz, so eine Art Glaubensbekenntnis in meiner Kindheit, über den ich mich immer sehr ärgerte. Ich war so richtig sauer und riss mir vor Wut Löcher in die Hosen. Heute kriegt man dafür einen Designerpreis, damals bekam man eine gescheuert.
Da der Satz recht häufig fiel, hatte ich eine ärgerliche Kindheit. Heute sage ich die vier Worte Früher-war-alles-besser zwar nicht laut. Aber ich denke sie manchmal. Heimlich. Im Verborgenen denken, heißt konkret, ich veröffentliche den Satz nicht auf Facebook.
Trotzdem wohnt meinen Gedanken der seltsame Trieb inne, so ein inneres Drängen und Sehnen, sich irgendwie zu manifestieren, so dass auch andere sie mitkriegen. Meine Hirnströme neigen zu Geschwätzigkeit.
Um das zu verhindern, versuche ich heimlich im Bett zu denken, mit der Decke über dem Kopf und da brummele ich ganz leise ins Kissen, so dass nur nicht schwerhörige Milben mich verstehen können.
Früher-war-alles-besser.
So strohdumm, wie er sich anhört, ist der Satz garnicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo er zutrifft. Im Literaturbetrieb. Manchmal versuche ich in dieses Biotop meine Nase zu stecken. Entweder kriege ich dann eins auf eben diese oder ersatzweise eins auf die Schnauze oder ich ziehe mein Riechorgan freiwillig ganz schnell wieder heraus und schlurfe zurück ins Büro, wo ich mit ein paar ziemlich langweiligen Tätigkeiten mein Geld verdiene.
Aber immerhin kriege ich welches. Nette kleine Euros statt was auf die Nase. So viel, dass ich mir eine Mietwohnung leisten kann und einen gebrauchten japanischen Kleinwagen. Letzterer ist ausgesprochen wichtig für mein Wohlbefinden, da ich ein libidinöses Verhältnis zu meinem Auto unterhalte. Irgendwen muss man ja lieben.
Falls man sich früher entspannen wollte, ging man spazieren. Heute muss es mindestens ein Halbmarathon sein.
Wenn man früher einen Job hatte, mit dem man so einigermaßen sein Geld verdiente, war alles gut. Heute muss es auch noch Spaß machen, man soll glücklich sein, ausgefüllt, ein Dauergrinsen als Gesichtsmaske tragen, weil man so schön ausgebeutet wird und sich nebenbei zum Wohle der Firma ständig selbst optimieren. Da rutscht einem doch der Mittelfinger aus der geballten Faust.
Neulich erzählte ich auf einer Party jemandem, der einigermaßen vernünftig aussah, wie langweilig mein Job sei und wie bekloppt meine Chefin. Neben mir stand so eine Gisela, bei der zu Hause sich Psycho-Ratgeber und Esoterik Schwulst bis unter die Decke stapeln. Die Lektüre dieses modernen Glaubensbekenntnisses hat ihr die letzten verbliebenen grauen Zellen aus der Hirnschale gedrückt. Gisela ist esoterisch so durchgeglüht, dass sie im Dunkeln leuchtet. Sie erklärte mir, ungefragt natürlich:
„Wenn du deine Arbeit so hasst, musst du kündigen.“
„Wie soll ich dann meine Miete bezahlen?“ fragte ich.
„Das wird sich finden“, meinte sie.
Wenn ich auf die Giselas dieser Welt höre, meinen Job kündige und mich selbst verwirkliche, was nebenbei bemerkt in meinem Fall bedeutet täglich zehn bis zwölf Stunden zu schlafen und das Folterwerkzeug Wecker aus dem Schlafzimmer zu verbannen, und wenn der Vermieter, ein aggressiver Frühaufsteher, mich irgendwann aus einer meiner wohlverdienten Tiefschlafphasen klingelt und mich fragt, wann ich zu zahlen gedenke, ich sei um Monate im Rückstand und ich ihm erkläre, das werde sich finden, dann werde ich sehr schnell einen neuen festen Wohnsitz im Bezirkskrankenhaus haben. Dort kann ich meine Selbstfindung unter dem Einfluss von Psychopharmaka fortsetzen und sogar sechzehn Stunden täglich schlafen.
Meinen Aufenthalt dort könnte ich verlängern, indem ich behaupte unter einem Burnout zu leiden, weil der Vermieter mich so bedränge und weil die Welt so schlecht sei. Letzteres wird sich nicht so schnell ändern.
Besagte Gisela von der Party wird mir bestimmt nicht mit ein paar Euros aushelfen, nachdem ich ihren Rat befolgte, gekündigt habe und das mit der Miete sich nicht so schnell gefunden hat. Natürlich weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Das hatte mir besagte Gisela noch mit auf meinen verschlungenen Lebensweg gegeben.
Aber ich bin vom Thema, dem Literaturbetrieb abgekommen. Früher, als alles besser war, da sahen die Biografien von Schriftstellern in etwa so aus.
„Er – in Ausnahmefällen war es auch eine sie – also er arbeitete als Hausmeister, Totenwäscher, Taxifahrer, Kellner, Almhirt und Weichensteller. Der Titel seines ersten Erfolgsromans lautete: Die-Angst-der-Leiche-vor-dem-Waschen.“
Eine Schriftsteller-Biografie von heute geht etwa so:
„Sie studierte acht Semester am Leipziger Literaturinstitut. Diverse mäandernde Preise entdeckten sie als geeignete Trägerin. Sie debütierte mit dem Lyrik-Band Ich-und-mein-Handy.“
Verstehen Sie mich jetzt? Wenn nicht – auch egal. Dieses immer von allen verstanden werden wollen, wonach so viele Menschen insbesondere weiblichen Geschlechts sich andauernd sehnen, ist sowieso unerträglicher Ballast.
Früher gab es den Geniekult. Deshalb haben so wenig Frauen geschrieben, weil sich das Genie nicht mit ihrem Körperbau vertrug. Der war eher geschaffen für Haushalt und Altenpflege und Kaffeekochen und verstanden-werden-wollen.“
Insofern ist heute alles besser. Frauen dürfen auch mal genial sein, solange sie jung genug sind, um am Leipziger Literaturinstitut zu studieren und Eltern ihr eigen nennen, die genug Geld haben, um sie auch anschließend zu unterstützen, damit sie sich mit siebenhundert-bis-tausend-Euro-Stipendien monatlich durchs Leben fretten können.
Ansonsten müssen sie eben doch Verkäuferin werden und sich ein Beispiel an ihren Schriftsteller-Vorfahren nehmen.
Ob sie jemals Geld verdienen mit dem Schreiben, so viel, dass sie sich mit hoffentlich lange intakten Zähnen knapp über dem Hartz-Vier-Niveau festbeißen können, ob ihnen das gelingt, hat ja nichts damit zu tun, wie gut sie sind, sondern ist das Ergebnis von König Zufall, durch den sie irgendeinen aktuell bescheuerten Mainstream treffen oder ob sie in der Lage sind, ausreichend verschwurbelt zu schreiben, um weitere Literaturpreise und Stipendien auf einem hart umkämpften Markt an sich zu reißen, vergeben von Literatur-Juristen, die auch nicht besser sind als ihre Kollegen in der schwarzen Robe am Amts- oder Landgericht.
Wer ihre Sprache nicht spricht, wird aussortiert. Das war früher so. Das ist heute so. Wer sagt denn, dass alle Werte den Bach runtergehen?
Vielleicht sollte ich also den Satz Früher-war-alles-besser kreativ umschreiben und sagen: Heute-ist-alles-anders.
Ja – ich weiß, das klingt nicht sehr intelligent, aber ich habe nie behauptet, Eigentümerin eines hohen IQ zu sein.
Beim letzten Intelligenztest, dem ich mich spaßeshalber unterzogen habe, war ich grenzdebil.
Ja – Mann – das ist doch was, worauf ich stolz sein kann.
Wenn schon erfolglos unterwegs im Literaturbetrieb, dann wenigstens grenzdebil. Deshalb liebe ich auch kurze oder Ein-Wort-Sätze. Die verstehen ich und meinesgleichen nämlich gut.
Mein Lieblingssatz, seit ich ungefähr zehn bin, das ist der Klassiker:
Ich Tarzan – Du Jane.
Geniale vier Worte plus Bindestrich. Wenn man den verstanden hat, darüber meditiert, ich meine so richtig tief innen-drinnen, dann kann man alle Liebesromane aus dem Bücherregal in die Tonne hauen, so richtig Platz schaffen, das nennt sich „Simplify your life“.
Letzteres ist ein Buchtitel, geschrieben von einem, dem seine Hochbegabung die deutschen Wörter aus dem Hirn gelöscht hat.
Deshalb muss man erst Englisch lernen, bevor man sein Leben simplifyen – ich meine: vereinfachen kann.
Das finde ich kompliziert. Kann aber auch an der Grenzdebilität liegen.
Wenn man sowas Tolles hat, braucht man sowieso nicht solche Bücher lesen und spart sich haufenweise Geld.
Das Leben wird von alleine einfach. Es gibt Leute, die meditieren stundenlang im Lotussitz oder auf Knien wie arme kleine Sünder, machen sich die Gelenke kaputt mit dem Ziel wenigstens einmal am Tag den Kopf leer zu kriegen.
Als Grenzdebiler bekommt man das geschenkt von Gott Vater oder Gott Mutter oder dem Jesuskind.
Es hat so viele Vorteile. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Strengt auch zu sehr an.
Ein Kumpel von mir, der beim IQ Test noch schlechter abschnitt als ich – ja das geht –, er klärte mich auf:
„Unsere Synapsen sind nicht testfähig“, sagte er „Weil die Erfinder der Fragebögen sie nicht haben und deshalb nicht abfragen können.“
„Dann sind wir Aliens?“ fragte ich.
„Wir nicht“, erklärte er. „Die Anderen.“
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Margit Marenich
„Ein doppelter Haselnuss-Hagel-Macchiato mit extra viel Drama“
Sie rennt ins Gewitter raus und du denkst nur: „Verdammt! Wie ist das nur so schnell so schief gegangen?“. Gerade mit ihr.
„Warte Hannah! Du hast nicht mal deine Jacke!“, sie bleibt stehen und dreht sich zu dir um. Du siehst ihren pinken BH unter dem durchnässten Oberteil. Pink, mit Strass.
„Ich weiß, was du willst.“, schluchzt sie nur und hält dir ihr Handy ins Gesicht. Da ist eine wirklich lange Message am Bildschirm. „Jasmin hat mir gerade alles über dich geschrieben. Alles!“
Diese …! Wieso kann sie ihr Maul nicht halten? Was in ihrer Wohnung passiert ist, geht niemanden sonst was an.
Jetzt mischen sich Hagelkörner unter die schneller fallenden Regentropfen und bleiben in Hannahs offenen Haaren hängen. Mit nassen Augen sieht sie dich an, als wolle sie dich erschlagen.
Du musst das noch hinbiegen, sie irgendwie rumkriegen. Sechs Wochen hast du in das hier investiert.
Ihr ihre Jacke um die Schultern zu legen, findet sie sicher romantisch. Du hebst die Arme. Bevor du sie berührst, reißt sie sie dir weg. Ihr pinker BH verschwindet hinter dem Reißverschluss.
„Du dachtest du kaufst mir einen Kaffee und Cookies und dann was? Was, Jahn?“. Sie hält das Handy wie einen Stein zum Werfen. „Was dachtest du, was ich mache?“
Mit einem Schnauben denkst du an alles was über sie erzählt wird. Die Fotos. Echt alle in der Schule haben die gesehen. Da hat sie sich nicht so geziert.
Ihre Augen funkeln immer mehr. Deine Augen huschen zu ihrem Wurfarm. Zurück. Sie weint jetzt. Ihr Arm fällt schlaff herunter. Mit einem Stich denkst du an das Gerede. Echt alle in der Schule reden über sie.
„Sorry, Hannah.“, hörst du dich nuscheln. Du findest ein Taschentuch in der Hosentasche und hältst es ihr hin. Sie hört einen Moment auf zu schluchzen, als sie es nimmt.
Fuck! Das sollte das Wochenende sein, in dem alles in Ordnung kommt. Eltern und Geschwister erst am Montag zurück. Das heißeste Mädchen bei dir oben. Stattdessen stehst du im Regen und alle Leute starren dich an. Mit kaum verstecktem Lachen oder einem „Wird das arme Mädchen gerade belästigt?“ - Blick. Handys auf dich gerichtet.
Dabei wäre es so einfach. Wenn du sie nur rumkriegen könntest.
„Hannah - “.
„Sex löst gar nichts.“. Sie lehnt sich plötzlich zu dir rüber. Ihre Augen glitzern rötlich. Und flüstert mit erstickter Stimme in dein Ohr, „Ich habs versucht.“
Damit rennt sie zur Bushaltestelle.
Der Alte mit dem Hund, der gerade vorbeikommt, grinst dich an. „Passiert allen mal.“
Ohne zu überlegen rennst du ins Shopping Center zurück. Auf dem trockenen Boden machen deine nassen Schuhe dieses nervende Geräusch.
Auf deinem Handy sind neue Messages. Eine von Jasmin. Von. Jasmin.
Du willst den Mistkübel neben dir treten.
Ein paar andere in der Klasse wollten Details über Hannah. „Über das echte Zeug.“. Du kannst jetzt schon hören, was sie am Montag über dich sagen werden.
Dieser Samstag ist noch schlimmer als der vor sechs Wochen.
Es war alles so perfekt. Hannah hat deine Einladung angenommen. Du warst mit ihr extra in diesem Coffeeshop. Damit er alles sehen kann.
Vor einem der Shops stehen zwei Jungs, die Finger verschlungen, die sich aneinander lehnen. Mit einem Stich im Magen siehst du weg. Die sind sogar jünger als du, denkst du nur und gehst schneller.
Als du zum Coffeeshop zurückkommst, sind die Teller und Tassen schon abgeräumt. Du kannst nicht anders und siehst zum Tresen hin.
Dieselbe Barista, die du gar nicht kennst, steht noch da. Das erste heute, das gut läuft. Sie lächelt dich an und du denkst, dass du mit ihr flirten kannst.
„Einen Kaffee vielleicht? Lemon-Strawberry-Cheesecake ist heut im Angebot.“.
Bei ihr zu landen kannst du kübeln. Aber ein heißes Getränk wäre nicht schlecht. In der Wärme sind die Hagelkörner in deinen Haaren geschmolzen. Du spürst Wasser über deine Kopfhaut rinnen.
Hey. Er ist ohnehin nicht da.
„Einen Haselnuss-Latte-Macchiato zum Mitnehmen, bitte.“
„Sofort.“, die Barista dreht sich zur Seite. „Hi Noah - du bist 10 Minuten zu früh.“
No! Fuck.
„Ich mach das hier, Ayla. Das Übliche, Jahn?“. Noah wartet nicht auf deine Antwort, sondern misst das Kaffeepulver, während das Mädchen zu den Kunden an den Tischen geht.
Das ist das erste Mal seit sechs Wochen, dass du ihm gegenüberstehst.
Er sieht dich an. Deine nassen Haare. „Nicht gut gelaufen, hm?“.
Du hörst dich irgendwas schreien. Im Spiegel hinter dem Tresen drehen sich alle Köpfe. Fast packst du ihn am Kragen. „Du und deine Schwester- “.
„Jasmin ist Hannahs beste Freundin. Sie musste sie warnen.“
Er hält dir den Kaffee hin. Was hält dich eigentlich davon ab, ihm das Zeug in die Fresse zu schütten?
Dein Blick fällt auf die winzige Narbe auf seiner Unterlippe, die vor sechs Wochen noch nicht da war. Dann nimmst du einfach nur den Becher und rennst weg. Zurück ins Gewitter. Bevor du fünf Schritte aus dem Shopping Center raus bist, landen schon vier Hagelkörner im Blätter-Muster auf dem Milchschaum und du bleibst stehen.
In diesem Moment hasst du absolut alles auf der Welt. Am meisten ihn, immer besser. Er hat einfach alles. So einfach.
Es ist erst sechs Wochen her, dass dir das nichts ausgemacht hat. Dass du an Samstagen mit ihm Games gezockt und Spaß gehabt hast. Bevor…
Dein Becher landet neben dem Mülleimer und der Regen wäscht den letzten Kaffee weg, den du je von ihm kriegen wirst.
„Du hättest auch einfach nach einem Deckel fragen können.“
„Was?“
Noah steht mit einem Schirm hinter dir und hält ihn dir hin. „Willst du meinen Reserve-Hoodie? Ist im Spind.“
Das war’s! „Ich will deinen verdammten Schirm nicht.“
„Ist deiner. Du hast ihn vor sechs Wochen vergessen.“
Vor sechs Wochen.
Als er alles kaputt gemacht hat. Mit dem Kuss. Wegen dem du ihm die Lippe blutig geschlagen hast. Nicht weil es eklig war. Weil es gut war. Deine Schultern verkrampfen sich.
Nie ist irgendwas ein Problem für Noah. Auch nicht für die Jungs vor dem Shop vorhin.
„Warum ist das alles kein Problem für dich?“. Endlich, nach sechs Wochen, siehst du ihm in die Augen. „Was ist dein Geheimnis?“, denkst du nur.
„Nichts. Ich hatte es eben satt. So richtig.“. Er hält dir immer noch den Schirm hin. „Wie lange kannst du noch, so wie jetzt?“.
Deine Füße zucken beide nach Rechts. Richtung Ausgang. Richtung Bus. Wieso läufst du nicht?
Einen Moment lang schwanken Noahs Augen nach unten. Bevor… „Und ich mag dich.“
Das war’s jetzt. Irgendwas weder Lachen noch Keuchen bleibt dir im Hals stecken. Du nimmst den Schirm und versuchst dich zu räuspern. Nochmal. Was ist das? Hättest du nur noch den heißen Kaffee.
„Gehen wir zurück.“, sagt Noah nur. „Ich hab auch Ersatz-Sneakers im Spind.“
Das sollte das Wochenende werden, in dem alles wieder in Ordnung kommt. Vielleicht kommt wenigstens eines heute ins Reine.
Während du den Macchiato ohne Hagelkörner trinkst, hört es draußen auf zu regnen. Alles scheint ruhig. Wie sonst auch immer, wenn du hier warst. Oder bei ihm in der Wohnung.
„Schade, dass wir aufgehört haben.“, du denkst an die letzte Gamingsession. So nah am gewinnen.
Noah lächelt hinter dem Tresen.
Du verschluckst dich an deinem Kaffee, als dich sein Blick trifft.
Margit Marenich, geborene Wienerin. Lebt und arbeitet immer noch da. Schreibsprachen Deutsch und Englisch. Begeistert vom Lesen, Zeichnen und Reisen. Studium der Komparatistik führte indirekt zum Schreiben und nach Frankreich.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leonie Groihofer
Leben geben
Sie versucht, sich noch länger unter Wasser zu halten, den Druck unzähliger Kubikmeter als warme Masse auf ihrem Körper zu spüren, aber sie kennt den Auftrieb, er hat schon eingesetzt, angesetzt, er lässt sie nicht mehr los. Treibt Miriam unaufhaltsam Richtung Oberfläche. Dann ist sie wach. Kurz benommen, weil der Druck noch immer da ist, weil sie sich den Druck für einen Moment nicht erklären kann. Für einen Moment nur, dann steht sie auf, deckt den Tisch samstagmorgendlich, stellt auch die Erdbeermarmelade hin, obwohl sie ihr zu süß ist. Über der An-Taste des Radios zögert sie. Radiohören wäre Schonfrist. Schonfristen kann sie sich nicht leisten. Das Radio bleibt aus, dafür kostet sie die Erdbeermarmelade, wider besseren Wissens, in einer kindischen Hoffnung, sie würde ihr vielleicht doch schmecken, weil Markus sie so gerne isst. Eigentlich, denkt sie, müsste ich ausnutzen, dass Markus nicht da ist, und sie überlegt tatsächlich eine ganze Weile, welche Dinge es gibt, die sie tun könnte, jetzt, während Markus weg ist, ohne jedoch ernsthaft auf etwas zu kommen, bis ihr einfällt, dass Markus ja nicht einfach so weg ist, dass es einen Grund gibt, warum Markus weg ist, dass Markus ja genau darum weg ist, damit sie Dinge tun kann, die sie nicht tun kann, wenn er da ist. Nachdenken. Eine Entscheidung treffen.
Sie lässt sich Zeit, wäscht das Brotmesser mit der Hand, trocknet es sorgfältig ab. Sie hat sich vorgestellt, sie würde sich an ihren Schreibtisch setzen, oder auf die Couch im Wohnzimmer, mit einem Block auf den Knien, Pro und Contra auflisten. Sie hat sich vorgestellt, sie würde noch einmal alle Artikel lesen, alle Informationsseiten durchgehen. Sie hat sich vorgestellt, sie würde sich vorstellen, wie ihre Großmutter entschieden hätte. Oder ihre Urgroßmutter. Sie hat keine Lust.
Sie hat keine Lust, das ist ihr mit einem Mal vollkommen klar, als sie sich auf das Sofa gesetzt hat. Am liebsten würde sie Markus anrufen, er solle nach Hause kommen und sie würden sich ein gemütliches Wochenende machen. Aber das geht nicht, natürlich geht das nicht, das würde er ihr auch genau so sagen, froh sollte sie sein, dass er ihrem Wunsch nachgekommen ist, dass er sie so gut verstanden hat. Und jetzt muss ich mich selber verstehen, denkt Miriam. Sie schaut an sich herab, schaut an ihrem Körper herab, dem vertrauten, dem selbstverständlichen, dem gegenüber man mit den Jahren des Erwachsenseins eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt, bis sich das Alter bemerkbar zu machen beginnt. Aber dazu muss es nicht kommen. Nicht so schnell jedenfalls.
Ich sollte nackt sein, denkt Miriam plötzlich, zögert trotzdem einen Moment, bevor sie dann doch ein Kleidungsstück nach dem anderen abstreift, zuletzt die Socken. Sie legt sich auf den Rücken, den Kopf leicht an der Sofalehne abgestützt, sodass sie sich selbst betrachten kann. Die etwas zu langen Zehennägel. Die rasierten Unterschenkel. Die ausladenden Oberschenkel. Das zusammengestutzte Schamhaar. Den im Liegen perfekt flachen Bauch. Die unförmig zur Seite hängenden Brüste. Sie erinnert sich an eine Meditationsübung aus ihrer Yoga-Phase: Sie macht die Augen zu und wandert von oben nach unten, fängt beim Scheitel an, spürt ihre Wangenknochen unter der Haut, ihre angespannten Schultern, ihren Brustkorb, der sich hebt und senkt, das unangenehm vertraute Kreuz, die Kraft in ihren Beinen, spürt auch die Hände, leicht schwitzig, da, schon fangen sie zu kribbeln an, als würden sie sich genieren vor dieser Leibesvisitation.
Über diesen ihren Körper hat sie zu entscheiden.
Eine plötzliche Unruhe packt sie, vielleicht sollte sie Laufen gehen, sich bewegen, „den Kopf frei kriegen“, wie man so sagt. Sie will aufstehen, aber etwas lässt sie zögern. Seit gestern erfüllt sie eine seltsame Ehrfurcht, eine seltsame Scheu gegenüber ihrem Körper, als wollte sie ihn beschützen, in Watte packen, konservieren.
Morgen Abend kommt Markus nach Hause. Die kleine Digitaluhr auf dem Couchtisch, die auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur anzeigt, macht Tick. Tick. Tick. Tick. Tick. Tick. Tick. Tick.
Hast erfasst Miriam. Sie streift ihren Trainingsanzug über, schlüpft in ihre Laufschuhe, ist erleichtert, als endlich die Haustür hinter ihr ins Schloss fällt. Ihre Schritte sind schwerer als sonst, hallen in den Schläfen wider. Die Gedanken kommen von allein, aber es sind die falschen, die schon oft gedachten. Dass sie naiv waren, alle miteinander, dass sie das nicht kommen gesehen haben. Dass sie sich vielleicht eingeredet haben, sie würden die SULV hier nicht einführen, nicht rechtzeitig jedenfalls, in der abergläubischen Hoffnung, dass es gerade deswegen doch passieren würde. Wie sie am Ende alle überrascht waren, wie schnell es gegangen war. Zehn Jahre nach Einführung in den USA, wenige Monate nach dem Beschluss in Deutschland, wurde die Etablierung eines Systems zur Staatlich Unterstützten Lebensverlängerung in Österreich verkündet, bei einer schnöden Pressekonferenz, deren Livestream sie alle viel zu spät einschalteten, weil sie nicht geglaubt hatten, dass es tatsächlich passieren würde. Und dann die Unsicherheit, ob es sie noch betreffen würde oder nicht. Bei welchem Jahrgang sie die Grenze setzen würden. Und später das Gefühl, sie hätte noch ewig hin, bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag, bis zu der Entscheidung. Und zwischendrin Markus, der etwas in ihr Leben brachte, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Alles Ausreden. Sie weiß, sie hätte viel früher beginnen sollen, sich ernsthaft Gedanken zu machen. Spätestens, als die Einladungen zur Untersuchung bei ihren Freundinnen eintrudelten. Als manche ein riesiges Geheimnis daraus machten und andere über kaum etwas Anderes mehr sprechen konnten. Miriam hatte mitdiskutiert, Meinungen gehabt, Fakten aufzählen können. Trotzdem hatte es sich immer fern angefühlt. Als ob es sie nicht beträfe. Man kann das sowieso nicht rein rational entscheiden, hat Miriam gesagt. Man muss sowieso das Ergebnis der Untersuchung abwarten, hat Miriam gesagt. Im Grunde gibt es eh nur eine vernünftige Entscheidung, hat Miriam gesagt.
Sie bleibt stehen. Zu abrupt, das Keuchen atmet weiter. Sie hat sich gefreut, gestern. Als ihr der Arzt das Untersuchungsergebnis mitgeteilt hat, hat sie sich gefreut. Mit einer aufflammenden, ungekünstelten Freude hat sie sich gefreut, wie früher als Kind, wenn die Wohnzimmertür aufging und sie den erleuchteten Christbaum zum ersten Mal sah. Und auch der Arzt hat gelächelt, als fände auch er, dass es eine gute Nachricht sei, die er ihr überbracht hat. Eine gute Nachricht, die tausend Türen in Miriams Kopf aufgerissen hat, durch die seit gestern der Wind bläst, ein unaufhörlicher, einer, der undichte Fenster zum Raunen und Bäume zum Wanken bringt. Und ein Satz wirbelt jetzt wie ein weißes Blatt Papier durch diesen Wind, bis es an Miriams Frontallappen kleben bleibt wie an einer Windschutzscheibe. Ich wollte immer schon schwanger werden.
Und in diesem Augenblick weiß Miriam, dass das stimmt. Dass es stimmt, spätestens seit jenen Tagen, als sie mit Andrea oder Flora oder Isabelle spielte, nachspielte, was sie im Fernsehen gesehen oder sich von den Erwachsenen abgeschaut hatten, als sie spielten, dass sie toughe Frauen waren, die ihre unsichtbaren Männer an ausrangierten Telefonen zur Schnecke machten, spielten, dass sie Auto fuhren und einkauften und Urlaub machten und sich mit Freundinnen über Erwachsenendinge stritten. Als sie spielten, dass sie schwanger waren und Babies bekamen.
Miriam zwingt sich, weiterzulaufen. Einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Den Sturm in ihrem Kopf leise zu halten. Zu ordnen, was jetzt also klar ist. Seit heute weiß ich, dass ich schon immer schwanger werden wollte. Und seit gestern weiß ich sicher, dass ich schwanger werden kann.
Für die weitere Familienplanung sprechen der SULV-Expert:innenrat sowie der Gesundheitsminister eine ausdrückliche Empfehlung an alle Frauen bzw. Menschen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen aus, vor Beantragung der Staatlich Unterstützten Lebensverlängerung (SULV) einen kostenlosen Fertilitätstest in einer Spezialambulanz durchführen zu lassen. 90% der Frauen, die SULV beantragen, nehmen dieses Angebot in Anspruch. Bitte beachten Sie, dass der Antrag auf SULV vor der Vollendung des 25. Lebensjahres abgeschlossen sein muss und vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin in Ihrer nächstgelegenen Ambulanz.
ministerium-fuer-soziales.at
Damit bin ich noch keinen Schritt weitergekommen, denkt Miriam. Sie hat es plötzlich eilig, nach Hause zu kommen. Sich an den Computer zu setzen, noch einmal alle Empfehlungen, alle Berichte zu lesen. Obwohl das nur Zeitschinden wäre. Weil sie alles, was sie wissen muss, längst weiß. Weil sie weiß, dass alle, Markus, ihre Mutter, ihr Chef, Isabelle, ihr zur Sterilisation raten würden, wenn sie sie fragen würde. Es ist das Vernünftigste, sagt Miriam sich. Sie läuft jetzt langsamer, fühlt sich auf einmal schlapp, erschöpfter als gewöhnlich. Erreicht das Haus wie eine Rettungsboje. Nimmt den Lift hinauf in die Wohnung anstatt wie sonst die Stiegen.
FAQ
Was bedeutet „demographiesteuerndes Anreizsystem“?
Die SULV (individuelle Lebensverlängerung) stellt unsere Gesellschaft vor große Veränderungen. Ein großer Teil der Bevölkerung wird viel länger gesund leben und erwerbstätig sein können. Um einen funktionierenden Sozialstaat aufrecht zu erhalten, gibt es daher einige Anpassungen bezüglich der Anspruchsberechtigten für staatliche Leistungen. Weiterführende Informationen finden Sie unter Familienbeihilfe NEU bei SULV , SULV und Pension .
ministerium-fuer-soziales.at
Sie sollte noch einkaufen gehen, irgendetwas kochen, das Markus nicht gerne isst, Karottensuppe zum Beispiel, und danach vielleicht die Fertigmohnnudeln, denen er so erstaunlich viel Verachtung entgegen bringen kann. Markus, der sich schon entschieden hat. Bei ihm gab es nicht viel zu überlegen, hat er gemeint, seinen Wehrdienst hatte er bereits absolviert, alle Voraussetzungen erfüllt, da war es keine Frage, ob er den Antrag stellen würde oder nicht. Markus, der seit über einem Jahr einmal im Monat zur Apotheke trabt und seine SULV-Ration abholt. Der das nie vergisst, niemals nervig findet. Markus, der für die nächsten 30 oder 50 Jahre keine Falten, keine Glatze, keine grauen Haare bekommen wird, keine Altersweitsichtigkeit, der sich die nächsten 150 Jahre nicht mit altersbedingten Krankheiten wie Diabetes oder Demenz auseinandersetzen wird müssen, dessen Krebsrisiko nur langsam ansteigen wird.
Das alles kann Miriam auch haben, wenn sie will. Ihren Ausweis in der Apotheke mit merkwürdigem, aber unleugbarem Stolz vorzeigen. Sich gut fühlen, beruhigt fühlen, bestärkt fühlen, wenn sie vor dem Frühstück die zwei Pillen schluckt. 200, 300 Jahre leben, statt 80 oder 90. Reisen, Bücher lesen, Sprachen lernen, nachdenken. Ja, auch arbeiten, viel arbeiten, um genügend Vermögen für die lange Zeit als Pensionistin anzusparen, aber sie wird Sabbatjahre nehmen können, vielleicht eines alle 15, 20 Jahre. Wahnsinnig, die dazu Nein sagt. Sie sieht ein Paradies vor sich wie ein unberührtes Wochenende. Das köstliche Gefühl, Zeit zu haben. Und Markus. Wenn ich es nicht mache, dann müssten wir uns trennen, denkt Miriam auf einmal, verbietet sich den Gedanken noch im selben Moment, weiß, dass er wahr ist, lässt den Zweifel trotzdem zu, und auch den nächsten Gedanken. Beziehungen sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Sie muss sich alleine entscheiden.
Es fühlt sich seltsam an, im Supermarkt durch die Regalreihen zu gehen, sie ist unaufmerksam, nimmt die falsche Butter, die, die Markus immer leicht ranzig findet. Als sie in der Tiefkühlabteilung steht, packt sie so etwas wie Aufmüpfigkeit, sie will etwas Neues probieren, greift schon nach den Nougatknödeln, als ihr der Mut entweicht wie Luft aus einem Fahrradschlauch. Sie hat den absurden Gedanken, es wäre zu riskant, diese Nougatknödel zu essen, sie könnte davon einen anaphylaktischen Schock bekommen und keine Luft mehr bekommen und ersticken und dann wäre alles umsonst, besonders all die Gedanken, die sie sich heute schon gemacht hat. Miriam nimmt doch die gewohnten Mohnnudeln, nicht ohne ein Gefühl von Niederlage. Sie kennt sich. Sie ist noch nie aufmüpfig gewesen. Sie wird keine von denen sein, die die SULV in Anspruch nehmen und trotzdem ein Kind zur Welt bringen. So, wie es noch immer ein paar Frauen machen. Trotz all der Warnungen von Ärzten, das während Schwangerschaft und Stillzeit notwendige Aussetzen der Medikation könnte die lebensverlängernde Wirkung der Therapie erheblich beinträchtigen. Trotz der finanziellen Nachteile, des erloschenen Anspruchs auf Familienbeihilfe für Mütter mit SULV. Trotz der in jeder Zeitungskolumne vertretenen Meinung, es sei moralisch falsch, beides zu wollen: ein Kind und 200 zusätzliche Lebensjahre.
FAQ
Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen der SULV und einer etwaigen Familienplanung?
Die lebensverlängernde Therapie muss für die Dauer der Schwangerschaft und Stillzeit ausgesetzt werden. Schwangerschaft und Geburt stellen eine weitreichende körperliche Belastung dar, die nach Ansicht von Expert:innen1 die Wirkung der SULV dauerhaft beeinträchtigen könnte. Frauen mit SULV wird dringend dazu geraten, sich vorbeugend einer Sterilisation zu unterziehen.
ministerium-fuer-soziales.at
An der Kassa hat sie das Gefühl, dass noch irgendetwas fehlt in ihrem Einkaufswagen. Irgendetwas Tröstliches. Sie will schon zu den Schokoriegeln für Spätentschlossene greifen, aber etwas hält sie zurück. Marietta. Mariettas insistierende Stimme, die ihr Vorträge hält über Kakaobauernfamilien, die sich zugrunde schuften, über Palmölplantagen, für die der Regenwald dran glauben muss. Marietta, für die Miriam eine scheue Bewunderung empfindet, eine mit schlechtem Gewissen durchsetzte, eine Zuneigung, die sich immer mehr vollzusaugen scheint mit schlechtem Gewissen. Sie denkt daran, wie sie mehr und mehr Zeit verstreichen lässt, bevor sie auf Mariettas Nachrichten antwortet. Wie sie sich am liebsten Ausreden einfallen lassen würde, wenn Marietta vorschlägt, einen Kaffee trinken oder gemeinsam zu diesem Konzert oder jenem Vortrag zu gehen, und dann doch mitkommt. Wie sie ihr aufgefallen sind, die zarten Fältchen um Mariettas blassblaue Augen. Wie sie Mariettas Stimme jetzt deutlich hört, mit nordwestdeutschem Einschlag, diese Stimme, die sich sicher ist, dass Miriam ihr zustimmen wird, wenn sie sagt, dass es ungerecht sei, dass gesunde Menschen in Österreich lebensverlängernde Medikamente bekommen, während anderswo die Lebenserwartung bei gut 50 Jahren liegt. Und natürlich stimmt Miriam ihr zu, auch jetzt, wo Marietta gar nicht da ist, sondern vielleicht gerade in Portugal oder den Niederlanden oder zuhause in ihrer WG, natürlich ist es ungerecht. Aber, denkt Miriam, es ist nun einmal so. Und meine Entscheidung dafür oder dagegen ändert nichts an der Situation einer Somalierin oder Nigerianerin. Und je länger ich arbeiten kann, desto mehr kann ich spenden, denkt Miriam, denkt es wie einen Satz, der nicht von ihr selbst stammt, wie etwas, das man eben so sagt, das man eben so gehört hat, das sich eben so gehört. An den sich die üblichen Sätze anschließen, die Miriam in Diskussionen mit Freundinnen selbst schon oft gesagt, oft gehört hat. Dass es Ausgleichsmaßnahmen gebe. Dass sie der SULV die migrationsfreundlichste Politik verdanken, die in der EU je geführt wurde. Dass das doch nicht nichts sei.
Sie erschrickt. Also hat sie sich schon entschieden? Der Augenblick fällt ihr ein, der kurze, gestern, als der Arzt schon zum Lächeln angesetzt hat, bevor er ihr den ausgedruckten Befund in die Hand gedrückt hat. Der kurze Augenblick, in dem sie gehofft hat, er würde ihr etwas Anderes sagen. Es würde das passieren, was sie sich in manchen Nächten kurz vor dem Einschlafen ausgemalt hat, nur dann, kurz vor dem Einschlafen, um sich vormachen zu können, sie hätte es gar nicht gedacht, nur geträumt, gehört, gelesen. Dass sie der Arzt nach der Untersuchung anschauen würde, mit diesem prüfenden Blick, den man aus Filmen oder Fernsehserien kennt, und dann sagen würde: „Aber Frau Pichler, Sie sind doch schon schwanger!“ Doch der Augenblick ist verstrichen, der Arzt hat ihr den Zettel in die Hand gedrückt, ihr diese und jene Zahl darauf erklärt und am Ende die Worte ausgesprochen: „Es spricht nichts dagegen, dass Sie ein Kind austragen können.“
Es spricht etwas dagegen, dass sie ein Kind austrägt.
Sie trägt ihre Einkaufstaschen nach Hause. Es fühlt sich an, als hätte sie zu schleppen. Sie braucht eine Pause.
Liebe am See, irgendeine alte Folge. Sie merkt zu spät, dass es die ist, in der Saskia Robert endlich sagt, dass sie schwanger ist, nachdem es die Zuschauer schon geschlagene drei Folgen gewusst haben, ja sogar schon vor Saskia geahnt hatten, wegen der Schwindelanfälle, die sie seit Folge 2643 geplagt hatten.
Was hat sie denn vor in diesen 200 Extra-Jahren? Was wäre denn anders als jetzt?
100 Jahre „Liebe am See“ schauen.
Sie drückt auf Stopp. Legt ihre Hände über beide Augen.
Erlaubt sich, aus der untersten Lade im Küchenkasten die Tafel Schokolade hervorzuholen, zwei Stück abzubrechen, in den Mund zu schieben.
Natürlich könnte sie etwas anfangen mit diesem Leben. Mit dieser ganzen Zeit. Allein schon das Gefühl, Zeit zu haben. Sie könnte doch noch ihren Doktor machen. Markus verlassen. Andere Männer lieben. Markus zurückerobern. Sich mehr Fehler erlauben, vielleicht.
Dann ist das Leben vorbei, sagt Markus manchmal, wenn sie übers Kinderkriegen reden, und Miriam weiß, er meint die Jugend. Das Nur-für-sich-selbst-da-sein-Müssen. Das Sich-jederzeit-neu-entscheiden-Können. Das Noch-immer-nicht-hundert-Prozent-erwachsen-sein-Müssen.
Miriam streckt sich, spürt ihre vom Sitzen steifen Glieder. Fühlt sich plötzlich wahnsinnig alt in diesem ihrem, immer schon ihrem Körper. Wundert sich, dass er seit 24 Jahren ohne Pause funktioniert. Seltsam, dass unsere Herzen nicht öfter zu schlagen aufhören.
Ich bin jung, ich bin jung, ich bin jung.
Jung, das waren sie, als sie einer dem anderen nackt gegenüber standen. Ein Risiko eingingen. Sagten „Ich will dich“ ohne sicher sein zu können, dass der andere „Ich dich auch“ antworten würde. Jung. Zerbrechlich. Verletzlich. Hungrig, wach, neugierig. Rührend, zum Weinen rührend schön. Wann ist man jünger, als wenn man ein Kind bekommt?
Irgendwann wird Markus sich auch ein Kind wünschen, denkt Miriam. Und dann wird er sich eine Frau suchen, die noch kann.
Beziehungen sind nicht für die Ewigkeit gemacht, Miriam.
Sie zwingt sich, das Andere zu sehen. Das zweite Studium, das sie sich in ein paar Jahren leisten könnte. Zeitlich und finanziell, muss sie hinzufügen. Vielleicht doch noch in die Forschung gehen, vielleicht doch noch ins Ausland, vielleicht noch einmal ein Jahr nichts machen. Das köstliche Gefühl, Zeit zu haben. Zu lernen. Immer mehr von dieser immer noch so unbegreifbaren Welt verstehen können. Den Dingen auf den Grund gehen können.
Nicht können. Niemals können. Unergründlicher Grund. 200 Jahre Serien schauen. Habe ich denn Träume?
Ja, Miriam.
Sie sieht das Kind nicht, sie spürt es. Zeugen, heranwachsen fühlen, gebären. Küssen. Lieben. Das Leben dafür geben.
Das ganz normale Opfer, das jede bringen muss.
Und dann denkt sie kurz, sie müsse verrückt geworden sein, weil sie da auf einmal etwas spürt, in ihrem Bauch, ganz weit unten, und erst als es hochzusteigen beginnt, hinauf in die Magengegend, weiß sie, es ist nur die Wut.
Es ist immer besser, die Wahl zu haben, hat Isabelle gesagt, als sie Miriam erzählt hat, dass bei der Untersuchung herausgekommen war, dass es bei ihr ohnehin schwierig wäre. Ein zurechtgelegter Satz, den man mit gut geölter Stimme ausspricht, der so dick in Vaseline eingecremt ist, dass unmöglich festzustellen ist, ob man ihn ernst meint oder nur nachplappert, einer, der er von selber herausflutscht, weil ihn jede sagen könnte, ein Satz, der eigentlich schon gesagt ist.
Es ist immer besser, die Wahl zu haben, es ist besser, die Wahl zu haben als nicht, es ist besser, die Wahl.
In England zum Beispiel, da ist Sterilisation Pflicht, für Männer und für Frauen, die Lebensverlängerung in Anspruch nehmen wollen. Hier in Österreich könnte Miriam vielleicht beides haben, ein Kind und, wenn nicht 300, vielleicht 250 Jahre leben, aber eben nur vielleicht, eben nur so, dass einem nie jemand etwas darüber erzählt oder sich bei jeder Gelegenheit in schwammige Umwege flüchtet, eben nur so, dass man niemandem etwas darüber erzählen darf. Dann besser ehrlich sein, so ehrlich wie Marietta, wissen, was das Richtige ist und gerade deswegen das Richtige tun. Darwin konnte dem Leben keinen Sinn geben, hat Marietta gesagt, wohl aber dem Tod. Platz machen für das, was nach uns kommt.
Marietta wird Platz machen, wird viel früher Platz machen als Andrea oder Isabelle, als Markus. Und sie, Miriam, wird zusehen. Wird vielleicht noch leben, wenn Marietta schon 100 Jahre tot ist. Wird sich unmöglich noch wirklich, noch ehrlich an sie erinnern können. Oder?
Ich bin zu feig, denkt Miriam. Nicht mutig genug, um so zu sein wie Marietta. Und noch etwas denkt sie, ganz leise, sodass sie so tun kann, als hätte sie es überhört: Für Marietta reicht ein Leben.
Für Miriam nicht?
Im Zimmer ist es dämmrig geworden. Wenn Markus sich noch nicht entschieden hätte. Wenn sie gemeinsam entscheiden würden. Der Geruch von Markus‘ T-Shirt, wenn sie ihre Nase an seiner Schulter verbirgt. Markus‘ Kopf in ihrem Schoß, Küsse auf seine Schläfe, seine Augen, seinen Mund. Markus‘ Hände, Markus‘ Zeigefinger, von den Augen bis zur Nasenspitze. Markus umarmen. Markus‘ Arme.
Wie oft wird es noch einen Markus für sie geben?
Bringt nicht auch Markus ein Opfer, so oder so?
Miriam hat es nie zugegeben, aber sie hat die laute Kritik der Feminist*innen an der SULV-Regelung nicht ganz verstanden. Hat die Argumente der Politik einleuchtend gefunden. Die offenkundige Notwendigkeit demographischer Steuerung. Die medizinischen Nachteile für Mütter. Die Gefahr, am Ende gar keine zeugungsfähigen Männer mehr zu haben, wenn sie sich wie in England auch sterilisieren lassen müssten.
Jetzt glaubt sie zu verstehen.
19-Jährige ohne Gebärmutter, die sich nach ein paar Bier für die SULV anmelden und es nie bereuen werden.
Sie, mit Gebärmutter, die eine Funktion ihres Körpers abschalten lassen soll.
Und Markus. Aber Markus. Markus, den sie trotzdem und unabhängig davon und mit voller Berechtigung liebt, den sie jetzt liebt, in der Gegenwart, dem einzigen, was real ist. Morgen ist schon Schimäre. Ein Kind ist schon Schimäre.
Draußen ist es fast Nacht. Sie hat Hunger. Sie hat noch gar nichts gekocht.
Der Schlüssel dreht sich im Schloss.
Da bist du, sagt Markus. Ich hab‘ mir gedacht, ich steh‘ dir bei.
Sie kann es ihm nicht verübeln.
Er ist zu früh.
Er weiß schon, was er tut.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Senka
Die klirrenden Münzen eines monísto
Sandyr wühlt in Kumkas Deutsche Mark Sammlung und grinst. Ja, das ist genau das, was sie gesucht hat.
Brauchst du sie wirklich nicht mehr?
Kumka zuckt mit den Schultern. Er hat die Münzen aufgelesen, als er klein war, weil er kein Taschengeld bekommen hat, aber eigenes Geld für Gummischlümpfe im Lotto-Laden haben wollte.
Sandyr will die Münzen noch bearbeiten, die Gesichter der Frauen aus ihrem Stammbaum draufkleben und sie in ein monisto flechten. Das wird sie dann anai-anae nennen, als ein Stück für ihre Ausstellung. Da wird es noch geflochtene Panneaus geben, wird ganz hübsch sein. Sie stapelt die Münzen nach Größe. Anai-anae bedeute die Mütter der Mütter, hat sie vor Kurzem gelernt, das sei nämlich ihre Sprache, das Udmurtische, nur ihre Familie hätte das nicht sprechen dürfen. Aber wem erzähle sie das, der Kumka, der kenne das doch sicherlich auch! Sie lacht und wirft das rot gefärbte Haar über die Schulter. Kumka macht: Hm-m. Aber eigentlich kennt er das nicht. Seine Eltern sprechen Russisch, sein Opa auch, er wüsste nicht, ob sie jemals eine andere Sprache hätten sprechen wollen.
Kumkas Mama freut sich besonders, wenn Sandyr zu Besuch kommt. Sie zwinkert ihnen zu, sie sorgt dafür, dass Kumkas Eltern während Sandyrs Besuch nicht in der Wohnung sind. Sandyr hat eine Lebensgefährtin, aber das wissen weder ihre, noch Kumkas Eltern. Kumka weiß das, weil er ihr auf Instagram folgt.
Vor Kurzem hat sie dort ihren Namen von der russifizierten Fassung Aleksandra zu Sandyr geändert, außerdem in der Beschreibung alles gelöscht und „udmurtisch-feministische Liturgie im deutschen Exil“ hingeschrieben.
Kumka fragt, ob sich dadurch was verändert habe. Sandyr rümpft die Nase. Es gab danach einen Shitstorm in so einer Bubble von Leuten, von so scheiß Physiognomikern, die meinen, man müsse am Aussehen einer Person die Herkunft ablesen können, sonst sei diese nicht valide, aber mit solchen Idiotinnen will sie auch nichts zu tun haben. Und sie bekommt mehr Follower-Anfragen von russischsprachigen feministischen Profilen und russisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland, aber sie sei sich da nicht sicher und nimmt nur die Anfrage von Leuten an, die Kunst machen. Hat Kumka gewusst, dass so viele russisch-orthodoxe Kirchen in Deutschland Instagram haben?
***
Sanja hänge andauernd am Handy, ein Wunder, dass sie überhaupt ihre Klausuren bestehe.
Die Mutter skypt mit ihren Freundinnen und sie eröffnen die Runde rituell mit Geschichten von ihren Kindern. Wer zum wie vielten Mal gebärt, wer sich geschieden, wer sich eine Anstellung bei der Gazprom geschnappt hat.
Sandyr macht sich nicht die Mühe, ihrer Mutter zu erklären, dass auf diesem Handy auch die Lektüretexte abgespeichert sind. Sie überfliegt Butler, Kristeva und Žižek, macht sich nebenher Notizen, wie sie alle später im Seminar verreißen wird, und behält die Benachrichtigungen im Auge, ob bei Kommentarverläufen der Eventposts von out-ural Trolle auftauchen, wen sie blockieren, wen sie mit einem präzise gewählten Mat zurechtweisen, wen sie konvertieren könnte.
Konvertieren, Lajma seufzt, Sandyr soll es endlich mal lassen, das so zu bezeichnen. Außerdem spiele sie doch damit voll in dieses Narrativ rein, auf das sich das Propaganda-Gesetz stützt, mit der sozialen Übertragbarkeit… Und sie seien doch keine Sekte.
Manchmal spricht Lajma so, als sei sie Teil von Sandyrs Aktionsgruppen. Manchmal tut sie auf gebürtige Deutsche und will Sachen erzählt bekommen, wie es da so ist, woran sich Sandyr erinnere. Und Sandyr erinnert sich nur an die Sprache, die sie erst nach dem Umzug nach Deutschland gelernt hatte. Alle Erinnerungen, die sie hat, sind Erinnerungen an Urlaube in Russland, im Sommer, wenn die Stadt leer ist, weil alle sich vor dem Stadtsmog in ihre Datschas zurückgezogen haben. Um im Winter hinzufahren, dafür hatten sie keine passende Kleidung.
Ja-ja, winkt Sandyr ab. Gegen den Mat hätte Lajma aber nichts einzuwenden, oder wie?
Gegen den Mat hat Lajma auch was, aber Sandyr verwendet ihn mit Fingerspitzengefühl, da vertraut ihr Lajma schon. Sandyr weiß, dass das keine Worte sind, die man schreit oder inflationär verwendet. Eine knappe präzise Setzung bewirkt mehr. Wie bemitleidenswert verhält es sich im Gegenzug bei den Deutschen oder auch bei den Engländern – wo sie zwanzig Mal „Fuck!“ brüllen müssen, braucht Sandyr nur einen einzigen besonnen ausgesprochenen Begriff und damit ist alles gesagt. Lajma beschreibt Sandyrs Art oft als besonnen. Das lässt Sandyr manchmal daran zweifeln, ob Lajma wirklich hört, was aus Sandyrs Mund kommt.
Du musst halt echt allen in diesem Land andauernd beweisen, dass du kein Kamel bist! schreit Sandyrs Mutter ins Laptop-Mikrophon, damit es bis Russland hörbar ist.
Lajma prustet los. Sie bekommt durch die Kopfhörer nur Fetzen mit, die sie allesamt sehr amüsieren, sie zieht sich den Stöpsel aus einem Ohr: Was soll das denn bedeuten?
Das mit dem Kamel? - Ja.
Kennst du das nicht? Sagt man halt so. - Wo sagt man das?
Na, bei uns. - In Russland? Oder in eurer Familie? Oder auf Udmurtisch?
Sandyr zuckt die Schultern, das weiß sie nicht, aber man sagt es halt so.
Seitdem sagt Lajma, wenn es Sandyr von innen schüttelt und sie niemanden um sich haben will und alle hasst: Du bist kein Kamel. Und Sandyr stimmt zu: Ich bin kein Kamel.
Wenn die russischsprachigen Bekannten in der Uni ihr inadäquates Verhalten vorwerfen, weil sie den Dozenten darauf hingewiesen hat, dass Belarus und Russland zwei unterschiedliche Länder sind, und sein Nachfragen nach ihrer persönlichen Meinung zu Lukaschenko nichts in einem Literaturseminar verloren hätte, sie außerdem nicht qualifiziert sei, irgendwelche Auskunft zu Belarus zu geben, weil sie keinerlei Berührungspunkte mit dem Land hätte. Ich bin kein Kamel.
Wenn ihre Mutter ihr sagt, sie solle die eigenen Nerven schonen und ein gesundes Maß an Ignoranz an den Tag legen und die Nachrichten Propaganda sein lassen.
Today’s affirmation: Ich bin kein Kamel.
***
Wenn Sandyr den Ellbogen versehentlich auf den Tellerrand abstellt, noch während sie merkt, dass es das spitze Gewusel von Perlen an ihrer Haut ist und nicht das glatte Tischholz, und den Ellbogen schnell hochreißt, klappt der Teller bereits um und die Glasperlen platzen unsichtbar über die Küchenfliesen, in die Schatten, die die Tischlampe nicht ausleuchtet. Sie lauscht, ob der Lärm ihre Mutter aufgeweckt hat, aber diese schnaubt leise weiter vor sich hin. Als sich Sandyr auf allen vieren auf den Boden niederlässt, bohren sich die Perlen in ihre Knie, Zehen und Handflächen. Sie verzieht das Gesicht und schüttelt sie sich von den Händen.
Sie stellt sich vor, wie die Perlen zwischen den Fliesen Wurzeln schlagen, sprießen, Blumen tragen und zu Perlensträuchern emporwachsen. Die Perlen reifen in Hülsen heran, wie die dünnen Akazienhülsen, aus denen Sandyr mit ihrem Vater Pfeifen gebastelt hatte. Er pustete rein und es kam ein Ton heraus, Sanja pustete und die Hülse blieb stumm. Sie pustete und pustete, spuckte wütend in die Hülse. Da zeigte ihr Vater auf das Wiesen-Rispengras: Schau mal, Hahn oder Henne? Sanja ließ die Hülse fallen, maß die Rispen mit dem Auge ab: Henne. Ihr Vater zog die Rispen mit Daumen und Zeigefinger am Stiel entlang hoch. Eine lange Rispe schaute aus den restlichen hervor. Na, doch ein Hahn, hm? Sanja schüttelte den Kopf: Nochmal!
***
Sandyr lehnt am Fensterbrett und hält die Tasche und den Mantel ihrer Mutter. Diese schimpft und es hallt bis zur Toilettendecke hoch. Der Termin für den Antrag für die Große Witwenrente, nach dem Absetzen der Kleinen Witwenrente, zieht sich bereits seit zwei Stunden. Sandyr versteht nicht, warum ihre Mutter darauf bestand, dass sie zum Übersetzen mitkam, denn diese versteht alles einwandfrei und schafft es, gleichzeitig auf ihre Tochter und die Sachbearbeiterin einzureden. So schnell kann nicht mal Sandyr zwischen den Sprachen switchen.
Es rieselt in die Kloschüssel. Weißt du, bei uns, da stellt man sich mental auf Schikane ein, ja? Und hier tuen sie auf zivilisiert, machen Sicherheitskontrollen, geben dir so ein Nummernzettelchen und was dann?
Hm-m, macht Sandyr mechanisch.
Und dann sitzt da diese Tussi und wühlt sich durch die Papierstapel und kann nicht mal Kopfrechen! Sandyrs Mutter wäscht sich die Hände ab. Weißt du, bei uns, da weiß ich halt, ich bringe einen Cognac mit und ich erniedrige mich ein wenig, aber dann wird da auch was gemacht!
Sandyr reicht ihrer Mutter die Sachen zurück. Das ist klassistisch, Mama, und du romantisierst Korruption.
Die Mutter gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Wer hat dich bloß erzogen, dass du so aufgeklärt bist, hm?
Sandyr zieht ihr Smartphone hervor, trottet der Mutter hinterher und klickt sich durch die Nachrichten. Neuigkeiten vom Justizministerium Russlands, weitere Eintragungen von queeren und feministischen Initiativen als Ausländische Agenten, Auszüge aus Gesetzesentwürfen gegen Agitation…
Sie öffnet die Kalenderübersicht und starrt auf den roten Eintrag, geht die Check-Liste durch, die sie sich dafür notiert hat. Ja, sie hat definitiv alle Papiere vorbereitet. Sie hat darin einzigartige Expertise, mit acht Jahren ist sie bereits Behörden-Briefe mit den Eltern durchgegangen und war stolz darauf gewesen, wenn sie den Eltern ein „Nein, das muss so!“ sagen konnte. Der Antrag auf das Auslandssemester in Perm sei ohnehin rein formal. Es will ja sonst keiner hin.
***
Lies mir aus den Krym’schen Legenden vor.
Oh, nein, Kind, nicht schon wieder! Hast du danach keine Alpträume?
Nein. Ich will das Märchen über Oksana!
Und das Märchen über das Rübchen? Wollen wir nicht gemeinsam alle Tiere herbeirufen, damit sie zusammen die Rübe herausziehen?
Nein! Ich will das Märchen über Oksana!
Na, wenn schon, dann vielleicht das Märchen von den Schwestern? Wo der einen Schwester der schöne lange Zopf von einer Hexe abgeschnitten wird und sie stirbt, und dann muss die andere Schwester sich den Zopf von der Hexe holen?
Nein! Das Märchen von Oksana!
Und das Zauberwort?
Nein!
Das ist nicht das Zauberwort.
Bitte. Danke. Nein! Sanja plustert sich auf.
Die Mutter seufzt.
Oksana, Oksanochka, so eine schöne Frau, so stark, niemand konnte sagen, er hätte jemals eine Träne in ihrem Auge gesehen. Die schwarzbärtigen Kazaken scheuten sich, sie anzusprechen. Nicht, dass sie sich fürchteten, aber vorsichtig waren sie.
Am heißen Tag ist Stille in der Siedlung. Jeder versteckt sich von der Hitze, und die Oksana trägt das Tragjoch mit den Leinwänden zum Fluss zum Bleichen. Gej-gej, Oksana, Oksanochka…
Gej-gej, Oksana! ruft Sanja.
… Wenn du gewusst, wenn du geahnt hättest, wärst du nicht mit den Leinwänden zum Fluss hinunter gegangen. Du wärst nicht weggegangen, wenn du gewusst hättest, dass von der weiten Steppe Unheil naht.
***
Ein Panneau flechten bedeutet, die Muster der Welt wahrzunehmen, abseits der Muster, die uns von dem ӟуч beigebracht werden. Es bedeutet, zu heilen. Die Hände arbeiten, der Geist arbeitet, langsam mit dem Atem, die Fäden in den Fingerknöcheln eingekeilt. Befeuchte den Wollgarn mit der Spucke, drehe ihn schmal, ordne ihn in das Gewebe ein, kämme die Knoten aus. Du wirst starke Finger haben, starke Handmuskeln. Sanja prustet los und schaltet sich stumm. Starke Finger, ja-ja…
Und behalte unbedingt das Werkzeug deines Vaters, wnuchka, die Birkenrinde und das Brenneisen und das Messerchen. Wer weiß, vielleicht holst du es hervor und merkst, die Rinde, die schmeichelt deiner Haut und du willst sie formen. Dann schnitzt du ein tujesok nach dem anderen und sagst den Deutschen, das sei traditionell, vegan und nachhaltig, aus aufgeforsteten sibirischen Wäldern. Die Oma, die hat ein gutes Auge fürs Marketing, das kommt gut, wenn du die Preise hoch setzt.
Das ist kultureller Exhibitionismus, Oma.
Was sagst du? Du verwendest so schlaue Worte, mein Kind, ich bin so stolz auf dich. Zeigen sie in den Nachrichten bei euch die Brände? Das sind nicht die Gewitter - wann hat es zuletzt Gewitter gegeben? Das sind nicht die Torfbrände wegen der trockenen Erde, nein. Das sind Menschen, die das Gras anzünden, weil sie es immer so gemacht haben, um es schnell auszuroden. Weißt du, das Gras, das könnte man ja auch abmähen. Da sollte es Strafen geben, heutzutage, auf oberster Ebene sollen sie da was erlassen, dass das auch ankommt, bei den Menschen. Dieser Dunst über Moskau vor ein paar Jahren, das hat der Kreml davon, wenn sie Sibirien brennen, wenn sie die eigenen russländischen Menschen das eigene Land anzünden lassen. Wir sind ja schon weit weg hier, was die da oben mit Europa und den USA machen, falls das mal gefährlicher wird, wir sind hier sicher. Wir fürchten Gayropa nicht, wir räuchern uns schon selbstständig aus.
Oma, was sagst du da, das macht keinen Sinn, nimmst du deine Medikamente ein?
Du fragst mich immer nach den Medikamenten, wenn ich dir etwas Wichtiges sagen will.
Ja, aber nimmst du die?
Sanechka, mir gefällt dieser bevormundende Ton nicht. Ich werde jetzt auflegen.
Warte, warte, ich werde bald ganz in der Nähe sein, in Perm.
Was willst du hier?
Naja, arbeiten. Nützlich sein.
Also, ich weiß nicht, meine Liebe, du machst doch was mit Literatur, oder? Das braucht doch hier niemand.
Ich wollte mehr sowas in Richtung Menschenrechte und Feminismus machen.
Ja, aber das braucht doch in Perm erst recht keiner. Sind doch nur Kriminelle dort, gab’s neulich wieder mal eine Statistik, da haben sie das auch dokumentiert, ja.
Sandyr lacht verunsichert auf. Brauchst du mich denn?
Versteh mich nicht falsch, mein Kind, aber ich musste mich daran gewöhnen, euch nicht zu brauchen.
***
Sandyr wartet, bis Lajma eingeschlafen ist, schiebt sie vorsichtig von sich, dreht sich auf den Bauch und legt die Nase an den Bettrand. Sie hat sich in der Kindheit angewöhnt so einzuschlafen. Damals trug sie einen langen Zopf und damit die Hexe ihr das Haar nicht abschneiden konnte, hatte sie es sich unter den Bauch geklemmt. Sie hatte ja keine Schwester, wer hätte ihren Zopf zurückbringen können? Und hätte die Hexe versucht, ihr den Zopf unter dem Bauch hervorzuziehen, da wäre Sandyr schon aufgewacht und hätte sich gewährt.
Am Anfang hat Lajma gefragt: Tut dir der Hals nicht weh, wenn du so schläfst? Sandyr hat versucht zu erklären, mit der Hexe und dem Zopf und der Schwester, und Lajma hat den Kopf zur Seite geneigt: Aw, du warst so ein phantasievolles Kind.
Lajma mag es, Sandyr Eigenschaften zuzuschreiben, bei jeder Zuschreibung runzelt Sandyr die Stirn. Sie fühlt sich nicht besonnen, sie war nie phantasievoll, sie ist nicht mutig. Sie wendet den Kopf zu Lajma und stupst mit dem Zeigefinger in Lajmas Bauchnabel. Sie hat eigentlich keine Ahnung, aber Lajma hat das noch nicht durchschaut. Sie nimmt sich jede Nacht vor, Lajma am Morgen zu fragen: Willst du mich in Perm besuchen?
***
Sandyr schaltet sich stumm, winkt in die Kamera und ergänzt ihre Pronomen im Namen für den Zoom-Calls. Die meisten haben ihre Kameras ausgeschaltet. Sie hat vorab ein Handout an die Organisierenden geschickt, mit Beratungsstellen in Deutschland für russischsprachige, queere Menschen, Migrationsmöglichkeiten und die ersten Schritte, um sie einzuleiten. Es wurden fünf Personen eingeladen, die auf Social Media in Support-Gruppen aktiv sind. Jede soll einen Impulsvortrag halten, was an Deutschland besonders toll sei. Sandyr hatte vorab nachgefragt, ob es denn nicht sinnvoller wäre, aufzulisten, was ihr nicht gefalle, um auf Herausforderungen vorzubereiten, aber das hätte nicht ins Konzept gepasst. Der Umzug ins Ausland sei schon anstrengend genug, die Desillusionierung käme auch so, an diesem Punkt gehe es vor allem darum, Mut zu machen und Kraft zu geben. Sandyr soll als letzte sprechen.
Die Deutschen seien höflich und grüßten immer, das Justizsystem sei gerecht und die Medizinausstattung auf höchstem Niveau, die Polizei behandle einen wie einen Menschen, die Krankenversicherung erstatte alles, der Sozialstaat sorge für jeden, die Politik sei feministisch, klar, weil ja Bundeskanzlerin, die Medien berichteten unparteiisch, Lesben und Schwule dürften heiraten, Kinder kriegen, trans und nicht-binäre Menschen eine Personenstandsänderung machen…
Sandyr hält die Luft an. Sie möchte fragen: Kennt ihr Deutsche, so privat? Allesamt ewig freundliche Übermenschen, die immer hilfsbereit sind, ja? Wart ihr denn nie ernsthaft krank, habt ihr nie nächtelang in der Notaufnahme warten müssen, mit Verdacht auf Schlaganfall bei der Mutter, und dann eine völlig übermüdete Ärztin angeschrien, die auch nichts dafür konnte? Habt ihr schon mal versucht, eine Anzeige gegen fremdenfeindliche Gewalt zu erstatten, und euch angehört, wie der Polizeibeamte immer neue Rechtfertigungen für den Angreifer fand, Verständnis wecken wollte, das sei ja ganz anders gemeint gewesen? Habt ihr nie einer gerichtlichen Auseinandersetzung beigewohnt, Sachbearbeitung von mehreren Jahren, Richter, die irritiert sind, von kulturellen Unterschieden? Habt ihr schon mal jemanden hier verloren und beerdigt?
Sie atmet aus, da ist es wieder: Sie unterstellt, sie wirft anderen vor, etwas nicht erlebt zu haben, als mache sie das zu etwas Besserem, als hätte sie dadurch eine klareren Blick. Sie ist die falsche Person, um bei solchen Runden Erfahrungen zu teilen, oder vielleicht auch: Sie hat die falschen Erfahrungen in einem richtigen System gemacht. Sie muss ein Einzelfall sein, denn wenn sie der Lajma Sachen erzählt, dann erwidert sie: Also, das glaube ich jetzt nicht! Und wenn sie Lajma sagt, das klinge für sie so, als meinte Lajma, dass Sandyr lügt, sagt Lajma: Das verstehst du nicht, das sagt man so in Deutschland, das heißt doch nicht, das ich dir wirklich nicht glaube. Und die Oma, die sagt: Jetzt bist du aber undankbar! Was glaubst, wie es den Kindern auf dem Nordpol geht. Und allen, allen geht es gut in Deutschland und nur Sandyr rutscht durch die Paragraphen, durch die Regelungen, durch die Konzepte.
Sie schaltet ihr Mikro an, zieht die Mundwinkel auseinander und streckt die Nase hoch, damit die Tränen nicht aus den Unterlidern schwappen: Es wurde ja alles schon gesagt, ich würde einfach nur Sachen wiederholen. Wollen wir direkt mit der Fragerunde starten?
***
Sandyr schaut vom Lektüretext hoch. Der Zug ist auf einer Brücke über dem Rhein angehalten. An den Stangen türmen sich bunte Schlössertrauben mit aufgedruckten Initialen. Sandyr fragt sich, ob bei der Konstruktion von Brücken das Gewicht von solchen Liebesbekundungen mitberechnet wird und ob sie einstürzen könnten, wenn zu viele Schlösser angebracht sein würden. Sie stellt sich vor, wie unter ihr die Brücke knarzt, wie der Zug langsam anfängt, in sich zusammenzufallen, und sie für einen kurzen Moment schwerelos wird, ehe der Waggon auf dem Wasser aufschlägt. Sandyr drückt die Wange an das kalte Glas und überlegt, welche Schlagzeilen es gäbe, zu viel Liebe bräche Brücken ein, ein älterer Herr, der sich über den Vandalismus beschwert, den die jungen Leute mit den Schlössern betreiben, vage Stellungnahme der Eisenbahngesellschaft… Sie entsperrt mechanisch das Smartphone und scrollt durch die News Broadcasts, ohne mit dem Blick an den Überschriften hängen zu bleiben. Sie öffnet eine Datei für eine neue Liste. Was zu tun wäre, sobald der Antrag für Perm genehmigt ist. Der Cursor blinkt. Sandyr schaut wieder auf die Schlösser draußen. Die Genehmigung würde erstmal nur eine Reihe weitere Aufgaben zum Abarbeiten bedeuten, das war’s. Sie checkt die Mails, den Telefonverlauf, falls sie zufällig die Benachrichtigung über einen verpassten Sprachanruf weggedrückt hat, wechselt zur leeren Datei zurück.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Knaß
Uns Gespenster (Ein Spiegelspiel)
(1)
Vielleicht hatte es etwas mit dem Wasser zu tun und dass ich nach Sternen tauchen wollte, im Fischteich. Sie war am Ufer gesessen, und hatte andere Wörter geformt. Ich dachte, wenn ich das wirklich will, dann hat der Laich Zacken. Meine Beine voller Schlamm, im Hintergrund der Wald und der Berghof. Und zwischen den Grashalmen hat etwas geraschelt. Hörst du es, hat sie geflüstert und mich erwartungsvoll angesehen.
Das Rascheln war kein Geräusch der Wiese, es kam aus einem anderen Leben, wurde immer lauter, bis es uns die Welt abschnitt, wir rannten vor ihm davon, dann, ich verlor Wassertropfen, sie einige Wörter, es hat beides verschlungen, ich weiß das, ohne dass ich hingesehen hätte.
In mein Tagebuch schrieb ich am Abend, das hätte nicht passieren dürfen. Was sie schrieb, weiß ich nicht, aber ich stelle mir vor, das hätte nicht passieren dürfen. Ich stelle mir vor, sie schrieb es mit meinen Tropfen so wie ich ihre Wörter verwendete. Danach haben wir nicht mehr darüber geredet. Ich habe einige Sterne gemalt und daruntergeschrieben: Froschlaich mit Zacken.
(2)
Vielleicht hatte es etwas mit Herkunft zu tun und dass sie nach Meeresrauschen im Wald Ausschau hielt. Sie hatte einen Stift und meinte, sie könne die Bäume damit umschreiben. Sie dachte, wenn sie das wirklich will, dann würde Sand aus den Ästen rieseln. Wir gingen durch eine Wüste zurück zum Hof und verwischten unsere Spuren selbst
An dem Abend hat niemand von uns etwas geschrieben, aber das Geräusch war zurückgekommen. Ich flüsterte, hörst du es, und sie nickte und verlor ihren Kopf dabei. Da wusste ich, dass ich nicht mehr davonlaufen konnte, vor ihm. Also stand ich auf und hielt meinen Kopf fest, während ich auf das Fenster zuging.
Aber als ich den Vorhang beiseiteschob, war da nur eine Wand. Ich habe geflüstert, es ist nichts, es ist wirklich nichts, und ihren Kopf vom Boden aufgehoben. Ich flüstere das noch immer, wenn ich abends allein im Bett liege, es ist nichts, es ist wirklich nichts mehr, es ist niemand. Und jedes zweite Mal glaube ich mir, dass es stimmt.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sophie Vizthum
Seit zwei Minuten offline
Liebe Fanny,
wie geht es dir da drüben in Tokio? Hast du schon einen riesigen Pikachu gekauft? Wie schmeckt Sushi ohne Glutamat? Ich muss dir gleich gestehen, allzu Spannendes kann ich nicht berichten – aber ich habe mich heute nicht übergeben und das ist schon was.
Du fehlst mir hier. Und immer, wenn ich dich vermisse, versuche ich mich abzulenken. Ich habe also mal wieder Tilly geschrieben. Du erinnerst dich vielleicht noch an sie: ich habe sie in so einem Online Forum Anfang der Zweitausender kennengelernt. Die, die auch Probleme hat. Die, die alle paar Sekunden von online zu offline wechselt.
Tilly schrieb mir, dass sie gerade eine Demonstration gegen die Unterdrückung Schwarzer in den USA organisiert. Dagegen kamen mir meine Sorgen irgendwie winzig vor.
Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, was sie sich dadurch erhofft, hier in Österreich? Aber Tilly würde sagen, natürlich verstehst du das nicht, du hast kein Gefühl für die Welt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, warum wir überhaupt noch reden.
Ich habe gesehen, dass du jetzt auch viel postest und so was. Ich hoffe, dass du nicht auch in diese digitale Generation abgerutscht bist, die für alles eine Rechtfertigung parat hat? Du bist nicht schuld am Elefantensterben, dein Einkauf wird CO2-neutral versandt, diese Jogginghose ist aus der schönen Provinz Chinas – das können sie uns ja verkaufen und so, aber glauben muss ich es nicht, oder?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir alles zu viel wird. Ständig gibt es nur Probleme, aber kauf mich, dann geht es dir besser. Wenn ich mir die Zähne putze höre ich fremden Menschen beim Quatschen über Schwangerschaftsprobleme, beim Planen von Weltreisen oder beim Testen von Produkten zu – dabei bin ich weder schwanger, noch habe ich Geld für eine Reise, noch brauche ich so ein Scheißproteinpulver. Aber ich könnte dir stundenlang von Episiotomien und Proteinpancakes erzählen.
Ja, natürlich könnte ich endlich die selbstgemachten Ohrringe von Anna kaufen und sie dadurch unterstützen. Klar, wären zwei Sportleggins zum Preis von einer super. Und die Babybären in Käfigen in Bulgarien tun mir eh leid. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber wo bleibe da eigentlich ich?
Ich habe übrigens jemanden kennengelernt, das wird dich sicher interessieren. Elias heißt er – er kocht gerne und schaut mir beim Spielen auf der Wii zu.
Er merkt sich so Dinge, die anderen gar nicht auffallen. Zum Beispiel, dass ich die eingedrehten Nudeln lieber habe, weil ich denke, sie schmecken nussiger.
Wenn wir gemeinsam kochen, darf ich auf der Fläche gleich neben dem Herd sitzen, wie damals, und rühren. Ich rühre alles um, Wasser, Currys, Chillis, ich rühre mal nach links, mal nach rechts und rede und alles ist gut. Erinnerst du dich noch, damals in der Therapie, da haben wir es nicht anders gemacht.
Wenn ich Elias dann sehe wird sicher alles besser. Er gibt mir das Gefühl, dass es okay ist, mal abzuschalten – wir hören nichts, wir sehen nichts, wir igeln uns ein und der Lärm, den lassen wir vorbeiziehen. Ich glaube, ich werde meinen Fokus auf ihn richten. Zumindest bis du wieder da bist. Schauen wir mal, wie lange es gut geht.
Ich sollte jetzt gehen. Ich bin schon viel zu lange online. Aber eigentlich bin ich gar nicht daheim. Vor mir dreht sich ein Ringelspiel, es dreht und dreht sich und malt eine bunte, runde Spur in die Luft, dort wo sonst eigentlich die Kinder sitzen, weißt du. Die Kinder? Die sind schon lange nicht mehr da. Vielleicht schlafen sie auch nur. Musik höre ich keine.
Jemand in schwarzen Adidas-Hosen boxt gegen einen ledernen Ball. Das dumpfe, mechanische Geräusch des nachgebenden Boxsacks bringt mein Blickfeld zum Wackeln.
Gestern Abend war ich schon hier, mit Elias, wir haben uns Zuckerwatte geteilt und Schaumbecher verschlungen. In der Geisterbahn war mir schlecht. Heute Morgen bin ich wieder gekommen, bin durch die Maschinenreihen spaziert, habe mich auf winzige Fahrgeschäfte gesetzt, die nicht gut genug abgesperrt sind und habe geraucht. Ich habe auch versucht Cola zu kaufen, aber die Automaten blinkten alle rot. Sonst ist noch niemand da. Vielleicht war auch nie jemand da. Und es ist alles nur in meinem Kopf.
Jagen, das tun sie uns alle, mit ihren Scheißideen von Vollkommenheit. Hier sitze ich, kurz nach Sonnenaufgang an einem Junimorgen und überlege, heutzutage nehmen wir die Maschinen überall hin mit. Besonders ist das schon lange nicht mehr. Und freiwillig irgendwie auch nicht.
Ich warte auf Elias.
Schreib mir mal wieder.
Sayonara!
.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Christian Weiglein
Schafe
Ich treffe ihn gegen vier Uhr Nachmittag auf dem Weg zur Post und wir stellen fest, dass wir beide zur Post gehen möchten und dann unterhalten wir uns kurz und machen uns auf den Weg. Wir zwei jetzt zusammen zur Post, denke ich. Was mich beschäftigt, sagt er, ist das Burgfest. Das Burgfest steht kurz bevor, sagt er. Wir wissen vom Burgfest, alle reden vom Burgfest und andauernd hören wir im Vorübergehen auf unserem Weg zur Post Einheimische, die sich über das bevorstehende Burgfest unterhalten. Was mich beschäftigt, sagt er, ist nicht das Burgfest an sich, sondern die Geschehnisse auf dem Burgfest, aber nicht die Geschehnisse an sich, sondern die Art und Weise, sozusagen der Modus ihres Geschehens. Diese ganz spezielle Burgfeststimmung auf der Burg am Tag des Festes, sagt er und ich meine zu wissen, was er sagen möchte, weil auch mir das Burgfest besonders durch seine eigentümliche Stimmung immer aufgefallen ist. Also die Burgfeststimmung, so er weiter, diese Burgfeststimmung beschäftigt mich. Bis zur Post ist es noch weit, denke ich. Warum gehst du zu Fuß zur Post, frage ich mich … Wir unterhalten uns über das Burgfest, wie sich alle hier über das Burgfest unterhalten, denke ich und sage, dass das Burgfest alle seine Besucher beherrscht, ihr Denken beherrscht. Die Burg nichts als eine Ruine, sage ich, aber das Burgfest herrscht über der Stadt, steht, wo alle Mauern fielen. Die Burgfeststimmung, sagt er, ist die Stimmung, in der wir vom Fest und der Burg, präziser: Burgruine, beherrscht werden. Das ist das Geheimnis der Burgfeststimmung: Herrschaft. Bis zur Post, denke ich, ist es noch weit.
Im letzten Jahr wurde er vom Organisationskomitee des Burgfestes von der Helferliste gestrichen. Das wissen wir beide, aber ich schweige, weil es mir peinlich ist, ihn auf seine Streichung von der Helferliste hinzuweisen. Tatsächlich ist die Streichung Resultat eines Skandals, über den ich mich genauso wie über die Folgen des Skandals ausschweige. Ich bin nicht nur vom Burgfest, sondern auch von ihm beherrscht, denke ich jetzt. Es ist mir eine Freude über Skandale zu sprechen, aber in seiner Anwesenheit kann ich über den ihn betreffenden Skandal nicht sprechen, denke ich. Alles was mit dem Burgfest zusammenhängt, hängt mit dem Skandal zusammen und wird in seiner Anwesenheit zum Unaussprechlichen. Auf dem Weg zur Post, denke ich, unterhalten wir uns über das Burgfest, aber viel mehr noch schweigen wir über das Burgfest. Ich schweige über meine Beteiligung im Helferkommitee des Burgfestes, das die Helferlisten-Streichung zu verantworten hat. Mein mir angestammter Platz auf der Helferliste hat mich in das burgfestliche Komitee hinein ordiniert, denke ich. Sein Platz war an der Kaffeemaschine, das heißt hinter der Kaffeemaschine und zwar jedes Jahr zum Burgfest einen Sonntagnachmittag. Jetzt: nur noch Besucher, er nur noch vor (nicht hinter) der Kaffeemaschine, nur noch Kaffee kaufend (nicht kochend). Wir haben ihm sein Erbrecht genommen, denke ich auf dem Weg zur Post neben ihm gehend. Wir lassen uns nichts anmerken.
Bis zur Post, sagt er, gehe ich sonst nie zu Fuß, denn es ist ein weiter Weg. Auch ich, sage ich, gehe nie zu Fuß zur Post, aber heute, sage ich gehend, treffen wir uns zufällig beide zu Fuß auf dem Weg zur Post. Das ist die Burgfeststimmung, sagt er, die Burgfeststimmung herrscht über uns und zwingt uns zu Fuß zu gehen, wo wir sonst nie zu Fuß gehen. Herrschaft, sagt er, feudal, sagt er. Er: Wir sind alle Bauern hier unter der Burg. Nicht die Burg ist Ruine, wir sind ruinös, wir hier unten in der Stadt zu Füßen der Burgruine. Fast einmal um die halbe Burg herum hier unten, denke ich. Bis zur Post ist es weit. Auf unserem Weg zur Post kreisen wir um die Burgruine herum. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten führt in unserer Stadt um die Burgruine herum, um den Burgberg herum, um dessen Ausläufer sich alle Straßen krümmen. Unter dem Burgberg krümmen auch wir uns, denke ich. Krümmung und Herrschaft, sage ich. Er nickt.
Die Aufgaben des burgfestlichen Komitees erschöpfen sich nicht im Streichen von Namen von der Helferliste. Das Komitee organisiert Kaffeepulver, das von den Helfenden zu Kaffee aufgekocht wird. Das Komitee organisiert ebenfalls Kuchen, d.h. es bestimmt Helfende, die am Tag des Festes einen Kuchen backen und auf die Burg hinaufzutragen haben, wo der Kuchen zum Kaffee gereicht wird. Der Ausschank des Kaffees und das Reichen der Kuchen erreicht am späten Nachmittag einen Höhepunkt, dessen Kommen sich durch Entzündung eines Lagerfeuers ankündigt. Auch das Lagerfeuer wird vom burgfestliche Komitee organisiert. Ist der Höhepunkt überschritten und das Lagerfeuer angeheizt, werden Vorbereitungen zum Abendessen getroffen. Auf dem Burgfest werden traditionell Schafskadaver auf eiserne Stangen gesteckt und über den Flammen des Lagerfeuers bis zur Schwärze erhitzt. Das Organisationskomitee hat mit den Schafen aber nichts zu tun, denn das Organisieren der Schafskadaver (sogenannte Lämmer) wird der städtischen Metzgerei überlassen. Das Organisationskomitee tätigt eine Bestellung und der Metzger liefert. Der Metzger ist sehr geschäftstüchtig, seine Filiale liegt ganz in der Nähe der Post, denke ich auf dem Weg zur Post, der auch der Weg zur Metzgerei ist.
Was mich beschäftigt, sagt er und reißt mich damit aus allen meinen Gedanken, ist der Skandal, mein Skandal, sagt er. Ich war gegen das Streichen deines Namens von der Helferliste, sage ich unvermittelt. Das Streichen deines Namens von der Liste war unausweichlich, sage ich. Er nickt. Ich habe mich, schon als dein Name bereits von der Helferliste gestrichen war, noch für dich ausgesprochen, sage ich, habe angeregt, den Namen nur zu verschieben, von der Liste der Kaffeekocher auf die Liste der Kuchenreicher, sage ich. Er nickt. Du kennst die Alten, sage ich, niemand schlimmer als die Alten. Die Alten regieren unerbittlich, sage ich. Feudal, sagt er. Die Alten, so ich weiter, die Alten häufen ihre Urteile wie Falten. Furchen, sagt er. Furchen, sage ich, du kennst die Alten, Urteile, Falten, Furchen, ihr Gesicht rau und hart wie ein Acker. Um die ganze Stadt überall Äcker und hier unter der Burg alle Bauern, sagt er. Aber die größten Äcker, so ich weiter, finden wir in den Gesichtern der Alten. Noch bevor sie im Kirchhof zu liegen kommen, beerdigen sie sich im eigenen Gesicht, sage ich. Das ist die Schwere ihrer Urteile, die ihre Gesichter bricht, sage ich, schwer wie Torf.
Im letzten Jahr stand mein Gesprächspartner im Zentrum eines Skandals: Die Alten haben feine Zungen. Man meinte, im Kaffee den Geschmack der Schafe zu erkennen. Er war dem Metzger zur Hand gegangen. Man hatte ihm beim Tragen der Schafskadaver beobachtet, man hat ihm vorgeworfen, sich die Hände nicht gewaschen zu haben. Kaffeekochen mit diesen Händen, diesen Schafshänden, haben sie gesagt. Diese ganz bestimmte Burgfeststimmung, denke ich jetzt auf dem Weg zur Post, war ausschlaggebend für den Skandal. Die Worte der Alten fallen zwischen die Biertischgarnituren mitten hinein in die Kuchenkrümel, ein Skandal wächst aus ihnen, gebrochene Worte aus gebrochenen Gesichtern, schwer wie Torf die Urteile. Ich denke an das Wort Modus. Der Modus des Burgfests ist sein Geheimnis. Herrschaft, sage ich. Er nickt. Bis zur Post ist es jetzt nicht mehr weit. Dieser Teil der Stadt wird vom Burgberg beschattet.
Die Metzgerei liegt ganz in der Nähe der Post, wir passieren ihre Schaufenster und beobachten das dort ausgestellte Fleisch, werden langsam, werden beide immer langsamer und bleiben beide vor der Eingangstüre der Metzgerei stehen, die eine Flügeltüre ist. Bis zur Post ist es nicht mehr weit, sage ich. Er nickt. Ich zögere kurz und sage dann, ich müsse eigentlich gar nicht zur Post. Ich müsse zur Metzgerei, in die Metzgereifiliale hinein und dort eine Bestellung aufgeben. Er nickt. Auch ich muss nicht zur Post, sagt er. Wir treffen uns auf der Straße, sage ich, und geben vor, zur Post zu müssen, obwohl wir nicht zur Post, sondern zur Metzgerei müssen. Ich habe dich belogen, sagt er, weil ich vorsichtig bin. Ich habe einen Plan, sagt er, dessen Ausführung mich zur Metzgerei führt. Ich nicke. Ich denke, sagt er, jetzt kann ich es dir sagen. Er weiter: Ich gehe jetzt in die Metzgerei hinein und kaufe dem Metzger alle Schafskadaver ab, kaufe alle Kadaver zur Burgfestzeit für völlig überhöhte Preise, sagt er. Der Metzger ist sehr geschäftstüchtig, sage ich. Er nickt. Ich sage, ich müsse die Schafskadaver für das Burgfest bestellen. Am besten gleich bezahlen, sage ich. Er nickt. Ich werde alle Schafskadaver aufkaufen, sagt er, bis kein einziger Schafskadaver mehr für das Burgfest übrig ist. Das Burgfest zerstören, sagt er. Ich nicke. Ich werde in die Metzgerei hineingehen, sage ich, und die für das Burgfest nötige Anzahl an Schafskadavern bestellen und gleich bezahlen. Ich habe dich angelogen, weil mir das peinlich ist, sage ich, peinlich jetzt zum Burgfest vor dir die Schafe zu kaufen, sage ich. Wegen dem Skandal, sage ich. Er nickt. Die Metzgerei hat große, schwere Flügeltüren, in deren Glasfenstern sich unsere Gesichter spiegeln. Überall Furchen, sagt er. Feudal, sagt er. Jeder von uns nimmt einen Flügel in die Hand, zieht die Tür zur Metzgerei auf – wir halten kurz inne, sehen uns noch einmal an, taxieren den Blick des jeweils anderen so zwischen den Türen der Metzgerei stehend, riechen schon den Blutgeruch, der von den Schlachtbänken hinten in den Verkaufsraum der Metzgerei quillt – und dann … dann gehen wir einfach mitten hinein.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ferenc Liebig
Von der Bedeutung des Sterbens
Der Mann ist auf YouTube. Im Hintergrund sieht man eine wilde Landschaft aus Bergketten und dichten Wäldern. Der Mann zupft an seinem olivgrünen Wollpullover. Der Mann trägt einen langen Bart, das blonde Haar ist zerzaust. Er sieht aus, als wäre er gerade aufgestanden. Seine Stimme ist kratzig. Der Mann sagt, er sei in dieser Gegend aufgewachsen. Die Kamera zoomt näher an ihn heran. Er zeigt die Straße herunter und meint, es gäbe keinen besseren Ort als diesen. Man folgt dem Mann mit der Kamera. Der Mann berührt die Leitplanke. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blassweiß. Man hört das Rauschen eines Flusses, ohne ihn sehen zu können. Der Mann bleibt stehen und zeigt auf den Boden. Seit Jahren würde er die Kadaver von der Straße sammeln. Hauptsächlich kleinere Tiere. Er holt einen Plastikbeutel und einen Spachtel aus dem Rucksack. Der Mann verdeutlicht, er liebe die Tiere. Er könne nicht ertragen, sie dort liegen zu lassen. Kurz wird der Großteil eines Satzes durch ein vorbeifahrendes Auto verschluckt. Letztendlich versteht man nur das Wort unwürdig. Der Mann geht in die Hocke, kratzt energisch den Klumpen aus Fell und getrocknetem Blut von der Fahrbahn. Wichtig ist, dass sie noch frisch sind. An heißen Sommertagen werden die Tiere so schnell von Insekten befallen, dass er kaum fündig wird. Angezogen vom Zersetzungsgeruch würden Schmeißfliegen bei günstiger Witterung bereits nach wenigen Minuten ihre Eier ins abgestorbene Gewebe legen. Genau bei Minute 3:41 schaut er auf, die Kamera fängt seine tiefblauen Augen ein, die schwungvollen Wimpern, die gekringelten Haare auf der Nasenwurzel. Er hätte angefangen, sich nur noch von diesen Tieren zu ernähren. »Man würde«, nun pausiert er, in seinen Augen verfängt sich ein dramatisches Zittern, »leider Gottes viel zu viele von ihnen erwischen.« Am häufigsten wären es Katzen und Hasen, manchmal Waschbären, Eichhörnchen, Vögel. Auch wenn sie schnell sind, so ist es doch ihre Unvorsichtigkeit, die sie leicht zu Opfern macht. Man nimmt einfach keine Rücksicht mehr. Auf nichts. Deswegen hätte er alles hinter sich gelassen. Der Mann sagt, er liebt es, in der Natur zu leben. Nur dort wäre er unabhängig. Das letzte Mal hätte er als Jugendlicher eine Zeitung gelesen. Er bräuchte nicht zu wissen, wo Krieg ist. Das würde nichts ändern. Auch nicht, ob Menschen den Mond besiedeln oder nicht. Der Mann zieht das bis zur Unkenntlichkeit plattgefahrene Tier von der Straße ab, zeigt es in die Kamera und steckt es dann fast schon liebevoll in den Beutel. Sich von ihrer anzunehmen zeugt von Respekt. Sie nicht bloß dem Stadium der Verwesung zu überlassen. Ihrem Tod einen Nutzen zu geben. Das Video hat 99.476 Klicks und 6.377 Likes. Nach sechs Minuten bricht es plötzlich ab.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Esther De Soomer
Seeanemonen
Monika erinnert sich heute noch daran, wie sie an jenem Morgen nicht wie immer den Fahrstuhl nahm, sondern die neun Stockwerke zu ihrem Arbeitsplatz zu Fuß bestieg. Es war ein gewöhnlicher Morgen, und sie war selbst ein wenig von ihrer spontanen Entscheidung überrascht. Während sie die Treppe hochging, hatte sie Zeit, darüber nachzudenken, und ihr fiel ein, wie die Immergleichheit der Tage an manchen Momenten schlecht auszuhalten war, und sich dann eine Änderung des üblichen Verhaltens aufdrängte. Sie fragte sich, ob sich andere Menschen, die sich ebenfalls gelegentlich von der täglichen Monotonie bedrückt fühlten, auch vergeblich mit Kleinigkeiten abzulenken versuchten, mit einer noch nie vorhin probierten Beilage an der Speisetheke zum Beispiel, oder mit heimlichem Schuheausziehen unterm Schreibtisch, um mit Strumpffüßen den Teppichbelag zu befühlen. Bestimmt ginge es ihnen auch so, dachte Monika, denn sie unterschied sich doch kaum von der Mehrheit der Menschen, die, genauso wie sie, ereignislose Leben führten. Sie vermutete sogar, dass selbst schlagfertige Menschen, die Art von Menschen mit Einfluss und Entscheidungskraft, die Meetings im Stehen organisierten und sich mit Karriereplanung beschäftigten, ab und zu Tagen ausgesetzt waren, an denen der Magen mürbe ist und der Geist stumpf. Dieser Gedanke tröstete sie ein wenig, es war ihr, als ob sie ihre Beschwernisse nicht alleine tragen musste, aber nach einigen Stufen überfiel ihr trotzdem das Gefühl, dass sich ihr Kummer nicht zu teilen, sondern nur zu vervielfältigen schien. Daraufhin verfehlte sie die letzte Stufe zum Treppenabsatz zwischen der zweiten und dritten Etage und stürzte. Sie brauchte einige Sekunden, um festzustellen, dass ihr nichts wehtat, oder zumindest nichts, das nicht auch schon vorher wehgetan hatte. Und sie entschied sich, noch ein wenig liegenzubleiben, ein Viertelstündchen oder zwanzig Minuten vielleicht, sie nahm sich nichts Großes dabei vor, und trotzdem erinnert sie sich heute immer noch daran.
Sie lag in einer eher unbequemen Haltung, aber die kühlen Treppenfliesen pressten angenehm kalt an die glühende Backe und ihr Verstand tat sich ein Spaltbreit auf. Wäre etwas wie eine Einsicht oder ein Vorhaben dagewesen, ihr Denken hätte dafür empfänglich sein können.
Monika lauschte auf das Surren der Aufzüge nebenan, das man mit einigem Wohlwollen für das Meer halten konnte, und sie stellte sich vor, dass unten am Empfang, wo Daria hinter einem riesigen, an einem Raumschiff erinnernden Desk saß, Wasser hereinfließen würde, das das Bürogebäude mitsamt Treppenhaus langsam überflutete, und dass sie darin herumschwimmen würde, wie irgendein exotisches Meereswesen in einem Aquarium. Sie würde an den Besprechungsräumen und den Kaffeeküchen vorbeigleiten, bis zum deckenhohen Fenster ihres Büroraums, das sich nicht öffnen ließ, zweifelsohne aus Sicherheitsgründen, und sie würde hinausglotzen, auf den schlängelnden Verkehrsstrom draußen, der aus Autos bestand, in denen Menschen saßen, die auf klare Endziele zusteuerten, und auf die Wolken darüber, die trotz ihrer launischen Farb- und Formwechsel stets einen unbeirrbaren und standhaften Eindruck machten.
Ihr kam das Wort Einflussnahme in den Sinn.
Dann dachte sie an eine sich ein Spaltbreit öffnende Muschel.
Dann an Seeanemonen, Geschöpfe die gleichzeitig Tier und Pflanze sind, und deren Larven Gehirne haben. Die Larven schwimmen so lange umher, bis die Zeit gekommen ist, um aufzuwachsen. Dann docken sie am festen Boden an, verankern sie sich und lassen das Gehirn absterben. Was bleibt, sind ihre sanft wehenden Tentakel, die sie vorbeischwimmender Nahrung entgegenstrecken.
Monika war froh darüber, dass ihr die Seeanemonenanekdote, die Oscar ihr mal erzählt hatte, nicht aus dem Gedächtnis geraten war, wie sie sich immer freute, wenn ihr unnützes Wissen nicht abhanden gekommen war.
Sie presste die andere Backe an den kalten Fliesenboden und versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, den Verstand zu verlieren. Aber sie verfügte über zu wenig Einfallsreichtum, um diesen Gedanken zu Ende zu denken. Also dachte sie an Oscar, der jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr im neunten Stock arbeitete, weil er Life Coach geworden war und Menschen beim Sortieren ihrer Leben half, eine Tätigkeit, bei der er vielleicht über Seeanemonen redete und Verankerung und absterbende Gehirne.
Man kann an vieles Denken, wenn man fünfzehn, zwanzig Minuten unbeweglich auf einem Treppenabsatz liegt, aber irgendwann stockt der Verstand, und was bleibt, ist ein Körper, der sich nur mit sich selbst und seinen regungslosen Zustand befassen kann. So ging es auch Monika. Sie stellte sich vor, dass sie, wenn sie nur ganz still sein würde, einfach liegenbleiben konnte. Dass im neunten Stock niemand ihr Verschwinden bemerken würde, wie bisher niemand ihr Schwinden bemerkt hatte. So lag sie da, in unkomfortabler Haltung, aber ganz kurz zufrieden.
Dann stieß jemand zwei Stockwerke über ihr mit ziemlicher Wucht die Brandschutztür zum Treppenhaus auf. Hastige Schritte hallten die Treppe hinunter.
Ein Mann, schätzte Monika.
Wenn er sie hier so liegen sähe. Vielleicht würde er sie in den Arm nehmen. Sie leise wiegen, zwischen der zweiten und dritten Etage.
Das kam ihr dann aber nach ihrem kurzen Moment der Zufriedenheit zu pathetisch vor. Also stand sie rechtzeitig auf, wie sie immer rechtzeitig aufstand für einen Tag ohne Ereignisse. Ein Mann mit Bart, in der Hand ein Telefon, rannte an ihr vorbei. Sie hatte ihn schon einige Male gesehen, Oscar hatte damals mit ihm zusammengearbeitet, und sie wollte ihn grüßen, aber er schien sie nicht zu bemerken, als ob sie bereits verschwunden war. Sein Telefon klingelte. „Ja“, sagte er, und „geht schon“ und dann war er zu weit unten, um die Gesprächsfetzen noch verstehen zu können.
Gebraucht zu werden, dachte Monika, und da ihr Verstand wohl zu kurz geraten war, um sich dabei etwas Konkretes auszumalen, entschied sie sich, das Denken einzustellen, und den langen Weg zum neunten Stock weiter hochzusteigen.
Inzwischen, viel später, Daria arbeitet schon längst nicht mehr als Rezeptionistin in dem Bürogebäude, und die Aufzüge sind durch neuere, stillere Teile ersetzt worden, denkt Monika, während sie Zahlen von einer Tabellenspalte in die nächste verschiebt, dann und wann immer noch an diesen Morgen zurück. Sie kann noch ganz genau die kalten Fliesen nachempfinden und das Meeresrauschen und die Restwärme einer mal dagewesenen Zufriedenheit. Sie kann noch die Schritte hören des Mannes, der sie nicht sah. Und wenn sie jemand darum beten würde, würde sie die Seeanemonenanekdote genau nacherzählen können. Sie würde mit Schwimmbewegungen die Irrwege der Larven nachahmen, und mit elegant über ihrem Kopf wehenden Armen die nach Fraß ausgedehnten Tentakel. Und bei der Stelle über das abgestorbene Gehirn, würde sie den Kopf auf die Brust fallen lassen und still sitzenbleiben, ganz still, ein Viertelstündchen oder zwanzig Minuten, und dann noch länger, so lange, bis man sie überhaupt nicht mehr bemerkte.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Frederike Schäfer
Asiatisches Essen
Ich habe gelernt: Wenn Hugo auf seine Unterlippe beißt, ist er mit der derzeitigen Gesamtsituation überfordert. Ich könnte sagen: unsicher. Ich könnte sagen: in die Enge getrieben. In die Enge getrieben und doch nicht in der Lage, etwas an seinem Zustand zu ändern. Ich denke, manchmal, ja, manchmal ist mir Hugo ganz und gar ähnlich. Wie er da sitzt, auf meinem Wohnheimbett, am starren, angelehnt an weiße Raufasertapete, immer weniger sagt, bald gar nichts mehr sagt, auf seiner Unterlippe kaut, und sein Unwohlsein erfüllt den ganzen Raum, meinen ganzen Raum, Munas offensichtlich nicht, denn vielleicht, ja, vielleicht würde Muna dann aufhören, wenn Hugos Unwohlsein in ihrer Realität auch nur irgendwie bemerkt werden würde. Oder, denke ich, oder sie macht das extra. Früher hätte Muna das nicht gemacht, früher hätte Muna nichts gesagt, einfach nichts gesagt und sich im Nachhinein über die Dummheit der Welt aufgeregt. Aber jetzt sagt sie etwas, sie sagt nicht nur etwas, sie diskutiert, gegen eine Partei, die gar nicht existent ist, denn Hugo schweigt und ich auch, und da sind keine Gegenargumente. Aber ich schätze, das stört Muna nicht. Oder sie will einfach was loswerden, weil sich die Dinge aufgestaut haben und Hugo die nötige Fläche bietet, um alles Angestaute zu katalysieren und rauszulassen.
Und ich dachte noch, heute, ja, heute wird ein guter Tag, ein guter Muna-und-Hugo-und-ich-Tag.
*
„Woran denkst du?“
Ich schaue zu Muna, und Muna schaut zu mir.
„Morgen, Muna“, sage ich.
„Morgen“, sagt Muna und richtet sich auf. „Na sag schon“, sagt Muna. „Woran denkst du?“
„Ach nichts“, sage ich.
Muna steht auf und beginnt mit ihrem morgendlichen Yoga-Programm. Das hat sie mir erklärt. Viel Yoga statt viel duschen. Wegen der Wasserverschwendung, hat Muna gesagt. Muna hat auch gesagt, sie wäscht sich ihre Haare nur noch mit Olivenseife, hart. Kein Duschgel. Deo nur in der plastik- und aluminiumfreien Variante. Rasieren selten. Muna hat gesagt, der Mensch hat eine Verantwortung. Muna hat gesagt, was interessiert die Erde, ob ihre Schamhaare rasiert oder ihre Haare gewaschen sind. „Aber“, hat Muna gesagt, „aber, nenn mich nicht Hippie! Das ist so ein kack mystifizierter Ausdruck und klingt, als wäre ich auf so einem Eso-Trip. Bin ich aber nicht. Ich habe bloß nachgedacht.“ Ich denke, Muna hat recht. Ich denke, Muna ist identitätsfindungsmäßig weiter als ich. Ich denke, ich sollte weniger Zeit im Bad verbringen. Ich denke, meine Anstrengungen im Bad sollten sich in etwa in Richtung der Anstrengungen hinsichtlich meiner Socken bewegen. Meine Socken haben Löcher.
Ich setze mich auf das Bett, beobachte Muna kurz, wie sie es völlig problemlos schafft, ihre Handflächen im Stand auf dem Boden abzulegen, und nehme mein Handy.
Hugo: Heute 18 Uhr bei dir?
Ich tippe: Ja. Kochen oder bestellen?
Ich weiß, dass Hugo bestellen wollen wird. Hugo will immer bestellen. Bestellen und sich dann aufregen, wenn das Curry fettiger ist als gedacht. Gedacht im Sinne von: Er weiß es, aber er steht nicht drüber. Ich esse mein Curry, und das ist lecker.
Hugo schreibt: Bestellen. Hab Luft auf asiatisch.
Ich schreibe: Ok.
Hugo schickt ein Herz-Emoji.
Ich schicke ein Herz-Emoji.
*
Hugo hat Muna Hippie genannt. Hugo hat sich beschwert, sein Essen ist zu fettig. Muna war allem Anschein nach erst in der Phase Er-ist-Fridas-Freund-und-ich-verkneif's-mir, dann doch nicht. Hugo hat gesagt „Fett, alles Fett. Widerlich“, mit ganz langgezogenem „i“, und Muna hat ihre Augen zusammen gekniffen, hat Hugo anvisiert und angegriffen. Über das Konsumverhalten in der westlichen Welt, Lebensmittelverschwendung, immer und überall alle nur am Sichbeschweren, und überhaupt, wenn sich Hugo beschweren wollen würde, dann doch nicht über das Fett, sondern über das tote Rind in seinem Curry, Massentierhaltung, Methan, CO2, Monokulturen, und ob er das denn nicht wisse. Aber sie, sie müsse sich das immer anhören, ein Hippie, was ein Schwachsinn, sie habe einfach nur nachgedacht, und wer mal ordentlich nachdenke, der könne zu gar keiner anderen Lösung kommen, aber sie ein Hippie. Und dann ging es weiter, Beispiele, das ganze System, Kapitalismus, aber wir, wir als Akademiker, und ihre Stimme klingt dabei so verächtlich, sie spuckt das Wort Akademiker in das Wohnheimzimmer, und ich, ich verstehe nicht, warum wir, warum nicht er, und ich blicke zu Hugo, angelehnt an die Raufasertapete, beißt er sich auf seine Unterlippe, und ich sehe mich, und Muna macht weiter, trotz unseres Schweigens diskutiert sie gegen eine nicht existente Partei, erzählt von Walrössern vor der russischen Küste, deren Lebensgrundlage Eis einfach verschwindet und die sich aus Platzmangel auf einen Berg retten und folglich nicht wieder runter kommen, weil einfach zu viele, und stattdessen springen und fallen sie, die Klippe herunter, der einzige Ausweg. Und ich denke an braune, schwabbelige, dicht gedrängte, gehäufte Körpermassen, und ich stelle mein Curry zur Seite. Und Muna macht weiter, Politik, Kohle, Klimaabkommen, alles lachhaft, und wir, sie sagt wieder wir, wir würden uns über ein bisschen Fett aufregen, als wenn's sonst nichts gäbe. Doppelmoralisten, überall. Avocados aus Peru kaufen und Kippen auf den Boden werfen, bei Amazon bestellen, dann überlegen, ich könnt' ja zur Klimademo gehen, nein, doch lieber YouTube-Compilations gucken und Trauben ohne Kerne essen und keine Obdachlosenmagazine kaufen, aber Billig-Kaffee aus Uganda. Muna sagt, der Tag, an dem unser iPhone in die vollgekotzte Schüssel einer Clubtoilette plumpst, ist der beste Tag in ihrem Leben. Ich will noch ansetzen, das kenne ich irgendwo-, aber lass es lieber. Hugo lässt es auch.
*
Muna sagt nichts. Muna sitzt da und sieht abwechselnd Hugo, dann mich an. Hin und her. Hin und her. Muna nimmt sich ihren Teller, nimmt sich ihre Gabel, schiebt sich gebratenen Reis mit Gemüse in den Mund, kaut, schluckt und fragt: „Kommt ihr klar?“
Hugo und ich sehen uns an, Hugo sieht Muna an, Hugo nimmt sich ebenfalls seinen Teller, sagt „klar“ und isst weiter.
Ich denke, ich mag nicht weiter essen, aber ich will auch nicht als verschwenderischer, westeuropäischer Klimakiller rüberkommen, also esse ich. Keiner von uns sagt etwas. Wir sitzen und essen und schweigen, und vermutlich, ja, vermutlich wird das schwierig werden mit Muna und Hugo, und vielleicht auch mit Muna und mir, weil Hugo und ich allem Anschein nach ein Wir geworden sind, ohne dass ich das gemerkt hätte. Das mit der Wir-Werdung, das ist etwas, das ich nicht verstehe, und es scheint dennoch der einzige Weg zu sein, eine echte Beziehung führen zu können. Kein Wir waren: Munas Eltern und meine Eltern. Offensichtlich, wohin das geführt hat. Muna sagt, ihr Vater ist ein Idiot. Ich sage nicht, mein Vater ist ein Idiot.
*
Muna sagt: „Lasst uns ein Spiel spielen.“
Ich denke, ich bin ihr dankbar, dass sie's versucht.
Ich sage: „Okay.“
Hugo sagt erst mal nichts, sieht auf seine Uhr.
„Hugo“, sage ich und lege meine Hand auf seinen Arm. Das habe ich noch nie gemacht, meine Hand in einer liebevollen Geste auf seinen Arm gelegt, ihn mit gespielter Entrüstung angesehen und gesagt „Aber Schatz“. „Aber Schatz“ sage ich nicht. Mit „Schatz“ begibt man sich auf dünnes Eis. Ironisch gebrochen gerade zu verkraften ist der Übergang zu alltäglicher Gewohnheit fließend. Es bleibt also bei „Hugo“. Bei „Hugo“ und „kannst später ruhig hier pennen“. Neunzig Zentimeter waren bislang nicht das Problem, Muna dagegen, ja, ich weiß. Vielleicht ist meine zärtliche Berührung derart überzeugend, auf jeden Fall sagt Hugo „Ist gut“, gibt mir einen Kuss auf die Stirn und rutscht auf den Boden zu Muna, und ich sitze kurz da und spüre den Nachdruck seiner Lippen auf meinem Kopf, und mir wird ganz warm innen drinnen, und der Gedanke dominiert, das könnte ich immer haben. Und ich rutsche auf den Boden, und ich frage: „Was wollen wir spielen?“
*
Wir liegen im Bett. Munas lautes Atmen erfüllt das Wohnheimzimmer. Wir sind nicht nackt. Wir tragen Jogginghose und T-Shirt und Boxershorts und T-Shirt. Ich liege mit dem Rücken zu Hugo, der Blick auf die dunklen Umrisse von Muna. Hugo ist hart. Mit einer Hand holt er sich einen runter, die andere liegt auf meiner rechten Brust. Hugo hat eben geflüstert: „Bist du noch wach?“ Ich habe nicht geantwortet. Ich liege da, meine Augen sind offen, und ich höre zu, wie Muna atmet. Ein, aus. Ein, aus. Und ich bilde mir ein, wie ich Munas Stimme höre, vielleicht bilde ich mir das gar nicht ein, vielleicht ist sie das wirklich, und sie sagt, leise, dicht an meinem Ohr, dass nur ich es hören kann, Baby, you're wasting your young years. Merci und gute Nacht.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at