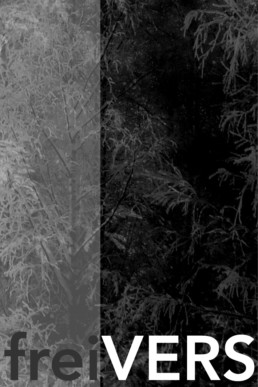freiVERS | Ferenc Liebig
Meldebescheinigung
Der Junge ist damit beschäftigt,
seine Ausweisnummer an ein Gedicht zu hängen,
Zahl für Zahl den Begriff Herkunft abzutragen,
als wäre er ein Fluss und seine Heimat ein Felsen,
denn von Liebe und Tod redet es sich leichter,
von den Gewissensbissen, die nur aufwühlen
und keinen Trost verteilen,
von grasbewachsenen Berührungen,
die am Handtuch enden,
sei getrocknet, schreibt er,
du missverständliche, verschwitzte Achsel,
sei endlich, schreibt er,
du überforderte, schiefe Schulter.
Er beendet das Gedicht mit der Zeile
und doch findet sich überall Glück darin
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Ferenc Liebig
Das Haus. Stillstand.
(1)
Das Haus ist zu groß für einen,
der seinen Lebensbaum längst
gefällt hat, um Brennholz
für den Winter zu haben.
Aber groß wäre es auch,
wenn man nicht einsam wäre,
inmitten der Leere,
die zu jeder Jahreszeit
durch die Fenster lugt
und ihre abgenagten Kadaver
auf die Veranda legt.
(2)
Man spricht über Tiere.
Der Marder hat den Schlauch
der Scheibenwaschanlage durchgebissen,
Ein Waschbär hätte die Vorräte im Schuppen
geplündert und unter dem Dach nisten Vögel,
im Anbau zeigst du auf drei Bienenstöcke,
draußen dann sagst du,
schau mal hier, durch dieses Loch im Zaun
wäre der Fuchs hindurchgekommen
und hätte sich die Hühner geholt.
Deine Erinnerung an früher
ist wie morsches Holz.
Du puhlst darin den Staub
der Vergangenheit hervor.
(3)
Und dann ist es ruhig.
Du hast die Axt zurückgestellt,
läufst barfuß über das hüfthohe Gras,
berührst die Blütenköpfe
mit der Neugier eines Kindes.
Die Sehnsucht würde dich
am Leben halten.
Die Sehnsucht lässt dich aufstehen
und an früher denken.
Wenn der Herbst kommt,
beruhigt dich die Dunkelheit.
(4)
Das Haus ist groß,
von innen wirkt es nochmals größer,
als würde einen optischen Trick geben,
der das Äußere kleiner erscheinen lässt.
Das Haus war schon immer zu groß gewesen,
selbst als die Eltern noch lebten,
mit Decken um den Beinen,
in den letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers.
Du sprichst von Vergebung,
Hohlräumen unter deiner Haut,
damals noch mit Berührungen befüllt,
trocknen sie nun langsam aus,
werden kleiner, drängen sich an die Knochen,
bis sie gänzlich verschwunden sind und
nur noch ein ledriger Film verbleibt.
(5)
Durch die Wälder treibt es uns,
ganz tief hinein in die seligen Schatten,
wo wir uns Läuterung versprechen
und so sind es unsere bemoosten Füße,
die hinein ins wuchernde Dickicht laufen,
sich Schneisen bahnen
durch benachbartes Grün.
Nichts vermenschlicht,
nicht einmal mehr wir,
werden nur eins dieser Geräusche,
das noch kurz widerhallt
und sich dann gänzlich niederlegt.
(6)
Du holst tief Luft, hältst die Luft
in deinen Lungen, schließt deine Augen,
atmest langsam wieder aus.
Nichts könnte dich von hier trennen.
Während du das sagst, wird dir bewusst,
wie wenig du von der Welt gesehen hast.
Gestriger Regen tropft von den Blättern.
Ein Jaulen kommt aus den Tiefen.
Du holst erneut tief Luft,
berührst dabei deinen Brustkorb.
Es riecht nach Erde.
Die Baumkronen verdecken
den Großteil des Himmels.
(7)
Im Haus ist es dunkel.
Geweihe hängen an den Wänden.
Im Schrank warten polierte Gewehre.
Auf unbehandelten Holzbrettern in der Küche
befinden sich Tassen und Gläser und ein Foto
der Eltern wurde neben ein Kruzifix befestigt,
wie sie auf einem Berg stehen,
Arm in Arm, ein angedeutetes Lächeln,
im Hintergrund Wald und Wanderer.
Da waren sie noch glücklich, sagst du,
nimmst das Bild in die Hand und
schüttelst wortlos den Kopf.
(8)
In der Bestallung gibt es ein Versteck.
Als Kind hättest du dort im Verborgenen
Gedichte geschrieben.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Ferenc Liebig
Artenschutz
als würde man an einem Fenster
hinaus starren und plötzlich ist das
Licht anders und diese Andersartigkeit
anfangs noch ameisenklein wächst an
zu einem Knistern mit Flügeln und wo
waren noch die Sterne oder die Wolken
oder die Zeit denn so im Tüll ist es
wie weggewischt und nur das Licht erinnert
an die Unterschiede zwischen Hell und Dunkel
und nur das Licht weiß von Meer und Land
und nur das Land weiß von Licht und Meer
und nur das Meer weiß von Land und Licht
und man hat Hände in der Luft und berührt
sich durch die Witterung hindurch und durch
die Witterung hindurch ist der schlohweiße Blick
der vom Fenster hinausstarrt mit seinen gebogenen
Wimpern und seinen schneetief verwehten Fragen
ein Fisch der offenmundig am schlammigen Ufer
nur noch hinnehmen kann
und wozu das Ganze
wozu dieser Hinterhalt
der den Vorhang beiseite bewegt
als wären es rückwärtige Gezeiten
man durchlebt noch einmal und nochmal und nochmal
und am Ende ist man in einer Schleife des Erlebens
und das Fenster steht offen und das Licht ist auf der Haut
und die Haut glüht und kurz ist es eine Sehnsucht
bald schon eine Trauer
die man nicht erklären kann
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ferenc Liebig
Von der Bedeutung des Sterbens
Der Mann ist auf YouTube. Im Hintergrund sieht man eine wilde Landschaft aus Bergketten und dichten Wäldern. Der Mann zupft an seinem olivgrünen Wollpullover. Der Mann trägt einen langen Bart, das blonde Haar ist zerzaust. Er sieht aus, als wäre er gerade aufgestanden. Seine Stimme ist kratzig. Der Mann sagt, er sei in dieser Gegend aufgewachsen. Die Kamera zoomt näher an ihn heran. Er zeigt die Straße herunter und meint, es gäbe keinen besseren Ort als diesen. Man folgt dem Mann mit der Kamera. Der Mann berührt die Leitplanke. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blassweiß. Man hört das Rauschen eines Flusses, ohne ihn sehen zu können. Der Mann bleibt stehen und zeigt auf den Boden. Seit Jahren würde er die Kadaver von der Straße sammeln. Hauptsächlich kleinere Tiere. Er holt einen Plastikbeutel und einen Spachtel aus dem Rucksack. Der Mann verdeutlicht, er liebe die Tiere. Er könne nicht ertragen, sie dort liegen zu lassen. Kurz wird der Großteil eines Satzes durch ein vorbeifahrendes Auto verschluckt. Letztendlich versteht man nur das Wort unwürdig. Der Mann geht in die Hocke, kratzt energisch den Klumpen aus Fell und getrocknetem Blut von der Fahrbahn. Wichtig ist, dass sie noch frisch sind. An heißen Sommertagen werden die Tiere so schnell von Insekten befallen, dass er kaum fündig wird. Angezogen vom Zersetzungsgeruch würden Schmeißfliegen bei günstiger Witterung bereits nach wenigen Minuten ihre Eier ins abgestorbene Gewebe legen. Genau bei Minute 3:41 schaut er auf, die Kamera fängt seine tiefblauen Augen ein, die schwungvollen Wimpern, die gekringelten Haare auf der Nasenwurzel. Er hätte angefangen, sich nur noch von diesen Tieren zu ernähren. »Man würde«, nun pausiert er, in seinen Augen verfängt sich ein dramatisches Zittern, »leider Gottes viel zu viele von ihnen erwischen.« Am häufigsten wären es Katzen und Hasen, manchmal Waschbären, Eichhörnchen, Vögel. Auch wenn sie schnell sind, so ist es doch ihre Unvorsichtigkeit, die sie leicht zu Opfern macht. Man nimmt einfach keine Rücksicht mehr. Auf nichts. Deswegen hätte er alles hinter sich gelassen. Der Mann sagt, er liebt es, in der Natur zu leben. Nur dort wäre er unabhängig. Das letzte Mal hätte er als Jugendlicher eine Zeitung gelesen. Er bräuchte nicht zu wissen, wo Krieg ist. Das würde nichts ändern. Auch nicht, ob Menschen den Mond besiedeln oder nicht. Der Mann zieht das bis zur Unkenntlichkeit plattgefahrene Tier von der Straße ab, zeigt es in die Kamera und steckt es dann fast schon liebevoll in den Beutel. Sich von ihrer anzunehmen zeugt von Respekt. Sie nicht bloß dem Stadium der Verwesung zu überlassen. Ihrem Tod einen Nutzen zu geben. Das Video hat 99.476 Klicks und 6.377 Likes. Nach sechs Minuten bricht es plötzlich ab.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ferenc Liebig
abc
am morgen empfängt sie patient a, einen depressiven schriftsteller, der durch eine recherche über viren auf öffentlichen raststätten zum hypochonder geworden ist und nun von angstzuständen geplagt, kaum noch zeit zum arbeiten findet. dabei muss, will er, den großen roman schreiben, eine familie, mehrere generationen, scheitern, krisen, seitensprünge, ein apfelbaum im garten, leichen im keller, er sitzt ihr im sessel gegenüber, schwitzt, schnieft, sucht spucke in seinem trockenen mund, lehnt aber das wasser ab, in dem eine zitronenscheibe schwimmt, blinzelt, kratzt, reibt oberschenkel, blickt unruhig zwischen zimmerpflanze und bild, ein weg zwischen birken, der in einen wald führt, gemalt von einem, der nie in russland war, aber immer nach russland wollte, und sagt, „die medikamente sind wie bukowski nach einer versoffenen nacht auf dem klo, ich brauche andere oder mehr oder beides“, ob sie nicht welche in blau hätte, blau war mal seine lieblingsfarbe, aber dann las er richard ford, seitdem nicht mehr blau, sein blick wandert zur uhr, wieder zu ihr, rutscht ab, er mag ihre rundungen, sie knöpft ihre strickjacke zu, er versteht, das er entlarvt wurde, er spricht von durchfall, von parasiten, er kombiniert seine textfragmente, bis er überzeugt vom parasitärem durchfall ist, da war ein hund, „sie wissen schon, im park, sie notiert, hund im park, was war mit dem hund, na der hund war da, wo, im park“, „und“, „ich war auch im park“, „haben sie sich berührt“, „nein“, der schriftsteller zuckt zusammen, in seinem letzten buch ging es um eine frau, die sich in einen mann verliebt hatte, der dann an krebs gestorben ist, „das muss man sich mal vorstellen“, sagt er, gereizt, „da fängt man an und schon hört es wieder auf, wie soll mal da erst anfangen, wenn man schon weiß, dass es enden wird, ja, enden muss“, sie blickt auf ihr heft, hund im park, mehr steht da nicht, sie könnte aufschreiben, dass er angst vor bindungen hat, aber hat er wirklich angst vor bindungen, „ich bin eher wie arno geiger“, sagt er und sagt, „er wäre momentan lieber nicolas mathieu, aber generell sieht er sich als arno geiger“, er hätte gestern ein ziehen in der brust gespürt, in herznähe, danach ein stechen unter dem bauchnabel, „da sind doch nur därme, oder“, sie hebt die schultern, um sie fallen zu lassen, „und heute morgen, da ist etwas ganz besonderes passiert, eine taube saß auf meinem fensterbrett und ich dachte, das ist ein guter einstieg, jemand wacht auf, sieht eine taube, taube fliegt weg und er beginnt von seinem vater zu erzählen, väter sind wie tauben, mütter wie möwen, und dann ist die taube wirklich weggeflogen und ich fand die idee bescheuert, als hätte die idee nicht einmal vorher gut sein können und auf einmal, herzrasen, atemnot, schwitzige hände, magengrummeln, taube füße, kopfschmerzen, ohrenglühen, durst, blähungen, juckende augen, gliederschmerzen, gedanken an raymond carver, knochen, kot, der körper als verdauungsapparatur, sie wissen schon“, man nickt sich nun zu, der schriftsteller, weil er glaubt, die richtigen worte gefunden zu haben, sie, weil sie glaubt, er bräuchte diese zuversicht.
patient b kommt eine viertelstunde, nachdem patient a den raum verlassen hat, sie lüftet und schaut aus dem fenster, unten steht ein umzugswagen, man räumt aus, kartons, ein halbes sofa, das in luftpolsterfolie verpackt auf eine sackkarre gehievt wird, patient b trägt einen alten pullover und abgenutzte hosen, er sieht wie ein student aus, ist aber kein student mehr, er ist wie ein text von patient a, eine dieser schwurbligen zeilen, ihr fällt sogar eine ein, das dach da drüben ist nass, obwohl die sonne scheint, patient b sagt, er hätte was mit einer frau, die verheiratet ist, und der mann der verheirateten frau hat auch etwas mit einer frau, die nicht seine frau ist und das problem ist, das alle irgendwie parallel mit jemanden zusammen sind, der die frau eines anderen ist oder halt der mann einer anderen, „verstehen sie“, „natürlich“, „und wie soll ich da, das macht doch gar keinen sinn, wenn man am ende“, „was sind sie am ende“, „na“, „was na“, „ich weiß nicht, dann bin ich nur jemand, der eine frau hat, die mit einem anderen schläft und ich selbst schlafe mit einer frau, die auch noch mit einem anderen mann schläft und irgendwie will ich nicht, das alle durcheinander schlafen, ich will“, „was wollen sie“, sie schaut vom block aus, sein ständiges zögern in den sätzen nervt sie, seine schultern hängen, die haut glänzt, er erinnert sie an den sohn einer nachbarin, söhne von nachbarinnen können schrecklich verliebt sein, denkt sie und stellt sich den sohn, wie er bei ihr ein paket abholt und sie nur im bademantel, was für ein klischee, sie muss schmunzeln, patient b missfällt das, „warum grinsen sie“, „ach nichts“, „wie nichts, man ist doch immer“, „was“, „na nur einer von vielen“, „vielleicht muss man einer von vielen sein“, daran hätte er auch schon gedacht und ob er sich einen neuen fernseher holen soll, weil sein alter so eine schlechte auflösung hat, ob sie das nachvollziehen kann, wie man austauscht, wenn es nicht mehr reicht, vielleicht müsste der sohn etwas reparieren, die glühbirne ist kaputt, der wasserhahn tropft, eine schraube sitzt locker, und dann zieht er sein t-shirt aus, sie hofft, dass er sich die achseln rasiert, männer sollten sich die achseln rasieren, und ihre eier auch, eier, was für ein komisches wort, hoden ist aber auch nicht besser, sie schreibt in ihr heft, hoden vs. eier, patient b ist noch immer bei den fernsehern, „da ist etwas besser, ja, größer, neues format, 3-d, was weiß ich, interne festplatte, internet, und dann wird der alte einfach entsorgt“, er will nicht der fernseher sein, „kennen sie ferenc liebig“, „nie gehört, was ist mit dem“, „der hat ein buch geschrieben, über eine frau, die krebs bekommt, ach falsch, die sich verliebt, der mann kriegt krebs, irgendwie so, was ist wenn das bild ausfällt, die lautsprecher nicht mehr funktionieren, was machen sie dann, sie sollten vielleicht mal das buch lesen, es gibt schlimmeres, als ein fernseher zu sein und letztendlich, wer sagt eigentlich, ob das gut ist, wenn wir nur mit einem zusammen sind, der uns möglichweise gar nicht ausfüllt“.
sie legt das heft beiseite, in ihrer pause müsste sie protokollieren, zusammenfassen, bezüge herstellen, hund im park, hoden vs. eier, sie starrt auf den bildschirm, schreibt etwas, löscht es wieder, der nächste patient klingelt, sie öffnet die tür, eine distanzierte begrüßung, schon steht sie im flur, hantiert an ihren verknoteten schnürsenkeln herum, „sie können schon platznehmen“, sagt sie und starrt wieder auf den bildschirm, der nachbarsjunge, drahtig, dunkelhaarig, sie hat ihn noch nie mit einem mädchen gesehen, nur mit seinen halbstarken kumpels und motorrollern, rauchend, in jogginghosen, weiten shirts, basecaps richtend, „ich komme dann gleich nach“, patient c ist schon im zimmer, sie schaut zu den schuhen, der knoten ist noch drin, na komm, sagt sie zu sich, steht auf, läuft über den weichen teppich, ihre füße versinken leicht, sie greift nach dem block und setzt sich, im gegensatz zu patient c blickt sie auf einen sonnenuntergang, die farben verteilen sich auf dem wasser, schimmern, rot, gelb, lila, orange, gold, ein gräuliches blau, zehn, höchstens fünfzehn minuten und die sonne wäre verschwunden, sie mag dieses bild, die grobe struktur, die kräftigen farben, die melancholie, die vielleicht nur sie wahrnimmt, „wie war ihr tag bisher“, fragt sie, „wie die anderen tagen, wie alle tage seit dem tod“, patient c klemmt die nase zwischen daumen und zeigefinger, schnieft, wackelt mit dem handrücken am linken nasenloch und schlägt dann die beine übereinander, viel bewegung in diesem kantigen körper, „ich wünschte einfach, er wäre da, aber er ist nicht da, ich kann nichts mit ihm teilen, das ist frustierend, wenn die einsamkeit sich so äußert, dass man wütend wird“, und in dieser hilflosigkeit wird man zu einem haus ohne dach und die ganze zeit regnet es hinein und die feuchtigkeit frisst sich in die wände, mit einem kopfschütteln sagt sie, sie würde jetzt mit einem mann schlafen, der picasso für ein restaurant hält, „nicht wirklich, oder“, „doch, ich sagte, lass uns doch zu picasso gehen und er fragte, ob das der neue italiener ist und ich antwortete, nein, wenn dann schon spanier und er meinte, das ist doch kein spanier, er habe pizza auf der karte gesehen und dann sagte ich ihm, nicht mi casa, picasso und er sagte, er würde nicht verstehen und ich habe trotzdem oder vielleicht deswegen“, an dieser stelle unterbricht sie, verlangt ein taschentuch und reibt an den nasenlöchern wie vorher mit dem handrücken, sie wisse nicht, wohin das führt, diese selbstaufgabe, aber sie könne sich nicht wehren, immer wieder fragt sie, wieso das ihnen passieren musste, andere dürfen doch auch glücklich alt werden, mehr wollte sie nicht, nur glücklich alt werden, und nun bliebe ihr das verwehrt, wie so vieles andere auch, sie notiert, manches kann man nicht überwinden, selbst dann nicht, wenn man die möglichkeiten dazu hat, sie ist der letzte patient für heute, noch zwanzig minuten, wer weiß, irgendwann betrachtet sie vielleicht die birken.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ferenc Liebig
Brücken
Der Mann, er weiß nicht, wo er im Leben steht, ob er überhaupt steht oder schon längst sitzt, und was es bedeuten würde, wenn er denn nun sitzt und nicht mehr steht, dieser Mann, der unruhig ist, ein wenig aufgescheucht sein Leben begeht, nie ankommen mag, sich selbst nicht sicher, ob er überhaupt ankommen will, weil ankommen letztendlich auch Endgültigkeit ausstrahlt, die ihm dann sagen würde, von nun an geht es nicht mehr weiter, hier wirst du verweilen oder schlimmer noch, ausharren müssen, der sich dem Pejorativ dieses Wortes bewusst ist, ausharren, als würde es keinen Ausweg mehr geben, als wäre man eingeschlossen von etwas, das man nicht bezwingen kann, dieser Mann, der ungerne wartet, da warten doch bekanntermaßen bedeutet, sich in Abhängigkeiten zu begeben und Abhängigkeit für ihn wie eine Fessel ist, die sich immer fester schnürt, sich in seine Haut schneidet, kaputte Zellen zurücklässt, Wunden, aus denen Narben werden, Narben, die im Sommer weiß bleiben, die sich abheben, für jeden sichtbar sagen, dir hat man etwas fürchterliches angetan, dass du für den Rest deiner Tage mit dir herum tragen wirst, von denen du auch nach etlichen Versuchen der Gewöhnung den Blick niemals abkehren kannst, weil abkehren mit verdrängen gleichzusetzen ist und verdrängen nur vorübergehend funktionieren kann und nie eine langfristige Lösung ist, dieser Mann, der sich nach Dingen sehnt, die er nicht in Worte fassen kann, denn Worte kratzen nur an Oberflächen, zerkratzen sie, bis das, was man darunter vermuten könnte, noch besser versteckt ist, bis einem Angst und Bange wird, nie dahinter steigen zu können, hinter die Geheimnisse, die verschachtelt, ungeordnet, nicht zähmbar, ineinanderfließend ihre Grausamkeit verdeutlichen, die Freiheit mit Grenzenlosigkeit verwechseln, dieser Mann, fast vierzig, ein wenig müde von seinen unbeherrschbaren Gedanken, läuft an einem Büro vorbei, in dem eine Frau einen Aktenordner auf den Schoß hat, ihn wieder und wieder durchblättert und nach einem Rechenfehler sucht, der ihr sagt, es gäbe noch Hoffnung.
Diese Frau, Mutter zweier Kinder, alleinerziehend, vom Mann im Stich gelassen, der sich irgendwann dazu entschieden hat, es sein zu lassen und von einer Brücke gesprungen ist, aufgeschlagen auf einer dicken Eisschicht, den Schädel in Einzelteile hat zerspringen lassen, wie ein Glas, das einem unachtsam aus der Hand gleitet, sich in Splittern auf einem Boden verteilt, diese Frau mahnt sich zur Ruhe, aber da ist keine Ruhe mehr, nur Bedrohung, Ängste, Rechnungen, die zwar geöffnet, aber ungelesen sind, weil ungelesen sagt, vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, vielleicht kriegen wir noch die Kurve, vielleicht müssen wir nicht aus der Wohnung ausziehen, das Auto verkaufen, uns von den alten Möbelstücken trennen, die im Antiquariat möglicherweise etwas abwerfen, vielleicht passiert etwas Überraschendes, ein Gewinn, obwohl man nirgends mitspielt um gewinnen zu können, vielleicht ein Erbe, weil jemand stirbt, der zur Familie gehört, von dem man noch nie gehört hat, der kurz nach der Geburt verschwunden ist, weil die Mutter noch minderjährig, der Freund überfordert, die Eltern besorgt um das Ansehen in der Gemeinschaft waren, vielleicht trifft man auf einen Mann, der sich nicht daran stört, zwei Kinder mit großzuziehen, der sich nicht von den Schulden abschrecken lässt, diese Frau, Seite um Seite umblätternd, ohne wirklich erkennen zu können, was auf den Seiten steht, weil Tränen verschwimmen lassen, die leersaugende Ohnmacht dem Kopf keinen klaren Gedanken fassen lässt, Hoffnung wie ein Fremdwort ohne Übersetzung bleibt, diese Frau, kurz aufblickend, sieht das Bild ihrer Kinder auf dem Schreibtisch stehen, die Kinder, auf einem Platz in Madrid, knallbunt angezogen, die Arme umeinander gelegt, wie Geschwister, denen Streit fremd ist, die aussehen, als könnten sie niemanden was zu Leide tun, erinnert sich, wie sie danach Eis essen gegangen sind, kurz nachdem sie das Foto geschossen hatte und sie vom warmen Wind gestreichelt, eine Leichtigkeit verspürt hat, die ihr nur dieses eine Mal begegnet ist.
Erdbeereis, sagt der Junge und nahm die Eiswaffel entgegen. Für sein Alter war er schon sehr weit. Weit sein oder besser gesagt, weiter sein als der Rest ist meistens mit Problemen behaftet, weil es nicht normal ist, weiter zu sein und dann sitzen erst die Erzieher mit den Eltern in der Runde und sprechen über Auffälligkeiten, dann kommen Therapeuten, wollen das man Häuser und Bäume malt und Fragen beantwortet und mit Figuren spielt, am besten Situationen nachstellt, Situationen, die Zuhause passieren, die zum Alltag gehören, die Einblicke über das Verhalten der Eltern gewähren, die nach Ursachen suchen, weil man mit den anderen Kindern nicht zurecht kommt, sie ausschließt, von ihnen ausgeschlossen wird, weil man Dinge sagt, die andere Kinder in dem Alter nicht sagen, die überfordern mögen, aus ratlosen Blicken gekräuselte Stirne machen, die das Kind bewerten, kategorisieren, in eine Ecke stellen, die niemand sonst betreten sollte, weil es komisch ist und man auch Angst hat, vom Kind bewertet, kategorisiert zu werden, dass es einen durchschaut, die Regeln und Rituale hinterfragt, sich auflehnt, gefährlich wird, mit seinem Wissen die Überforderung durchdringt und der Junge, an seinem Erdbeereis leckend, lächelt seiner Schwester zu, die zwei Jahre jünger ist, zu ihm aufschaut, wie jüngere Geschwister zu älteren Geschwistern aufschauen, stolz und wissbegierig, sich in ihrer Nähe vor den Gefahren des Lebens beschützt fühlen. Der Junge flüstert seiner Schwester etwas ins Ohr, die daraufhin kichert und für diesen Moment scheinen die Sitzungen in hellen Räumen, mit Therapeutinnen, die ihre Beine übereinandergeschlagen haben, die ihre Haare zum Zopf tragen, ihre Stimmen fürchterlich ins Kindliche verziehen, vergessen und er streckt seine Brust raus, wackelt mit der Hüfte, hüpft von einem Bein aufs andere, was seine Schwester dazu animiert, es ihm nachzumachen, woraufhin ihr Eis auf den Boden fällt, einen vanillefarbenen Fleck auf dem hellen Pflastersteinen hinterlässt und ihr Tränen in die Augen treibt. Kurz nur, weil der Junge ihr sein Eis gibt und sagt, es gibt Schlimmeres als den Verlust einer Eiskugel und dann schaut er zu seiner Mutter, die von der Geste angetan, ihm einen Luftkuss zuwirft.
Der Fleck wird am nächsten Morgen von der Straßenreinigung wegspült. Vermischt mit chlorversetztem Wasser wird er langsam den Bordstein herunterrinnen, in einem Gullischacht verschwinden und von dem anbrechenden Tag, der aufsteigenden Sonne, den Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, die Bussen nachrennen, schwere Einkäufe tragen, überlegen, ob sie die Fenster wirklich geschlossen haben, sich fragen, ob sie glücklich sind, mit ihrem Beruf, die sich einen Ausweg aus der Eintönigkeit erträumen, die ihre Bedürfnisse dem Funktionieren unterordnen, die das Wochenende mit Freunden planen, in Schlangen im Supermarkt den Einkaufszettel noch mal studieren, weil sie das Gefühl nicht loswerden, etwas vergessen zu haben, die sich mal wieder bei ihren Eltern oder ihren Kindern melden müssten, aber abends zu erschöpft sind, um zum Telefonhörer zu greifen und dann doch lieber fern sehen oder Bücher lesen oder auf dem Sofa sitzend Wein trinken und ihrem Partner vom Tag erzählen, vom Chef, der sich wieder aufplustern musste, der alten Frau mit den Plastiktüten, die Pfandflaschen gesammelt hat, der neuen Richtlinie oder dem Formular, auf dessen dritter Seite ein Rechtschreibfehler ist, dem überschwemmten Keller eines Kollegen, der seit Wochen schon gesagt hatte, dass seine Waschmaschine merkwürdige Geräusche macht, den Kindern, die sich in der Schule langweilen und auf die nächste Hofpause warten, den Jugendlichen, die in Parks Gras rauchen und der Meinung sind, ihre Klausuren verrissen zu haben, die sich über Jungs oder Mädchen unterhalten, traurig oder euphorisch werden, die irgendwann zur Uhr schauen und sich verabschieden, den Touristen, die sich vor Sehenswürdigkeiten fotografieren, in Museen einkehren, die die im Reiseführer empfohlenen Restaurants ausprobieren, den Nachrichten, die von Krisen berichten, Toten, Prominenten, die mit Fehltritten auf sich aufmerksam machen, nichts mehr mitbekommen. Der Fleck wird dann schon lange nicht mehr da sein.
So wie der Mann. Er biegt nun um die Ecke, geht seiner Wege, öffnet die Tür zu seiner einsamen Wohnung, macht Dosenraviolis im Topf warm, denkt darüber nach, sich einen Hund anzuschaffen, um sich gebraucht zu fühlen, um an Halt zu gewinnen, obwohl er unschlüssig ist, ob er dadurch wirklich an Halt gewinnen würde und ob er der Verantwortung überhaupt gerecht werden könnte und so isst er die Raviolis im Stehen und der Schatten, den er wirft, wird langsam länger und bald wird der Schatten verschwinden und dann ist nur noch Dunkelheit da und er wird noch immer im Raum stehen, die Raviolis zwar gegessen trotzdem Hunger haben und vielleicht wird er sich an das Mädchen erinnern, in das er mal verliebt war, die in ihm nicht mehr als einen guten Freund sehen wollte und sich dann auf einer Party in einer Ecke mit einem Jungen aus der Parallelklasse verknotet hat und wie sein Herz in tausend Splitter brach und er dann los ist, die Treppe heruntergestürmt, sich aufs Fahrrad geschwungen hat, nach Hause ist und sich im Bett liegend geschworen hat, er würde das nie machen, dieser Demütigung der Liebe noch einmal eine Chance geben.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at