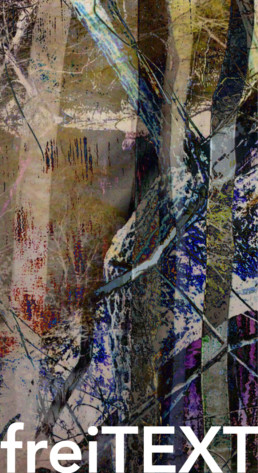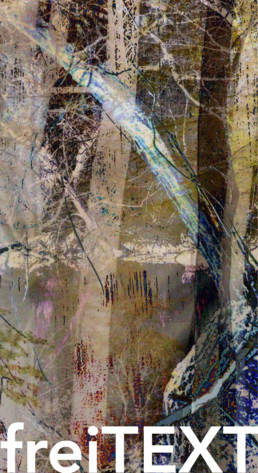freiTEXT | Kerstin Nethövel
Die Kreiselegge
Ein Spaziergänger kam an einem Feld entlang und sah einen Mann am Rand des Ackers quer zur Pflugrichtung rücklings am Boden liegen. Seine Kleider waren zerrissen, und die Haut war aufgeschürft und zerkratzt. „Was ist passiert?“, fragte der Spaziergänger. „Nichts“, sagte der Mann, der am Boden lag. „Nicht viel jedenfalls. Ich habe das Feld bestellt und bin dabei nicht weit gekommen.“ „Und warum liegst du da?“ „Ich sagte dir doch, ich wollte den Boden für die Aussaat vorbereiten. Und bei der Arbeit bin ich unter die Egge geraten.“ „Aber du kannst doch da nicht liegen bleiben“, sagte der Spaziergänger. „Warum denn nicht?“ „Wenn es regnet, wirst du nass, in der Nacht ist es zu kalt, und wenn die Sonne brennt, wirst du geblendet. Außerdem staubt es dann zu sehr. Ich werde dich unter deinem Arbeitsgerät hervorholen.“ „Tu das nicht“, sagte der Mann, der am Boden lag, „Ich habe mich schon vor langer Zeit zwischen den Zinken eingerichtet und eine Position gefunden, in der sie mir nicht weh tun können. So lässt es sich aushalten, wenn ich mich nicht bewege. Ich spüre nicht mehr, dass ich nass werde. Ich spüre nicht mehr die Kälte, und ich werde auch nicht geblendet. Ich liege schon zu lange hier. Der Regen wäscht mich, die Sonne wärmt mich, die Nacht deckt mich zu. Geh einfach weiter. Ich habe mich mit meiner Situation abgefunden, also finde du dich auch damit ab.“
Der Spaziergänger aber blieb weiter stehen und sah auf den Mann hinunter und überlegte, wie er ihn am besten aus den Krallen dieses Gerätes herauslösen könne. „Denk gar nicht erst darüber nach“, sagte der Mann am Boden. „Wir wollen alles dabei belassen, wie es ist.“ Der Spaziergänger ließ nicht locker, machte einige Schritte nach vorn und sank in die weiche Erde des Ackers ein. „Komm nicht näher. Vergiss es.“ „Doch. Ich will dir helfen, und ich werde dir helfen. Ich kann dich doch so nicht zurücklassen“, sagte der Spaziergänger und ruckelte an dem Bodenbearbeitungsgerät herum. Der Mann am Boden unterdrückte einen Schrei. „Jetzt hast du mich geschnitten.“ Er deutete auf den Blutfaden, der seitlich an seiner Hüfte herunterrann und in die Erde tropfte. „Ich sagte dir doch, du sollst weitergehen. Lass mich in Ruhe. Die Zacken sind eingerastet. Sie lassen sich nicht von der Stelle bewegen. Du kannst nichts dagegen tun. Und ich, ich kann es aushalten in dieser Position, wenn ich mich nicht rühre. Du kannst mir nicht helfen.“ Der Spaziergänger aber gab keine Ruhe und beharrte darauf, den, der am Boden lag, aus den krakenähnlichen Griffen des Gerätes zu befreien. Er dachte, wenn ich all meine Kraft aufbiete, kann ich es beiseite bewegen. Und er griff mit den Händen fest zu und biss die Zähne aufeinander und zog und zerrte, und je mehr er zog und zerrte, desto mehr bohrten und gruben sich die Zinken der Kreiselegge in den Körper dessen, der am Boden lag, und rissen das Fleisch von seinen Knochen. Als der Spaziergänger das Gerät endlich ein Stück beiseite geschoben hatte und sah, dass von dem Mann fast nichts übrig geblieben war, setzte sich die Egge langsam in Bewegung und kam auf ihn zu.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Angela Regius
als es anfing mit dem zu hause bleiben hatte ich angst dass es wieder so sein würde wie damals mit dem essen und dem essen und dem . die mangelnde struktur teil des problems und arbeit eine antwort mit ihren prozessen und räumen die standardisiert sind wegen gesundheitlichen erkenntnissen und den kernarbeitszeiten. never change a running system aber was läuft denn überhaupt und was ist bloße kompensation ein anderes ventil für etwas das tiefer sitzt das nicht zu lösen ist sondern abgearbeitet werden muss mit am besten antrainierter methodik. ich esse und esse nicht sondern liege auf dem sofa aktualisiere kaue an den nägeln fahre mit den fingern durch haare und fühle mich oft als wäre aufstehen eine unstemmbare angelegenheit. ich esse und esse nicht aber ob das so wäre wenn du nicht hier wärst mit mir in einer wohnung ob ich tatsächlich stärker geworden bin oder einfach nur das bild aufrecht erhalte weil da jemand ist der es sieht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Viviane Kern
Die Entsorgung
I
Von meiner Wohnung zur Straße sind es 137 Schritte und 52 Stufen, ich zähle jedes Mal genau, um die Länge meiner Schritte einschätzen zu können und brauche meist exakt diese Anzahl. Habe ich mehr Schritte, ist dies ein handfestes Indiz dafür, dass ich gedankenversunken durch die Welt laufe und dies meine Beine hemmt, habe ich weniger, besteht die Gefahr, dass ich mich zu sehr durch den Tag hetze.
Kaum betrete ich die Straße, versuche ich leblose Dinge in hierarchische Kategorien einzuordnen und überlege, was diese in mir auslösen. Ein Mistkübel steht auf der gedanklichen Leiter weiter unten als vergleichsweise ein Auto, bedingt durch die Assoziation mit Schmutz, Ekel und Abfall. Dass in Mülleimer all jene Dinge gestopft werden, die man nicht braucht, deprimiert mich. Zugleich entfacht der Anblick die Neugier in mir, was wohl alles darin stecken könnte. Eine Ode an die Freude singe ich innerlich, wenn ein Mistkübel ungewollt aufgegangen ist und der ganze Müll wüst und entblößt auf der Straße liegt. Der halb ausgetrunkene Kaffee vermischt sich mit dem Papier, das die Flüssigkeit absorbiert, gepaart mit nicht identifizierbaren Essensresten und einem bunten Berg aus Plastik, das den rinnenden Kaffee nicht aufsaugen kann. Plastik ist beständig, nimmt nichts auf, manchmal sehne ich mich danach. Mülleimer müssen geleert werden, irgendwann platzen sie aus allen Nähten und bereits ein kleines Teilchen würde sie zum Überlaufen bringen. Leert man die eigenen Mülleimer nie, geht man von alleine daran kaputt. Kaum verlasse ich meine Wohnung, sehe ich Menschen, deren Mülleimer so groß sind, dass man es ihnen von außen bereits ansieht.
Zu den Mülleimern gehört auch das Wort entsorgen, das ich schön finde. Ich werde entsorgt, von meinen Sorgen befreit, ich kann diese abschütteln und loswerden, sie werden entleert – einfach so - für mich. Es ist befreiend, etwas in den Mistkübel zu werfen und nie wiederzusehen. So setze ich Fuß für Fuß vor mich, spüre wie meine Sohle den festen Grund berührt, wieder emporgehoben wird und gegen die Luft ankämpft, die kein Gewicht hat.
An der Ecke eines Wohnhauses verdorren Blumen vor lauter Hitze und fehlendem Wasser, die Stängel werden bereits leicht braun und beginnen sich zu verbiegen. Die Blumen werfen ihre Blüten ab und versuchen verzweifelt, sich das Leben zu retten. Blumenstiele sind für mich saftig, die Blüten sollen duften, Farbe tragen, um der Welt einen Hauch von Schönheit zu verleihen. Ein Mann lehnt an einer Hauswand und zieht an einer Zigarette. Das Papier verwandelt sich mit dem Tabak in Asche und kleine Teilchen davon fliegen durch die Luft. Der Mann hält den Rauch kurz in seinen Lungen, bis er diesen genüsslich ausstößt, den Rhythmus der Stechuhr für einige Zeit durchbrechend. Der Rauch treibt aufwärts, als wäre er nie hier gewesen, in den Kondensstreifen-freien Himmel, die Luft ist sehr trocken.
Ich gehe die Straße entlang weiter, zähle meine Schritte, alle Geräusche, die zu mir hervordringen, nehme ich intensiv wahr: Stimmen, Motoren und ich sehne mich nach Wasser und Kälte. Der Schweiß tropft mir von der Stirn auf meine Schulter und rinnt den Oberarm langsam herab, ich kann spüren wie er kurz innehält, bevor er auf den Asphalt tropft und in diesem Moment ein kleiner Fleck auf dem Gehsteig hinterlässt. Er wird aufsteigen und verdunsten. Was wohl alles diesen kleinen Teil des Gehsteigs schon berührt hat? Ein Mann, der hinter mir geht, steigt genau auf meinen akkurat hinterlassenen Fleck und verwischt meine Spuren.
II
Ich setzte mich in das Kaffeehaus, in dem ich immer sitze. Zweiter Tisch von links genau der rechte Stuhl, hier kann man das tägliche Geschehen gut beobachten. Ich betrachte die einzelnen Gesichter, die vorbeieilen und obwohl es die Geschwindigkeit der passierenden Leute nicht wirklich möglich macht, mehr als einen flüchtigen Blick auf deren Ausdruck zu werfen, habe ich das Gefühl, man könne Jahre darin lesen.
Verharrend in meinem Beobachten passiert etwas Suspektes, fast Bedrohliches, mit dem niemand gerechnet hat: Ein Mann schaut in alle Richtungen und versucht sich vor einem Mistkübel zu positionieren, dass sichergestellt ist, dass niemand seinen verdächtigen Vorgang sieht. Unter seiner Jacke holt er, sein Plan wirkt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr penibel durchdacht, den wer trägt bei dreißig Grad im Schatten eine Jacke, ohne die Intention, etwas verbergen zu wollen, einen Sack hervor, der zu groß ist um in die kleine Öffnung des Mistkübels zu passen. Während er sich halb auf die Mülltonne legt und sich gegen den Sack stemmt, kommt sein Blut in Wallung und sein Gesicht errötet. Der Sack will nicht hineinpassen, als wäre ihm bewusst, hier geschieht eine tätliche Entgleisung.
Der Mann beginnt sein Gesicht zu verziehen, ich meine sogar zu erkennen, dass er vor sich hinmurmelt. Er blickt wieder nach links und rechts, um ja unentdeckt zu bleiben. Jetzt beginnt das ganze Geschehnis zu eskalieren und trägt sich wie folgt zu: Dem Mann ist bewusst, dass sein Sack nicht in die Öffnung passt, legt diesen bedächtig am Boden, fast zärtlich, um dann viermal fest mit dem Fuß auf eine genaue Stelle zu steigen. Er hebt den Sack wieder auf, greift hinein und versucht den Inhalt zu zerreißen, doch die Kohäsionskraft des Gegenstandes trotz ihm. Er presst den Inhalt kraftvoll zusammen, dieser scheint jedoch gummiartig wieder in seine alte Position zu springen. Noch einmal fordert er den Mistkübel heraus und probiert den Sack durch die Öffnung zu befördern, erfolglos. Jetzt beginnt er richtig wütend zu werden und stößt einen Schrei aus, es hört sich an wie:
„Scheiß Mistkübel“, und tritt dagegen.
Einmal mit dem Fuß und da dies nicht zu reichen scheint, schlägt er mit beiden Fäusten oben auf den Deckel.
Was jetzt passiert, war vorherzusehen: Der Mistkübel öffnet sich und entleert die Schwere, die an ihm haftet. Freude, schöner Götterfunken! Wie angewurzelt steht der Mann da, als er merkt, was sein Wutausbruch für Konsequenzen hat. Er eilt so schnell er kann mit seinem Sack davon.
III
Erst jetzt merke ich, wie die Wespen einen Festschmaus vor meinen Augen genießen: Meine bestellte Limonade, ich habe noch keinen Schluck getrunken. Ich bezahle und mache mich auf den Heimweg, von der Straße zu meiner Wohnung sind es 137 Schritte und 52 Stufen, ich zähle sie pedantisch genau. Lange denke ich an diesen Mann und hoffe, dass er irgendwann diese Last des Sackes loswird, die er sich von der Seele reißen wollte. Manchmal sehe ich Menschen, deren Mülleimer so groß sind, dass man es ihnen von außen bereits ansieht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Olav Amende
Olav Amende - Mittag. Fügnis.
Der 12-Uhr-Glockenschlag weitet sich in der Stadt. Vom Friedhof bis zur Seniorenresidenz, die der stilvoll gekleidete Gruftie-Altpunker mit Sisters of Mercy im Ohr zum Beginn seiner Schicht betritt; von der Kleingartenanlage, in der der ehemalige Vorstand die beiden fremden Spaziergänger auf sicherer Distanz hält, bis zum Wasserturm, auf dessen Gesims sich ein weißes Täubchen niederlässt und dabei von niemandem erblickt wird. Der 12-Uhr-Glockenschlag schwebt über den versteinerten Wellen des Marktplatzes und auf diesem steht heute eine Gulaschkanone in Grün. Betrieben wird die grüne Gulaschkanone von einer Rentnerin – einstige Köchin in einer Oberschule oder einem Kindergarten oder in einem VEB-Großbetrieb, der Papiersackfabrik vielleicht. Unterstützt wird sie von ihrer Enkeltochter. Gerade ist Pause. Das Mädchen übt sich im Radschlagen. Sie schlägt die Räder quer über den gesamten Marktplatz, so lange, bis ihr schwindelt und sie in Folge dessen aufs Hinterteil fällt. Da hupt ein von rechts kommendes Auto einem Kontrahenten von links hinterher und bremst nicht ab. Morgen wird das in den „Groitzsch-Pegauer Nachrichten“ nachzulesen sein, wenn es diese noch gäbe. Im Blumenladen haben sich die alten Frauen zum Schwatzen versammelt, während der Florist das Kleingeld zählt, das sie ihm in die Tasche seiner Schürze stecken und eine ihrer Freundinnen nebenan beim Metzger an der Theke zur Aufbesserung ihrer Rente Metthalbbrötchen zubereitet, sehr zur Freude zweier junger Männer. Am Rathaus klopft ein Lehrling Steine – ein Quadratmeter ergibt eine Stunde, schätzt er und blickt auf das Trassierband in zwanzig Meter Entfernung. In der Zwischenzeit ruft sein Großvater zwei durch die Anlage des Kleingartenvereins „Naturfreunde 1907“ e. V. streifenden jungen Männern entgegen: „Was gibt es hier Interessantes?“ Die Stille, die zwischen dieser Frage und der Gegenfrage: „Was gibt es für Sie Interessantes?“ klafft, ist das Echo des 12-Uhr-Glockenschlags, der Moment, in dem sich das Täubchen auf das Gesims des Wasserturms niederlässt oder sich von diesem erhebt, der Gruftie-Altpunker aus seinem Ledersakko in den weißen Kittel schlüpft, die ehemalige Großköchin den Kanoneninnenraum umrührt, ein Besucher der Groitzscher Buchhandlung hinter einer Reihe Schulpflichtlektüre ein verstecktes Buch entdeckt und das Mädchen ein Rad zu viel schlägt.
Zwei Arbeiter der Stadtreinigung sitzen in ihrem Wagen und schlürfen Erbsensuppe. Das Mädchen stellt sich an den Rand der Dreierstufen und lunzt zu den Schreibenden auf der Parkbank. Einer der beiden schaut mal hin, mal weg, mal hin, bis er endlich begreift, dass das Mädchen darauf wartet, dass er ihr zuguckt, wenn sie über die Stufen jumpt. Gut, schaut er eben wieder hin. Das Mädchen grinst, beugt sich zurück, der Lehrling erhebt den Fäustel, die Arbeiter pusten auf ihre Löffel, das Mädchen springt. Der ehemalige Vorstand des Kleingartenvereins „Naturfreunde 1907“ verschließt seinen Schuppen und murmelt, während sich das Täubchen in die Luft erhebt, der Pfleger über die Hand eines alten Mannes streicht, sich einer der beiden jungen Männer auf der Bank eine Faser Mett aus den Zähnen zieht, und das Mädchen auf dem Bauch landet. Es feixt. Die Großmutter rührt noch einmal die Kanone um.
Im Buchladen holt einer der beiden Schreibenden Prousts „Auf der Suche nach der usw.“ hervor. Die Verkäuferin tritt heran und sagt: „Ach, der. Der ist hier hängengeblieben.“ Der 12-Uhr-Glockenschlag verhallt, das Weiß der Taube löst sich ins Weiß der Wolken und die ehemalige Großköchin reicht ihrer Enkeltochter eine Schüssel mit Erbsensuppe.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Magdalena Maier
Glück
Ich stehe vor meinem Teich und stell mir vor, er wär das Meer. Also voll Salz und Fische und mit Sand am Rand. Wenn jemand die Blätter vom Apfelbaum mit Booten oder Wellen austauschen würde, wäre die Transformation perfekt. Was will man sonst von einem Meer? Wasser, Salz, Boote, Fische, Wellen, Strand.
Leider ist mein Teich kein Meer. Gestern war der Himmel grau, heute ist er blau und mein Teich spiegelt die Wolken, weil er glaubt, er sei ein Spiegel. Mich spiegelt er nicht. Die Katze vom Nachbarn fällt durch die Hecke und landet trotzdem auf allen Vieren. Dass ich regelmäßig stolpere und hinfalle, rechtfertige ich dadurch, dass ich nur zwei Beine habe. Mit zwei als Back-up würde ich auch nicht stürzen. Die Katze vom Nachbarn kitzelt inzwischen meine Waden mit ihrem Schwanz. Die Katze ist schwarz. Ich stell mir vor, dass das Glück bringt.
Aus Reflex trete ich das Tier, als es mich zu Kratzen beginnt. Das Geräusch, das dem kleinen Körper entflieht, würde bei einem Menschen tief unten aus der Kehle kommen. Ein Fluch fällt mir aus dem Mund und jagt die Katze in die Flucht. In meiner Haut ist eine Linie, die rote Perlen aufzufädeln beginnt. Ich stelle mir vor, es wären Rubine. Leider schmelzen sie unter meinem Blick und rinnen in meine Socken.
Egal, die muss ich sowieso waschen, weil ich jetzt einen Schritt in den Teich hinein mache. Dass das Wasser in der Wunde nicht brennt, verunsichert mich. Ist das nicht normalerweise so bei Salzwasser? Meine Schuhe werden vom erdigen Boden verschluckt und ich sehe sie nicht mehr. Der zweite Schritt fällt mir schwer, weil sie im Morast eingesunken sind und mit dem anderen Fuß bleibe ich stecken, stolpere, würde auf allen Vieren landen, wenn ich nur 4 Beine hätte. Aber so klatsche ich mit meinem ganzen Körper in den Teich hinein.
Mein Gewand ist schwer an meiner Haut, bewegt sich träge vor Nässe, klebt an mir und gleichzeitig schwimmt es von selbst. Meine Schuhe sind aus blei und erschweren meine Brustschwimmbewegungen. Fast kann ich es nicht glauben, also ich schon nach kürzester Zeit am anderen Ende des Teichs angekommen bin. Ist das Meer nicht größer?
Die Sonne scheint an diesem Ufer. Der Sand ist ziemlich grobkörnig und manch einer würde behaupten, es wäre Kieselsteine, die ich letzten Sommer hier aufgeschüttet hätte, aber ich weiß, dass es Meeressand ist. Weil man am Strand nicht mit nassen Kleidern steht, ziehe ich das T-Shirt aus und werfe es ins Wasser. Dann die Schuhe, schließlich die Socken. Die Hose geht unter, als ich sie nachschmeiße, die Unterhose schwimmt. Die Brise, die in dieser Bucht weht, ist kühl, aber sie trocknet die Wassertropfen an meinem Körper. Nur die Haare bleiben länger nass und kleben als Coolpack an meinem Nacken.
Die Hecke zum Nachbarn ist hoch. Die Fenster vom anderen Nachbarn sind mit Rollläden verschlossen. Obwohl sie beide immer zu Hause sind, sehen sie mich nie, wenn ich hier nackt stehe. Kein Wunder, ich bin ja auch am Meer. FKK-Bereich, da schaut man nicht hin. Die Katze sitzt am anderen Ufer und beschnuppert meine Unterhose, die es dort drüben angeschwemmt hat. Bringt meine Unterhose jetzt Glück?
Bis meine Haare trocken sind, dauert es noch eine Weile. Ich setze mich in den Sand und beginne eine Burg zu bauen. Manch einer würde sagen, es sei eine Kieselpyramide, aber manch einer würde auch sagen, die Luft würde hier nicht nach Meer schmecken. Manch einer würde so einen blauen Himmel wegen der Rollläden gar nicht bemerken. Er würde nicht sehen, dass im Sonnenschein heute ein Meer in meinem Garten rauscht. Er würde seine Wäsche waschen und die dunklen Wolken am Nachmittag argwöhnisch beäugen, bevor er die Wäscheständer über Nacht doch lieber wieder ins Wohnzimmer stellt. Er würde im Regen von Morgen die Gartentür nur zum Stoßlüften öffnen und wenn er aus dem Fenster im ersten Stock schauen würde, würde er seufzen. Seufzen über den seltsamen Nachbar, der wieder und wieder einen Handstand vor dem Teich versucht und wieder und wieder scheitert und im Wasser landet.
Was der Nachbar nicht weiß, ist, dass ich Morgen eine Schnitzelgrube in meinem Garten finden werde. Dass es regnet, macht das Ganze ein wenig unangenehm, aber einen Handstand wollte ich immer schon lernen. Die Katze leistet mir an Regentagen selten Gesellschaft und so langsam frage ich mich, ob sie tatsächlich Glück bringt, oder ob sie mir das nur von ihrem Besitzer leiht. Weil dann müsste ich es ja irgendwann zurückgeben. Und darauf habe ich keine Lust.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jasmin Gerstmayr
Der dritte Wunsch
Ich wische über mein Phone, nach rechts, rechts, rechts. Währenddessen fällt mein Blick auf meinen Bonsai-Baum. Ich habe ihn gestern gedüngt, nur ein klein wenig, denn wenn man es zu gut meint mit den Dingern, dann sind sie beleidigt. Genauso ist es mit den Frauen. Alle wollen sie den Bad Boy mit dem Dreitagebart. Aber wehe, man ist in den richtigen Momenten dann nicht lieb und sanft. Ha, ein Match. Endlich mal wieder. Ich schaue mir ihre Profilbilder an. Sie hat raspelkurze Haare und trägt schwarze weite Sachen. Eigentlich nicht mein Typ, ich mag lange Wallemähnen, die man den Mädels aus dem Gesicht streichen kann, bevor man sie küsst. Wenigstens ist ihre Figur ganz ok. Vielleicht ein bisschen zu wenig Busen. Naja. Hast du morgen Lust auf ein Treffen, schreibe ich ihr. Gern, antwortet sie fast sofort. Ich befühle die Erde meines Bonsais. Sie ist noch feucht. Stolz streiche ich über seine kleinen Blätter. Ich habe wirklich ein Händchen dafür.
Ich bin vor ihr da, wie sich das gehört, denn eine Dame lässt man nicht warten, auch wenn die, die jetzt kommen wird, wohl keine klassische Dame ist. Zumindest von der Frisur her. Ich stelle mich vor das Lokal und zünde mir einen Tschick an. Da biegt auch schon ein Mädel um die Ecke, mit glattrasiertem Kopf. Sie trägt einen schwarzen Mantel und kommt direkt auf mich zu. Lukas, stellt sie fest, ohne eine Miene zu verziehen. Ihre Augen schauen ganz nett aus, groß und bernsteinfarben. Freut mich, sage ich und gebe ihr Küsschen auf die Wangen. Dabei bemerke ich, dass sie ein wenig größer ist als ich, obwohl sie keine High Heels trägt. Den Rest des Abends werde ich auf Zehenspitzen verbringen, soviel steht fest. Ich dämpfe meine Zigarette aus und schnippe sie lässig davon. Sie hebt ein wenig die Augenbrauen. Ich tue so, als würde es mir nicht auffallen, und halte ihr die Tür auf.
Es ist recht voll, und wir setzen uns erst mal an die Bar. Ich will ihr aus dem Mantel helfen. Geht schon, sagt sie. Sie trägt lockere, schwarze Sachen, wie auf den Fotos. Naja. Bier passt, fragt sie mich. Ich nicke, und noch bevor ich die Initiative ergreifen kann, bestellt sie zwei Bier. Ich kenne keine Frauen, die Bier trinken, sage ich. Ich kenne keine, die es nicht tun, meint sie gleichgültig. Sie schiebt mir mein Bier hin. Die nächste Runde geht auf mich, sage ich mit fester Stimme. Schon gut, antwortet sie. Sie nimmt einen großen Schluck von dem Bier und seufzt zufrieden. Es schmeckt auch wirklich herrlich. Sie wischt sich mit dem Handrücken den Schaum von der Oberlippe. Also, was machst du so, fragt sie mich. Ich nenne den Namen der Firma, bei der ich ihm Controlling tätig bin, und erläutere die grundlegenden wichtigen Aufgabenbereiche meiner Position. Aha, grinst sie, stolz drauf, gell. Es ist das erste Mal, dass ich sie heute lachen sehe. Sie hat schöne Zähne, perfekt aneinandergereiht. Mein Gesicht wird ein wenig heiß. Na, und was machst du, frage ich kühl. Sie ist in der Erstbetreuung von Flüchtlingen tätig. Klingt spannend, sage ich, und das meine ich auch so, obwohl ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen kann, wie das ist, als junge Frau mit so vielen fremden Männern. Ob die einem nicht auf die Pelle rücken. Ich halte aber lieber den Mund. Wahrscheinlich schüchtert sie die Typen sowieso alle ein. Schöne Profilbilder hast du übrigens, sage ich stattdessen. Sie hört mich aber nicht, denn sie beugt sich über den Tresen und bestellt noch zwei Bier. Passt das, fragt sie mich, obwohl sie eh schon bestellt hat. Ich nicke ein wenig verwundert. Sie lehnt sich plötzlich zu mir, nahe zu mir. Ihr Atem riecht nach etwas Minzigem und ein wenig nach Bier, aber nicht unangenehm. Wenn du drei Wünsche frei hättest, sagt sie mit leiser Stimme, wofür würdest du dich entscheiden. Ich finde die Frage irgendwie merkwürdig, bei einem ersten Date. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, sage ich. Es stimmt zwar nicht, aber egal. Sie scheint meinen Widerwillen zu bemerken, denn schnell sagt sie: Gleiche Rechte für alle, und genügend Zeit für meine Malerei. Sie macht eine Pause. Den dritten Wunsch, meint sie dann, den würde ich mir aufheben, denn man weiß nie, was noch kommt. Klingt vernünftig, sage ich und nehme noch einen Schluck von meinem Bier. Eigentlich kann ich auch einfach drauflosreden, ich sehe sie sowieso nie wieder. Irgendwie ist es ja auch lustig, auf solche Frauenfragen zu antworten. Ich wünsche mir ein kleines Haus, irgendwo im Grünen, und zwei Kinder, sage ich. Ich erkläre ihr, wie wichtig es ist, dass das Haus einen großen Garten hat, denn ich möchte mein eigenes Gemüse anbauen. Ich warte darauf, dass sie lacht. Ich bin nicht ungeschickt mit Pflanzen, verteidige ich mich schon mal. Habe ich das behauptet, sagt sie, und erzählt von den Anbauversuchen auf ihrem Balkon, Chilis, Heidelbeeren, Minigurken. Nur die Tomaten, die gehen mir immer ein, meint sie achselzuckend. Du darfst sie nicht direkt in die Sonne stellen, erkläre ich, das mögen sie nicht. Sie brummt irgendetwas Unverständliches. Gehen wir eine rauchen, sagt sie dann.
Draußen beginnt sie, sich mit irrer Geschwindigkeit eine Zigarette zu drehen, und hält sie mir hin. Danke, sage ich und fische mein Feuerzeug aus meiner Hosentasche. Ich nehme einen tiefen Zug. Es ist keine besonders klare Nacht, man sieht nur ein paar Sterne. Trotzdem irgendwie schön. Wir sagen beide nichts. Nach einer Weile dämpft sie die Zigarette aus, im Aschenbecher auf dem Stehtisch. Irgendwie habe ich plötzlich das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen, dass ich eigentlich sonst meinen Tschick nicht einfach auf den Boden werfe, aber dann lasse ich es doch. Magst du mir deine Wohnung zeigen, sagt sie mit sanfter Stimme und nimmt meine Hand. Hm, das ging ja flott. Klaro, sage ich perplex und ein wenig dümmlich. Ich denke schnell nach, ob meine Wohnung in einem vorzeigbaren Zustand ist, und gratuliere mir selbst zu meinem Ordnungssinn. Nur das Poster mit dem Playboyhäschen über dem Sofa könnte mir Probleme bereiten. Egal. Ich streichle ihre Hand, den ganzen Heimweg lang. Sie ist ganz weich.
Nach dir, sage ich. Sie zieht sich rasch ihre Schuhe aus und geht ins Wohnzimmer. Für ihre Größe hat sie unerwartet zarte Füße. Fast niedlich. Sie lässt sich auf das Sofa fallen, als wäre es ihr eigenes. Ich muss grinsen. Cooles Bild, sagt sie dann, und deutet auf das Playboyhäschen mit den Megatitten. Ich kann nicht erkennen, ob sie das jetzt sarkastisch meint, darum sage ich lieber nichts. Sie steht wieder auf, tritt dicht an mich heran und flüstert: Was war der dritte Wunsch. Ohne meine Antwort abzuwarten, geht sie vor mir auf die Knie, zieht mir die Jeans herunter und nimmt meinen Schwanz in den Mund. Herrlich. Ich stöhne.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, bin ich erstaunlich gut drauf. Kein Kopfweh, keine Gliederschmerzen. Naja, waren ja auch nur zwei Bier. Der Platz neben mir ist leer, darum gehe ich in die Küche, nur in Boxershirts. Soll sie mein feines Sixpack ruhig auch mal bei Tageslicht sehen. In der Küche ist sie aber nicht, und auch nicht im Bad. Schnell schaue ich bei den Schuhen nach. Ihre sind nicht mehr da. Ich seufze. Ich greife nach meiner Jeans und ziehe mein Phone aus der Hosentasche. Keine neue Nachricht. Wie, sie bläst mir einen, wir haben Sex, und sie haut einfach ab. Echt jetzt. Genervt wandere ich zurück ins Bett. Irgendwie fühle ich mich doch ein wenig müde. Ich schließe die Augen und döse ein bisschen und denke an mein kleines Haus mit dem Garten. Die Wiese streift meine Waden. Ein Junge und ein Mädchen spielen Fußball. Sie kreischen unbeschwert. Ich beuge mich über eine Tomatenstaude. Es hängen einige glänzende Früchte dran. Abendessen, ruft sie plötzlich. Sie trägt ein schwarzes Kleid und steht barfuß auf der Wiese. Ihre Füße sind wirklich niedlich, die Zehen ganz klein. Ich gehe zu ihr hin, ein wenig auf Zehenspitzen, und lege meinen Arm um sie. Sie lehnt sich gegen mich. Die Tomaten werden, sage ich. Ich spüre ihr Lächeln.
Als ich wieder aufwache, checke ich zuallererst mein Phone. Keine neue Nachricht. Ich überlege, ob ich ihr schreiben soll. Warum nicht, denke ich mir dann. Ich begnüge mich mit einem simplen: Danke für den schönen Abend. Kuss, Lukas. Schnell absenden. Ich stehe langsam auf und trotte zu meinem Bonsai ins Wohnzimmer. Er schaut noch immer prächtig aus, allerdings hat er über Nacht zwei braune Blätter bekommen. Beunruhigt zupfe ich sie ab. Dann fällt mein Blick auf die Wand über dem Sofa. Ich traue meinen Augen nicht und trete näher heran. Das Poster mit dem Playboyhäschen fehlt. Stattdessen klebt da ein Post-It: Danke, würde mir die gern selbst aufhängen. Mit Smiley. Ungläubig schüttle ich den Kopf und lasse mich auf das Sofa fallen. Dann checke ich mein Phone, wieder. Keine neue Nachricht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stefan Kreiger
Auto
Auf dem Weg nach Hause in dem Boliden: Genaugenommen habe ich ihn gestohlen oder zumindest beiseite geräumt, wie man so sagt. Das Auto meines Vaters ist mehr oder weniger das Einzige, was ich retten kann von dem ganzen Hofstaat. Der Zustand, den er mit seinem vorzeitigem Tod hinterlassen hatte, verspricht ein riesen Scheißhaufen zu werden. Beginnt zu wachsen, kaum dass er seinen letzten Atemzug getan. Eigentlich schon vorher, vielleicht lange vorher. Es hatte sich was angesammelt. Heute weiß ich mehr. Aber viele Dinge kann man ignorieren. Manche ein Leben lang. Juristisch bin ich etwas mehr involviert als mir lieb ist, in dieses Kartenhaus, das in Zeitlupe über mir beginnt in sich zusammenzufallen - und eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs darstellt.
Mir ist seltsam, meine Zukunft scheint mir ungewisser als sonst. Ich schwimme in dem fetten, silbernen Mercedes, der eher einem Zuhälter gut zu Gesicht stünde - Seltsame Fassaden, die mir zwei Nummern zu groß sind. Das Gaspedal spürt man kaum. Ich glaube mich an eine Halbautomatik zu erinnern. Bequem, zugegeben und der Fuß liegt wohl etwas lockerer als sonst: Ich trete drauf - Turbo. Aber meinen Testosteronspiegel hebt es nicht merklich, auch wenn es so gedacht sein dürfte. Ich kann Fahrzeuge solcher Machart nicht ausstehen. Irgendetwas daran ist verkehrt, überzogen - zu breit, zu lang, dafür zu flach. Als hätte man in einer Dimension gespart, damit er in den Anderen besser klotzt. Was soll man dazu sagen. Mehr Status als Transportmittel eben.
Gedankenversunken geht es weiter heimwärts. Neben mir seine Seidenkrawatten und das Silberbesteck. Ein paar andere Erinnerungsstücke rollen lose auf der Rückbank. Ich fühle mich schäbig. Ich telefoniere und erfülle jede Voraussetzung für Rollenbilder, die ich eigentlich zu meiden suche. Eine Zivilstreife macht sich bemerkbar, hält mich auf. Ich versuche unauffällig - also weder zu schnell noch zu langsam - ranzufahren. Es gelingt mir stattdessen fast eine Vollbremsung am Pannenstreifen. Mein Herz klopft, mehr prinzipiell als aufgeregt, wie immer eigentlich wenn Freund und Helfer meine Wege kreuzen: Die angeborene Hassliebe zu den Autoritären. Meine sexuellen Vorlieben erklären sich so, obendrein. Uniformierte Figuren nähern sich geübt dem Raumschiff.
Dem Gesichtsausdruck der Beamtin ist zu entnehmen, dass sie Anderes erwartet hat, als ich das Beifahrerfenster elektrisch runterlasse. Unbeholfen, weil ich die neumodische Mechanik nicht sofort bedienen kann und wohl eigentlich eher nach einer Kurbel suche. Sie hat keinen Pferdeschwanz, wie so viele ihrer Kolleginnen, als sie sich siegessicher ins Cockpit beugt. Ich bekomme ungewollt völlig automatisch mein schuldbewusstes Büßergesicht, das ich schon seit meiner Kindergartenzeit mit mir rumtrage. Ich habe keine Kontrolle darüber. Sie blickt sich um und sieht einen Dieb. Man solle sich nicht wehtun, lacht sie lapidar und meint wohl alles zusammen, sprich: Fahrzeug, Ware, Fahrstil und Telefonat in Kombination. Sie winkt den Kamerad herbei, der die Nummerntafel übers System jagt.
Ich stammle etwas von toten Vätern, Erbstücken und pflegebedürftigen Verwandten (der Anruf) um eine grobes Bild zu skizzieren. Ich spüre Schweißperlen. Der Check ergibt nichts. Sie sieht mir nochmal in die Augen, da sie mich nicht einordnen kann, wie ich vermute. Ich versuche standzuhalten. Ich habe nichts falsch gemacht - nicht wirklich jedenfalls - dennoch fühlt es sich so an - das machen sie immer so. Ich löhne einen Fantasiebetrag von glatten fünfzig Mücken in mitteleuropäischer Währung in bar und bekomme im Gegenzug eine Quittung und die üblichen elterlichen Ratschläge für künftiges Verhalten. Ich verspreche mich zu bessern und bedanke mich demütigst. Halb geheuchelt, halb ernst gemeint, wie es meiner ambivalenten Natur entspricht - Erledigt.
Zuhause parke ich den Schlitten in die Tiefgarage und hoffe insgeheim, dass mich keiner der Nachbarn auf den neuen Untersatz anspricht. Da steht er nun und triumphiert - ich verwünsche ihn. Es wird eine Weile dauern, bis ich ihn veräußern kann. Das deutlich funktionalere Eigengefährt wird lieblos als Dauerparker vors Haus befördert. Ich sammle Mut und rausche in den nächsten Tagen zu einer dieser Kfz-Verkaufsstellen - mit dem neuen Ding. Der Berater inspiziert auf Herz und Nieren, labert einen Standarttext. Ich glaube ihm nicht und meine im Privatverkauf mehr lukrieren zu können. Also wieder zurück - langsam wird es eine Odyssee. Bis ich mich dazu durchringe, Näheres in die Wege zu leiten, vergehen Wochen. Dann alles sehr schnell: Fotos, Beschreibung, Anzeige, Ebay-Generation eben.
Einschlägige Interessenten melden sich, versprechen das Blaue vom Himmel. Auf den Fotos sehe er ja gut aus, man nehme ihn auf jeden Fall, und so weiter. Ein Treffen wird arrangiert. Tags darauf, abgemachte Uhrzeit: Ich stelle mich runter, damit man mich findet. Ein Wagen fährt vor, nicht unähnlichem Jenem, den ich eigentlich loswerden zu gedenke. Drei Typen steigen aus und mir wird schlagartig bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe. Sie passen ins Bild. Ich lege sie in die dazugehörige Schublade und versuche mich nicht zu sehr über meine Vorurteile zu ärgern. Auch sie erkennen mich sofort und freuen sich über Beute. Eine Probefahrt: Ich sehe mich gezwungen mitzufahren uns steige ein - in eine archaische Blase, die zu beschreiben mir jegliche Worte fehlen.
Wir sitzen zu viert im Ufo, der Jüngste von Ihnen am Steuer. Die andere Beiden geben sich als Vater und Bruder aus. Man möchte offensichtlich die patriarchale Flotte erweitern, stelle ich mir vor. Als sie in der 30er Zone mit Karacho den Turbo austesten, fragen ich mich was ich hier eigentlich tue. Nerven liegen blank, mein Unterbewusstsein schickt Stoßgebete, Gott weiß wohin. Der Rest verblasst - Wieder Tiefgarage: Dieses und Jenes wird plötzlich bemängelt, mit Speziallampen wird die Lackierung enttarnt und überhaupt. Sie reden auf mich ein, wissen ihre Zeilen auswendig. Ich bin ein gefundenes Fressen. Sie sind von weit angereist und wollen das Ding unbedingt, aber nicht zum ausgeschriebenen Preis. Es geht lange hin und her und sie kriegen mich soweit - Schließlich habe ich die Schnauze voll.
Ich will nicht mal mehr zurück zu der Verkaufsstelle, wo deutlich mehr geboten war - Der Mann dort hatte recht behalten. Aber die Karre ist schon abgemeldet und ich habe keine Lust mehr auf weiteres Prozedere. Ich lenke ein. Handschlag - in Mehrzahl. Ihre Flossen fühlen sich an wie nasse Lappen. Keiner von ihnen sieht mir in die Augen bei diesem Ritual. Sie haben ein Schnäppchen gemacht und freuen sich. Gleichzeitig verachten sie mich zutiefst und ich Sie. Unmut staut sich, in der ansonsten so gemütlichen Garage an diesem Tag - So funktioniert die Welt. Der Älteste von Ihnen entdeckt schlussendlich noch das Behindertenemblem am Heck, versucht es angewidert abzukriegen. Er weiß nicht wohin damit und drückt es mir in die Hand. Ich fühle abermals seine schlappe, feuchte Pfote in der Meinen.
Papiere werden unterfertigt, Unterlagen ausgehändigt. Ich trenne mich vom Zündschlüssel und damit dann doch recht abrupt von dem Unding. Die Bürde, die Last, die verbundene Emotion und das Symbol, zu dem dieses Auto für mich geworden war, verlassen mich allerdings erst Jahre später. Leise und schleichend. Wie eine Schildkröte die, wenn man eine Weile nicht hinsieht, fort ist. Vielleicht um die nächste Ecke, eine Straße weiter, unter der Brücke, am Kiosk vorbei, aus der Stadt raus, über die Grenze, westwärts, den Kontinent auf dem Schiffsweg verlassend, im Nebel an neuen Ufern anlegend, eingereist, nach Kalifornien, weiter übergesetzt und immer fort. Aber die Welt ist eine Kugel und die Schildkröte kommt wieder. Du siehst hin, siehst weg, siehst nochmal hin und schon ist sie wieder da.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Maline Kotetzki
Kirschrot
Langsam ließ sie die Bürste durch ihr ohnehin schon spiegelglattes Haar gleiten. Sie griff es im Nacken zusammen und drehte es solange, bis an ihrem Hinterkopf ein fester Knoten entstand, den sie mit einer goldene Spange feststeckte. Keine dieser Bewegungen nahm sie bewusst wahr, alles an ihr war auf Automatisierung eingestellt. Wenn sie jemand fragen würde, welche Ohrringe sie anlegte - es waren die blauen mit den kleinen Perlen -, sie könnte die Frage nicht beantworten. Seit drei Wochen war das nun schon der Fall. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, was seit dem Anruf geschehen war. Sie hatte einfach nur funktioniert, obwohl dieses „Einfach“ gar nicht so leicht gewesen war. Mit nichts von alledem hatte sie gerechnet, aber wer tat das schon? Es gab Dinge, über die kaum jemand sprach, vielleicht, weil man damit keine Geister rufen wollte, die unter den Türspalten durchkletterten und sich einnisteten.
Der Regen fiel in langen, grauen Fäden vor dem Fenster herunter, während sie mit einer Tasse Tee in der Hand hinausblicket. Eigentlich würde sie lieber einen Kaffee trinken, aber ihr Herz pochte ohnehin schon zu schnell und hinter ihren Schläfen sammelte sich bereits ein stechender Schmerz, den auch das beste Lavendel-Öl aus dem Reformhaus nicht wegdünsten konnte.
Durch die letzten Wochen war sie wie durch einen dichten Nebel geschlafwandelt, nur begleitet von ebenjenem Schmerz, der auch jetzt ihren Kopf durchdrang. Sie wusste nicht, was sie alles unterschrieben, welchen Plänen sie zugestimmt hatte. Wahrscheinlich hatte sie sich Sachen aufschwatzen lassen und alles würde exorbitant teuer sein, aber das kümmerte sie nicht, obwohl es das wahrscheinlich sollte. In ihr war kein Platz für Gedanken über Geld, alles war verdrängt worden. Sie war froh gewesen, jegliche Entscheidungen in die Hände anderer zu geben, nur hier und da ein Kreuz machen oder ihren Namen unter ein Schriftstück setzen zu müssen. Dennoch war sie beim Unterschreiben immer wieder ins Stocken geraten, denn das auf dem Papier, das war nicht nur ihr Name. Sie hatten ihn zusammen getragen und jetzt war sie die alleinige Trägerin. „Namen sind Schall und Rauch.“ Aber dieser Name hatte ein Gewicht, das sie niederdrückte. Jedes Mal, wenn sie ihn aussprach, blieb ihr für ein paar Sekunden die Luft weg. Vielleicht sollte sie ihn wieder ändern, vielleicht, dachte sie und wusste im selben Moment, dass sie es doch nicht tun würde.
Eine Sache hatte sie in dieser Zeit verstanden. Das Wort „immer“ hatte keine Macht. Sie hatten sich geschworen, immer beieinander zu bleiben, immer zusammen zu sein. Und jetzt? Jetzt gab es nur noch ein Nie, das sich bis ins Endlose ausdehnte. Nein, „immer“ gab es nicht, damit hatten sie sich belogen, weil sie es nicht besser wussten. Es gab nur „niemals mehr“. Niemals mehr diese Stimme hören – warum gab es auf der Mailbox keine persönliche Ansage? – niemals mehr eine Berührung, niemals mehr dieser Geruch nach Zitronen und Kaffee und Holz. Sie vermisste den Körper, der sie so viele Jahre begleitet hatte, der jeden Morgen und jeden Abend neben ihr im Bett gelegen hatte, das jetzt seltsam unausgeglichen aussah und dessen eine Seite sich nicht mehr veränderte, nicht mehr unordentlich, nicht mehr schlafeswarm wurde. Sie konnte nicht verstehen, wie sich alles ändern konnte und doch so aussah, als ob es stillstand. Und wie die Welt noch immer so wie vorher war, auch wenn sie nicht anders hätte sein können.
Die Tasse Tee in ihrer Hand wurde langsam kälter, es stieg kein Dampf mehr auf. Sie blickte an sich hinunter. Da waren die schwarzen Schuhe, das schwarze Kleid, die schwarzen Strümpfe. Über einem Stuhl hing der schwarze Mantel. Wie blind hatte sie die Teile aus dem Schrank genommen; nur auf die Farbe geachtet. Keines dieser Kleidungsstücke würde sie je wieder tragen können, das war eine der wenigen Sachen, derer sie sicher war. Sie würde sie wegwerfen oder in die hinterste Ecke ihres Schrankes stopfen und hoffen, dass sie sie so schnell nicht wieder benötigen würde.
Wieder blickte sie hinaus in den Regen und in ihren Gedanken regte sich etwas, was sie nicht zu fassen bekam. Alles wurde übertüncht. Vom Klingeln des Telefons. Von einer besorgten und gleichzeitig unbeteiligten Stimme. Von Bildern, die während des Gesprächs durch ihren Kopf brausten und von denen sie hoffte, so sehr hoffte, dass sie nie stattgefunden hatten. Von einer Umarmung. Von einem weiteren Telefonat, bei dem der Hörer aufgeknallt wurde. Von einem Lachen. Von den Tagen dazwischen. Von blauen Farbspritzern auf dem Küchenboden. All das war so viel wichtiger als alles, was seitdem geschehen war und je wieder geschehen würde. Morgen um diese Zeit würde sie schon den Weg zwischen den Birken entlang gegangen sein, den Blick fest auf den Boden gerichtet. Nur die Füße des Pfarrers würden sich in ihr Sichtfeld schieben und sie würde ihnen im Takt zu den Kirchenglocken folgen. Bis sie zu einem Loch kamen, an das sie nicht denken wollte, das ebenso bodenlos war wie die Zukunft, die sich vor ihr ausbereitete.
Wieder dieses Pochen im Kopf. Sie hatte etwas vergessen, etwas Wichtiges. Sie versuchte, ihre Gedanken darauf zu lenken, weg von den Tanzschritten und den Schmerzen in den Füßen, weg von den Klängen einer Trompete und dem Geschmack von Zitronenravioli. Es hatte etwas mit dem Regen zu tun, da war sie sicher. Sie konnte den Gedanken fast schon erhaschen, wie die Schnur eines Drachens, der knapp über ihrem Kopf schwebte und den der Wind stets nur einige Zentimeter zu hoch fliegen ließ. Sie streckte sich ihm entgegen, stand auf den Zehenspitzen, griff in die Luft. Und plötzlich hielt sie ihn in der Hand.
Es waren Regenschirme! Mit so etwas Banalem hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. In Filmen hatten immer alle schwarze Regenschirme bei so einem Wetter. Oft trugen sie dann auch noch schwarze Sonnenbrillen, was ihr immer paradox vorgekommen war, aber wenn sie sich ihre Augen so ansah, konnte sie es jetzt sehr gut nachvollziehen. Meistens stiegen die Menschen aus Taxis oder Limousinen, zumindest aus schwarzen Audis aus und von der Seite wurde von irgendeinem Mann in einem zu engen Anzug ein Regenschirm über sie gehalten, der ebenso schwarz war wie ihre Kleidung. Wie konnte sie das vergessen? Und wie konnte sie an so etwas denken?
Vollkommen unangebracht, wirbelte eine Stimme durch ihren Kopf, die verdächtig nach ihrer Tante klang. Die hatte jedes Mal geseufzt, wenn sie auch nur einen lauteren Schritt gemacht hatte, und ebendiese Worte gemeinsam mit einer Schwade Zigarettenrauch zwischen ihren Zähnen ausgestoßen. Wie konnte sie jetzt an einen Regenschirm denken? Es war tatsächlich so gar nicht angebracht, aber was hieß das schon?
Draußen hielt ein Taxi. Sie blickte auf die Uhr an ihrem rechten Handgelenk. In zwanzig Minuten musste sie dort sein. Sie stellte die Teetasse in die Spüle, zog den Mantel an und blieb an der Tür stehen, neben der ein kirschroter Regenschirm lehnte, der ihr mit seiner knallenden Farbe immer wie der perfekte Schutz gegen das nasse Grau vorgekommen war. „Damit du ihn nicht liegen lässt. Etwas Knalligeres hatten sie nicht“, weil sie in den Tagen davor immer ohne aus der Wohnung gegangen war und damit jedes Mal das Wetter herausgefordert hatte. Ihren alten Schirm, einen schwarzen, der heute so perfekt gepasst hätte, hatte sie irgendwo liegen lassen. Sie zuckte mit den Achseln, wedelte die Stimme ihrer Tante weg wie deren Rauch, der ihr immer im Hals kratzte, und nahm den roten Schirm in die Hand. Er würde das einzige Stück seien, das sie auch nach dem heutigen Tag verwenden würde. Sie hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet ein Regenschirm sie an diesem Tag zum Lächeln bringen würde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ferenc Liebig
Brücken
Der Mann, er weiß nicht, wo er im Leben steht, ob er überhaupt steht oder schon längst sitzt, und was es bedeuten würde, wenn er denn nun sitzt und nicht mehr steht, dieser Mann, der unruhig ist, ein wenig aufgescheucht sein Leben begeht, nie ankommen mag, sich selbst nicht sicher, ob er überhaupt ankommen will, weil ankommen letztendlich auch Endgültigkeit ausstrahlt, die ihm dann sagen würde, von nun an geht es nicht mehr weiter, hier wirst du verweilen oder schlimmer noch, ausharren müssen, der sich dem Pejorativ dieses Wortes bewusst ist, ausharren, als würde es keinen Ausweg mehr geben, als wäre man eingeschlossen von etwas, das man nicht bezwingen kann, dieser Mann, der ungerne wartet, da warten doch bekanntermaßen bedeutet, sich in Abhängigkeiten zu begeben und Abhängigkeit für ihn wie eine Fessel ist, die sich immer fester schnürt, sich in seine Haut schneidet, kaputte Zellen zurücklässt, Wunden, aus denen Narben werden, Narben, die im Sommer weiß bleiben, die sich abheben, für jeden sichtbar sagen, dir hat man etwas fürchterliches angetan, dass du für den Rest deiner Tage mit dir herum tragen wirst, von denen du auch nach etlichen Versuchen der Gewöhnung den Blick niemals abkehren kannst, weil abkehren mit verdrängen gleichzusetzen ist und verdrängen nur vorübergehend funktionieren kann und nie eine langfristige Lösung ist, dieser Mann, der sich nach Dingen sehnt, die er nicht in Worte fassen kann, denn Worte kratzen nur an Oberflächen, zerkratzen sie, bis das, was man darunter vermuten könnte, noch besser versteckt ist, bis einem Angst und Bange wird, nie dahinter steigen zu können, hinter die Geheimnisse, die verschachtelt, ungeordnet, nicht zähmbar, ineinanderfließend ihre Grausamkeit verdeutlichen, die Freiheit mit Grenzenlosigkeit verwechseln, dieser Mann, fast vierzig, ein wenig müde von seinen unbeherrschbaren Gedanken, läuft an einem Büro vorbei, in dem eine Frau einen Aktenordner auf den Schoß hat, ihn wieder und wieder durchblättert und nach einem Rechenfehler sucht, der ihr sagt, es gäbe noch Hoffnung.
Diese Frau, Mutter zweier Kinder, alleinerziehend, vom Mann im Stich gelassen, der sich irgendwann dazu entschieden hat, es sein zu lassen und von einer Brücke gesprungen ist, aufgeschlagen auf einer dicken Eisschicht, den Schädel in Einzelteile hat zerspringen lassen, wie ein Glas, das einem unachtsam aus der Hand gleitet, sich in Splittern auf einem Boden verteilt, diese Frau mahnt sich zur Ruhe, aber da ist keine Ruhe mehr, nur Bedrohung, Ängste, Rechnungen, die zwar geöffnet, aber ungelesen sind, weil ungelesen sagt, vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, vielleicht kriegen wir noch die Kurve, vielleicht müssen wir nicht aus der Wohnung ausziehen, das Auto verkaufen, uns von den alten Möbelstücken trennen, die im Antiquariat möglicherweise etwas abwerfen, vielleicht passiert etwas Überraschendes, ein Gewinn, obwohl man nirgends mitspielt um gewinnen zu können, vielleicht ein Erbe, weil jemand stirbt, der zur Familie gehört, von dem man noch nie gehört hat, der kurz nach der Geburt verschwunden ist, weil die Mutter noch minderjährig, der Freund überfordert, die Eltern besorgt um das Ansehen in der Gemeinschaft waren, vielleicht trifft man auf einen Mann, der sich nicht daran stört, zwei Kinder mit großzuziehen, der sich nicht von den Schulden abschrecken lässt, diese Frau, Seite um Seite umblätternd, ohne wirklich erkennen zu können, was auf den Seiten steht, weil Tränen verschwimmen lassen, die leersaugende Ohnmacht dem Kopf keinen klaren Gedanken fassen lässt, Hoffnung wie ein Fremdwort ohne Übersetzung bleibt, diese Frau, kurz aufblickend, sieht das Bild ihrer Kinder auf dem Schreibtisch stehen, die Kinder, auf einem Platz in Madrid, knallbunt angezogen, die Arme umeinander gelegt, wie Geschwister, denen Streit fremd ist, die aussehen, als könnten sie niemanden was zu Leide tun, erinnert sich, wie sie danach Eis essen gegangen sind, kurz nachdem sie das Foto geschossen hatte und sie vom warmen Wind gestreichelt, eine Leichtigkeit verspürt hat, die ihr nur dieses eine Mal begegnet ist.
Erdbeereis, sagt der Junge und nahm die Eiswaffel entgegen. Für sein Alter war er schon sehr weit. Weit sein oder besser gesagt, weiter sein als der Rest ist meistens mit Problemen behaftet, weil es nicht normal ist, weiter zu sein und dann sitzen erst die Erzieher mit den Eltern in der Runde und sprechen über Auffälligkeiten, dann kommen Therapeuten, wollen das man Häuser und Bäume malt und Fragen beantwortet und mit Figuren spielt, am besten Situationen nachstellt, Situationen, die Zuhause passieren, die zum Alltag gehören, die Einblicke über das Verhalten der Eltern gewähren, die nach Ursachen suchen, weil man mit den anderen Kindern nicht zurecht kommt, sie ausschließt, von ihnen ausgeschlossen wird, weil man Dinge sagt, die andere Kinder in dem Alter nicht sagen, die überfordern mögen, aus ratlosen Blicken gekräuselte Stirne machen, die das Kind bewerten, kategorisieren, in eine Ecke stellen, die niemand sonst betreten sollte, weil es komisch ist und man auch Angst hat, vom Kind bewertet, kategorisiert zu werden, dass es einen durchschaut, die Regeln und Rituale hinterfragt, sich auflehnt, gefährlich wird, mit seinem Wissen die Überforderung durchdringt und der Junge, an seinem Erdbeereis leckend, lächelt seiner Schwester zu, die zwei Jahre jünger ist, zu ihm aufschaut, wie jüngere Geschwister zu älteren Geschwistern aufschauen, stolz und wissbegierig, sich in ihrer Nähe vor den Gefahren des Lebens beschützt fühlen. Der Junge flüstert seiner Schwester etwas ins Ohr, die daraufhin kichert und für diesen Moment scheinen die Sitzungen in hellen Räumen, mit Therapeutinnen, die ihre Beine übereinandergeschlagen haben, die ihre Haare zum Zopf tragen, ihre Stimmen fürchterlich ins Kindliche verziehen, vergessen und er streckt seine Brust raus, wackelt mit der Hüfte, hüpft von einem Bein aufs andere, was seine Schwester dazu animiert, es ihm nachzumachen, woraufhin ihr Eis auf den Boden fällt, einen vanillefarbenen Fleck auf dem hellen Pflastersteinen hinterlässt und ihr Tränen in die Augen treibt. Kurz nur, weil der Junge ihr sein Eis gibt und sagt, es gibt Schlimmeres als den Verlust einer Eiskugel und dann schaut er zu seiner Mutter, die von der Geste angetan, ihm einen Luftkuss zuwirft.
Der Fleck wird am nächsten Morgen von der Straßenreinigung wegspült. Vermischt mit chlorversetztem Wasser wird er langsam den Bordstein herunterrinnen, in einem Gullischacht verschwinden und von dem anbrechenden Tag, der aufsteigenden Sonne, den Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, die Bussen nachrennen, schwere Einkäufe tragen, überlegen, ob sie die Fenster wirklich geschlossen haben, sich fragen, ob sie glücklich sind, mit ihrem Beruf, die sich einen Ausweg aus der Eintönigkeit erträumen, die ihre Bedürfnisse dem Funktionieren unterordnen, die das Wochenende mit Freunden planen, in Schlangen im Supermarkt den Einkaufszettel noch mal studieren, weil sie das Gefühl nicht loswerden, etwas vergessen zu haben, die sich mal wieder bei ihren Eltern oder ihren Kindern melden müssten, aber abends zu erschöpft sind, um zum Telefonhörer zu greifen und dann doch lieber fern sehen oder Bücher lesen oder auf dem Sofa sitzend Wein trinken und ihrem Partner vom Tag erzählen, vom Chef, der sich wieder aufplustern musste, der alten Frau mit den Plastiktüten, die Pfandflaschen gesammelt hat, der neuen Richtlinie oder dem Formular, auf dessen dritter Seite ein Rechtschreibfehler ist, dem überschwemmten Keller eines Kollegen, der seit Wochen schon gesagt hatte, dass seine Waschmaschine merkwürdige Geräusche macht, den Kindern, die sich in der Schule langweilen und auf die nächste Hofpause warten, den Jugendlichen, die in Parks Gras rauchen und der Meinung sind, ihre Klausuren verrissen zu haben, die sich über Jungs oder Mädchen unterhalten, traurig oder euphorisch werden, die irgendwann zur Uhr schauen und sich verabschieden, den Touristen, die sich vor Sehenswürdigkeiten fotografieren, in Museen einkehren, die die im Reiseführer empfohlenen Restaurants ausprobieren, den Nachrichten, die von Krisen berichten, Toten, Prominenten, die mit Fehltritten auf sich aufmerksam machen, nichts mehr mitbekommen. Der Fleck wird dann schon lange nicht mehr da sein.
So wie der Mann. Er biegt nun um die Ecke, geht seiner Wege, öffnet die Tür zu seiner einsamen Wohnung, macht Dosenraviolis im Topf warm, denkt darüber nach, sich einen Hund anzuschaffen, um sich gebraucht zu fühlen, um an Halt zu gewinnen, obwohl er unschlüssig ist, ob er dadurch wirklich an Halt gewinnen würde und ob er der Verantwortung überhaupt gerecht werden könnte und so isst er die Raviolis im Stehen und der Schatten, den er wirft, wird langsam länger und bald wird der Schatten verschwinden und dann ist nur noch Dunkelheit da und er wird noch immer im Raum stehen, die Raviolis zwar gegessen trotzdem Hunger haben und vielleicht wird er sich an das Mädchen erinnern, in das er mal verliebt war, die in ihm nicht mehr als einen guten Freund sehen wollte und sich dann auf einer Party in einer Ecke mit einem Jungen aus der Parallelklasse verknotet hat und wie sein Herz in tausend Splitter brach und er dann los ist, die Treppe heruntergestürmt, sich aufs Fahrrad geschwungen hat, nach Hause ist und sich im Bett liegend geschworen hat, er würde das nie machen, dieser Demütigung der Liebe noch einmal eine Chance geben.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Liona Binaev
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mir ist heute eingefallen, dass ich gestern tot sein wollte, besser als andersrum. Du hast reichlich eingekauft: Tomaten, Gurken, Quark, Kaffee, Äpfel, Chips, drei Packungen, ich öffne sie alle, Kaugummis, zwei Packungen, ich schmeiße sie weg. Der Zeiger tickt so laut, als wolle er meine Wut erreichen, aber mir geht es großartig, seit nicht mehr gestern ist. Du hast auch drei Konservendosen mit Fisch gekauft, haltbar bis: siehe Seitenprägung, 01/2025.
»Ieh«, sage ich. »Fisch kommt mir nicht ins Haus.«
»Seit wann?«
»Seit gestern.«
Du lachst nicht, ich lache nicht, der Fisch lacht nicht. Ich bestehe darauf, dass wir den Fisch heute essen oder wegschmeißen, du sagst, hast du deine Tage, ich sage, unoriginellerweise ja, wir essen den Fisch zum Mittag, sagst du, mit Kartoffeln.
Heute ist Sonntag, also war gestern Samstag. Am Samstag hat eine junge Frau in unserer Nachbarschaft gegoogled.
Ich gehe spazieren. Du sagst, das Essen ist fertig, wenn du wiederkommst.
Ich biege rechts ab, links ab, geradeaus. Die Welt gefällt mir. Wenn ich lächle, lächelt etwas zurück. In der Bäckerei meines Vertrauens beschenkt man mich mit Spritzgebäck, wenn ich nur einmal im Monat komme. Ich war gestern schon da. Ich will rechts abbiegen, links, nicht geradeaus, da winkt mir jemand zu und ich gehe geradeaus. »Heiß aus der Fritteuse«, sagt jemand und packt mit der Zange zu. »Wie geht es dir?«
»Heute geht es mir großartig«, sage ich.
»Lass es dir schmecken.«
Am Samstag hat eine junge Frau in unserer Nachbarschaft gegoogled, wie man sehr wahrscheinlich am besten stirbt und komplexer Suizid war die Antwort. Sie hat sich diesen Begriff auf der Zunge zergehen lassen wollen, aber er ist nicht geschmolzen, nur wie ein Anker in ihren Bauch gesunken.
Gestern ereilten mich gute Nachrichten, es gibt Antworten auf meine Fragen.
Ich habe mal einem Menschen aus der Uni gesagt, er könne mich immer anrufen und gestern musste ich daran denken, dass ich eine Lügnerin bin, denn gestern hätte dieser Mensch mich nicht anrufen können, ich war unerreichbar. Er hätte im Sterben liegen können und ich war unerreichbar.
Das Essen ist fertig, ich bin heilfroh, dass der Fisch verwertet ist. »Lass es dir schmecken«, sagst du. »Weißt du, was mir aufgefallen ist«, sagst du. »Du hast alle Chipstüten geöffnet und die Kaugummis liegen im Müll.« »Lass es dir auch schmecken, mein Lieber!« »Ich frage mich natürlich, warum du das gemacht hast.« »Google kann dir sicher aushelfen!« Du lachst nicht, ich lache nicht, aber der tote Fisch in meinem Bauch freut sich, Frau Anker wiederzusehen.
»Ich will ein bisschen mehr im Jetzt leben«, sage ich. »Mich irritiert ein Kaugummi, der fünf Jahre haltbar ist. Und Chips, wenn sie immer knusprig bleiben. Das ist sehr unachtsam, so weit im Voraus zu denken.« Du räumst den Tisch ab. »Schauen wir unsere Serie weiter?«, frage ich. »Die geht mir zu lang«, sagst du.
Ich schreibe eine Karte an meine liebe Freundin aus der Uni, weil ich achtsam sein will. Es ist eine Beileidskarte; sie hat guten Humor. Der Tag hat noch neun Stunden und ich schreibe ein paar Karten mehr. Alles Gute an meine Mutter, Herzlichen Glückunsch zur Hochzeit an meinen Bruder, Mit 80 geht die Party erst los an meinen Vater, ich schreibe sogar dir kleinem, fiesen Arschloch ein paar liebe Worte. Deine Karte ist die einzige ohne Text auf ihrer Motivseite. Ein Schmetterling, der sich an einer roten Blüte nährt. Ich finde die Karte pervers, also passt sie gut zu dir.
Diese eine olle Frau aus der Nachbarschaft, die gestern die Macht des Internets entdeckte, hat eine Rasierklinge von ihrem Freund ausgeliehen, Aspirin und Quetiapin in einer Schublade gefunden und ist dann über ein Seil gestolpert.
Du gehst aus. Du sagst, ich gehe aus, weiß nicht, wann ich wiederkomme. Ich sage, du mich auch, du sagst, das finde ich unfair, ich sage, du mich immer noch auch. Du gehst aus. Früher hätte mich so eine Konversation tief getroffen. Gestern zum Beispiel. Gestern hätte ich vielleicht impulsiv gehandelt und versucht, dich meine Rache spüren zu lassen wie die kleinen Borderline-Mädchen mit Verlustangst. Aber heute ist nicht gestern und ich reagiere sehr erwachsen. Ich lasse mir ein Bad ein. Lege George Michael auf und singe fick dich im Takt der Blubberblasenplatzer. Mir fällt ein, dass du dich gestern auch sehr fragwürdig verhalten hast. Mir fällt außerdem ein, dass du dich für dein Verhalten gestern nicht entschuldigt hast. Und du hast der Frau aus der Nachbarschaft außerdem nicht gesagt: Bei deiner Vorgeschichte sollte ich wissen, dass dich solche Konversationen tief treffen. Die Frau hätte darauf wahrscheinlich geantwortet, dass sie sich bemüht, ihr Wohlsein nicht von anderen Menschen abhängig zu machen, da dies den endgültigen Verlust ihrer Autonomie bedeuten könnte. Du hättest vielleicht erwidert: Hä? Oder aber vielleicht: Wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht hättest du gar nichts gesagt und wärst ausgegangen. Ich würde dieser bescheuerten Frau aus der Nachbarschaft gerne mal sagen, dass es unverantwortlich ist, einem Menschen, der mit viel Geduld und Liebe mit ihr umzugehen versucht, eine so große Last aufzubürden und ihn hintergründig für ihre negativen Gefühle verantwortlich zu machen, da sie eben dies in ihren langjährigen Therapiesitzungen zu unterbinden versucht hätte und es eigentlich besser wissen müsste. Aber diese scheiß Frau von nebenan lernt es einfach nicht.
Das Badeöl färbt das Wasser so schön rot wie die Blüte auf der Karte mit dem Schmetterling.
Ich bin froh, dass heute Sonntag ist. Samstage sind schwere Tage für mich. Erstaunlicherweise freue ich mich am Freitagabend immer auf sie, ich steige in die U-Bahn und denke mir, eine Woche geschafft, dir geht’s gut, morgen gönnst du dir mal eine kleine Auszeit, Netflix und Paul Celan, aufstehen gegen 9, Kaffee kochen und während die Maschine schwarzes Gold tropft, meditieren, das goldene Licht überzieht meinen Körper, ein- und ausatmen und es bemerken, ich kann machen, was ich will, der Tag gehört mir, ich könnte jetzt, ich werde jetzt, aber dann kann ich plötzlich nicht und werde auch nicht. Es ist dieses Gefühl im Bauch. Dieser Schrei, nicht von Edvard Munch, es quietscht wie ein Schwein vor dem Bolzenschuss.
Aber daran will ich jetzt nicht denken, es ist Sonntag. Ich schau jetzt gleich Netflix und dann werde ich vielleicht ein paar von Celans Gedichten lesen. Aber erstmal mach ich mir Kaffee. Eine Packung ist leer, aber du hast ja heute neuen gekauft. Ich lächle kurz leicht irritiert, denn heute ist ja Sonntag und ich frage mich, wo du eigentlich eingekauft hast, wenn heute Sonntag ist. Aber dann meditiere ich meine Fragen einfach weg und rege mich nicht über das rote Badeöl auf, das mir aus dem Badezimmer gefolgt ist.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at