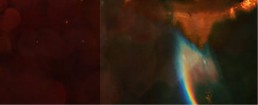freiTEXT | Stephan Weiner
ER und ICH
Solange ER und ICH zusammen sind, ist alles gut. WIR fürchten UNS nicht. Auch nicht vor dem kleinen Raum mit den weißen Fliesen an der Wand. ER und ICH wohnen noch nicht sehr lange hier. WIR wurden nicht richtig gefragt, ob WIR hier wohnen wollen - hatten aber auch nichts dagegen. WIR wissen nicht genau, warum WIR hier einziehen mussten. Aber WIR glauben, es ist wegen der Geschichte mit dem Kugelmenschen – dem Dicken, der UNS zu sich eingeladen hat.
Der Dicke hatte UNS gemeinsam eingeladen. WIR kennen ihn aus dem Wartezimmer des Arztes, der immer so viel redet. WIR haben ihn dort schon oft gesehen. Und der Dicke wollte UNS schon lange einmal zum Abendessen bei sich haben; sagt, er könne UNS helfen. WIR wissen nicht, wobei er UNS helfen möchte, kommen der Einladung aber achselzuckend nach. Als WIR das Haus betreten, steht der kugelrunde Gastgeber im Eingangsbereich und blickt von ein paar Stufen auf UNS herab. ICH ducke mich vorsichtshalber ein wenig, ER streckt den Kopf empor.
Der Dicke begrüßt UNS, nimmt UNSERE Jacke und führt UNS in ein großes Zimmer mit Kamin. WIR sind nicht allein. Sechs weitere Paare sind anwesend – stehen rum – mustern UNS. In solchen Situationen schicke ICH IHN gerne vor. ER ist bei so etwas viel souveräner. IHM macht es Spaß, sich den Gegebenheiten anzupassen. Mit einem Blick hat ER die Essenz seines Gegenübers erkannt und beginnt, sie gekonnt zu kopieren. WIR können auf diese Weise sein, was WIR wollen. Reich, arm, dick, dünn, schlau, dumm – einfach alles. Das ist ein gutes Gefühl. Seit ER und ICH zusammen sind, beherrscht mich daher ein Gefühl absoluter Klarheit. Mein Drang nach Freiheit, der offenbar nicht mit der allgemein akzeptierten Ordnung vereinbart werden kann, hat MICH oft in Schwierigkeiten gebracht. Doch mit IHM ist der Drang verschwunden. Tatsächlich verspüre ICH überhaupt keinen Drang und keinen Wunsch nach Veränderung mehr. Die überraschende Einladung des Dicken zu akzeptieren, ist für UNS kein Akt der Höflichkeit. WIR tun niemandem einen Gefallen, möchten UNS nicht einschmeicheln, um neue Freunde zu gewinnen oder Ähnliches. WIR gehen ohne besondere Absichten durchs Leben und haben nicht vor, etwas daran zu ändern.
Der Gastgeber rollt durchs Zimmer. Lächelt durch die Runde und richtet unangenehm lang seinen Blick auf UNS. Wieder ducke ICH mich, während ER den Blick erwidert. „Wir wollen helfen“, sagt der Dicke, und versucht seine Stummel-Arme auszubreiten. Allgemeines Nicken begleitet diese Geste. „Wir glauben, dazu in der Lage zu sein, da wir früher einmal genauso waren.“ ER und ICH wissen nicht, was WIR dazu sagen sollen und scheinen das mit UNSEREM Gesichtsausdruck auch deutlich gemacht zu haben. „Alle hier waren einmal eins“, erklärt der Dicke. „Alle sechs Paare in diesem Raum, waren mehr als nur einer Meinung – sie waren sechs Individuen.“ Er beugt sich leicht nach vorne und betrachtet UNS dramatisch durch seine Augenbrauen. „Auch ich und meine Partnerin waren einmal eins“, fährt er fort. „Wir sehnten uns nach nichts. Lebten von Tag zu Tag und wünschten uns, nur zusammen zu sein. – Doch ohne Verlangen lebt es sich schlecht. Es macht krank. Das einzig Gute: Wenn man erst merkt, wie krank, dann ist der erste Schritt zur Gesundung, zur Spaltung, zur Normalität schon getan.“ Als der Dicke das Wort „krank“ ausspricht, nicken die 6 Frauen und 6 Männer im Takt, jeweils abwechselnd, zuerst die Männer, dann die Frauen, und scheinen dabei ihr eigenes Gegenteil zu verkörpern. „Wer krank ist, will gesund sein. Wer abhängig ist, will frei sein. Wer in Gefahr ist, sucht die Sicherheit. Wer im Chaos versinkt, entwickelt Regeln zu seiner Bändigung. Wer hasst, will lieben. Wer arm ist, will reich sein. Wer unsicher ist, sucht nach einer Erklärung. Wer stumm ist, sucht nach einem Wortführer. Und wer unterdrückt wird, will sich emanzipieren!“ Mit dem letzten Satz dreht er sich einmal im Kreis und zeigt dann mit einem seiner speckigen Finger auf eine Tür. Langsam betritt eine dünne Frau den Raum. WIR starren sie an. WIR können nicht anders. Nicht ihre fehlende Statur ist das, was IHN und MICH am meisten schockiert, es ist ihre ungeheure Größe. Sie überragt den Dicken in ihrer Länge um das Doppelte. Er selbst, klein und fett, sieht daneben wie eine extrem gestauchte Version von ihr aus. „Meine Frau“, schreit er förmlich. Applaus von den anderen Gästen. ER ist vollkommen entsetzt. ICH sehe es an seinem Gesichtsausdruck. Es wäre besser, jetzt zu gehen, denke ICH noch. „Du siehst, wir sind genau wie du. Und wir können helfen. Wir können helfen, dich von ihm zu befreien. Du musst dich von ihm trennen, um glücklich zu werden. Du musst erkennen, dass du krank bist. Du musst dich entzweien und auf die Suche gehen. Musst dich nach einem geeigneten Partner umschauen; musst Sehnsucht entwickeln. Du kannst nicht für immer alles in dir vereinen. Das ist nicht normal!“ Mit jedem Satz kommt der Dicke einen Schritt auf UNS zu. ER bekommt Panik. ICH kann noch an mich halten. Plötzlich spüren WIR die Wand hinter UNS. WIR können nicht weiter zurück. WIR müssen nach vorne. ICH möchte IHN aufhalten, aber es ist zu spät. Wild hämmern seine Fäuste auf die Brust des Dicken. Der weicht zurück und seine Frau versucht sie auseinander zu bringen. Vor lauter Verzweiflung greife ICH hinter mich, greife nach dem Erstbesten, einem Schürhaken neben dem Kamin und steche zu. Blutend liegt die dünne Frau am Boden. ER und der Dicke lassen voneinander. Die anderen Gäste sehen MICH traurig an. ER und ICH verlassen langsam das Haus. Hinter UNS hören wir laute Geräusche; Schreie. WIR schauen uns achselzuckend an, laufen zur Straße und in die Stadt, bis WIR vor unserer Wohnung stehen. WIR betreten UNSER Zimmer und werden erwartet. Sie nehmen UNS mit und bringen UNS in das weiße Zimmer. IHM und MIR ist das egal. WIR legen uns auf die an der Wand stehende Pritsche.
„Wir glauben dir“, sagt der Mann mit dem weißen Bart. ER und ICH sitzen aufrecht auf UNSEREM Bett und starren auf UNSERE Fußspitzen. Es sind nur zwei. „Es ist Okay sich nach Gesundheit zu sehnen, wenn man erkennt, dass man krank ist“, fährt der Mann fort. „Wir sind zu zweit und du bist nicht rund. Kannst nicht in zwei verschiedene Richtungen sehen. Bist einfach nur du.“ Der Mann spricht mit IHM, ICH schaue zu. Was er sagt, ergibt keinen Sinn. Wie können ER und ICH nur in eine Richtung sehen? Wieso sollte ICH mich nach Gesundheit sehnen? Wieso sollte ICH mich überhaupt nach etwas sehnen, wo ER und ICH doch alles haben? WIR beschließen, dem alten Mann, der uns trennen will, zu ignorieren. WIR beschließen, UNS wieder hinzulegen und von gar nichts zu träumen.
Stephan Weiner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Annika Büsing
Steffen
„Für dich ist das Leben ein gewaltiger Scherz, oder?“
„Ja“, sage ich, „das ist es.“
„Hast du schon mal irgendwas verloren, was dir wirklich wichtig war?“ Ich hebe die Schultern, aber er erwartet gar keine Antwort von mir. „Ich meine nichts, wo du sagst: ‚Oh schade, das war echt ganz schön irgendwie.‘ Ich meine wirkliche Verluste.“
„Ich weiß, was du meinst.“
„Ach ja?“
„Ja, ich bin nicht blöd.“
„Nee, das ist ja dein Problem. Vielleicht wärst du netter, wenn du ein bisschen blöder wärst.“
Er hasst mich. Vermutlich ist das in Ordnung so. Ich hasse ihn auch.
„Meine Oma“, sage ich.
„Was?“
„Meine Oma“, wiederhole ich ironiefrei. „Meine Oma ist gestorben. Das ist mein einziger wirklicher Verlust.“
Er sagt erstmal nichts. Vielleicht überrascht ihn meine Ehrlichkeit, vielleicht hat er auch nicht damit gerechnet, dass ich begreife, dass er mit mir über den Tod sprechen will. Ich überbrücke die Stille und gieße ihm einen Schluck Wein nach. Ich finde, es ist ein trauriges Spektakel an Weihnachten rumzusitzen, in die Glotze zu gucken und alleine Wein zu trinken. Aber es ist ja nicht so, als würde er mir ein Glas anbieten. Überhaupt hätte ich nicht vorbeikommen sollen. Nicht klingeln. Das war eine gewaltige Schnapsidee, um seinen Sprachgebrauch zu kopieren. Ich wollte nett sein. Das kommt dabei raus.
Wir konnten uns vom ersten Augenblick an nicht leiden, er und ich. Und das ist ein Problem, weil wir nämlich ziemlich viele Stunden am Tag zusammen rumhängen. Mehr noch. Wir müssen uns ansehen, anfassen, unsere Gefühle miteinander besprechen, seltsame Übungen machen, bei denen wir uns vorstellen, dass wir ganz klein werden und getragen werden müssen, wo immer wir hinwollen. Ich weiß, das klingt, als wären wir zusammen in einer Therapiegruppe, aber in Wahrheit sind wir beide in der gleichen Klasse einer renommierten Schauspielschule. Als ich ihn dort das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: „Warum haben die diesen fetten Scheißtypen genommen?“ Und jetzt wird er schon als nächster großer Tatort-Kommissar gehandelt. Das liebste Attribut, das die Lehrer an meiner Schule vergeben ist: ‚authentisch‘ und Steffen ist ‚unfassbar authentisch‘. Ich finde, er ist unfassbar kacke, aber mich fragt ja keiner. Meine Freundin, der ich manchmal Bilder schicke, wenn mir langweilig ist, sagt: „Der ist nicht überhaupt nicht fett.“ Ich verstehe nicht, warum Leute immer so objektiv sein müssen. Jedenfalls hassen wir uns, Steffen und ich. Ich kann noch nicht einmal so tun, als würde ich ihn mögen. Das konnte ich aber noch nie. Ich bin halt nicht blöd, ‚nicht nett‘, würde Steffen sagen. Aber wenn nett sein blöd sein heißt, dann verzichte ich lieber. Ich lehne mich zurück. Die Glotze läuft ohne Ton weiter und wirft wechselndes Licht auf sein Gesicht. Er sitzt unbewegt da. Er trägt ein rot-kariertes Flanellhemd und eine Jeans. Immerhin sitzt er nicht in Jogginghose vor der Helene Fischer-Show. Es gibt noch Hoffnung für ihn. Er wird durchkommen. Aber Typen wie er kommen sowieso immer durch.
Es gab eine Stunde im Schauspielunterricht, die war zum Kotzen. Ganz ehrlich. Wir haben über Trennungen gesprochen. Jeder Scheiß wird ans Licht gezerrt bei uns. Du darfst praktisch keine Geheimnisse mehr haben und ja, ich habe vorher auch gedacht, dass das ein Klischee ist. Aber leider basiert dieser ganze Unfug dann doch darauf, Zugang zu den eigenen Gefühlen herzustellen. Affective Memory, nennen sie das und es ist demütigend. Wir bildeten Kleingruppen und die Dozentin entschied, wer in welche Gruppe gehen sollte, allein weil sie postulierte, dass sie weiß, wer gut harmoniert. Sie hat überhaupt keine Ahnung. Uns wird überdies oft gesagt, dass wir gut harmonieren, Steffen und ich, was der blanke Hohn ist, weil es mich sogar wütend macht, wenn er harmlose Sätze sagt wie: „Ich wollte, dass wir es gut haben.“ Das war auch so eine Stunde, nach der ich gedacht habe: Schmeiß hin! Aber egal, zurück zu der Trennungsstunde. Also, man sollte eine Erinnerung heraufbeschwören. Und wir mussten vorspielen und dann musste man aufstehen und seine Geschichte erzählen. Klar tut das weh, auf der Bühne zu stehen, und von so intimen Dingen wie Zurückweisung und Einsamkeit zu erzählen – es soll wehtun. Und es geht ja keiner hin und erinnert sich an eine Party, bei der man jemanden, der hackestramm war, mit Edding bemalt hat. Man erinnert sich an schmerzvolle Momente. Irgendwie hatte sich die Gruppe auf Trennungen eingeschwungen. Mir erschien das über die Maßen lächerlich. Es war so ein Moment, in dem ich mich fragte, warum ich nicht Jura studierte oder BWL. Und dann war Steffen dran. Und als er mit seiner Szene fertig war und erzählen sollte, da sagte er: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin noch nie verlassen worden. Ich höre das, wenn andere erzählen, was sie durchgemacht haben, wie sie getrauert haben und das alles, und ich stelle fest, dass ich davon keine Ahnung habe. Vielleicht hab ich einfach viel Glück gehabt. Vielleicht wurde ich aber auch einfach noch nie so geliebt.“
Ich wollte aufstehen, hingehen und ihm ins Gesicht schlagen. Das geht mir oft so mit ihm.
Ich merke, dass er mich von der Seite ansieht. Vielleicht überlegt er, was er sagen soll. Oder besser: Vielleicht überlegt er, was er nicht sagen soll. Meine Oma liegt jetzt auf dem Tisch, im übertragenen Sinne, und das war natürlich ein hoher Einsatz. Ich weiß nicht, warum ich die Wahrheit gesagt habe, denn ich bin sicher nicht der Überzeugung, dass er sie verdient hat. In ein paar Jahren wird er einen Arsch voll Geld verdienen. Nicht, weil er talentierter wäre als andere, sondern weil er so überzeugt von sich ist. Und ich habe immer den Eindruck, dass er genau weiß, dass dieser Tag kommen wird.
„Warum bist du nicht bei deiner Familie?“, frage ich.
„Willst du das wirklich wissen oder nur nen Spruch drüber machen?“
„Kannst du nicht einfach ne Frage beantworten?“
„Wohnen nicht hier“, sagt er.
Ich sehe ihn an. Inga, die im ersten Jahr ist, ist total verknallt in ihn. Inga ist ein dummes Huhn. Ich habe ihn nach drei Gin Tonic schon mal gesagt, dass sie sich keine Hoffnungen machen soll.
„Wieso sagst du sowas?“, hat sie gefragt.
Und ich habe gesagt: „Weil Typen wie der nur an sich denken.“
„Was ist mit dir?“, fragt er. „Warum bist du nicht bei deiner Familie?“
„Ich war“, sage ich.
Ich sehe ihn an. In seinem Blick liegt eine Frage und weiß der Himmel warum, vielleicht weil Weihnachten ist oder weil er alleine ScheißHeleneFischer guckt – ich bin gewillt sie zu beantworten.
„Ist ausgeartet“, sage ich lakonisch.
Und dann passiert etwas Seltsames: Er lacht. Er steht auf und geht in die Küche
Bewegungslehre und Körperbewusstsein II mit Steffen. Bei der mit Abstand durchgeknalltesten Dozentin der Schule. Steffen musste wie alle anderen so eine Flatterhose anziehen, die die größtmögliche Bewegungsfreiheit garantiert. Er sah aus wie ein fetter Flughund.
„Ey Steffen“, sagte ich, als er reinkam.
„Halt einfach die Fresse!“, sagte er.
Bewusstheit. Langsamkeit. Bla bla bla. Acrobalance war angesagt und keiner kann sich da rausreden. Man könnte allenfalls vorbringen, dass man tot ist. Und selbst dann würde die Pocher sagen, dass man keinen Schritt vor dem anderen gehen kann. Sie war auch bekannt dafür, Leute durch die Prüfung fallen zu lassen, wenn sich aus ihrer Sicht keine echte Hingabe erkennen ließ. Man musste also den Arsch zusammenkneifen und sich hingeben. Was passiert jetzt also bei der Acrobalance? Im Wesentlichen dies: Man steckt einen Mann und eine Frau zusammen und, Überraschung, der Mann hebt, trägt, wirft die Frau in allerlei Positionen. Dieser Teil gehört zum Adagio. Aus dem Ballett kennt man den Adagio als Teil des Pas de Deux. Er setzt eine Menge Körperkontakt voraus, Vertrauen, Kontrolle und ja: Hingabe. Alle hassen es. Und kein Tatort-Kommissar dieser Welt wird es je wieder brauchen. Aber: „Man kann keinen Schritt vor dem anderen gehen.“ (Pocher) Der zweite Teil besteht im Wesentlichen aus Handständen und komplizierten Bewegungswechseln die, Überraschung, die Frau auf dem Mann ausführt, vorrangig auf seinen Handflächen auch auch auf seinen Knien und Füßen. Es fallen Begriffe wie base und flyer, aber man könnte auch sagen: Er liegt auf dem Boden und man turnt so auf ihm herum. Pochers Kurs wurde deswegen intern als „Sexkurs“ gehandelt, denn der Legende nach war schon der ein oder andere Student nach unendlich erscheinenden Wochen in der selbst gewählten Askese nach der Acrobalance-Stunde und ein paar Gläsern Wein auf dumme Gedanken gekommen. Irgendwer fickt immer mit irgendwem in einer Schauspielklasse. Und alle wissen das hinterher. Die Kombination Mann-Frau ist am beliebtesten bei Acrobalance-Duos, denn Acrobalance setzt konzeptionell Stärke voraus und sieht sie vorrangig in Männerhänden. Man könnte auch Duos aus zwei Frauen bilden oder zwei Männern (wie in der Liebe). Für die Pocher kam das aber nur im Ausnahmefall in Frage. In unserer Klasse schon mal gar nicht, weil wir exakt so viele Männer wie Frauen waren. Also stellte sie nach einer enthusiastischen Vorrede und im Anschluss an ein paar Vorübungen und das ungenierte Studium unserer Körper (es wurden T-Shirts angehoben und Bäuche begutachtet) die Paare zusammen. All meine Gebete blieben unerhört. Die Pocher zählte zu jenen Dozenten, die der Ansicht waren, dass Steffen und ich ausgezeichnet harmonieren. Sie trieb mich in den Wahnsinn. Jemandem so nah zu sein, den man schlagen, quälen, töten will, ist schwer auszuhalten. Und obendrein ist dieser ganze Unfug abartig anstrengend. Man ist jede Stunde nass geschwitzt und man schwitzt seinen Partner gleich mit voll. Man spürt seinen Atem, seinen Körper, ob man will oder nicht, und für mich galt in diesem Fall: NICHT. Es war die Hölle. Aber wir waren irgendwie gut. Die Pocher war zufrieden mit uns, um nicht zu sagen, sie war begeistert. In einer Stunde attestierte sie Steffen ein hervorragendes propriozeptives Bewusstsein.
„Was ist das?“, fragte ich.
„Tiefensensibilität“, erklärte die Pocher. „Er weiß ganz exakt, wo er im Raum steht.“
Wow, dachte ich tiefenironisch. Und die alte Hexe konnte meine Gedanken lesen und sagte zu mir: „Von allen Mädchen hier musst du dir am wenigsten Sorgen machen. Er wird dich niemals fallen lassen. Er liest deine Bewegungen. Er liest sie ohne hinzusehen.“
Danach mochte ich ihn noch weniger. Wir gingen mit der Bestnote aus dem Kurs. Wir waren das Bestnoten-Pärchen. Max und Juliane waren das Fickpärchen. Robert und Anna das Heulpärchen (Anna heulte jede Stunde).
Bestnoten-Pärchen. Aber es änderte nichts.
Er kommt mit einem zweiten Weinglas zurück und stellt es wortlos auf den Tisch. Er greift nach der Weinflasche und gießt Wein in das Glas. Mir fällt auf, dass er die Ärmel seines Hemdes aufgekrempelt hat. Vielleicht soll das suggerieren, dass er ein anpackender Charakter ist. Er stellt die Flasche wieder weg. Lehnt sich zurück.
„Ist das für mich?“, frage ich.
„Nein, für den Weihnachtsmann“, sagt er.
„Dem Weihnachtsmann musst du Milch hinstellen“, sage ich und greife nach dem Glas.
„Hast du Ahnung von Wein?“, feixt er.
„Nein. Du?“
Er zuckt mit den Schultern. „Probier halt!“
Ich probiere den Wein. Ich habe wenig Vergleichswerte, aber vermutlich ist der hier ganz gut.
„Warum guckst du Helene Fischer?“
„Ich gucke es nicht.“
„Erzähl keinen Scheiß! Klar guckst du das!“
„Es läuft. Ich gucke es nicht.“
„Aso. Nur so nebenbei.“
„Ja, nur so nebenbei.“
„Kannst du mir nicht mal die Wahrheit sagen?“
„Warum sollte ich?“
Hat er recht. Warum sollte er? Wir schweigen eine Weile. Helene singt, wird gehoben, getragen, geworfen. Ich kann jedoch keine echte Hingabe erkennen, ich denke, die Pocher würde sie durchfallen lassen.
„Also, erzählst du mir jetzt von deiner Oma?“, fragt Steffen unvermittelt.
„Was soll ich dir erzählen?“, frage ich.
„Wie war sie so?“
„Unbeherrscht“, sage ich.
„So wie du“, sagt er.
„Du kennst immer die Antwort schon, oder?“, sage ich. „Du kennst die Geschichte. Man kann dich mit nichts überraschen. Du hast alles immer schon durchschaut.“
„Meinst du, du wärst anders?“
„Vielleicht bin ich nicht so borniert.“
„Oh doch, Annika, du bist borniert! Für Leute wie dich ist dieses Wort erfunden worden. Borniert sein heißt auf seinen Vorstellungen zu beharren – und das tust du. Wenn du einmal eine Vorstellung von etwas hast, ist die in Stein gemeißelt. Macht keiner was dran.“
„Ich kann nichts dafür, dass Menschen so zum Kotzen berechenbar sind“, sage ich.
„Ja, na klar.“ Er schüttelt den Kopf. „Berechenbar.“
„Du bist natürlich total unkonventionell.“
Warum lasse ich mich von ihm beleidigen, zurechtweisen, erziehen? Es ist immer die gleiche Leier. Einmal waren wir auf einer Party. Anna (die Heulsuse) hatte Geburtstag und hatte alle in ihre WG eingeladen und es gab Nudelsalat und Rotwein (gekauft von Leuten wie mir, die keine Ahnung von Wein haben) und überall brannten Kerzen und es lief Bon Iver. Es war eigentlich echt nett. Wenn er nicht dabei gewesen wäre. Er kommentierte den ganzen Abend lang, was ich sagte: Entweder korrigierte er es oder stellte es in Frage oder er machte Witze auf meine Kosten. Als ich nach Hause ging, war ich so wütend, dass ich nicht schlafen konnte. Ich saß vor dem Fernseher und hasste mein Leben.
„Was willst du eigentlich hier?“, fragt er. „Bist du nur hergekommen, um mich runterzumachen?“
„Hattest du was Besseres vor?“
„Warum bist du so?“
„Wie bin ich denn?“
„Feindselig bist du.“
„Zu allen Leuten?“
„Nein, zu mir.“
„Denk mal drüber nach!“
„Okay, ich hab’s verstanden. Du hältst mich für ein Riesenarschloch. Aber wenn das so ist, dann verrat mir, was du hier willst! Warum kommst du an Weihnachten vorbei, setzt dich auf mein Sofa und putzt mich runter? Erklär es mir! Ich kapiere es nicht!“
„Du bist die Grenze. Irgendwie wollte ich heute Abend wissen, wie es da aussieht.“
„An der Grenze?“
Ich schaue in mein Weinglas und schwenke den Wein ein bisschen rum.
„Weißt du noch, wie die Pocher zu mir gesagt hat, dass du mich nie fallen lassen würdest? Sie hat Recht. Du bist der einzige Mensch, der mich noch nie enttäuscht hat.“
„Was angesichts deiner Einschätzung meiner Person nur sehr bedingt ein Kompliment ist.“
Ich höre das Grinsen in seiner Stimme. Ich muss ein bisschen lachen. Aber eigentlich ist mir auch zum Heulen zumute.
„Das war richtig scheiße mit meiner Familie“, sage ich.
„Klar“, sagt er leichthin, „ist halt Weihnachten.“
Aus der Küche kommt ein Geräusch, das klingt wie ein Gong.
„Was ist das?“, frage ich.
„Essen ist fertig.“
„Was ist denn Essen?“
„Currywurst aus dem Ofen.“
„Häh?“
„Bratwurst von gestern kleinschneiden, Auflaufform, Currysoße drüber, in den Backofen bis es gongt.“
„Du bist ja ein echter Gourmet!“
„Was meinst du, wie geil das zum Weißwein ist?“
Ich ertappe mich beim Lachen. So wirklich tief innen drin. Der Typ hat sie nicht alle.
„Na komm schon!“, sagt er.
Annika Büsing
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
23 | Martin Peichl
Wie man Dinge repariert (Auszug)
WEIHNACHTEN – das ist verkatert den Zug ins Waldviertel verpassen und zwei Stunden lang auf den nächsten warten. Es ist kurz nach Mittag, die Geschäfte am Hauptbahnhof haben noch offen. Ich überlege mir ein Bier zu kaufen, aber dann fällt mir ein, was du dir von mir zu Weihnachten gewünscht hast, also setze ich mich auf eine Bank und öffne meinen Laptop. Irgendwo nach Tulln ist ein Baum auf die Schienen gestürzt. Ich muss die S-Bahn nach Absdorf-Hippersdorf nehmen und dann weiter Richtung České Velenice. Ich will dir 3 FUN FACTS über Absdorf-Hippersdorf schicken, aber eine schnelle Internetrecherche ergibt, dass es nicht einmal 1 FUN FACT über Absdorf-Hippersdorf gibt.
Die -30-Prozent-Schilder in der Auslage sind genauso rot wie die -50-Prozent-Schilder, sind genauso rot wie die -70-Prozent-Schilder. Es wäre besser, denke ich, wir würden uns alle selbst Rabattschilder umhängen, das würde vieles erleichtern, wenn ich mir zum Beispiel ein -30-Prozent-Schild umhängen würde, das wäre ehrlich, weil 100 Prozent zu verlangen, wenn man genau weiß, dass man selbst keine 100 Prozent geben kann, ist dreist, ist auch irreführend, ist schlichtweg Betrug. Und je nach Lebensphase oder Situation könnte man die Rabatte auf das eigene Ich anpassen. In der Bar nach dem vierten Bier zum Beispiel könnte man mit dem Preis noch weiter runtergehen. Oder, wenn man ausnahmsweise mal ausgeschlafen ist, ein wenig rauf. Angebot und Nachfrage würden sich ganz natürlich selbst regulieren. Und zu Weihnachten dann Ausverkauf, runter mit den Preisen, ALLES MUSS WEG.
Es ist eine seltsame Zeit mit dieser Endjahresstimmung direkt unter der Haut, wenn die Listen im Kopf ganz schwer werden und die Gedanken einstürzen wie Schneehöhlen, wie Vanillekipferl-Bruchstücke hineinbröckeln in deine Wahrnehmung und aus dir rausbrechen in Form von sentimentalen Ungenauigkeiten. Ich überlege, dir das zu schreiben, immer überlege ich, dir zu schreiben, aber du bist nicht alleine, du bist besetzt, bis ins neue Jahr hinein. Stattdessen schreibe ich ein paar Listen für dich: die 10 schönsten (alternativ: die 10 schirchsten) Hauswände, gegen die ich dich gedrückt habe. Oder: die 10 Momente, in denen ich Angst gehabt habe, es könnte dich jemand schwängern (alternativ: die 10 Momente, in denen ich Angst gehabt habe, du könntest ein Kind wollen von mir).
Länger schon schreibe ich an einer Liste mit Wörtern, die wir betrunken besser aussprechen können als nüchtern. Deine Nummer 1: BINDUNGSHORMONE. Meine Nummer 1: KURZFRISTIG. Die Liste ist WORK IN PROGRESS, und wärst du jetzt hier, würdest du sagen, weil alles für mich WORK IN PROGRESS ist, auch unser Verhältnis, unsere Fast-Beziehung oder unsere Manchmal-Beziehung oder was auch immer das ist, was wir uns da einbilden. Du hast ja recht: alles WORK IN PROGRESS, vor allem das eigene Ich. Und egal an wie vielen Leben ich mich parallel versuche, kein einziges davon habe ich im Griff. Und ich will dir schreiben: Schau, ich weiß nicht, wer du für mich bist, aber ich weiß, dass niemand so schön das Wort SCHNAPS ausspricht wie du.
Martin Peichl
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
15 | Marc Späni
Natürlich machen wir nicht auf
Wenn sie mit ihrer roten Kappe durch die Straße geht, verfärben sich die Fassaden der Wohnhäuser ins Dunkelbraune, die Feuerleitern ziehen ihre Sprossen ein und die Klimaanlagen halten die Luft an. Katzen, Hunde, Mäuse und Ratten stecken bereits in Mauerritzen und wir, die wir hinter den matten Scheiben wohnen, seit Ewigkeiten schon, im Wohlfühl-Licht vollautomatischer Beleuchtungssysteme, wir richten uns auf wie Nagetiere, lassen die EBook-Reader, Smartphones, Spielkonsolen und Fernbedienungen sinken und horchen mit angehaltenem Atem.
Zwar vermuten wir, dass sie zum Sanatorium am Ende der Straße will, zu diesem mächtigen weiß getünchten Komplex mit den großen Fensterfronten und dem von Zitterpappeln gesäumten Park, wo wahrscheinlich diejenigen leben, die ihre Wohnungen hier aufgegeben haben, freiwillig oder unter Zwang, das vermuten wir, reden es uns ein, obwohl wir genau wissen, dass sie sich bisweilen auch einen der Hauseingänge vornimmt, in einen Innenhof einbiegt oder in eine der schmalen Gassen mit den Müllcontainern. Natürlich können wir nicht wissen, was sie eigentlich tut, hier bei uns und in den weiten Bogengängen des Sanatoriums, in den Aufenthaltsräumen, Fernsehzimmern, Krankenstationen und Appartements – was wir wissen, haben wir aus den Medien, auch die grässlichen Bilder von den Tatorten; die Nachbarn (diejenigen, die noch da sind) ergänzen, was sie zu wissen glauben, im Flüsterton. Natürlich sagen wir uns, es sei nicht erwiesen, dass sie dafür verantwortlich sei, sie mit ihrer roten Kappe, dass sie das alles angerichtet haben soll, ohne eine Spur von Skrupel oder Mitleid, dafür mit chirurgischer Effizienz und maschinenhafter Präzision. Nicht selten sind unter den Opfern auch Tiere, was das Ganze nicht besser macht.
Mit jeder verlassenen Wohnung steigt die Gefahr für die Zurückgebliebenen, das wissen wir natürlich, und wir sagen uns immer wieder, dass wir nicht öffnen würden, wenn es klingelte oder klopfte, auf gar keinen Fall; dass wir in Schockstarre verharrten, bis die Schritte sich wieder entfernen, auch wenn es heißt, dass sie bisweilen nur auf einen Tee vorbeischaut, Geschichten von früher erzählt, sogar eigene Plätzchen mitbringt und die Katze streichelt.
Früher, als wir den Kindern noch Märchen vorlasen, um sie auf das Leben vorzubereiten, von Geißlein, die am Ende doch gerissen werden, geschändeten Prinzessinnen und Hexen, die Kinder fressen, da haben wir jeweils schnell und atemlos weitergelesen, bis die Schritte auf dem Pflaster nicht mehr zu hören waren. Heute stellen wir manchmal den Fernseher lauter, und wenn dort wieder dieselben Schreckensmeldungen ausgestrahlt werden, die wir mit ihr in Verbindung bringen könnten (die vielleicht aber auch von jemand ganz anderem handeln), dann schalten wir um auf eine Telenovela, einen Historienfilm oder, wenn es sein muss, auf den Shoppingkanal, wo sie dermatologische Pflegesets, Schlankheitsgürtel und batteriebetriebene Zen-Brunnen verkaufen, und sollten sie für einmal nur handgeschmiedete Japanmesser oder Profi-Kettensägen bringen, dann wenden wir uns eben den Dingen zu, die wir uns über die vergangenen Monate ins Haus bestellt haben: Ich habe eine Modelleisenbahn Spur H0 um Polstergruppe und Salontisch gelegt, zwei miteinander verbundene Kreise, digitales Stellwerk, Landbahnhof mit 12V-Beleuchtung – der Fernseher liefert passende Landschaftsbilder –, Elsa ihrerseits telefoniert seit Tagen auf einem neuen Smartphone mit ihrer Schwester, die zwei Straßen weiter wohnt.
Ein einziges Mal hatten wir nach draußen gehen und uns vergewissern wollen, dass Rotkappe wirklich zum Sanatorium geht, aber schon im Treppenhaus haben die Nachbarn uns aufgehalten, uns beschworen, stattdessen ihr neues Dolby Surround-System zu bestaunen, die ergonomische Sprudelmatte für die Badewanne oder den Elektro-Haubengrill mit Niedergarfunktion. Ob wir, raunen sie, die Sache mit Woolfe denn nicht mitbekommen hätten. Woolfe, der Kriminalist, habe dem Morden ein Ende setzen wollen, Woolfe, den wir alle aus dem Lokal-Fernsehen kennen. Aber dann habe man ihn in einem Schacht gefunden, mit aufgeschnittenem Bauch.
Elsa und ich, wir sagen uns immer, dass wir einfach nicht zur Tür gehen würden, sollte sie vor unserer Wohnung auftauchen, auch wenn sie nur zum Tee kommt, Geschichten erzählt und Plätzchen mitbringt, die überraschend gut schmecken sollen, besser noch als die gekauften. Während der ICE im Maßstab 1:87 nach vier Runden unter dem Fernsehmöbel den Orientexpress überholt, hören wir ein Klopfen: ein feines, höfliches Klopfen, kein Donnern mit dem Türknauf, kein Schrillen der Klingel, nur ein feines, diskretes Klopfen; wir wissen nicht, wer es ist, aber wenn wir durch den Spion schauen würden, was wir natürlich niemals täten, sähen wir den Zipfel des roten Käppchens.
„Ich geh schon“, sagt Elsa, und ich nicke stumm.
Marc Späni
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
14 | Gloria Ballhause
Der Tanz
Die Blätter einer Kastanie rascheln über meinem Kopf im goldgelben Schein der Sonne. Überall liegen stachelige Fruchtschalen herum. Die Stacheln sind schön, denke ich und dann patsch, patsch, patsch. Er taucht aus dem Nichts auf. Ich sehe, wie seine geschwollenen Füße auf die unregelmäßig verlegten Steinplatten klatschen, direkt auf mich zu, oder besser gesagt: im Zickzack um die stacheligen Fruchtschalen herum, aber mit einem unmissverständlichen Ziel – die Bank, auf der ich sitze. Er plumpst neben mich. Ohne zu zögern greift er nach dem Becher Automatenkakao, den ich neben mir abgestellt habe.
„Ey…!“, rufe ich.
Keine Reaktion. Der Barfüßige nimmt noch einen Schluck aus dem Becher. Aber wenigstens die Bank verteidigen, denke ich. Ich verschränke die Arme vor der Brust und blicke geradeaus. Minuten vergehen ohne ein Wort. Dann ist meine Pause zu Ende. Als ich aufstehen will, rollt sich vor meinen Füßen ein Satz aus wie ein neu gekaufter Teppich.
„Warum sind die Menschen, wie sie sind…“
Ich drehe mich zu ihm. Der Barfüßige ist jung. Anfang Zwanzig vielleicht, aber nicht viel älter. Sein dunkelbraunes Haar ist akkurat geschnitten. Die Striemen auf seinen Wangen sind frisch.
„Warum trägst du keine Schuhe?“, frage ich. Ein Teppich gewebt aus Menschheitsfragen ist mir zu viel. Der Barfüßige schiebt seine Unterlippe vor, als würde er schmollen. Er bietet mir etwas von meinem Kakao an. Ich schüttele den Kopf. „Behalte ihn“, sage ich. Er trinkt in einem Zug den Becher aus. Um die Kakaoklümpchen vom Boden des Bechers zu erwischen, stochert er mit seinen Fingern darin herum. Als der Becher leer ist, schmeißt er ihn in den Mülleimer neben der Bank.
„Ich tanze jetzt. Deshalb habe ich meine Schuhe weggeworfen. Ich will tanzen“, sagt er abrupt. Vor meinem inneren Auge sehe ich dicht aneinander gedrängte Menschen. Das Licht zuckt. Mittendrin tanzt der Barfüßige gedankenverloren. Von der Decke regnet es Konfetti.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nur, dass ich etwas sagen sollte, aber auch nicht wem. Die Sonnenstrahlen versiegen. Der Geruch von ungewaschenen Hosen und einsam auf den Straßen verbrachten Nächten steigt mir in die Nase. Ich zünde mir eine Zigarette an.
„Kann ich mal einen Zug von deiner Zigarette haben?“, fragt er. Er nimmt sich nacheinander zwei Zigaretten aus der Schachtel, die ich ihm hinhalte. Eine davon verschwindet in seiner Hosentasche.
Wir rauchen schweigend.
Meine Füße gleiten wie von selbst aus meinen flachen Halbschuhen. Ich schiebe sie mit den Füßen ein Stück von mir weg.
„Wie sollten die Menschen sein?“, frage ich.
Der Barfüßige überlegt, „Wie du und ich“ antwortet er. Er bläst Kringel in die Luft und lacht. „Sie sollten wie du und ich sein.“
Ein kleiner Strauß Fältchen ergießt sich von seinen Augen bis zu den Schläfen. Wir rauchen die Zigarette auf und dann noch eine. Die Blätter der Kastanie rauschen in unsere Stille. Nach einer Weile gleiten meine Strumpfhosenfüße wieder in die Schuhe. Ich gehe zurück in die
Bibliothek. Unter meinen Sohlen knacken die Fruchtschalen und ich rede mir ein, dass flache Damenhalbschuhe ihm nicht hätten helfen können.
Gloria Ballhause
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
13 | Markus Grundtner
Müll, aber schön
„Wir müssen über deine Tassen reden“, sagt Klaudia. Ich besitze kein einheitliches Set, alle auf einmal erworben. Meine Tassen habe ich im Laufe der Jahre angesammelt. „Die sind einfach unästhetisch“, sagt Klaudia.
Das mag sein, dafür kann ich mein Leben anhand meiner Tassen erzählen: Meine älteste Tasse ist schwarz – mit einem roten Stern darauf, das Rot fast weggewaschen. Die Tasse meiner Jugend: Sonntagmorgens habe ich verkatert Kaffee getrunken und mir vorgestellt, etwas zu sein, was ich nicht bin, und etwas werden zu können, was ich niemals werden kann.
Außerdem besitze ich eine Tasse mit einem Goldzeisig darauf. Neben dem Jus-Studium bin ich durch die Natur gezogen, um Vögel zu fotografieren. Ich habe nie gelernt, den Apparat unter Ausnützung all seiner Möglichkeiten zu verwenden. Wenn es das Schicksal will, mache ich ein gutes Bild. Fotografie ist mein Ersatz für Glücksspiel.
Ich habe eine Tasse aus dem Kafka-Museum in Prag. Ich habe mit „Vor dem Gesetz“ zu lesen begonnen und werde nicht aufhören, bis ich Kafka verstanden habe. So viel kann ich mittlerweile sagen: Wenn Kafka wüsste, dass sein Gesicht heute auf Tassen gedruckt wird, käme er zur Überzeugung, in seiner eigenen Prosa gelandet zu sein.
Dann sind da noch viele Tassen von Menschen, die meinen, das Büro wäre ein Ort für mich, um Spaß zu haben. Sie haben mir Spruchtassen geschenkt, dass es nichts Heimtückischeres gebe als Montag, nichts Ersehnenswerteres als Freitag und das einzig Wahre im Leben Kaffeetrinken sei.
All meine Tassen packe ich in eine Schachtel, denn im Dezember übersiedeln wir. Am Umzugstag fällt genau diese Schachtel als einzige von vielen im neuen Stiegenhaus die Treppe hinunter. Alle meine Tassen zerbrechen. Klaudia spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände, sie entschuldigt sich. Den zweiten Teil glaube ich ihr.
Am Weihnachtsmorgen stolpere ich im Schlafzimmer über eine braune Schachtel, die ich für den letzten Umzugskarton halte. Ich öffne sie: Tatsächlich sind Klaudias Weihnachtsgeschenke für mich darin.
Ein wenig später blicke ich aus dem Wohnzimmer auf die Straße und trinke Tee aus einer meiner neuen Tassen. Sie sind aus Emaille: Spezialanfertigungen, auf denen die Vögel Mitteleuropas abgebildet sind. Jeder Vogel trägt neben dem Schnabel eine Sprechblase mit einem eigenen Kafka-Zitat.
Vor dem Wohnzimmerfenster schwebt ein zerrissenes Stück Cellophan vorbei, dreht seine Kreise im Wind und funkelt in der Wintersonne. „Wahrscheinlich die Verpackung von einem Geschenk“, sage ich zu Klaudia, die mich von hinten umarmt.
„Stimmt“, sagt sie, „Müll, aber schön.“
Markus Grundtner
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
7 | Larissa Böttcher
Goldene Tage
Ich richte mich auf, hier entlang, stromaufwärts, hinauf, mit dem Handballen voran.
Draußen drängt die Sonne mit ihrem taubenblauen Licht. Es schwappt über die Dächer. Jagt durch die Straßen. Bombardiert die Fassaden. Sprengt das Eis von den Frontscheiben. Klettert durch das Fenster zu mir herein, während ich still dasitze und direkt hinein stiere, nicht mal blinzle. Es zerrt an meinen Zügen, wälzt sich durch die Poren und zieht darunter jede einzelne Faser straff. Ich richte jeden Finger meiner Hand einzeln auf, greife zu und ziehe, ziehe an diesem Hebel, immer wieder, in alle Richtungen, bis der Rahmen knackend nach außen schwingt.
Der Wind treibt meinen Atem hinaus in den Hof. Unten, an der Hauswand, kleben zwei Schatten. Sie flüstern und zittern und stecken die Köpfe zusammen. Ich beuge mich vor, etwas zu weit, etwas zu schnell. Kälte schlägt mir ins Gesicht, meine Gedanken, meine Entwürfe, meine Utopien geraten ins Taumeln. Sie schreien auf, rutschen ineinander, verknoten sich und kippen mit mir nach vorn, prallen von innen gegen meine Stirn und ich klopfe vorsichtig dagegen und es klopft zurück. Ich friere, doch ich dränge weiter hinaus, ich verrenke mir den Hals, denn ich richte den Blick aus.
Irgendwo da unten, da hinten, wo sich alles mit Menschen füllt und Worte abgestoßen werden wie Fremdkörper, gibt es einen Fleck. Ich bin mir sicher, es gibt ihn noch, diesen Fleck, zinnoberrot, den ich auf die Tapete gemalt habe, groß wie ein Kieselstein. An diese Wand, diese Wände, deine kahlen Wände, hinter denen es still war, hinter denen es still ist. Hinter denen dieser Fleck existiert.
Nur du, ein ganz und gar geräuschloses Wesen, konnte unbemerkt verschwinden.
Meine Gedanken raufen sich frei. Gebliebene, Wiederkehrer, Fremdgewordenes. Ich öffne den Mund. Meine Lippen sind trocken, sie reißen auseinander und ich rufe etwas in den Tag hinaus, etwas, dass ich nicht verstehe und ich blinzle, blinzle immer schneller, ich spüre, wie es mich schüttelt, wie es mich aus dem Bett reißt, mich herumwirbelt, wie die Fasern unter meiner Haut auseinanderplatzen und durch meinen Körper schnellen. Ich greife nach dem Fensterrahmen, kralle mich fest.
Draußen gurren die Tauben so laut, dass man glauben könnte, ein Gewitter rollt heran und vielleicht ist es so, dass du das auch in der Ferne noch hören kannst. Vielleicht sitzt du dort am Fenster und schweigst, während ich den Rahmen loslasse und in die Welt hinausstürze wie ein Kind, guck mal, ohne Hände, siehst du's? Wie ich in das blaue Licht eintauche, Funken schlage und versinke?
Die Schatten schrecken auseinander.
Ich nicke ihnen zu.
Es sind diese goldenen Tage.
Larissa Böttcher
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
6 | Gorch Maltzen
Mikrokosmos (Bagatelle)
Fühle wieder etwas. Laufe herum und habe diese Taste in mir. Drücke sie und kann weinen. Freue mich zu weinen. Bin kaum eierschalen-, übergangsjacken-, durchpausdick. Bin noch vorsichtig, aber bin da. Seufze. Mute mir Zumutbares mutig zu. Musik bedeutet wieder etwas, alles. Gehe alte Wege und finde neue Wege alte Wege wie neue Wege zu begehen. Kann wieder Dinge zulassen. Telefoniere jetzt weniger als drei Stunden am Tag mit Hanna, um mein Herz auszuschütten. Übe wieder mehr als drei Stunden am Tag Klavier, neuerdings Bartók, auch Schönberg. Nehme Johanniskraut, Baldrian, widerwillig. Es hilft. Glaube ich. Habe aufgehört zu verblassen. Verlerne erlernte Hilflosigkeit. Nehme mir Zeit für mich. Weiß um eigene Verletzlichkeit. Lasse mich überreden. Gehe ab und zu mit zu Dingen, die alle wichtig finden. Hanna sagt, man darf sein Leben nicht verpassen. Habe aufgehört zu verpassen, passe auf. Spüre Samt, Lametta, Wachs. Bin dankbar für kleine Dinge. Das Jahr geht zur Neige. Sehe Raureif an Neonreklamen nachts. Schmecke Frost. Erwarte Blüte.
Gorch Maltzen
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
2 | Peter Paul Wiplinger
Advent-Advent
„Advent-Advent, ein Lichtlein brennt; erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier; dann steht das Christkind vor der Tür!“ Diesen Spruch sagten wir Kinder, auch im Chor, wenn wieder einmal die Adventszeit angebrochen war. Dann waren die Tage kürzer und am Abend wurde es immer früher dunkel. Draußen konnte es schon sehr kalt sein. Und der erste Schnee blieb liegen und verzauberte die Natur und alle Gegenstände, auf die er fiel und die er wie in ein weißes Federbett einhüllte. Drinnen in den Häusern brannte schon früh das Licht. Man hatte den Ofen im Wohnzimmer oder in der Wohnküche eingeheizt; es knisterte und duftete das Holz. Und vom Kachelofen kam die wohlige Wärme und erfüllte den Raum. Man war nun am Abend in der Familie mehr beisammen als sonst, keiner ging so wie im Sommer irgendwo auswärts hin. Sogar die Männer gingen seltener ins Wirtshaus; und wenn, dann blieben sie nicht bis in die späte Nacht. Sie spielten auch nicht Karten und es war nicht so laut in den Gaststuben wie sonst. „Die Stille Zeit“ ist nun, sagte man. Und so war jetzt lautes Lärmen unangebracht. Vielmehr sollte man „Einkehr halten in sich selber“ und sich vorbereiten auf das große Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, auf Weihnachten.
Bis dahin aber war es noch weit, einige Wochen waren noch davor. Und da galt es, mehr als sonst zu beten und viel zu tun. Als erstes wurde am Samstag vor dem ersten Adventsonntag von der Mutter der Adventkranz gebunden, aus den duftenden Tannen- oder Fichtenzweigen, die man sich selber aus dem Wald geholt hatte. Der Vater half ihr dabei. Bei uns wurden die Zweige der Einfachheit halber gleich auf den wie ein Wagenrad über dem Tisch hängenden hölzernen Lampenschirm mit Blumendraht aufgebunden. Das ging ganz gut so und war sehr praktisch. Denn die Lampe innerhalb des Lampenschirmes, der nach oben offen war, befand sich dann innerhalb des Adventkranzes und wurde von diesem umschlossen. Die vier Kerzen, drei lilafarbene und eine weiße, wurden in ganz flache Kerzenhalter gesteckt und dann mit dem Draht, der an den Kerzenhaltern war, am Adventkranz angebunden. Am Schluss wurde noch ein breites dunkel-lilafarbenes Seidenband mit silberner Borte an beiden Rändern querlaufend über den Kranz gewunden. Wenn alles fertig war, sagte der Vater zufrieden „Schön ist er wieder, unser Adventkranz, nicht wahr, Mutter!“ Und diese antwortete darauf „Ja, schön ist er wieder, unser Adventkranz.“ Damit war alles getan. Und man wartete jetzt nur noch auf den Abend des ersten Adventsonntags.
Nach dem Abendessen versammelten sich die ganze Familie und auch die Hausangestellten im Wohnzimmer. Die Kinder saßen in einer Reihe um den Tisch herum, die noch kleinen auf dem Schoß einer älteren Schwester. Die Hausangestellten saßen auf dem Sofa an der Wand. Wenn der Vater zur Streichholzschachtel griff und ein Streichholz anzündete, dann mit dem brennenden Streichholz auf dem Tisch kniend den noch weißen Docht der ersten Kerze entzündete, dann verstummte sogleich jedes Gerede und Geflüster, und alle schauten gespannt und zugleich ergriffen auf die nun brennende erste Kerze am Adventkranz. Nachdem das elektrische Licht ausgemacht worden war, erleuchtete das Licht der Kerze die Finsternis, und der Raum war in eine schwache Dämmrigkeit getaucht. Die Flamme der Kerze flackerte, es knisterte und roch nach Wachs. Schatten zuckten oder lagen auf den Gesichtern. Und dann hörte man die Stimme des Vater nach einem kurzen Sichräuspern sagen „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“; wobei er und wir andächtig das Kreuzzeichen machten.
Dann beteten wir das „Vater unser“ und ein „Gegrüßet-seist-Du-Maria“; anschließend das „Glaubensbekenntnis“ und ein oder zwei Gesetzchen des „Freudenreichen Rosenkranzes“, darunter das mit dem Text „Den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast...“. Darauf nahm der Vater ein Buch, immer dasselbe, in jedem Advent, und schlug es auf. Um besser lesen zu können, entzündete er eine kleine Kerze, die in einem grünen, mit Blumen bemalten, hölzernen Kerzenleuchter steckte. Aus dem Buch las er dann den Abschnitt, der für den ersten Adventsonntag bestimmt war. Er las mit fester Stimme und fast so wie der Herr Pfarrer in der Kirche. Alle hörten aufmerksam zu. Niemand von den Kindern hätte sich getraut, irgendeinen Unfug zu machen oder wie in der Schule zu „schwätzen“. Nur manchmal hörte man ein Husten oder Räuspern. Es konnte sein, dass die schon alte und von der langen, schweren Tagesarbeit ermüdete Köchin beim Rosenkranzbeten kurz einschlief, und man ihr tiefes, etwas geräuschvolles Atmen hörte. Dann stieß sie sogleich eine andere Hausangestellte, oder wer eben neben ihr saß, kurz an, und sie wachte gleich wieder auf, schaute etwas verwundert um sich und betete weiter. Alle waren bei dieser Adventandacht ganz dem Gebet und der Erbauung hingegeben. Nur die hinten auf dem Sofa eingerollt liegende Katze schnurrte ganz leise; doch das wurde von den Stimmen der Betenden übertönt.
Als kleiner Knirps konnte ich natürlich noch nicht so lange und komplizierte Gebete wie das „Vater unser“, das „Gegrüßet-seist-Du-Maria“ und schon gar nicht das „Glaubensbekenntnis“, den „Rosenkranz“ oder den „Engel-des-Herrn“ mitbeten. Und so saß ich da, manchmal neben unserer lieben Köchin Fanni und plapperte jene einfachen Worte mit, die ich schon reden konnte, deren Bedeutung ich aber oft noch gar nicht verstand. Wenn ich schon müde war oder müde wurde von der einschläfernden Monotonie dieses Gebetsstimmenchores, dann schlief ich ein, wobei ich mich bei der Fanni anlehnte, und sie den Arm um mich legte. Man ließ mich schlafen, weckte mich aber kurz vor dem Ende unserer Adventandacht auf und sagte leise zu mir: „Jetzt bist du dran, Peterle!“ Und dann musste ich zum Vater gehen, mich zwischen ihm und der Mutter hinstellen - gerade dass der Kopf über die Tischfläche ragte - die Hände zusammenfalten, zu einem bereits vor mir aufgestellten, eingerahmten Jesusbildchen, das einen kleinen, blondgelockten Buben zeigte, aufblicken und „mein Gebet“ sprechen, das man mich gelehrt hatte und das ich - mit Hilfe von Vater und Mutter, die es mit mir ganz langsam und deutlich sprechend mitbeteten - nun aufsagen musste. Meist begann der Vater mit dem ersten Wort und ich betete dann - ein jedes Wort in kindlicher Manier betonend - mein Gebet: „Weil jetzt, o liebes Jesukind, die Engelein so fleißig sind, drum will auch ich für Dich mich plagen...“ Weiter weiß ich es nicht mehr, hier bin ich immer stecken geblieben und habe nicht weiter gewusst. Heute, nach fast sechs Jahrzehnten, habe ich den Rest meines Kindergebetes vergessen. Aber das „Mich-plagen“ ist mir noch als etwas mir Unangenehmes bis heute im Gedächtnis geblieben.
Kaum dass ich etwas älter und größer war als ein Knirps von drei oder vier Jahren, habe ich das Mich-plagen für das Jesuskind in der Adventszeit schon als besondere Religionsübung aufgefasst und dem entsprechend kistenweise das gehackte Holz aus der Holzlaube unten für die Köchin Fanni über die Stiege hinauf getragen und in die Holzkiste geschlichtet. Wiederum etwas später, als ich mich dann geweigert habe, dieses Kindergebet noch weiter aufzusagen, hatte ich mich gefragt, warum auch ich mich, bloß deshalb, „weil die Engelein so fleißig sind“, nun so für das Jesuskind abplagen soll. Ich konnte und wollte nicht einsehen, was das eine mit dem anderen zu tun habe. Und überhaupt, warum schon wieder so ein opferverdächtiges Wort wie „Mich-plagen“ anstatt „Mich-freuen“?! Immer musste man „Opfer bringen“; in der Fastenzeit, in der Adventszeit; bei einem Gelübde oder bei einer Novene. Sünde, Reue, Buße, Sühne, Strafe, Verdammnis, Fegefeuer und Hölle - das alles waren Begriffe und Bestandteile einer düsteren Welt, die mit der Religion und dem Katholizismus schon früh in mein kindliches Empfinden hineingelegt wurden, ob ich das nun wollte oder nicht. Von Freude und Fröhlichsein war kaum jemals die Rede.
So wie am ersten Adventsonntag wurde nun an jedem Tag bis hin zu Weihnachten die gleiche Adventfeier in unserer Familie abgehalten. Jede Adventandacht lief nach diesem beschriebenem Muster ab, manchmal war sie etwas kürzer, ein anderes Mal ein wenig länger; immer aber war es das gleiche Zeremoniell. Das hatte etwas Beruhigendes, manchmal etwas Einschläferndes an sich, aber man konnte sich auf etwas verlassen, daß es so sein würde, wie man es kannte. Und da dies mit wenigen und kleinen Abänderungen über viele Jahre der Kindheit und dann der Jugend so verlief, bildete dies einen Bestandteil dessen, was man „Familientradition“ nannte und als solche bezeichnen kann. Meine Geschwister und ich wurden von Jahr zu Jahr größer. An meine Stelle und die meiner Kindergebete mit dem „O du liebes Jesukind, weil jetzt die Engelein so fleißig sind...“ und dem „Jesukindlein komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir! Mein Herz ist klein, darf niemand hinein, als Du, mein liebes Jesulein“ traten die Kinder und ihre Gebete meiner nun verheirateten älteren Geschwister, die fallweise zu unserer Adventandacht kamen. Sie saßen dann genauso andächtig wie wir damals, vielleicht ein wenig verschreckt, weil eben doch nur Besucher, um den Tisch im Wohnzimmer herum. Die Fanni gab es nicht mehr; die liebe alte Frau, meine wichtigste Bezugsperson in meiner Kindheit, war schon gestorben. Ebenso einige meiner Geschwister, die ein unerwarteter, viel zu früher, tragischer Tod aus der Familie herausgerissen und in den Herzen meiner Eltern tiefe, unheilbare Wunden hinterlassen hatte. Hausangestellte gab es längst nicht mehr. Das Geschäft war abgegeben, verpachtet. Ich war weggezogen und kam zwar regelmäßig, aber doch nur selten nach Hause. Vater und Mutter waren alt geworden, müde, krank, schweigsam. Nur an den Enkelkindern schienen sie sich noch zu erfreuen. Das laute Beten über längere Zeit fiel ihnen schwer. Die Stimme des Vaters war schwach und brüchig geworden. Die Mutter lebte in sich zurückgezogen, in ihrem eigenen unausgesprochenen Innern. Die Adventandachten hatten aber Generationen und Jahrzehnte überdauert und überbrückt; als etwas Gemeinsames, Verbindendes, Zuverlässiges.
Auch jetzt wurde noch an jedem Adventsonntag eine neue Kerze am Adventkranz angezündet und am vierten Adventsonntag die einzige weiße Kerze, als sichtbares Zeichen, dass das Fest der Geburt Jesu Christi nahe sei. Aber nicht mehr der alte Vater zündete sie an. Er konnte nicht mehr auf den Tisch klettern und sich beim Kerzenanzünden hinaufknien. Jetzt bat er eines seiner Enkelkinder. Und eine herzergreifende Traurigkeit lag in seiner Stimme und erfüllte auch mich, wenn er mit einem matten, etwas verlegenen Lächeln einem seiner schon größeren Enkelkinder das brennende Streichholz, das seine zitternde Hand an der Reibfläche nach mehrmaligen Versuchen endlich doch entzündet hatte, hinhielt und bat: „Geh’, sei so lieb und zünd’ mir die Kerze oben an!“ Dann stieg dieses Enkelkind auf den Sessel, kniete sich auf den Tisch, so wie einst der Vater das getan hatte, und zündete die Kerze oben am Adventkranz an. Dann flackerte die Kerze auf und erleuchtete die Finsternis. Und mit jedem Adventsonntag wurde es heller im Raum. Und wieder freuten sich Kinder auf Weihnachten; und mit ihnen die alten Eltern, die noch immer das Gleiche für die Enkelkinder taten, was sie Jahrzehnte hindurch für ihre eigenen vielen Kinder getan hatten.
Natürlich ging man auch jetzt noch während der Adventszeit in die „Rorate“, eine Frühmesse an Werktagen mit besonderen Gebeten und Liedern für diese Zeit der Vorbereitung in Erwartung des Herrn. Noch immer sang man die alten, bekannten Lieder, das „Tauet Himmel, den Gerechten...“ und „O Heiland, reiß die Himmel auf...!“ Noch immer saßen im Dunkel der Kirche, bevor die Kerzen am Altar angezündet wurden, die Frauen und die wenigen Männer hingeduckt in den Kirchenstühlen, eingemummt in schwere Mäntel und dicke, wollene Tücher. Denn der Winter ist bitter kalt in diesem Land an der Grenze, und die Kälte kriecht einem durch alle Kleider hindurch unter die Haut bis auf die Knochen. Noch immer wurde in der letzten Adventwoche ein Christbaum aus einem der Wälder der Bürgergemeinschaft geholt. Später brachte uns dann jemand den großen Baum. Noch immer wurde bei uns jedes Mal ein paar Tage vor Weihnachten die große Kiste mit der Krippe, mit den in Papier eingewickelten und in Holzwolle eingehüllten Figuren sowie dem hölzernen Stall, den der Vater schon vor Jahrzehnten gebastelt hatte, vom Dachboden ins Wohnzimmer herabgetragen. Und dann wurden dieser Stall und diese Gipsfiguren, die Hirten und Schafe, der Ochs und der Esel, Maria und Josef sowie die kleine Holzkrippe mit Stroh für das Jesuskind auf einem über die hohen Sofalehnen gelegten dicken Brett, das mit Moos ausgelegt und mit Tannenreisig und einem Zaun aus dünnen Haselnusszweigen umgrenzt wurde, aufgestellt; die Krippe noch leer und ohne das Jesuskind, das erst am Heiligen Abend hineingelegt wurde. Dann wurde noch ein kleiner Kiesweg, der gerade hin zum Stall führte, angelegt. Und auf dem standen dann kleine rote Kerzen in sternförmigen niedrigen Kerzenleuchtern, die zum Gebet oder zur Betrachtung für die Kinder angezündet wurden. Auch eine Beleuchtung gab es im Stall, so dass es die Heilige Familie hell hatte. Und dann saßen der alte Vater und die alte Mutter mit den vielen kleinen Enkelkindern vor der Krippe mit den angezündeten Kerzen und der kleinen Beleuchtung im Stallinneren und beteten die gleichen Gebete, die wir als Kinder gebetet hatten. Und der Vater sagte manchmal „Kinder, jetzt ist die Krippe noch leer, aber bald kommt das Jesuskind hinein; dann zu Weihnachten.“
Das alles wurde aus unserer Kindheit über Jahrzehnte hinweg hinübergerettet in die nächste und übernächste Generation. Ob es dort weiterlebt, weiß ich nicht. Mit dem Tod meiner Eltern und dem darauffolgenden Auseinanderbrechen der Großfamilie endete sowohl diese Gestaltung der Adventszeit, als auch die anderer Tage, Zeiten und Feste im Kirchenjahr. Es endete ein gelebtes Lebensbeispiel, eine Familientradition. Heute, nach all den Jahrzehnten, erinnere ich mich an meine frühe Kindheit. Ich sehe in meiner Erinnerung Lichter brennen, die es längst nicht mehr gibt. Und ich glaube die Stimmen von Vater und Mutter und von meinen längst verstorbenen Geschwistern zu hören, wie sie singen: „Tauet Himmel, den Gerechten, Wolken regnet ihn herab! Also rief in langen Nächten einst die Welt, ein weites Grab ...“ Und ich vermeine, dann auch den hellen Klang jenes Glöckchens zu vernehmen, das jedes Mal bei der letzten Adventandacht, nämlich der am Heiligen Abend, nachdem wir mit dem Beten und Singen geendet hatten und still dasaßen, zuerst kaum hörbar, wie aus weiter Ferne, dann aber näher kommend, geläutet hat, worauf der Vater zu uns Kindern sagte: „Horcht’s Kinder, es läutet; das Christkind ist da!“ Dann sind wir langsam aber innerlich ganz aufgeregt durch die dunklen Räume hinaufgegangen zu jenem Zimmer, durch dessen offenen Türspalt ein helles Licht geleuchtet hat, von dem man uns gesagt hatte, dass es von jenem Licht herrühre, das „das Licht der Welt“ sei. Und da stand dann ein wunderschöner, großer, geschmückter und nach Wald duftender Weihnachtsbaum. Davor und darunter lagen viele Päckchen. Und dann sangen wir alle gemeinsam und tief ergriffen das schöne alte Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht ...“
Peter Paul Wiplinger
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Katja Johanna Eichler
Schlamm und Schimmel
Sie trank inzwischen täglich Schlamm. Sie rührte sich jeden Morgen einen Teelöffel der Vulkanmineralien in ein Glas mit etwas Wasser, bis dies zu einer grauen Masse wurde und trank es. Jeden Morgen schaute er zu, wie die Masse in einem schmalen Rinnsal schwerfällig vom Glasboden in Richtung Rand rutschte und dann zwischen ihren beiden kirschroten Lippen verschwand. Jeden Morgen fand er, dass sie über Nacht wieder an Farbe verloren hatte, dass ihre Haut unterschiedliche Grautöne ausprobierte. Nach zwei Wochen fand er, dass ihre Haut auch die Grautöne verloren hatte und weiß, fast durchsichtig wurde. Im Folgenden fand er sogar, dass die Haut feine Risse bekam, so wie alter, weißer Marmor. Er dachte an antike Statuen in griechischen Tempeln, er dachte dann an Rom und an Pompej, an den Vesuv, der noch immer halb wach vor sich hin dämmerte und er dachte vor allem an Asche, die alle Häuser bedeckte und heiß in menschliche Lungen gesogen wurde. Inzwischen regnete es in jedem seiner Nachtträume Asche. Meist fiel sie in leisem Sinkflug auf eine zarte, fast durchsichtige Statue mit feinen Bruchstellen an Knien und Ellbogen. Bei näherem Hinsehen erkannte er Lola, obwohl ihr Statuen-Gesicht verzerrt aussah, die Stirn faltig, die Augen zusammen gepresst, der Mund eine schmale Linie. Es waren keine göttlichen Gesichtszüge, es waren schmerzverzerrte Linien. Eine Kore mit weltlich belastetem Antlitz.
Wenn er morgens aufwachte, lag sie nie mehr neben ihm. Vergeblich ließ er seine Hand Morgen für Morgen auf die andere Seite des großen Bettes wandern, das sie sich kurz vor Weihnachten zusammen gekauft hatten, nachdem sie diese Dachgeschosswohnung in der Innenstadt gemeinsam bezogen hatten. „Liebesnest”, hatte er sie damals liebevoll genannt. Jetzt war es „die Wohnung”. Eine Wohnung, in der zwei Menschen ein und ausgingen, um ihr Tagesgeschäft zu verrichten. Für Lola bedeutete das, früh aufzustehen, zur Uni zu gehen, danach die Unterlagen zu lesen, die wichtigen Stellen mit einem neongelben Marker anzustreichen und sie dann an der einzig richtigen Stelle in ihrem Universum von gereihten Ringordnern unterzubringen. „Die Wohnung” war zu einem Ort der Reihen geworden: Der Schuhreihen im Flur, der Bücherreihen im Wohnzimmer, der Reihen von Gewürz- und Müsligläsern in der Küche, von aufgereihten Kissen auf dem Sofa und Reihen von Duschgel- und Shampootuben im Bad.
In „Liebesnestern”, wie er sie meinte, gab es keine Reihen. Dort waren die Betten unordentlich, die Bettbezüge rochen nach Liebe und wiesen mehrdeutige Flecken auf. In „Liebesnestern” standen unbeachtet benutzte Weingläser herum, auf dem Küchentisch und neben dem Sofa, auf dem in wohliger Vertrautheit Kissen herum lümmelten. Espressokannen standen bereit, in denen jederzeit schwarzes italienisches Espressopulver aufgekocht werden konnte. Es gab Trauben im Kühlschrank und aufgebrochene Knoblauchzwiebeln, die achtlos neben großen Flaschen von frisch abgefülltem Olivenöl lagen. Es kam vor, dass Reste von Avocado, Schinken und roter Beete auf bunt befleckten Holzbrettern zu Zeugen eines gemeinsamen Kochens in leichter Bekleidung wurden, die einzig mögliche Schlussfolgerung nach einem Tag im Bett, der die Hautporen erfüllt hatte, aber nicht die Mägen. In „der Wohnung” fand sich von all dem nichts.
Als er Lola das erste Mal begegnet war, war sie weit davon entfernt gewesen, dem Abbild einer Göttin zu ähneln. Damals war sie eine Göttin. Sie unterschied sich von den anderen Erstsemesterinnen, die die Tischreihen des Hörsaals mit ihrer raschelnden und raunenden Profanität füllten, indem sie mit ihren Popos in viel zu engen Hosen die Klappstühle herunter drückten und nervös an ihren Haaren, dem billigen Modeschmuck und ihren Telefonen herum fingerten. Sie war ihm so anders als die anderen erschienen, dass ihr Anblick ihn geschmerzt hatte. An jenem Tag hatte er die Vorlesung dazu genutzt, sie genau zu studieren, ihr kantiges Profil mit dem starken Mund und der langen geraden Nase und ihre simplen glatten rötlichen Haare, die vorgaukelten, niemals irgendeiner Behandlung ausgesetzt gewesen zu sein. Als sie den Saal betreten hatte, schmucklos und schlicht gekleidet, hatten ihre Augen blitzschnell die Sitzreihen überflogen und zielbewusst seine selektiert. Er wusste, er hatte diese Wirkung, er war es gewohnt, dass ihm viele Blicke zukamen, doch damals war es anders gewesen. Nach der Vorlesung hatte sie hinter der weit geöffneten Flügeltür des Hörsaals auf ihn gewartet und er war auf sie zugegangen, als wäre dieser Augenblick alleine dafür bestimmt gewesen. Sie hatte ihm die Hand gereicht, sich ihm vorgestellt und er hatte ihre Hand mehrer Augenblicke in seiner gehalten. Nur drei Monate später waren sie zusammen gezogen. Er hatte sich glücklich gefühlt, bis das mit dem Schlamm begann.
Das mit dem Schlamm veränderte nicht nur seine Träume, sondern auch sein Geschmacksempfinden. Es fing damit an, dass er eines Morgens dachte, die Marmelade sei schimmelig. Oder das Toastbrot. Er nahm die Toastscheiben aus der Tüte, klappte sie auseinander und studierte sie sorgfältig. Aber er konnte keine Schimmelspuren entdecken. Er roch am verschmierten Deckel der Marmelade, stob mit der Messerspitze durch die rote Masse und quirlte die dunkelroten Punkte auf. Er konnte auch hier keine Schimmelschlieren entdecken. Irgendwann stellt er fest, dass sich der Schimmelgeschmack nicht nur auf das Frühstück beschränkte. Er zog sich durch alle seine Mahlzeiten. Er stellte auch fest, dass der Geschmack nicht pilzig, sondern steinig war. Er fragte sich, wie lange das mit dem Schlamm und dem Schimmel noch so weiter gehen konnte.
Es regnete, als er die Wohnung betrat, genau acht Wochen nachdem sie angefangen hatte, Schlamm zu trinken. Genau zwölf Wochen nachdem sie gemeinsam in ihr Liebesnest gezogen waren, das niemals eines werden sollte. Er zog seine Stiefel aus und stellte sie zu den anderen Schuhen, die sich im Flur an der Wand zwischen Eingangstür und WC-Tür aufreihten. Er zog seine durchnässte Jacke aus und hing sie an einen Haken aus der Reihe von Haken, die über die Schuhe wachte. Er ging in die Küche und sank erschöpft auf einen Stuhl. Es ließ das Licht aus, obwohl es draußen dämmerte und schaute abwechselnd zum Fenster hinaus und zu den Konturen der Trinkglas-Reihe auf dem Wandboard und der Müsligläser auf der Anrichte. Neben den großen Vorratsgläsern konnte er den weißen Kunststoffbehälter erkennen, der das puderige Pulver enthielt, das jeden Morgen als schmale Schlammlawine durch den Kirschmund rann. Er wusste, was auf dem Etikett stand, er wusste es auswendig, so oft hatte er es gelesen: Zeolith, Detox-Pulver, der Schadstoffbinder. Es würde alles absorbieren und hinaus transportieren, neue Energie geben, ja es half sogar gegen explodierte Atomreaktoren. Er hatte es selbst einmal probiert und er wusste, es machte Bauchschmerzen und einen grünlichen Stuhlgang, aber hey, alles nur leichte und völlig erträgliche Nebenwirkungen für einen maximal sauberen Darmtrakt. Plötzlich stand sie im Türrahmen, er erschrak und fragte sich, ob er die letzten Worte still gedacht oder laut gesagt hatte. Er hatte sie nicht kommen hören oder war sie die ganze Zeit da gewesen? Lief sie überhaupt noch oder schwebte sie bereits? Was hatte das Zeug schon alles absorbiert? Die letzten weltlichen Mikrospuren von Alkohol, Koffein und Schokolade? Oder bereits Nähr- und Mineralstoffe, gar erste Zellen? Höhlte es ihren Körper von innen aus? War sie nur noch die Hülle von Lola? Eine schwebende Kore in einem geordneten Imperium aus Reihen? Er sah ihr ins Gesicht. Es war nicht das verzerrte Antlitz aus seinen Träumen. Ihr Gesicht war klar und eben. Sie kam auf ihn zu, setzte sich auf seinen Schoß und legte ihre Arme um seinen Hals. Er konnte sie kaum spüren, aber er roch sie. Sie roch nicht nach Ascheregen. Sie roch nach Regenregen. Sie roch so anders als all die anderen. Sie roch so göttlich, dass es ihn schmerzte.
Katja Johanna Eichler
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>