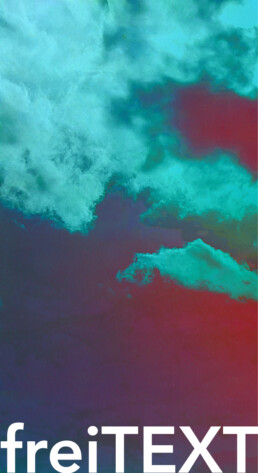freiTEXT | Maik Gerecke
Alles auf Null
Ich musste einfach raus. Raus aus dem Alltag, raus aus Berlin. Ich liebe die Stadt, keine Frage, aber welche Beziehung hat bitte jemals zu viel Nähe vertragen?
Deswegen kam der Auftrag gerade richtig. Es ging um ein »Schloss«, wie die Eigentümerin es nannte, für das sie leider bis nächste Woche schon ein Gutachten bräuchte. Geld spiele keine Rolle. Mein Kollege Frank hatte die Nase gerümpft und »Dit is ja fast in Polen« geseufzt, aber ich sah darin sofort die Gelegenheit. Deshalb übernahm ich das für ihn opferte der Firma heldenhaft mein Wochenende. Gleich gegenüber vom Objekt liegt ein alter Getreidespeicher oder so was, den man zu einer Art Herberge umfunktioniert hat. Mit Kneipe unten drin, perfekt also. Ich nahm mir ein Zimmer und verließ am Freitagmorgen die Stadt, nichts ahnend, dass dieser Zufall nicht so glücklich ausfallen sollte, wie es den Anschein erweckte.
Das Schloss ist in miserabler Verfassung. Mauerwerk und Fundament sind gerade noch zu retten, aber der Wald nagt schon daran. Insgesamt ist der Bau so marode, dass die Sanierung mehr kosten würde als der Neubaus. Zudem hat es sich eine beachtliche Population brauner Langohrfledermäuse unter dem Dach gemütlich gemacht.
Am Abend nach der Begehung sitze ich gegenüber auf der Terrasse und beobachte, wie eine rot-braun getigerte Katze zielsicher um die Schlossfassade schleicht. Von hier aus ordne ich eher in die Kategorie Altes Gutshaus, wofür auch die Bauinschrift an der Front spricht.
»Willste noch eens?« reißt mich der Kneipier aus den Gedanken und zeigt auf mein leeres Bier. Ich nicke, reiche ihm das Glas und frage bei der Gelegenheit, was er mir über das Gebäude erzählen kann. Er lächelt müde.
»Dit Ding hat mehr Regime jesehen wie icke«, schmunzelt er. »Ende 17. Jahrhundert gebaut, um 1900 rum komplett-erneurt, dann: Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazis, Osten, Kapitalismus. Und den Klimawandel überlebt’s auch noch. Wett ik drauf.«
Ich stelle gern solche Fragen unter Ansässigen, will Entscheidungen über ihren Lebensraum nicht allein der Willkür von Hausbesitzern überlassen; und es ist auch vorgekommen, dass ich ein Objekt der Denkmalschutzbehörde gemeldet habe. Oder dem Naturschutz.
Ich bedanke mich für die Auskunft und der Kneipier zieht ab. Zu meiner Überraschung sind die Tische gut besetzt und ich fühle mich fast etwas einsam so allein an meinem. Alles lacht und erzählt und als mein Blick über all die fremden Gesichter hinweggleitet – sehe ich sie plötzlich. Eine Familie mit zwei Kindern betritt gerade die Terrasse und setzt sich an ihren Tisch. Herzliche Umarmungen, Wangenküsschen, Gelächter. Die Szene zieht nur kurz meine Aufmerksamkeit auf sich, aber mehr braucht es nicht, um sie zu erkennen. Ihr Anblick lässt mich schockgefrieren. Wie kann das sein! Sie? Hier? In diesem Kontext?
Sie sieht anders aus als damals, trägt Make-up, hat sogar eine richtige Frisur. Trotzdem genügt ein Blick in ihre Augen und all die bitteren Gefühle, die ich über Jahre so mühselig in irgendeine finstere Ecke meines Unterbewusstseins verfrachtet habe, sind binnen Sekunden wieder da. Als wären sie nie weg gewesen.
Sie heißt Marla und sie ist der erste Mensch, dem ich im Leben wirklich begegnet bin. So beschreibe ich es bis heute, wenn ich von der »guten alten Zeit« erzähle. Kennen gelernt haben wir uns in der Welt der linken Hausbesetzer, auf einem Konzert, das jemand in seinem Wohnzimmer veranstaltete. In der Brunnenstraße 183 war das. Marla wohnte damals in der Liebig13, ich in der Köpi, und wie alle unsere Freunde, glaubten wir fest, dass Anarchie und Kommunismus eine Zukunft hätten.
Wir entdeckten schon nach drei, vier Sätzen unsere gemeinsame Leidenschaft für alte Häuser. Es dauerte keine Stunde und wir waren ein Team. Nicht mal eine Woche verging, bis wir ohne große Worte klar kommunizieren konnten: Marla zeigte mir ein Foto, zum Beispiel vom Stadtbad Lichtenberg, ich sagte: »Sonntag?«, überlegte, ob ich nochmal meinen Dealer – aber sie sah meinen Ausdruck und sagte: »Hab noch genug« und ich sagte: »Na gut, dann kauf ich den Wein.«
Wir bereisten eine Berliner Ruine nach der anderen, verbrachten ganze Nächte darin, studierten ihre Geschichten, erzählten sie weiter bis ins 23. Jahrhundert. Wir fühlten uns wohl, so seitab der Welt und in den Überresten vergangener Zeiten spukend, hatten keine Angst, wenn es dunkel wurde. Wir waren die Gespenster, die dort ihr Unwesen trieben.
Ein Abenteuer, an das ich mich bis heute gerne erinnere, ist das Haus der Statistik am Alexanderplatz. Unser mit Abstand größter Coup. Es war an Silvester und wir hatten über hundert Euro im Baumarkt gelassen – ein Seil, ein Brecheisen, Schutzhandschuhe – hatten der Kassiererin dieses offensichtliche Jungeinbrecher-Starterkit aufs Band gelegt und die hatte uns mit erhobener rechter Augenbraue angestarrt, bevor sie schweigend die Preise in die Kasse tackerte.
Als wir uns später seitlich an den Flachbau heranpirschten, war es längst dunkel und in der Ferne explodierten Böller und Raketen, während wir im Schutz der Büsche ein Fenster aufhebelten. Es dauerte ewig, bis wir drinnen waren, aber sobald unsere Füße auf dem alten Büroteppich standen, tanzten und kicherten wir wie zwei Grundschulkinder. Unser Ziel war das Dach des zweiten Turms von wo aus man direkt auf den Fernsehturm schaut. Der Weg dahin führte uns durch dunkele Kellergewölbe, über Möbelberge, wir kletterten aufs Zwischendach, drüben wieder rein. Ständig trafen wir auf Hindernisse, mussten umkehren, einen anderen Weg suchen. Aber wir gaben nicht auf. Wir gaben nie auf, wenn wir zusammen waren.
Nach über einer Stunde endlich im zehnten Stock des zweiten Turms angekommen, verzweifelten wir beinahe an der Suche nach dem Dachaufgang. Wir irrten durch verwüstete Flure, Klos und Büros und vor den Fenstern explodierten Raketen im Sekundentakt, tränkten die Dunkelheit in jede Farbe des Regenbogens. Bilder wie aus einem Traum. Und als wir endlich das Dach betraten, war das ein Gefühl für das ich bis heute keine passenden Worte finde. Unter uns die Stadt, die Menschen klein wie Insekten, gegenüber der majestätische Fernsehturm und um Null Uhr ein Feuerwerk – buchstäblich aus der ersten Reihe – zu dem wir Sekt aus Plastikbechern tranken. Dort oben war man jenseits der Dinge. Sah der Realität nur zu. Du warst, was du bist, ohne Angst vorm Gestern oder Morgen. Nicht mal nach Drogen verlangte es uns, wir vergaßen sie einfach. Stattdessen teilten wir jedes letzte Geheimnis, von dem man wirklich nie gedacht hätte, es jemals irgendwem zu erzählen. Alle Grenzen waren offen und wir so high von dieser Nacht, dass wir beschlossen im neuen Jahr alles auf Null zu setzen. Es besser zu machen als jemals zuvor. Was immer das bedeuten mochte.
Etwa zwei Jahre nachdem Marla verschwunden war, krempelte ich mein Leben komplett um. Ich machte unsere Leidenschaft zu meinem Beruf und wurde – Baugutachter. Genug gekämpft, dachte ich, genug geopfert und gescheitert. Das Kapital spekulierte weiter die Welt zugrunde, schluckte unaufhaltsam ein Hausprojekt nach dem anderen, renovierte und kernsanierte ihre Frei- und Vergangenheiten davon und ich – zog in eine Schöneberger Altbau-Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad, 65m², Dielenboden und Stuck an der Decke.
Und jetzt – jetzt sitzt sie einfach da, Marla, und ich kann nicht anders, als zu starren. Irgendwann bemerkt sie meinen Blick und erkennt mich sofort so wie ich sie vorhin, was ihren Gesichtsausdruck in sich zusammenfallen lässt. Das Tischgespräch zupft von rechts und links an ihr und sie bemüht sich zu tun, als wäre nichts. Dabei schaut sie ständig heimlich zu mir rüber. Ähnlich wie damals in der Brunnenstraße.
Nach 15 Minuten Augenpingpong steht sie auf. Sie verlässt ihren Tisch und läuft Richtung Tresen, aber kurz bevor sie im alten Getreidespeicher verschwindet, wirft sie mir diesen kurzen Blick zu, den ich sehr gut kenne. Und ich stehe auf, um ihr nachzulaufen.
Im Jahr nach dem Dach wurde dann die Liebig13 geräumt und ab da ging’s steil bergab. Marla zog zu mir in die Köpi und ich verlor kurz darauf meinen alten Job. Wir verschmolzen in diesem Jahr, waren ohneeinander nicht mehr vorstellbar. Manchmal waren wir tagelang unterwegs, tranken und koksten uns durch Bars und Clubs, zerstreuten uns danach und wussten Tage-, mitunter Wochenlang nicht, wo der andere war. 2014 starb Marlas Großmutter und hinterließ ihr eine Geld. Viel Geld! Marla ergriff die Gelegenheit und lud mich ein mit ihr auf Reisen zu gehen. Sie wolle raus, meinte sie. Raus aus allem. Erstmal Europa, dann mal sehen. Es wurden unsere beste Zeit seit Langem. Jeden Tag eine neue Stadt, ein neues Land oder Lost Place irgendwo in Europa.
In Portugal dann, mitten in Lissabon, verschwand Marla. Kein Abschiedsbrief, kein Warum, nichts. Typisch Marla. Nur ein paar Hundert Euro auf dem Nachtisch. Ich respektierte ihren Wunsch, fuhr ein paar Tage später nach Deutschland zurück und sah sie nie wieder.
Als ich an der Theke vorbei zu den Toiletten gehe, steht Marla schon da und wartet. Sie sieht mich an, schüttelt den Kopf, zieht die Schultern hoch und ich antworte indem ich mit dem Arm in Richtung Schloss zeige. Marlas Augenbrauen sagen: War klar, dass wir uns so oder so ähnlich wiedersehen. Und ich nicke: Allerdings. Sie seufzt und ihre Augen sagen: Tut mir leid, du kennst mich ja, manchmal bin ich einfach weg; und meine Mundwinkel antworten: Weiß ich doch, und meine Handgeste sagt: Schon OK. Dass sie nicht mit mir rüber ins Schloss gehen wird, habe ich schon verstanden und auch, dass sie noch eine Weile hier bleiben will, deswegen frage ich jetzt laut: »Neu bauen oder Denkmalschutz?« und zeige Richtung Schloss.
Ihre Augen halten an mir fest, wie damals immer, und ich weiß genau, was sie jetzt denkt und fühlt und warum und was sie gleich sagen wird.
»Denkmalschutz«, sagt sie.
Ich nicke und lächele.
Dann gehe ich hoch und packe meine Sachen.
.
Der Text entstand in einem Literaturworkshop im Rahmen des Projekts ‚Und seitab liegt die Stadt‘ des LCB Berlin. Er wird in Kürze zusammen mit anderen in der Anthologie ‚Ich muss hinaus. Die Stadt ist eine Gruft‘, herausgegeben vom Ökospeicher e.V. Wulkow, erscheinen. >> Nähere Infos <<
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sophie Schagerl
Friseurbesuch, abgeschnittene Enden
Draußen schwimmen die Fische ums Aquarium, lese ich. Draußen schwimmen die Fische ums Aquarium. Bei jeder Rückkehr schrumpft die Stadt zu einem Kloß unter dem Küchentisch zusammen, so weit habe ich mich gefühlt. Da ist etwas, das ich nicht weiß, um das ich nie Bescheid wissen werde, es ist die Gemütlichkeitslage, wo versteckt sie sich unter all den Übermalungen an der Wand?
Ich trete aus der Tür. Hier bin ich, bin ich, bin ich, mich sehen all diese Menschen, die ich sehe, wie sie ihre Leben in Girlanden verwirbeln ein Zirkuszelt aufstellen mitten auf der Einkaufsstraße, die über meinem Kopf Loopings schlägt, während ich gehe und an meine überanstrengten Beine denke. Ich fühle meine Oberschenkel, immerhin hier ist mein Körper er wird gesehen wird begutachtet und für anders befunden. All die Girlandenmenschen sehen mich und denken, diese Beine sind nicht meine nicht ihre nicht eure sie sind dort, wo die Girlanden entwirrt werden, nichts davon gehört zu meinem eigenen Wirrwarr.
Eine Tür fällt hinter mir zu, ich lasse meine Haare anfassen, jemand schneidet mir über meinem Gehirn etwas ab und ich schaue leicht nebelig von all diesen Girlanden all dieser Zirkusmusik in den Spiegel und sehe das gemächlichste Haarfegen hinter mir geschehen, das gemächlichste aller — das ich je gesehen habe. Da schreitet dieser Mensch und fegt und fegt und hat einen Wirbel am Kopf, wo mir eben alles abgeschnitten wurde, all die Fische und all die halben Jahre, die ganze halbe Zeit, da wippt der Schopf mit dem Fegen im Takt, wiesegleich wippt sie durch den Raum, diese fremde Girlande und schaut mich an mit ihrem Ichhabdichgesehenblick, das bringt mich aus der Umgebung. Das treibt mich davon aus dem Spektakel hinein in die Tagträumerei, was ist das jetzt wirklich mit den Abständen, die gibt’s, das habe ich gelernt, die Abstände, die gibt’s.
Die Schluchten habe ich erst gesehen, vom Randstein fällt die Welt steil bergab schneidet sich ein Flüsschen einen Graben, eine Träne: ein Graben, der für ordentliches Klettergeschick nicht bürgt und sich ins Fäustchen lacht bei all den Wanderungen Irrungen als ob da jemand an die Quelle gelangen könnte, die ist völlig überwuchert.
In meiner Abwesenheit sehe ich sie schon hantieren mit der Gartenschere, mähe mir meinen Rasen, möchte ich ihr zurufen, mähe mir den Rasen, zupfe an den Stauden und den Flechten, lass sie rieseln, möchte ich ihr zurufen, oder entkommt es mir, halte mir kurz die Hand vors Gesicht und greife nach der Brille, vor mir abgelegt, um sehen zu können, durch den Spiegel, ob sich denn im Blick der Schneidenden ablesen lässt, dass ich mich hörbar gemacht habe. Ob ich wirklich in den Garten gerufen habe? Ich sehe, ja, sie fängt den bebrillten Blick und hält inne beim Grasen kurz, sagt aber nichts, irgendwann ein Abwenden, ich setze die Brille auch wieder ab und falle zurück in die Ausgangsposition, die ohne jede Klarheit ohne Haltung auskommt, in ausreichender Sprachlosigkeit.
Alle Worte einfällig, nicht aufgeschlagen nicht ausgedrückt, sie fallen in mich ein und wenden sich ab zur Gänsehaut. Ich reibe an meinen Armen, gerade die Oberschenkel verloren, spür ich nicht mehr, jetzt wende ich mich den Armen zu und hole aus zur Aufmerksamkeit, die noch übrig geblieben ist vom Blickkontakt. In mir purzelt die Grammatik, vor allem die Suffixe schlagen übereinander, da lässt sich kein Abschluss finden beim Einfallen, das geht weiter und weiter und weiter, das Silbengestotter nimmt kein Ende und das Schneiden dauert auch so lange. Draußen schwimmen die Fische ums Aquarium, denke ich, wo wachsen die Pflanzen, wo verstecken sich die Fische, während sich die abgeschnittenen Enden in mir verstecken?
Zurück zuhause liege ich im Bett, das ich ins Zentrum des Raums gestellt habe. Ich betrachte die Möbelstücke, die ich im Laufe des letzten Jahres angetragen habe, um ihn gänzlich ausgefüllt erscheinen zu lassen. Ich habe diesen Schrank gekauft, damit er Raum einnimmt und diese Vorhänge, damit sie abschließen. Ich habe diesen Schrank gekauft, damit du ihn siehst und diese Vorhänge, damit du eintrittst in den Raum und dich freust über das Abgeschlossene, inmitten dessen du dich befindest. Die Möbel erfüllen alle einen Zweck, den Zweck, von dir gesehen zu werden. Sie stehen da und stauben an und werden bloß von mir betrachtet, liegend frage ich mich, ob sie zerfallen werden, wenn ich aufhöre, an dich zu denken.
Ich liege hier und versuche mich auszubreiten, breitbeinig liege ich hier, die Zehenspitzen an den Bettecken ausgerichtet und an mich klammere ich die schwerste der Decken. Als ich hier eingezogen bin, erinnere ich mich, hast du aus dem Fenster gespuckt und mich gefragt, wo ich bin. Schau mich an, wir tanzen, hast du gesagt. Da gab es noch keine Vorhänge und dementsprechend keine Abgeschlossenheit und so weht alles aus dem Fenster, alles, das du sagtest, auch das Tanzen ist nicht geblieben. Dann kamen die Möbel.
Ich strecke mich, hebe das Kinn. Ich betrachte mir die Kästen und Vorhänge und Stühle und Stuhlbeine, die alle bloß deinetwegen hier sind. Die Farben habe ich meinetwegen ausgewählt, aber die Formen, die Füllung, die ist für dich. Ich habe schwere Möbel mit schlanken Beinen ausgewählt, die punktuell aufs Parkett drücken, vielleicht Auszugsmale hinterlassen, wenn ich die Augen schließe und sie dann verschwinden wie du. Seitdem du verschwunden bist, sehe ich all diese Zirkusgirlanden an den Straßenrändern, die Stadt feiert Feste, trompetet und fegt Haarschnitte über die Randsteine, seitdem du verschwunden bist. Ich dagegen sammle Möbelstücke, die den ganzen Raum ausfüllen sollen.
Einmal in der Woche gehe ich treppab an einem herbstlich schwach beleuchteten Lampenladen vorbei und frage mich, welcher Schirm zu welchem deiner Hüte passen könnte und sehe dich rückwärts aus der Tür treten und sagen: „Wo bist du? Lass uns tanzen.“ Ich drehe Pirouetten in Gedanken, senke das Kinn, versuchend, den Blick abzuwenden von den üppigen Oberflächen, die mich an vergangene Entscheidungen erinnern. Es gelingt nicht, da stehst du fast im Raum und sagst: „Ich glaube, du brauchst eine Typveränderung, draußen verändern sich die Farben.“ Du öffnest den Schrank, den rechts im Blickfeld, die Tür macht leise Schwinglaute. Du ziehst das schwarz-weiße Hemd heraus, das ich von der letzten Reise mitgebracht habe, und hast recht, es war eine Herbstreise. Hältst es dir überzeugt vor die Brust, „Was meinst du, passt das zum Wind draußen?“ Ich nicke unentschlossen, liege hier im Zentrum des Raums und es ist mir gänzlich egal, was ich mir für die Außenwelt anlege. Ich verstehe sie nicht, im Moment.
Erhebe mich und lasse das Nachbild von dir im überfüllten Raum zurück, ich denke, es ist Zeit für einen Spaziergang, das Dämmerlicht zieht mich aus der maulwurfsblauen Decke, an den Zehenspitzen zuerst und kippt mich, die Füße kalt, Schuhe sind auszuwählen. Ich habe alle Schnürsenkel abgerissen, fällt mir auf, also trage ich Sandalen und klappere ins Freie, das mich sogleich überfällt. Die Feierlichkeiten dauern noch an, die Girlanden sind noch nicht in die Nacht verschluckt, haben noch keine Bars und Getränke ausgewählt, sie schwingen noch über die Zebrastreifen und sind laut dabei.
Es pfeift förmlich, mir pfeifen die Überreste der Feierlichkeiten, ich mag mir die Ohren zuhalten, aber ich halte nur aus und hole dann aus zum Klapperschritt, flappe um die Ecke, aus Gewohnheit sehe ich mir den Asphalt dort etwas genauer an, er fleckt und irgendwo hier hast du hingespuckt, als du mich gefragt hast, wo ich bin. Was feiern sie alle, schreit es mir aus den Korridoren, ich verdutze mich, schnell weiter eingliedern in die Routine, es hallt aus den Gewinden, ich verliere langsam die innerliche Liegehaltung und hasche nach den Girlanden auf der Straße, nicht mit den Händen, Girlanden sind keine Möbelstücke zum Festhalten, nur Luftschlangen, bunte.
Die ganze Stadt riecht nach Schokolade ich pruste laut schnupfe die Süßigkeiten regnen überall aus den Fenstern qualmt die Radiomusik des letzten Jahrhunderts, ich hüpfe schneller, fühle wieder meine Beine spannen, spanne mit meinen Schritten weit ausholend über die Fugen Risse in die Straßen, die Schatten der Rauchfänge möchte ich nicht einfangen mit meinen Schritten nur schnell weg von dieser Musik.
Wieder während dem Liegen stelle ich mir fast vergessenes Gefühl vor. Ich stelle mir vor, im Eckzimmer des Mutterhauses auf den Schlaf zu warten, der nicht kommen mag, den ich mit Willenskraft vertreibe, weil draußen noch Schritte zu hören sind, die in die Küche und zurück, die aus der Küche ein Glas Himbeersaft holen und jemandem vorsetzen, der nicht zu Besuch ist. Ich könnte Himbeersaftgeräusch verpassen, sollte ich jetzt einschlafen.
Ich höre die schlechten Dielen klappern unter den bloßen Sohlen oder unter den Holzschlapfen, die gab es einmal, als ich nicht auf den Schlaf warten wollte, das Glasgeräusch schwingt kurz, und durch den Türspalt ein Schimmer wie ein Schimmer Leben, der schüttelt die Decken auf und setzt auf beide Augen einen Kuss Ruhe, ruhige Schlaflosigkeit durch den Türspalt. Ich hebe das Kinn, vor allen Spalten steht jetzt ein Kasten, Massivholz, auf dessen Hochglanzoberfläche sich der Vorhang spiegelt. Verkaufe ich diese Vorhänge, frage ich mich.
Irgendwann ist es Zeit, die Möbel allesamt zu verkaufen, denkst du. Du denkst den Satz zu Ende und fühlst ein unregelmäßiges Pochen, irgendein Organ hält inne und möchte nicht ausräumen, irgendein Organ hat einen bittersüßen Anfall, nur ganz kurz, kaum merklich. Immerhin hast du bereits so oft begonnen, diesen Satz zu denken, so oft hast du gedacht, vielleicht sollte ich die Möbel allesamt — dann abgebrochen.
Dir fällt überhaupt auf, dass — dir fällt auf, die Zeit im Zeichen verschiedener Anfänge zu verbringen, aber nichts — nichts und wieder — zu Ende zu — Nichts hast du vollendet, verkauft. Nichts bist du losgeworden, nichts hat dich ausgezeichnet, bis auf all die leuchtenden Anfänge. All das Sektglasanstoßen, auf ein Neues — ein neues Jahr zuerst, dann auf neue abgeschnittene Enden. Winterlich hattest du noch an leuchtende Enden geglaubt, welch eigentümliche Verwirrung, wir waren keine Himmelskörper.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Britta Badura
Liebesleben
Es ist Freitag, Donnerstag, Mittwoch, alles durcheinander. Meine Kopfhaut juckt. Der Kaffee am Morgen war bitter, doch zweckdienlich. Dazu ein bisschen vom Kameldung, was ich seit meinen französischen Jahren rauche. Da gab es einmal Blutwurst in Lyon, eine Fahrt mit dem TGV nach Paris und einen Liebeskummer, den ich zwei Ehen später immer noch nicht überwunden habe. Google bestätigte mir, dass er immer noch mit der Frau zusammen war, für die er mich damals verlassen hatte, zwei Söhne, in etwa so alt wie meine. Er gefällt mir auf den Bildern gar nicht mehr. Mein Handy hat einen unbeantworteten Anruf. Soll es sich doch selber darum kümmern. Eine Eidechse sonnt sich auf der Terrasse und mein linkes Bein schläft gerade ein, weil ich es hochgelagert habe, ansonsten würde es beim langen Sitzen anschwellen. Bei beiden Schwangerschaften hatte ich immer schlanke Fesseln und sogar der Primar sagte kurz vorm Kaiserschnitt, als ich halbnackt vor ihm stand und er eine externe Wendung versuchte, zu meinem damaligen Mann: „Sowas schwängert man gerne.“ Andere Männer meinten, ich hätte so tolle Beine, doch sie wüssten nicht, was sie im Bett damit anfangen sollten – als hätte ich ihnen irgendwelche Signale in diese Richtung gesendet. Einmal war ich bei einer Körpertherapeutin, die mir Karten auf den Körper legte, dabei sagte sie, die linke Seite repräsentiere die mütterliche Linie, die rechte die väterliche. Prompt schwoll mein linkes Bein so an wie die Beine meiner Mutter und Großmutter. Verwundert rief ich die Therapeutin an, die allerdings nur meinte, meine körperliche Verfassung sei ihr ein Rätsel – so etwas sei ihr noch nie untergekommen. Ich werde auch nicht schlau aus diesem Körper, der nur aus sehnsüchtigen Schichten besteht. Und all seine Schönheit habe ich an Männer verschwendet, die nur das Programm Schmachtblick, Schmusen und Schuss kannten. Immer wieder habe ich trotzdem einen mit nach Hause genommen, doch ich habe es mir abgewöhnt, deswegen traurig zu sein. Ich will wieder ein Wackelzahnherz. Ich wünschte, ich könnte lieben wie Kinder. Mit Geduld. Mit offenem Auge. Die Nacktschnecken und die Kaulquappen. Kind in der Liebe sein. Wo es reicht, einander verstohlen beim Spielen zu beobachten, ein Herz im Wachstum zu haben. Überhaupt: der Zufall der Zuneigung. Warum nicht irgendjemandes Geliebte sein, ein paar Dinge ausprobieren, sich bloß nicht verlieben, sich um Gottes willen nicht verlieben, sondern ganz im Körper und in der Zeit sein. Welch Wunschgulasch. Wir lieben doch eh nur die Bilder, die wir uns vom anderen machen. So schnell nützt man sich ab und die Jukebox spielt Lügen, versteckt hinter Koseworten und verstreuten Erinnerungen. Ein Mann hat mich ein paar Wochen lang nur gevögelt und eines Nachts merkte ich, dass die Liebe eingefahren war, weil er mich plötzlich aufmerksamer ansah. Als er eine andere Frau kennenlernte, nicht besser als ich, nur anders, brach kurz meine mühsam zusammengezimmerte Welt zusammen. In einer Bar mixte ich nächtelang Caipirinhas. Ein Typ aus Berlin fand meinen Akzent so bezaubernd, dass er bis zum Schluss meiner Schicht blieb, um mich, sein Rad nebenher schiebend, nach Hause zu begleiten, wo er mich zwar mit einem Kuss verabschiedete, doch ohne Nummer oder andere Anknüpfungspunkte. Ein paar Tage später sah ich sein Rad in der Innenstadt und steckte ihm eine Alpenmilchschokolade in den Gepäcksträger. Wir gingen dann tatsächlich miteinander ins Kino, irgendeinen seltsamen isländischen Film, doch nachdem ich bei ihm zuhause aufgewacht war, meinte er, er sei noch nicht über jemanden hinweg und er melde sich. Das E-Mail ein paar Tage später trug den Betreff „Pretty girls make graves“ und hatte sonst keinen relevanten Inhalt zu bieten. Ich verließ die Stadt. Vermutlich muss ich mir eingestehen, dass ich alle meine Lebensentscheidungen aus Liebeskummer getroffen habe. Deswegen kann ich meine Zukunft nicht planen, nicht in das Korsett von Vorstellungen zwängen, doch dieses Warten, dass einmal etwas Spannendes passiert, macht mich mürbe. Und währenddessen schreibe ich Einkaufslisten, erkundige mich über Versicherungen, zahle pünktlich alle Rechnungen, vergesse keine Geburtstage, und versuche, meinen verfallenden Körper instand zu halten. Die vergeblichen Verwobenheiten, die wir unser Leben nennen. Es ist Mittwoch, sehe ich im Kalender, und auf der Kaffeepackung steht: „Nichts für schwache Herzen.“
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Amalie Mbianda Njiki
Rotlicht
Mein Raum befindet sich an einem verborgenen Ort, andere verschlungene Räume falten und winden sich um ihn herum. Manchmal dringen gedämpfte Laute von außen ein, von denen ich mir vorstelle, es seien Mutters Bauchgeräusche in jener Nacht vor meinem Abschied.
Meinen Raum kann jeder besuchen. Ihr tretet ein. Ihr haltet eure Luft an, um durch meine Luft zu tauchen, solange, bis euer Geruch meinen Raum flutet, meine Luft zu eurer wird und ihr schwer auf mich herabsinkt.
Meinen Raum richtet jeder nach seinen eigenen Wünschen ein. Es ist euch egal, ob ihr diesen, oder einen anderen Raum besucht, weil für euch alle Lippen gleich rot glänzen und alle Geschichten gleich sanft klingen.
Mein Raum ist für euch wie ein leeres Gefäß, das erst durch euch als Inhalt seinen Zweck erfüllt. Ihr denkt: Wer seinen Körper verkauft, ist nicht vollständig. Ich versuche mir vorzustellen, wie ihr meinen Raum mit einer meiner Zehen verlasst. Beim nächsten Besuch kauft ihr euch bereits meinen Arm. Oder ein Bein. Ihr kämt und kämt bis nichts mehr übrig wäre.
Noch beschreibe ich mich jedoch anders:
Wer seinen Raum vermietet, ist darin vollständig allein.
Mein Raum kann eure Fassaden so verziehen, dass sie beinahe menschlich wirken. Eure Linien zerfließen, eure Stirnen rillen sich angestrengt. Die Falten erinnern mich an das Wellblech, aus denen die Slums meines Mutterlandes geformt sind. Dorthin, wo Wände fest und aus Stein gefertigt sind, Hitze und Eindringlinge nicht so leicht nach innen gelangen, hat die Madame versprochen. Jetzt sind meine Wände so dick und undurchlässig, dass sich hier jeder Fremde eine Auszeit von der Kälte Deutschlands nehmen will, euer Schweiß perlt über mich hinweg wie Mutters Tränen in der Heimat.
Auch wenn ihr alle Zimmer meines Raumes zu kennen glaubt, kann sich euer schlechtes Gewissen nicht vor mir verstecken. Mein Raum füttert und füttert es, bis es nicht mehr zu übersehen ist, und wenn sich das schlechte Gewissen bereits den Kopf an der Decke stößt, verlässt es meinen Raum leise.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Marina Wudy
Sterne einatmen
Wir sitzen am Fenster und schauen in die Sterne. Der Mond muss auch irgendwo sein, aber noch habe ich ihn nicht entdeckt, zu viele Wolken ziehen über den Himmel. In der Nachbarwohnung läuft der Fernseher, die Geräusche dringen dumpf durch die Wand. Uschi, so nenne ich die Frau von nebenan insgeheim. An ihrer Haustür hängt ein Mandala, und durch das Küchenfenster zieht regelmäßig der Geruch von Kreuzkümmel und Kurkuma nach draußen.
Wie geht es dir heute?, fragst du. Du schaust mich dabei nicht an, hast deinen Blick weiter nach draußen in den Himmel gerichtet. Früher hast du dir oft vorgestellt, dass Sterne zwinkern können, und wenn einer einmal heller und wieder dunkler wurde, war das dein Beweis dafür. Sterne haben auch Gefühle, hast du dann gesagt.
Ich wende meinen Blick von dir ab, zurück zu den Sternen. Gut, sage ich. Gut geht es mir.
Bist du sicher?, fragst du.
Ja, sage ich. Warum?
Ach, sagst du. Du wirkst nicht so.
Warum das denn?
Ich richte mich auf in meinem Stuhl und drehe mich wieder zu dir. Noch immer schaust du mich nicht an. In der Luft hängt noch der Geruch des Chilis, das ich vor ein paar Stunden gekocht habe. Ich reiße das Fenster auf, schließe meine Augen, atme ein.
Naja, sagst du. Früher hättest du jetzt gesagt, komm, lass mal Sterne einatmen. Lass mal das Leben vergessen und einfach sein.
Sterne einatmen?, frage ich und runzle meine Stirn. Noch immer schaust du mich nicht an, hast den Blick starr aus dem Fenster gerichtet.
Ja, Sterne einatmen, sagst du. Die ganze Welt, die ganze Nacht. Alles, was ist, und was sein könnte. Möglichkeiten, Unendlichkeiten.
So ein Quatsch, sage ich. Unendlichkeiten.
Da, sagst du. Genau das ist es. Du denkst nur noch. Du fühlst gar nicht mehr.
Ich höre den Vorwurf in deiner Stimme, und er macht mich wütend.
Das stimmt nicht, sage ich. Ich fühle andauernd.
Aha, sagst du. Wann denn zuletzt?
Wie bitte?
Was war dein letztes Gefühl?
Was ist denn das für eine Frage?
Fragen brauchen Antworten. Auf so eine Logik stehst du doch. Also los jetzt.
Nein, sage ich. Der Vorwurf in deiner Stimme gefällt mir noch immer nicht.
Da hast du es.
Gestern, sage ich schließlich, nur um dir zu beweisen, dass du nicht Recht hast. Natürlich hast du nicht Recht. Natürlich fühle ich.
Gestern habe ich einen Text gelesen. Von einer Kollegin. Der war sehr interessant. Der hat mich zum Nachdenken gebracht. Im gleichen Moment, in dem ich den Satz ausgesprochen habe, merke ich meinen Fehler. Doch du bist schneller.
Ha, sagst du. Siehst du.
Ich mache meinen Mund auf, möchte mich verteidigen, dir sagen, dass das gar nicht stimmt, was du sagst, dass ich sehr wohl fühle, aber die Worte kommen nicht. Sie bleiben in meinem Hals stecken, störrisch, wie die kleinen dornigen Widerhaken, die früher in meinem Wollpullover hängenblieben, wenn ich über die Wiese vom Bauern Thomassun lief.
Eine Weile schweigen wir; ich denke über Theo nach, der mir in der zehnten Klasse das Herz gebrochen hat; über den Tag, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, und über den Moment, in dem ich den Anruf von der Polizistin bekommen habe, Frau Hollweg, Ihr Vater.
Aber all das ist Jahre her.
Trotzdem will ich dir nicht Recht geben.
Woran machst du das denn fest?, frage ich dich schließlich. Dass ich nicht fühle?
Du zuckst mit den Achseln. Das ist leicht. Du lachst nicht mehr richtig.
Das stimmt gar nicht, sage ich. Ich lache andauernd.
Vielleicht, sagst du. Aber nicht richtig. Nicht so, dass du nach Luft schnappen musst und deine Bauchmuskeln sich so anspannen, dass du danach Seitenstechen bekommst, und dass du dir dabei fast in die Hose pinkelst.
Ich will protestieren und sagen, dass ich mir auch ganz sicher nicht in die Hose pinkeln möchte vor Lachen, aber dann verliere ich mich in meinen Gedanken. Ich erinnere mich an die Lachanfälle, die ich früher hatte, über die banalsten Dinge. Herr Schmitt mit dem überdimensionalen Schnauzer, der immer mittwochs seinen Rasen gemäht hat und dabei seine Finger ganz merkwürdig abgespreizt hat. Den Fernsehmoderator, dem in der Live-Übertragung des EM-Finales eine widerspenstige Haarsträhne vom Kopf abstand.
Vielleicht hast du Recht, sage ich schließlich und kaue auf meiner Unterlippe herum.
Und die Texte, die du liest, sagst du und schüttelst deinen Kopf.
Was ist damit?, frage ich.
Die sind immer voller tiefsinniger Gedanken, aber frei von Gefühlen.
Ja und, sage ich. Ich mag Texte, die mich zum Nachdenken anregen.
Offensichtlich, sagst du.
Und jetzt?, sage ich und wickle einen losen Faden von meinem Pullover um meinen Zeigefinger. Was soll ich deiner Meinung nach tun?
Gar nichts. Einfach mal gar nichts.
Ich starre dich an, dein vertrautes Profil, das noch immer von mir abgewandt ist. Ich denke an den Nachmittag, als ich ohne Badesachen in der Bucht in Montenegro schwimmen gegangen bin, an den Geschmack von Salzwasser auf meinen aufgesprungenen Lippen und das Kribbeln in meinem Unterleib.
Und dann?, frage ich. Was soll das bringen?
Dann kommen die Gefühle. In der Stille.
Endlich drehst du auch deinen Kopf, siehst mich an, und in deinen Augen tanzt ein ganzes Universum.
Wir sitzen einige Minuten lang schweigend voreinander. Ich verliere mich in deinen Augen, und plötzlich bin ich nur noch Gefühl, bestehe aus kribbelnden Fingerspitzen und tanzenden Atomen und lebendiger Materie. Habe vergessen, wie Denken überhaupt geht, und dass du gar nicht hier bist. Dass dein Profil nur eine flüchtige Verzerrung meines eigenen Spiegelbilds ist, und deine Worte nur der Widerhall meiner eigenen Gedanken.
Ich hebe meine Hand und lasse meine Finger über die Sitzfläche des leeren Stuhls neben mir gleiten. Schaue in die Sterne, die sich in der Unendlichkeit verlieren. Atme noch einmal ein, tief und lange, bis jeder Winkel meiner Lunge mit der kalten Luft gefüllt ist. Bis die Kälte in mir explodiert, sich in Hitze verwandelt, und in ruckartigen Stößen durch meinen Körper schießt.
Ich wehre mich nicht dagegen, lasse es einfach geschehen, gebe mich hin; der Erinnerung an dich, allem, was hätte sein können, was ich nicht fühlen wollte und konnte, was unter der Oberfläche all die Jahre brodelte und mich zu einer leeren Hülle hat werden lassen; einer Hülle, die funktioniert, sehr gut sogar; aber so viel Leere, so viel Kälte. Ich denke an Mandala-Uschi, an den Bauern Thomassun, an meinen Vater, und frage mich, ob sie auch alle dieses Ziehen in sich hatten, wenn sie in die Sterne geschaut haben.
Irgendwann ist es vorbei, und als ich in den Himmel schaue, spüre ich, dass ich es gerade endlich wieder getan habe: Ich habe Sterne eingeatmet. Möglichkeiten, Unendlichkeiten. Alles, was ist, und alles, was sein könnte.
Ich spüre, wie eine Träne meine Wange hinunterläuft. Ich lasse sie laufen, halte sie nicht auf, und schaue weiter in den Himmel.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jannik Lober
Der Krieg mit den Käfern
Über den penibel gepflegten Rasen hinweg und vorbei an drei Gartenzwergen – der ganz rechts entblößt schamlos sein Hinterteil – höre ich die Schwengelpumpe im unermüdlichen Takt ächzen. Zug um Zug füllt sich der 10-Liter-Bauch der Plastikgießkanne, deren hellgrüner Tülle sich dabei ein hallendes Gurgeln entringt. Mit dem Handschuhrücken meiner Linken wische ich mir Schweißperlen von der Stirn und bin verblüfft, welch angenehm kühlende Wirkung der Klang von plätscherndem Wasser hat. Das akustische Wohlgefühl verflüchtigt sich allerdings bereits im nächsten Moment, denn während ich den bockelharten Lehmboden mit einer Handhacke bearbeite, weiß ich, ganz tief in mir drin, kniend vorm Gemüsebeet, dass ich im Begriff stehe, den Krieg gegen die Käfer endgültig zu verlieren. Beim Anblick meiner kümmerlichen, zu grauen Bällchen verschrumpelten Tomaten ist mir zum Heulen zumute; mehr aus gekränktem Stolz denn aus echter Trauer. Eine heranwehende Frühnachmittagsbrise ist durchsetzt mit dem Geruch nach gegrilltem Fleisch, Feueranzünder und drohender Niederlage. Ich beiße meine Zähne so fest zusammen, dass meine Kiefergelenke sandig knirschen. Dann drücke ich mir meine Kopfhörer ins Ohr und hacke (Only You von Yazoo auf voller Lautstärke) rachsüchtig weiter, verfalle unmerklich in den Rhythmus der Pumpe im Nachbargarten. Auge um Auge, Fühler um Fühler, ihr kleinen Wichser.
In irgendeiner Illustrierten, die ich einmal in einem stickigen Wartezimmer durchgeschaut haben muss, stand, dass sich alle Zellen im Körper eines Menschen innerhalb von sieben Jahren einmal komplett erneuern. Krass!, habe ich einen ganzen Augenblick gedacht und dann weitergeblättert zu Artikeln über das Mikroklima spröder Kopfhaut, die fünf besten Haftcremes auf dem aktuellen Markt und den anlaufenden Vorbereitungen zur Feier von Florian Silbereisens 40. Geburtstag. Jetzt, da ich aus der aufgelockerten Erde widerspenstige Hahnenfußausläufer ziehe (aus den Augenwinkeln verstohlen nach Eigelegen an runzelig gelbe Blattunterseiten Ausschau haltend), muss ich wieder daran denken. Schon seltsam. Da vollzieht sich im eigenen Inneren, im intimsten Intimbereich, so ein fundamentaler Wandel, aber man bekommt nicht die leiseste Spur davon mit. Wenn es nach den sieben Jahren wenigstens einen hervorspringenden Clown mit Konfettiregen, einen Fanfarentusch, zumindest einen lauten Knall gäbe. Oder ein elektrisch summender Neonröhrenschriftzug, der aus heiterem Himmel über dem Kopf aufploppt und sich in vor Staunen aufgerissenen Augen spiegelt: Herzlichen Glückwünsch! Sie sind ein rundum neuer Mensch! Gehen Sie über LOS, aber ziehen Sie rein gar nichts! Mehr Glück bei nächsten Mal!
„Na“, reißt es mich lautes Rufen jäh aus meinen Gedanken, „heute mal kein Schwarztee?“ Vor der unbarmherzigen Julisonne zeichnet sich unvermittelt die klar umrissene Silhouette eines Mannes mittleren Alters ab. Ich nahm die Hacke von der rechten in die linke Hand und überlege, ob ich knien bleiben oder höflicherweise aufstehen soll. Ich entscheide mich widerwillig für letzteres. Beim Erheben ziehe ich die Kopfhörer betont langsam aus meinen Ohren, atme geräuschvoll durch die Nase ein, schaue ihm erst dann ins beschattete Gesicht. Mit spitzem Mund antworte ich bündig: „Nein, heute nicht.“ Der niedrige Jägerzaun reicht Herrn Schulz gerade bis zur Mitte der stämmigen Oberschenkel. Von da ab aufwärts trägt er eine Art knapper Jeanshotpants, die vom ständigen Waschen schon ausgeblichen ist, ein weißes T-Shirt, unter dem sich die fortgeschrittenen Konturen eines drallen Bauchs wölben, und einen Fischerhut in den Deutschlandfarben. Auf seinen vollen Lippen liegt ein süffisantes Lächeln, aber seine blauen Augen leuchten freundlich, geradezu herzlich.
Dass etwas in meiner Gartenparzelle vor sich ging – genau genommen in meinem Kräuter- und Gemüsebeet – erkannte ich weniger am Regen, der jedes Jahr ein unmerkliches Stückchen dürftiger ausfiel, oder am Farbton des Bodens, der aus irgendeinem Grund Sommer für Sommer einen Hauch blasser zu werden schien; viel mehr kündete das plötzliche Auftauchen der Heerscharen von Käfern biblischen Ausmaßes von einer bisher unbemerkten Veränderung. Ich weiß noch genau, dass ich anfangs dachte, als es nur zwei, drei waren, die ich hier und da auf Gurkenblüten fand, wie schön doch die schwarzen Chitinpanzer mit der feinen weißen Musterung in der Sonne glänzten. Pittoresk hatte ich am gleichen Abend zu meiner Mutter am Telefon gesagt, dazu etwas von Artenvielfalt und NABU gesülzt. Heute schelte ich mich jeden Tag dafür: Pittoresk am Arsch, du blöde Kuh! Hätte ich damals schneller gehandelt, wäre es vielleicht nie so weit gekommen, sicherlich nicht so schnell. Im ersten Jahr befielen sie nur die Gurken, im zweiten vernichteten sie zusätzlich meine gesamte Zucchiniernte, dieses Jahr sind ihnen schon drei Tomatenstauden zum Opfer gefalle. Besser gesagt: Fallen ihnen zum Opfer; und über dem blutrünstigen Präsenz dräut düsterer noch das Futur. Letzten Sommer habe ich schließlich drei besonders fette Exemplare eingetütet und bin, meinen Bedenken und Hochmut zum Trotz, mit der Bahn zu meiner Exfreundin gefahren, die als Biologie-Doktorandin kürzlich eine Anstellung an einer nahen Universität gefunden hatte.
„Nezara viridula! Und was für gesunde Kerlchen auch noch, putzmunter!“ Für ihre wissenschaftliche Euphorie hätte ich ihr am liebsten einen der Schüttelkolben über den Kopf gezogen, die in allen erdenklichen Größen und Graden der Verkalkung neben Plastikterrarien und Blumentöpfen im kleinen Büro wie wahllos verteilt herumstanden. Begnügt habe ich mich dann aber mit einem zwischen Schneidezähnen hervorgepressten, trennscharf in zwei Silben zerlegten: „San-dra!“ „Gemeinsam mit dem Buchsbaumzünsler und der Kirschessigfliege zählt die Grüne Reiswanze wohl zu den größten Gewinnerinnen des Klimawandels.“ „Aber die sind doch ganz schwarz mit ein paar weißen Pünktchen, überhaupt nicht grün,“ bringe ich, meinen linken Arm an den Körper gelegt und an den Fingernägeln meiner rechten Hand kauend, kleinlaut vor, ziehe meine Augenbrauen gekräuselt zusammen. „Auch Südliche Stinkwanze genannt,“ Sandra wirft mir dabei einen Seitenblick zu, „ist die Grüne Reiswanze eigentlich in der Gegend um das Mittelmeer beheimatet und bevorzugt ein mediterranes bis subtropisches Klima. Durch die stetig steigenden Temperaturen und begünstigt durch die rapid schmelzende Eisschicht in den Bergen ist ihnen jedoch vor ungefähr zehn Jahren erstmals eine Alpenüberquerung geglückt. Seitdem dehnen sie als hochgradig invasive Art und sogenanntes Neozoon ihr Verbreitungsgebiet immer weiter nach Norden aus. Hier hast du drei schwarz gefärbte Nymphen, später als ausgewachsene Imago werden sie grün beziehungsweise braun im Winter. In allen Entwicklungsstadien stechen sie, als wählerisch kann man sie daher wirklich nicht bezeichnen, diverse Pflanzen, Samen und Triebe an, was für die befallenen Pflanze meist zu einer letalen Pilzinfektion führt.“ Ganz große Klasse, denke ich mir mit einem Stapel Papiere von Sandras Schreibtisch zornig Luft zufächelnd, ein sechsbeiniger Hannibal ante portas. Ich schaute zu den ausgeschalteten Neonröhren an der grauen Decke auf, kratze meinen Hals: „Was kann ich jetzt gegen die unternehmen?“ „Nun, du könntest es natürlich mit der chemischen Keule versuchen. Oder,“ mit ihrem Daumen schob Sandra die Krümel des Streuselkuchens, den ich als Geste des guten Willens mitgebracht hatte, zu einem säuberlichen Häufchen zusammen, und fuhr in einem Ton fort, der irgendwo zwischen Häme und Genuss lag, „du wartest bis es durch vermeintliches Nahrungsüberangebot zu einer Vermehrungsexplosion kommt, dann saugen sie sich selbst ihre Lebensgrundlage weg und verhungern letztlich.“ Sie schaute aus dem Unifenster in die Ferne, spielt sich gedankenabwesend an ihrem blonden Pferdeschwanz. „Danke, Sandra. Ich ruf dich an.“ Als ich gerade mit einem schwer zu beschreibenden Gefühl zur Bürotür hinauswollte, hörte ich hinter mir: „Und was ist mit denen hier?“ Sie deutete mit einem Stift auf die durchsichtige Zippertüte samt derer fidelen Insassen. Ich ging die wenigen Schritte zum Schreibtisch zurück und ließ meine Faust in einem einzigen fließenden Bogen auf die Tüte niederfahren. „Ich mache keine Gefangenen.“ Aus den drei aufgeplatzten Nymphenkörpern quoll gelb-beiger, zähflüssiger Schmodder und durch den Aufschlag war der kleine Berg aus Kuchenkrümeln zusammengestürzt.
Im Anschluss hatte ich es mit den unterschiedlichsten Hausmitteln und geheimen Wunderwaffen versucht, über die selbst in online-Gärtnerforen nur mit vorgehaltener Hand spekuliert wurde: Ich hatte Backpulver ausgestreut, mit schalem Bier gefüllte Fallgruben ausgehoben oder auch einen kostspieligen Kupferzaun in Miniaturgröße aufgespannt. Mein Leben bestand nur noch aus einer Verkettung von Finten, Gegenangriffen und verdeckten Offensiven; nur half alles nichts, die Käfer waren zähe, unerbittliche Gegner. Letzt Woche hatte ich schließlich mein gesamtes Beet plus Hecke in einer letzten verzweifelten Aktion stundenlang und literweise mit abgekühlten Schwarztee besprüht; sehr zur Belustigung von Herrn Schulz, der im Nachbargarten gerade den dritten Gartenzwerg (der mit dem nackten, leicht hinausgestreckten Hintern) zu den anderen beiden gestellt hatte. Seit drei Jahren flogen er und seine Frau, von deren stets mit einem freudigen Winken begleiteten Grußworten ich aufgrund ihres starken Dialekts noch nie auch nur ein einziges verstand hatte, im Sommer nach Rhodos. Von ihrem vierzehntägigen Strandurlaub brachten sie jedes Mal einen Gartenzwerg mit – wer weiß, wie es zu dieser idiotischen, mir gänzlich unbegreiflichen Tradition gekommen ist. Zu dritt gruppiert stehen sie jetzt im Halbkreis auf einem etwa Handbreit hohen Erdsockel, dessen Flanken Herr und Frau Schulz mit verschiedenfarbigen, den ägäischen Fluten abgetrotzten Muschelschalen hingebungsvoll dekoriert haben. In diesem Moment umflattert tänzelnd ein Paar aus Kohlweißlingen die eigenwillige Zusammenstellung aus nautischem Zierrat und leuchtend roten Zipfelmützen.
„Nein, der Tee hat leider auch nicht geholfen“, gebe ich kleinmütig, aber offen zu, halte Herrn Schulzes Blick stand. Beide Arme über dem Kugelbauch verschränkt wippt er von den Fersen auf die Zehenspitzen und wieder zurück. Seine Hüfte schwingt dabei so hin und her, dass ich in meinem Kopf unwillkürlich das wuchtige Glockengeläut von Almkühen höre. „Ich hab‘ Ihnen ja gesagt, Sie müssen was spritzen.“ „Wissen Sie, Herr Schulz“, in Kniehöhe wische ich mir ein wenig trockene Erde vom geblümten Sommerkleid, „ich bin mir da nicht so sicher, ob der Einsatz von hochgiftigen, krebserregenden Insektiziden wirklich notwendig ist.“ „Lassen Sie mich raten“, er bleibt mit dem Oberkörper vorgebeugt auf den Zehenspitzen stehen und zieht die buschigen Augenbrauen hoch, „Umweltschutz?“ Er bricht in schallendes Gelächter aus, das von Herzen kommt; sein Bauch und Adamsapfel springen glucksend auf und ab. „Passen Sie nur auf, dass Sie es den Biestern mit Tee und Gebäck nicht zu schön machen. Am Ende kommen die noch zu uns rüber!“ Während er sich hüstelnd mit der Faust auf den massiven Brustkorb klopft, weil er sich beim Lachen verschluckt hat, fällt mein neidischer Blick auf die Tomatenpflanzen der Schulzes: Pralle Tomaten, saftig, rund und fest, hängt dort eine neben der anderen schwer und appetitlich an den kräftigen Stauden. Mehr als einmal habe ich nachts wach in meinem Bett gelegen, war wie getrieben drauf und dran, in die Schrebergartenkolonie zu fahren, über den niedrigen Zaun zu steigen und alle dieser feixenden Früchtchen abzureißen. „Wissen Sie, Herr Schulz“, wie ein stupider Papagei plappere ich Sandras Worte nach, „die Grüne Reiswanze ist eine hochinvasive Art, ein Neozoon, dessen Habitat sich durch die Erderwärmung minütlich, ja selbst in diesem Moment, da wir hier reden, ausbreitet. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sie auch bei Ihnen ist.“ „Oooh“, er hebt die schwieligen Hände, als würde ich eine geladene Pistole auf ihn richten, „der Klimawandel. Die Trixie hat gesagt, der wäre nur eine Erfindung der hysterischen Klimanazis und Gendergagaisten“, er schnalzt geräuschvoll mit der Zunge, trommelt mit den Fingern an beiden Oberarmen, „Wählen würde ich sie natürlich nicht, aber die Frau redet schon Tacheles, das muss man zugeben, nennt die Dinge beim Namen. Die hat Chuzpe, hätte man früher gesagt, Chuzpe! Und intelligent ist sie, kann gescheit reden, erinnert mich manchmal ein bisschen an Sie!“ „Hören Sie, Herr Schulz, die wohl letzte Person auf diesem Planeten, mit der ich verglichen werden will, ist eine Beatrix von…“ Meinen Einwand überhört er und kommt jetzt richtig in Fahrt: „Das Klima hat sich geändert, ja, aber nicht das Wetter, das ist einfach nur sommerlich. Und Hitzewellen“, er macht mit den Fingern Anführungszeichen in der Luft, verdreht die Augen, „gab es auch schon immer. Nein, das Klima hier“, energisch zeigt er mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf den Boden, „HIER in der Kleingartenkolonie. Das gesellschaftliche Klima mein‘ ich. Früher war das ganz anders. Ja früher, da hat man gegenseitig auf sich Acht gegeben, sich ausgeholfen, war füreinander da, hat sich zugehört“, er zählt die genannten Punkte an den fleischigen Fingern ab, „Aber jetzt“, seine flach ausgestreckte Hand zischt einmal durch die Luft, sein Ehering blitz golden im Licht „ein falsches Wort und sie fallen über dich her, zack, Kopf ab. Dabei weiß man gar nicht, was jetzt schon wieder verkehrt war.“ An besagtes Früher habe ich, wenigstens in Bezug auf die Kleingartenkolonie, keine eigenen Erinnerungen: Mein Großvater väterlicherseits, zu dem ich erstmals den Kontakt herstellen konnte, als ich bei meiner Mutter ausgezogen war, hatte mir die Gartenparzelle erst vor drei Jahren vermacht – das großzügigste, zugleich aber auch nervenaufreibendste Geschenk meines Lebens. „Und neulich“, Herr Schulz rückt näher an den Zaun, schlägt einen so verschwörerisch-vertraulichen Ton an, dass ich es ihm ungewollt gleichtue, „da haben sie kurzzeitig doch wirklich die Wasserleitungen umgelenkt.“ Er deutet mit dem Daumen über seine rechte Schulter auf seine Gattin, die, eine hager, klein Frau mit sonnengegerbter Haut, bereits die dritte Gießkanne an der Pumpe füllt. „Kommt kein Wasser mehr, hat sie gesagt. Ich darauf“, er hebt Blick und Hände zum blauen Himmel, an dem zwei sich kreuzende Kondensstreifen verblassen, „dann pump eben fester, Ulrike. Tja, kam aber wirklich nichts mehr. Seit ein paar Tagen geht alles wieder tadellos. Beweisen kann ich nichts, aber ich bin mir sicher“, er legt die Rückhand an die Lippen, spricht aus dem Mundwinkel, „die da oben hatten ihre Hände im Spiel.“ „Vielleicht, Herr Schulz, liegt es auch am auffallend geringen Niederschlag. Vielleicht“, ich verspüre das dringende, fast körperliche Bedürfnis, ihm eine Lektion zu erteilen, „liegt es daran, dass es zu viele Menschen gibt, die im Unverstand rotes Fleisch essen, Berge von minderwertiger Kleidung kaufen und zu oft hirnlos um die halbe Welt fliegen.“ Halb väterliche, halb jovial entgegnet er: „Aber Sie sind doch noch so jung, Sie müssen die Welt und Ihr Leben genießen, in vollen Zügen! Packen Sie es an!“ Die Sonne brüllt von oben und ich recke, unter den Armen und zwischen den Pobacken furchtbar schwitzend, das Kinn empor: „Weil ich meinen Kindern einmal keine abgebrannte Müllhalde hinterlassen will, tue ich das eben nicht!“ Seine großen, blauen Augen strahlen großväterlich: „Kinder?! Donner und Doria. Hat da jemand etwa endlich einen anständigen Burschen kennengelernt?“ Als er mir zuzwinkert, reißt eine Saite in mir mit lautem Knall; ich kann nicht länger an mich halten und keife: „Vor allem liegt es daran, dass man den Klimawandel in zu vielen Mündern und zu wenig Köpfen finden. Das ist übrigens das, Herr Schulz, wo bei den Leuten früher“, mit den Händen mache ich Anführungszeichen in der Luft, „das Hirn saß, bevor sie es sich in irgendwelchen obskuren Telegram-Chatgruppen weggegrillt haben. Wenn die Leute noch ein Quentchen davon besäßen, hätten Sie noch genug Wasser und ich nicht dieses schwarze Geschmeiß im Garten, das unter dem schicken Panzer eigentlich“, ich kneife die Augen zusammen, „ganz braun ist.“
In Zeitlupe kann ich mitverfolgen, wie sich das breite Lächeln auf seinen Lippen gleich Zuckerwatte im Wasser auflöst und sich die Freude in seinen Augen zu einem waidwunden Ausdruck wandelt; im Hintergrund pumpt Frau Schulz indes unbeirrt weiter. Nach einer halben Ewigkeit sagt Herr Schulz schließlich: „Meine Frau und ich möchten Ihnen“, er nestelt linkisch mit Zeige- und Mittelfinger an der Gesäßtasche seiner Hose herum, „das hier geben. Wie Sie wissen, sind wir keine Studierten“, die mittlere Silbe versieht er mit besonderer Betonung, „Anders als Sie verstehen wir nichts von Ozonlöchern und Neowanzen, aber wir haben festgestellt, dass die hier ausgezeichnet gegen die Krabbelbiester helfen.“ Er macht eine kurze Pause, fährt dann, den Blick gesenkt, in einem leiseren, geradezu grüblerischen Ton fort: „Ich kann nicht erklären wieso, aber irgendwie hält es sie eben fern. Vielleicht der Geruch oder die Farbe oder wer weiß was.“ Über den Zaun hinweg legt er mir behutsam etwas Leichtes in die rechte Hand, das leise raschelt. Daraufhin wendet er sich um und geht, bleibt jedoch nach ein paar Schritten abrupt stehen und sagt, ohne sich umzudrehen: „Wissen Sie, Sie brauchen nicht zu glauben, Sie wären die Einzige, die sich Sorgen um die Zukunft macht.“ Seine Stimme klingt weder gekränkt noch versöhnlich, sondern einfach nur nüchtern, durch und durch sachlich. Im Fortgehen huscht über Herrn Schulzes Körper ein Schwarm Schattentupfer, die die Blätter an den Ästen des alten Kirschbaums in seinem Garten werfen. Da kein Wind geht, verharren sie, nachdem er aus meinem Blickfeld verschwunden ist, wieder regungslos auf dem Boden. Kurze Zeit darauf wird das Pumpen eingestellt.
Ich betrachte ein sorgfältig aus weißem Brotpapier gefaltetes, dreieckiges Tütchen auf meinem Handteller. Darauf hat jemand mit wenigen grünen und orangenen, fein geschwungenen Linien eine stilisierte Blume gemalt, die ihre Blüte leicht zur Seite neigt. Darunter steht in überraschend eleganter Schreibschrift Ringelblumensamen und für eine Weile hört man nichts als das Sirren von vorbeifliegenden Bienen und metallisch blitzenden Schmeißfliegen. Wie vom Donner gerührt fällt mir auf, dass ich immer noch die Hacke in der linken Hand halte. In der unerträglichen Hitze weiß ich nicht, was ich fühlen oder tun soll; mein Kopf scheint zum Bersten mit einer übelriechenden, gasartigen Substanz gefüllt. Als mein müder Blick auf den sonnendurchglühten Rasen fällt, sehe ich, wie sich ein einzelner Käfer meinen Füßen nähert. Sein pittoresker Panzer mit dem weißen Muster glimmt in der Nachmittagssonne und seine Beinchen sehen aus wie die langen Wimpern einer Kuh.
Nach den Tomaten werde ich die nächste sein, das ist mir jetzt klar. Aber – ich setze meinen Fuß ein paar Zentimeter nach vorne und vernehme, vielleicht auch nur im Geiste, ein feuchtes Knacken – nicht heute.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Thimo von Stuckrad
Kreis warmer Nässe
Nepomuk, genannt Nepo oder einfach nur Muki, hatte eben seine eng geschlossenen Fäustchen wieder neu ausgerichtet, akkurat die unteren Glieder der beiden Daumen aneinander gepresst, und seinen Kopf zurück auf die kegelige Gebirgskette seiner Mittelhandknochen gelegt, die ihn beruhigend an ein angrenzendes, aus dem Kissen herauswachsendes Gegenköpfchen denken ließ, als er ein felltierhaft wirkendes Räuspern vernahm. Vielleicht ein Bär; oder eine Giraffe en miniature. Beides würde ihn, anders als das Wort en miniature, nicht verwundern, hatten sich doch die sonst nur an wenigen Festtagen im Jahr flüchtig synchronisierten Gegengewichte von physischer Realität und Wunsch schon in seinem Traum heillos ineinander aufgehoben: ein plötzlich im Garten aufgetauchtes, zusätzliches Gebäude, das nur ein einziges Zimmer beherbergt hatte. Der Boden bestand aus einer Art dunkelgrauer, kurz geschnittener Watte und an den Wänden des Zimmers waren an jedem freien Quadratzentimeter Basketballkörbe unterschiedlicher Größe und Umfänge so sorgfältig befestigt, dass der Raum wie ein einziger, in Länge, Breite und Höhe gezogener Vorwurf wirkte.
Später hatte Nepo von zwei Aufzügen in einem Hochhaus geträumt, die jeweils nur dann aufwärtsfuhren, wenn man zunächst mit dem jeweils anderen mindestens ein Stockwerk nach unten gefahren war, was dazu führte, dass sich alle Insassen des Hauses und deren Besucherinnen stets auf der Treppe oder im öffentlichen Kellervorraum begegneten; darunter seine Mutter im Kimono. Bis auf einige Verstörungen also, die Kinder im Allgemeinen aber entweder gleich aufwachen lassen oder an die unauflösliche Gleichzeitigkeit des Sterbens gewöhnen, war das Träumen alles in allem ein guter Spaß gewesen.
Da hörte er wieder das Geräusch. Dieses Mal aber als ein anderes, denn es klang ungeduldiger jetzt und saftig. Wie ein Schluck lauwarmen Tees, der in der spitz verschlossenen Mundhöhle durch das Halbrund ungleichförmiger Zähne immer wieder erst gesogen, dann gedrückt, gesogen und gedrückt wird, so als sollte ein unentschlossenes Gehen auf Kies imitiert werden. Nepo strich die Bettdecke zurück, richtete sich auf, stützte sich auf seine Unterarme und streckte das Kinn in Richtung seiner Knie, sodass er aussah wie eine rückwärtig umgekippte Eins. Eigentlich waren es doch zwei Geräusche, die sich gleichmäßig gegeneinander getaktet beantworteten; und keines der beiden Geräusche kam aus ihm selbst. Da war einmal jenes lampionhafte Schwingen und Papierknistern, das Nepo erst an ein Räuspern hatte denken lassen, dann einige Momente danach, nach Nepos Zählung reichte die Zeit für ein genau dreimaliges Einatmen, das Mundhöhlenteegeräusch, das erst wie sich zickzackend nähernde Schritte anschwoll, um dann plötzlich wie verschluckt zu verschwinden. Viermal atmen, und die Folge der Geräusche begann wieder von Neuem.
Nepo beschleunigte sein Atmen, dann verlangsamte er es. Auch setzte er einige Atemzüge einfach aus, ließ die Luft nur noch durch seine Nasenlöcher strömen, danach nur durch den Mund. Und je länger Nepo durch allerlei Umstellungen und Veranstaltungen zwischen sich und den beiden Geräuschen versuchte, deren Abstand und Rhythmus unter seine Kontrolle zu bringen, desto mehr regte sich in ihm eine lustig anschwellende, blaugelb züngelnde Wut. Zuletzt sagte er in dem grimmigen, halbvollen Ton, den Kinder üblicherweise anschlagen, wenn sie mit nach innen begradigten Blicken jene grammatikalisch klingenden Entschuldigungsformeln der Erwachsenen nachsprechen: jetzt. Doch es geschah nichts.
Und weil nun Nepo zu jenen seltener werdenden Kindern gehörte, die begreifen, dass Zauberei und Geheimnisse nur dann wahr sind, wenn sie sie selbst bewirken, schlug er die Bettdecke ganz zurück und stand auf, um dem Fall auf den Grund zu gehen.
Die Geräusche blieben weiter in der Mechanik ihres Zwiegesprächs und hatten sich dabei auch weiterhin nichts zu sagen. Nepos Blick tastete durch sein Zimmer. Er lehnte sich nach vorne auf seine Zehenspitzen und winkelte die Knie dabei leicht an; geduckt und absprungbereit, so als suchte er nach kleineren Abweichungen im Raum. Vielleicht ein Flackern oder eine verdreht stehende Spielfigur, die nicht nur belegen würden, dass er ungefragt in einen fremden Kopf oder Traum geraten war, sondern auch auf einen Ausweg oder eine Art Portal hinwiesen. Aber alles war in der üblichen Ordnung: die nach unterschiedlichen Ernährungsklassen sortierten japanischen Plastikfiguren – phytophag, zoophag, pantophag, autophag – starrten aus ihren in Richtung Unendlichkeit polierten Augen durch sein Zimmer, über dem Schreibtischstuhl hing ein bleicher Regenbogen verschiedenfarbiger Fußballtrikots und hinter den seit dem vergangenen Sommer grünbeklecksten Vorhängen pixelte das erste Licht der Dämmerung auf die tiefschwarze Mauer des nächtlichen Vorstadthorizonts.
Nepo machte einen Schritt in Richtung der Zimmertür, um in seine hinter dem Fußende des Betts liegenden Pantoffeln zu schlüpfen. Er hatte dabei das Gefühl, etwas zählen zu müssen. Da fiel sein Blick auf den unregelmäßigen Spalt zwischen Tür und Bodenschwelle, durch den Nepo jeden Abend nach dem Zubettbringen das langsam schwindende Licht, die vergnügt eigenständigen Schatten seiner Eltern am oberen Ende der Stiege und die kurz vor dem Einschlafen immer langsamer werdende Zeit beobachtete. Vor wenigen Tagen erst hatte er sich vorgestellt aufzustehen, durch die Tür zu gehen und, plötzlich erwachsen, gemeinsam mit seinen Eltern ihren sich auf dem Flur kugelnden, ineinander auflösenden und jäh sich wieder spaltenden Schatten beim Ausbleichen zuzusehen. Er war darüber dann aber eingeschlafen und in einen nebligen Traum geraten, an dessen Ende ein Handydisplay eine Rolle spielte, das immer dann schwarz wurde, wenn er darauf zu schauen versuchte.
Nepo nahm einen weiteren Schritt in Richtung der Zimmertür und ging in die Hocke. Je länger er in das ungefilterte, blaugräuliche Licht des nahenden Morgens schaute, das sich vor seiner Zimmertür staute, desto breiter schien der Spalt selbst zu werden; wie die sich weitende, schlitzförmige Pupille eines riesigen, vor ihm liegenden Raubtiers. Ohne jede Vorankündigung verdunkelte sich der Spalt. So als würde das riesige Raubtierauge blinzeln, war mit einem Mal alles nächtliche Licht wie aufgesaugt und ein tiefer schwarzer Schatten floss nun über die Schwelle hinein in Nepos Zimmer.
Nepo hatte sich schon von dem inneren Abzählreim seines Atmens entkoppelt. Deshalb kippte er vor Schreck beinahe nach vorne um, als das schmatzende Kiesgeräusch wieder ertönte. Das Geräusch, in Nepos Verständnis von der Mechanik der Ereignisse: das zweite, antwortende Geräusch, musste sich genau vor seiner Tür befinden. Langsam richtete er sich auf, ging sacht bis zur Türe und strich dabei mit der Zungenspitze über die weichen Moorlandschaften, die die zwei zuletzt ausgefallenen Backenzähne in seinem Kiefer hinterlassen hatten. An einer Stelle spürte er die Umrisse eines keimenden Zahnkegels, der aus dem Zahnfleisch aufragte wie ein sehr kleines, angewinkeltes Knie. Nepo legte die Hand auf die Klinke und öffnete die Tür einen Spalt breit, indem er seine Hand langsam der Schwerkraft überließ.
Vor der Tür lag der Länge nach hingestreckt eine dicke weiße Katze. Sie wandte ihm ihren Bauch zu und fuhr unbeeindruckt damit fort, in einer Art Automatenbewegung die Zwischenräume ihrer Finger mit der Zunge zu reinigen. Erst als Nepo die Tür bis auf die Breite seiner Schultern geöffnet hatte, froren die Bewegungen der Katze ein und die letzten Reste des Antwort-Geräuschs rieselten zu Boden. Nepo bemerkte, dass die Katze über den gesamten Körper dunkel, ja beinahe schwarz gesprenkelt war, als hätte jemand sie gleichermaßen erfolgreich wie erfolglos mit Dreck beworfen: sie musste zwar getroffen worden sein, war dann aber nicht davongelaufen. Die Katze streckte noch immer einen Finger abgespreizt vor ihr leicht geneigtes Kinn und blickte dabei quecksilbern in Richtung des Rahmenwinkels der Zimmertür, als wäre von dort ein gütiges Nicken zu erwarten, das sie in der Ausführung ihrer Pläne bestärken könnte. Gerade als Nepo ein wenig in die Hocke gehen wollte, um mit den Flächen seiner Fingernägel über den Katzenbauch zu streichen, sprang die Katze auf. Das heißt, eigentlich wirkte es so, als ob die beiden Bilder der erst liegenden und dann vor ihm stehenden Katze übereinander geblendet worden wären. Nepo fühlte sich mit einem Mal auf seine Hände reduziert und begann, seine Pyjamahose nach Taschen abzutasten.
In diesem Moment setzte wieder das Lampion-Geräusch ein. Es musste aus der Wohnstube im Erdgeschoss kommen. Die Katze war bereits einige Stufen der Stiege hinabgesprungen, Nepo fiel dabei das Schwingen des tiefhängenden Katzenbauchs auf, das ihn an die Zöpfe Tennis spielender Mädchen erinnerte. Auf der letzten Treppe machte sie Halt und blickte sich nach ihm um. Dabei schien ihr ungewöhnlich breiter Mund ein O zu formen. Nepo war bereits in der Mitte der Stiege angelangt. Seine Schritte waren ungewöhnlich zielstrebig, als würde er im Innern einer Kompassnadel auf einen Ausgang in deren Spitze zugehen.
Schon auf der Stiege, noch mehr aber im unteren Flur und aus Richtung des Wohnzimmers herrschte ein ungewöhnlicher Geruch. Eine Mischung aus Zimt und jenem Geruch blauer, ledergesäumter Sportmatten, wenn sie zum ersten Mal nach den langen Sommerferien aus den Archiven der Schulsporthallen gezogen werden. Die Tür zur Wohnstube war geschlossen. Auch war es, nachdem das Knistern wieder verstummt war, völlig still und halb dunkel. Die Katze markierte mit ihrer Wange und Flanke den Türrahmen und reckte ihren Schwanz senkrecht nach oben als könnte sie so die verschiedenen Frequenzbereiche der Räume miteinander koppeln. Auch diesmal schienen die Bilder – die Katze mit gesenktem und gestrecktem Schwanz – unvermittelt aufeinander zu folgen. Als Nepo die Hand auf die Türklinke legte, drückte die Katze bereits ihre Nase in den Winkel zwischen Tür und Rahmen. Es war ihm früher nie aufgefallen, wie perfekt Katzengesichter in rechte Winkel hineinpassten. Sicher wegen der Evolution, dachte er.
Nachdem Nepo die Tür zur Wohnstube geöffnet hatte, wich er zunächst einen Schritt zurück, kratzte sich an einigen Stellen rund um den Bauchnabel, die plötzlich zu jucken begonnen hatten, und grub seine Zehenspitzen so tief in die Hornhaut seiner Pantoffeln, dass die Zehennägel zu schmerzen begannen. Die Wohnstube war verschwunden. Stattdessen befand sich hinter der Tür ein deutlich kleinerer Raum, sicher nicht mal so groß wie sein Kinderzimmer. In der Mitte des Raums befand sich ein großer roter Ohrensessel, vor der rechten Armlehne, die Nepo zugewandt war, ein Kindergartenstuhl, auf dessen Sitzfläche eine lindgrüne Maschine stand. Aus der Maschine liefen allerlei Schläuche mit grünlichen und gelben Substanzen, die an einen Arm angeschlossen waren, der unbekleidet auf der Armlehne lag. Tief in den Ohrensessel gelehnt saß ein Mann in einem Trainingsanzug, dessen Stoff an die Außenhaut von Heißluftballons erinnerte. Nepo erkannte darin seinen Onkel mütterlicherseits. Arno Kosswode. Zwar hatte er Onkel Arno seit einigen Jahren nicht mehr gesehen, aber Nepo erinnerte sich an die Nase, die einer der Länge nach halbierten Variante jener Sektkorken glich, die Tante Paula und Onkel Arno ihm bei ihren Besuchen früher zuhauf mitgebracht hatten – zum Werfen, wie Arno immer streng bemerkt hatte -; Arno blickte starr aus einem Fenster, das beinahe die gesamte rechte Wand des Raums ausmachte. Die restlichen Wände waren zu etwa zwei Dritteln ihrer Höhe, also etwa bis zu Nepos Scheitel, mit einer Holzvertäfelung verkleidet, deren Maserung ihn an die Darstellung der Gesichter mittelalterlicher Könige denken ließ. Oberhalb der Vertäfelung waren die drei Wände mit Fotografien von weißäugigen Katzenkindern, viele davon mit überschlagenen Beinen, behängt. Auf einigen Aufnahmen war auch die gesprenkelte Katze zu erkennen. Der Anschlag auf ihr Fell musste sich demnach schon in ihrer Kindheit ereignet haben. Obwohl er keinerlei Angst spürte, blickte Nepo über seine Schulter zurück in den Flur. Alles war dort an den gewohnten Plätzen: die gleichfarbige Reihe der Schuhe seines Vaters, die körperlosen Mäntel seiner Mutter an der Garderobe, der stets leere Schirmständer und der Jagdschein des Großvaters mütterlicherseits, der in einem unpassend metallischen Rahmen an der Wand gegenüber der Wohnstube hing.
Plötzlich richtete sich Onkel Arno in dem Ohrensessel auf, beugte sich mit dem Kinn beinahe bis auf die Höhe seiner Knie und begann damit, in kreisenden Bewegungen seiner Hände erst seine Unterschenkel, dann seine Oberschenkel zu massieren. Zu dem so entstehenden Lampionknistern gab der Apparat neben dem Ohrensessel ein langgezogenes Stöhnen von sich und durch die Schläuche schoben sich stoßweise die verschiedenfarbigen Flüssigkeiten voran.
„Dich brauch ich ja gar nicht, oder?“.
Onkel Arno hatte seinen Kopf nach Abschluss der Massage zu Nepo umgewandt. In seinem Mund standen aussichtslos einige Zähne wie Figuren einer Schachpartie kurz vor dem Unentschieden. Über sein Gesicht liefen breite, rote und weiße Streifen. Überhaupt wirkte sein Gesicht schraffiert, wie es nicht selten der Fall ist bei Dingen, in die lange Zeit nicht hineingeschaut worden ist.
„Hallo Onkel Arno, ich hab dich gar nicht, also, Mama hat gar nicht gesagt, dass du wieder kommst“.
Nepo entschied sich, einige Schritte in den Raum hinein und in Richtung des Ohrensessels zu machen. Dabei bemerkte er, dass das Fenster, durch das Arno gestarrt hatte, den Blick auf ein gewaltiges Bergpanorama frei gab: zwischen zwei Bergrücken – etwas zu weit gespreizte, dunkelgrüne Schenkel eines V, auf denen trostlos einige Windräder steckten - erstreckte sich ein langer, blauer See. Dahinter zu viel Licht. Hinter dem Ohrensessel bemerkte er den auf dem Korkboden des Zimmers zickzackenden Schwanz der Katze.
„Arno ist tot. Seilbahnunglück. Aber dich brauch ich gar nicht erst, oder?“.
Arnos Sprache klang stoßweise. Nepo stellte sich vor, dass die Stimme sich in einer der Flüssigkeiten befinden würde, und erst in Onkel Arnos Arm gepumpt werden musste. Er entschied sich für den Schlauch, durch den unzählige Luftbläschen in einem blass lilafarbenen Gel schwammen. Sprechbläschen.
„Ja, äh, ich weiß nicht. Also vielleicht kann ich dir helfen. Oder brauchst du was? Vielleicht was zu trinken?“, stammelte Nepo.
„Ja, helfen willst du! Helfen wollen immer alle. Gut sein.“ Arnos Stimme erinnerte nun an Nepos Vater, wenn er über seine Schulter hinweg über die Großtaten seines Schwiegervaters, des Jägers, sprach. Großtaten.
„Gut. Gut. Dann frage ich dich mal, wenn du schon so großzügig bist: bist du immer schon hier gewesen?“
Unwillkürlich streckte Nepo seine Hände aus und betrachtete seine Handinnenflächen. „Ja also ich bin hier, weil ich die Katze zu dir lassen wollte, also weil die Katze zu dir rein wollte, da hab ich aufgemacht. Ich wollte aber nicht ...“
Nepo hörte wie Arnos Finger auf dem Ballonstoffoberschenkel die Pumpgeräusche der Maschine zeitversetzt nachahmten.
„Das hast du schon letztes Jahr gesagt. Und die Jahre davor. Immer an Weihnachten bringst du mir diese Katze. Aber ich weiß es jetzt. Ich weiß, dass die Katze nur ausgedacht ist so wie die Begründungen deiner Tante, mich hier allein zu lassen.“ Arno blickte wieder nach vorne durch das Fenster. Die Augenlider zitterten wegen des übermäßigen Lichts. „Ihren eigenen Mann allein zu lassen“, ruckte Arno im Takt der Maschine, nun aber merklich leiser. Er sank in die Rückenlehne des Sessels und schloss die Augen.
Nepos Bauch hatte wieder zu jucken begonnen. Es musste etwas mit der Luft in diesem Raum zu tun haben, jedenfalls fiel ihm auch das Atmen zunehmend schwer. Er machte zwei rückwärtige Schritte und beschloss, bis zum Verlassen des Raums an sich hinabzusehen. „Ich würde dann…“
„Muki!“ Als Nepo aufblickte bemerkte er, dass Arno sich von der Sessellehne aufgerichtet und bis an den Rand der Sitzfläche vorgeschoben hatte. Es war aber nicht er, den Onkel Arno gemeint hatte. Die weiße, gesprenkelte Katze war offenbar auf die Oberschenkel des Onkels gesprungen, hatte sich dort abgesetzt und ließ sich nun mit den Daumenspitzen an den Wangen massieren. Arno und die Katze blickten sich einige Momente an. Es schien beinahe so, als nickten sie einander zu.
„Nepomuk.“ Arno wandte seinen Blick von der Katze weg auf Nepo zu. „Nimm sie bitte mit. Und sei gut zu ihr, ja?“
Nepo nickte. Gerade als er, gemeinsam mit der Katze im Flur angekommen, die Tür hinter sich schließen wollte, hörte er ein leises, gespielt wirkendes Wimmern aus dem Zimmer. Er schaute durch den verbliebenen Spalt. Onkel Arno wandte ihm sein Gesicht zu. Es wirkte verzerrt wie bei Kindern, die gewohnt sind, stets ihren Willen zu bekommen.
„Kannst du bitte die Tür einen Spalt offenlassen?“
Nepo nickte langsam und sagte ein tonloses „Gute Nacht“ in Richtung des Zimmers. Dann glitt er die Stiege hinauf, es wirkte beinahe so als würden die Stufen unter ihm in die exakt gegenläufige Richtung mitsteigen und seine Füße geräuschlos nach oben heben. Er stieg in sein Bett, zog die Decke bis an jene winzige Kerbe unterhalb seines Kinns, in der sich seit einigen Tagen ein verhaltener Druckschmerz aufhielt. Das letzte Geräusch, das er vernahm, war das langsame, spitzfingrige Schreiten der Katze über seine Matratze, bis sie sich auf Höhe seines Bauchnabels auf der Bettdecke einrollte.
Als Nepo aus traumlosem Schlaf am nächsten Morgen aufwachte, die Sonne stand schon hell über der Vorstadtsiedlung, lag sein Kopf in seinen wie zu einem Nest geformten Händen. Und unter der Stelle der Bettdecke, auf der am Ende der Nacht die Katze gelegen hatte, sickerte langsam ein Kreis nasser Wärme.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Wulkow
Sonst wirkt es nicht
Eine Hand auf dem Geländer. Fingerspitzen ertasten Sandkörner. Risse im Holz. Am Himmel kreisen Möwen, unter den gellenden Rufen wogt die Ostsee.
Kristin überspringt die letzten zwei Stufen. Für einen Atemzug hängt der Schwimmreifen um ihre Taille. Sie ist bereit. Über den Strand zu wetzen, sich ins Wasser zu stürzen. Die Luft riecht wie damals. Das Ufer voller Algen, alle finden’s ekelhaft. Nur Kristin nicht. Sie denkt an Spinat. Spinat und Kartoffelpüree.
Turnschuhe versinken im Sand. Sie bückt sich, gräbt die Finger hinein, sieht dabei zu, wie er zu Boden rieselt. Weich, wie Puderzucker, nur schwerer.
Sandburgen und Burggräben, den ganzen Tag, weil die Augen ihres Bruders dabei blauer leuchten. Haare von der Sonne gebleicht, fast weiß. Geschmolzenes Eis läuft an Fingern entlang. Die Haut bitter von der Sonnencreme.
Sie winken ihr zu. Manchmal ist es unheimlich. Der Blick, die Sommersprossen, die Art, wie sie gehen. Mama eingehakt neben Jens, der sie um einen Kopf überragt. Lachend kommen sie näher. Das gleiche Grübchen. Links. Kristin fährt sich über die Wange, bohrt den Finger in die kleine Vertiefung. Die zwei lassen sich neben ihr nieder, das Meer in den Augen. Wellen wischen die Jahre fort.
Sie sitzt zwischen Menschen. Erahnt, was mal war. Wie auf einem alten, verblassten Foto. Gegenüber ihre Großeltern. Omas Gesicht gerötet, wie immer, wenn sie sich einen Schnaps genehmigt hat. Neben ihr haut Opa mit der Hand auf den Tisch. Dieser Hand. Lange, breite Finger, Schwielen von der Landarbeit.
Kristin ist sieben, als er sie eines Morgens aufweckt, den Zeigefinger auf den Lippen. Es dürfe nicht gesprochen werden, das hat er am Abend zuvor erklärt. Sonst wirke es nicht. Er hilft ihr beim Anziehen, im Halbschlaf wankt sie die dunkle Holztreppe hinunter.
Die Sonne ist noch hinterm Horizont versteckt. Sie überqueren den Hof, aus dem Stall kommt ein Schnauben. Gräser und Bäume schlafen unter Morgenreif, auf den Feldern liegen letzte Schneereste verteilt.
Opa hält Kristins Hand. So fest, dass sie schmaler ist, als er an der Quelle wieder loslässt. Die beiden ziehen Jacke und Schuhe aus, krempeln die Hosen hoch. Das Wasser sticht auf der Haut. Kristin presst den Mund zusammen, watet hinter Opa in den Fluss. Sie waschen sich Gesicht, Hals und Arme.
Bis ihre Füße klirren. Da hebt er Kristin aus dem Wasser, setzt sie auf der Böschung ab und rubbelt sie mit einem Handtuch trocken. Die Haut brennt, unter den Händen kitzelt das Gras. Opa streicht ihr über den Kopf, während die Sonne am Himmel emporkriecht.
Die Menschen am Tisch gewinnen an Farbe. Kristin entdeckt Mama in Omas Zügen, Onkel Peer in Opas Bewegungen. Puzzlestücke ihrer selbst um den Tisch herum verteilt. Hier, zwischen ihnen, ist sie der Wildfang, der jeden Abend Matsch im Flur verteilt. Die Frau, die frisch geschieden ist. Eben erst geboren.
Im Hafenkanal liegt ein Boot. Am Bug ist ein Schild festgenagelt, auf dem Lütte steht. Kristin lauscht dem Wasser, das an die Schiffswand schwappt.
Die Fenster im Dach der Pension gegenüber sind schwarz.
Vielleicht liegen sie noch wach, Mama und Jens.
Denken an Oma und Opa, wie sie ins Taxi steigen, immer wieder winkend. An Onkel Peer, der bei Umarmungen zur Planke wird. Er weiß nicht so recht, was das alles soll mit dieser Nähe und den Küsschen.
Kristin schlendert zur Lütten hinüber, sieht sich um und klettert über den schmalen Steg aufs Boot. Verharrt vor dem Steuerhaus. Geht die Reling entlang. Backsteinhäuser säumen den Kanal, eines davon sieht aus wie das, in dem sie früher gewohnt haben.
Ein Vierteljahrhundert nistet sich ein in ihrem Bauch.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sonja Kettenring
Grün ist die Hoffnung
Sie steht in der Einfahrt. Eingehüllt in die dicke Jacke mit der Fellmütze, den großen Koffer neben sich, sieht sie die Straße hinunter. Als warte sie auf jemanden.
Was hat sie vor?, fragst du dich. Wo will sie nur hin?
Eine Stunde später steht sie noch immer da. Die Jacke hat sie mittlerweile ausgezogen, es ist warm geworden.
Du gehst hinaus. Musst sowieso zur Mülltonne.
Hallo, sagst du und fragst, was sie vorhat. Willst du vereisen?
Während sie nach einer Antwort sucht, folgst du ihrem Blick die Straße hinunter. Ein Auto fährt vorbei, noch eins.
Ich werde abgeholt, sagt sie irgendwann und du nickst, als wären damit alle Fragen beantwortet. Du bleibst noch eine Weile neben ihr stehen, den leeren Mülleimer in der Hand. Schließlich gehst du wieder hinein ins Haus.
Alle Viertelstunde siehst du aus dem Fenster, dem zur Straße hin. Sie steht noch immer da.
Irgendwann hörst du die Haustür, in letzter Zeit hast du gelernt, auf die Geräusche des Hauses zu hören. Du siehst erneut aus dem Fenster. Die Einfahrt ist leer. Im Haus fällt eine weitere Tür ins Schloss. Die weiße Tür mit dem grünen Glaswindspiel. Wenn du leise bist, hörst du es klingen.
Du überlegst, ob du jemanden anrufen solltest. Müsstest. Aber du hast längst alle angerufen, sie können auch nichts anderes tun als du.
Nichts könnt ihr tun.
Früher hat es auch schon mal länger gedauert, bis sie eine Antwort für dich hatte. Früher hast du gedacht, das ist richtig, das ist gut so. Wie oft hast du selbst falsche Antworten gegeben, einfach nur, weil du zu schnell warst, weil du die erstbeste Antwort gegeben hast. Die erstebeste ist nicht immer die richtige.
Später dauert es fünf Minuten, bis sie antwortet. Obwohl die Frage doch ganz einfach ist, deiner Meinung nach.
Später antwortet sie gar nicht mehr, später sieht es so aus, als verliere sie die Frage auf dem Weg zur Antwort.
Früher warst du oft mitten in der Arbeit, wenn sie geklingelt hat. Manchmal hat sie einfach nur geklingelt, um Hallo zu sagen. Das sollte man öfter machen, hast du gedacht. Manchmal war es dir auch zu viel, dieses Klingeln, dieses Hallo. Du bist gern für dich allein.
Später konntest du dich nicht mehr auf deine Arbeit konzentrieren, weil du den Geräuschen des Hauses gelauscht hast. Den fehlenden.
Später bist du es, die bei ihr klingelt. Aber sie macht nicht auf.
Du willst niemand sein, der auf Klospülungen lauscht. Jemand, der sich abends aus dem Fenster lehnt, um herauszufinden, ob bei ihr noch Licht brennt. Der sich Arbeit im Garten sucht, um unauffällig durch Fenster zu spähen. Der Zweite anruft, um mit ihnen über Dritte zu sprechen.
So jemand willst du nicht sein.
Früher hat sie mit jedem gesprochen. Sie hat in zwei Wochen mehr Leute kennengelernt als du in fünf Jahren.
Später fragen dich diese Leute, was mit ihr los sei. Wo sie denn sei, man sehe sie gar nicht mehr? Ist sie etwa ausgezogen?
Nein, sie ist nicht ausgezogen. Das weißt du. Es ist so ziemlich das einzige, was du weißt.
Aber da muss man doch etwas machen, sagt einer und klingelt energisch an ihrer Tür. Sie macht nicht auf. Sie macht niemandem mehr auf. Doch: der Polizei. Einer hat die Polizei gerufen. Die Polizei kommt und versichert sich, dass sie sich nicht umbringen will.
Wie findet man das heraus? Du hättest auch gern so eine Versicherung.
Früher hat sie sich mit einem Topf Reis zu euch auf die Terrasse gesetzt. Niemand hatte mehr Freude an einem Topf Reis als sie. Früher bekam sie eine Lebensmittel-Kiste und hat mit der Lieferantin an der Tür gelacht.
Später bleibt die Kiste vor der Tür stehen, den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend lang. Sie muss doch die Kiste hereinholen? Irgendwann trägst du sie vor ihre Tür.
Später ist in der Kiste nichts weiter als Knäckebrot.
Du willst niemand sein, der in anderer Leute Kisten hineinschaut.
Jemand erzählt dir vom Sozialpsychiatrischen Dienst. Wieder rufst du Zweite an, um über Dritte zu sprechen. Aber was können die machen, nichts. Da können wir leider nichts machen, sagen sie. Die Dritte müsse selbst bei ihnen anrufe. Sie sei schließlich volljährig, es sei ihre Entscheidung.
Du legst eine Postkarte vor ihre Tür, mit einer Telefonnummer darauf.
Irgendwann stehen zwei Frauen vor der Tür, vom Sozialpsychiatrischen Dienst. Noch jemand hat mit ihnen über Dritte gesprochen, jetzt können sie doch etwas tun, können vor dieser Tür stehen. Aber die Tür geht nicht auf.
Früher hat sie geschrien, geweint, getobt und gelacht. Oje, hast du gedacht.
Später ist da nur noch Stille.
Früher hat sie Zitronenkerne in die Erde gesetzt. Vielleicht klappt es, vielleicht wächst etwas, hat sie gesagt und sich über die ersten Blätter gefreut. Früher war sie diejenige, die dort, wo du schon hundert Mal vorbei gelaufen bist, ohne etwas zu sehen, ein Feld voller blühender Krokusse entdeckt hat. Früher hat sie alle Wunder dieser Welt gesehen.
Einmal hast du sie von ihrer Therapeutin abgeholt und in die Psychiatrie gefahren. An der Anmeldung stand ein älterer Herr der nicht mehr wusste, wie er hierher gekommen war. Wo denn sein Zuhause sei, fragte ihn der Mann hinter dem Plexiglas. Das hätte der ältere Herr auch gern gewusst.
Im Warteraum waren viele Menschen, im Warteraum war es laut. „Wenn es nur einmal so ganz stille wäre“, zitierte sie Rilke. Nicht nur einmal, ihr musstet lange warten. Dann endlich wurde sie aufgerufen.
Soll ich mit reinkommen?, hast du gefragt.
Ja, bitte.
Der Arzt hatte lange, lockige Haare, der Arzt sah müde aus. Neonlicht flackerte, Neonlicht surrte. Dem Arzt ging die Geduld aus, es dauerte ihm zu lange, auf ihre Antworten zu warten. Sie solle doch jetzt bitte antworten, dann müsse er wenigstens nicht mehr das Surren des Lichts ertragen.
Sie wollte nicht bleiben. Sie wollte, dass ich sie wieder mit nach Hause nehme.
Der Arzt vergewisserte sich, dass sie nicht die Absicht habe, sich umzubringen. Er hat sie einfach danach gefragt. So geht das also.
Später fährt sie noch einmal jemand hin. Später bleibt sie dort und jemand räumt ihre Wohnung aus. Du fragst, ob du das Zitronenbäumchen haben kannst.
Heute ruft sie dich manchmal wieder an. Ihr redet über das Wetter, übers Essen und das Fernsehprogramm. Nie musst du lange auf eine Antwort warten.
Du bist ebenfalls umgezogen. In ein Haus, in dem es nur deine eigenen Geräusche gibt. Du warst erleichtert darüber, nicht mehr auf die Klospülung lauschen zu müssen.
Einmal in der Woche gießt du das größer werdende Zitronenbäumchen und fragst dich, ob du vielleicht wirklich einmal Zitronen ernten wirst.
Manchmal wünschst du dir, wieder vor ihrer Tür zu stehen. Der weißen Tür mit dem grünen Glaswindspiel.
Ist es nicht wunderschön?, hörst du sie fragen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Simon Bethge
Von dem Raum
Von dem Raum erzählt sie, klein und weiß, und vollkommen schattenfrei, sensorische Deprivation, ja, so nenne man das, wie in diesen Meditationstanks oder den Folterkellern des Guo’anbu, des chinesischen Geheimdienstes, und zwei Stühle standen in ebenjenem Raum, genauso weiß wie der Rest, schwach nach frischem Lack hätten sie geduftet, obwohl sie sich an keine Luftbewegung erinnere, die ihr den Geruch hätte zutragen können.
Sie nahm also Platz, spürte die Linie der Rückenlehne durch ihren Pullover, gerade bis zum Schulterblatt, und als man ihn ihr vorsetzte, den anderen Menschen, den Mann, der die gleichen dicken Kopfhörerschalen auf den Ohren hatte wie sie, weich und dämmend und nur das Rauschen ihres Blutes, den Puls im Ohr, zurückwerfend, ja, da hätte sie sich gefragt, ob das schon alles sei, ob da noch was komme, vielleicht mit den Wänden, die bisher nichts gewesen waren außer weiß, oder ob die Stühle sich vielleicht zu drehen beginnen würden, zu kippen, aber nichts passierte, nichts.
Der Mann habe, so weiter, das alles gleich zu Beginn viel ernster genommen als sie selbst, gibt sie zu, obwohl sie nicht genau festmachen könne, woran sie das erkannt habe, denn sein Blick, der ja den ihren traf und nichts anderes bis zuletzt, war ganz normal, fast gelangweilt, so, als habe er sich schon zig Mal in dieser Situation befunden.
Sie sagt, sie habe eine Weile gebraucht, um sich ans Licht, besser, an seine Allgegenwart, zu gewöhnen, und nachdem es ihr schließlich gelungen sei, sicher, die Helligkeit sei erstmal unangenehm gewesen, aber eben auch authentisch, habe sie die Hände in den Schoß gelegt und ihr Gegenüber einfach betrachtet, habe, wie er, einfach gesehen und, das stelle sie gern zur Diskussion, auch gewartet, dass etwas in ihr vorgehe.
Sich löse vielleicht und hinüberschwebe, das Lächeln hätte sie sich deshalb einige Male verkneifen müssen, derart surreal sei ihr das Ganze und der Gedanke vorgekommen, was sollte sich schon lösen außer den Flusen an ihrem Oberteil oder winzigen Hautpartikeln, die, wie allgemein bekannt, täglich zu Abermillionen vom Körper abgestoßen würden, so natürlich auch jetzt, und sie stellte sich, sagt sie, sie stellte sich vor, allmählich von den Hautschuppen eingeschneit, verdeckt zu werden, wie sie so zu beiden Seiten des Stuhls auf den Boden, im Übrigen sei der weiß gewesen, ob sie das schon, nein, aber das könne man sich ja denken bei der Sorgfalt, mit der der Raum gestaltet worden sei, jedenfalls war ihr Gedanke, ihre bildliche Vorstellung, die von zwei Haufen, vielleicht auch einem Kreis aus diesen Schuppen und Schüppchen, der sich um sie bilden würde, bis so viele hinuntergetaumelt wären, dass man sie ohne Probleme mit dem nackten Auge sehen könnte.
Der Mann, der, wie sie sagt, dasselbe oder zumindest Ähnliches in verwandten Worten gedacht habe, das nehme sie jetzt einfach mal an, worüber sollte man während des In-die-Augen-Schauens, des dauernden Schauens und Angeschautwerdens auch sonst, übrigens wolle sie an dieser Stelle ein Lob für ihr Gegenüber aussprechen, das nicht etwa, wie man ja hätte erwarten können, irgendwann von ihren Augen abließ, um ihren restlichen Körper, um ihre Nase oder die Wölbungen unter dem Pullover, ganz zu schweigen von dem, was ihre noch immer im Schoß gefalteten Hände verbargen, durch das Verbergen geradezu akzentuierten, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, nein, brav habe der Mann seine Augen dort gelassen, wo sie hin gehörten, und das habe wohl dazu beigetragen, dass sie sich während der ganzen Zeit höchstens für sich, hier legt sie eine Kunstpause ein, nicht wegen sich selbst schämte.
Ihre Disziplin sei dagegen allmählich verpufft, oder, nein, Verpuffung klinge zu plötzlich, aber relativiere man sie durch eine Allmählichkeit in ihrem Ablauf, nun, dann ließe sich das schon so sagen, und als ihre Selbstbeherrschung langsam schwand, was ja eigentlich gegen den Sinn der Übung verstoßen habe, da habe sie angefangen, sich den Mann etwas genauer anzuschauen, von oben beginnend, also dem Scheitel, tatsächlich seinem Scheitelpunkt aus, der ein bisschen nach rechts verlagert war von ihr aus gesehen, und wie ein Schützengraben seine Haare in Freund- und Feindesland teilte, ein für ihr Empfinden ungeschickter Vergleich, aber, das müsse man verstehen, durchaus zutreffend, außerdem beweisbar, hätte sie, der kleine Vorgriff sei gestattet, den Mann danach wiedergesehen und fotografiert.
Nun, die geteilten Haare waren wie gesagt schwarz und mittellang und hinter die Ohren gestrichen, ihr Schnitt habe sie an alte Poster der Backstreet Boys erinnert, diese zum Heraustrennen in Jugendmagazinen, oder, präziser, an Nick Carter, der ja blond gewesen sei und so ein, nein, schon ein Süßer nach damaligen Standards, zwar nicht ihr Lieblingsmitglied der Band, rein vom Aussehen her, aber, da stimme man ihr sicher zu, der Talentierteste der fünf.
Solche Haare habe der Mann vor ihr gehabt, und dort, wo sie nicht von den Kopfhörern, diesen dicken, alles verschluckenden und einbehaltenden Kopfhörern, verdeckt worden seien, da hätten sie geschimmert im Licht, das womöglich von oben kam oder von hinten, wer könne das jetzt noch sagen, ein sehr schöner Glanz sei darin gewesen, passend auch zum Glitzern, denn nun seien ihre Augen weitergewandert, zum Glitzern der Ohrringe, die er trug, zwei auf jeder Seite, ihre Ränder hätten unter den Rändern der Kopfhörer hervorgelugt, je einer im Ohrläppchen, silbern, und einer im Tragus, näher zum Gehörgang, golden, warum sie die nicht früher bemerkt habe, fragte sie sich und antwortete sofort, dass sie sie ja strenggenommen gar nicht hätte bemerken dürfen, weil sie nicht Teil der Situation waren, nicht wie die Augen des Mannes, die weiterhin, das habe sie gespürt und direkt erwidert, auf ihren eigenen oder eher darin geruht hätten.
Derart ermahnt, fährt sie fort, sei ihre Konzentration für eine Weile zurückgekehrt, sie habe angefangen, ihr Blinzeln, von dem es ja, vergeblich habe sie danach gesucht, keinen Plural gebe, jedenfalls keinen ihr bekannten, ihr Blinzeln also zu zählen und es bald anzuhalten, das sei dem Mann nicht entgangen, denn auch er habe aufgehört für die nächsten paar Sekunden, die zusammengenommen nicht mehr als anderthalb Minuten ergeben haben können, alles andere sei ja weltrekordverdächtig und nichts, was sie oder ihr Gegenüber ausgehalten hätten, denn obwohl die Luft, wie gesagt, von nichts Äußerem oder Innerem bewegt worden sei, hätte das Rieseln der Partikel ja nicht aufgehört, und insofern seien auch ein paar in ihre Augen geraten, deshalb hätte sie sie wieder schließen, den Versuch, den Kampf fast schon, aufgeben müssen.
Stattdessen habe sie versucht, auf die, grob geschätzt, zwei Meter Entfernung zwischen den Stühlen und also den Beteiligten, die Augenfarbe des Mannes auszumachen, ein gar nicht so leichtes Unterfangen, trotz des Lichts und ihrer, das habe der Arzt vor Kurzem noch lobend angemerkt, einwandfreien Sicht, die weitaus fernere Zahlen und Buchstaben korrekt identifizieren konnte.
Grün, ja, das sei, sagt sie, die Farbe gewesen, auf die sie sich letztlich festgelegt habe, nicht ohne einen gewissen Restzweifel, aber in Anbetracht der Umstände hätte wohl auch eine eindeutige Erkenntnis zu nichts, jedenfalls nichts Substantiellem, geführt, daher hätte sie sich damit begnügt, sich vorzustellen, dass die Augen des Mannes nun eben grün waren, grün wie, und damit habe sie, wie sie erklärt, eine ganze Reihe von Assoziationen losgetreten, Smaragde, der einfachste Vergleich, das Meer an besonders tiefen Stellen, ein weiterer simpler Sprung, auch grün wie die Tür ihrer ersten Wohnung, deren Dielen, speziell an der Grenze zwischen Flur und Küche, noch spätnachts zum Knarren neigten, sehr zum Missfallen der unteren Nachbarn, einem, ja, wie solle sie sagen, äußerst streitlustigen Ehepaar, das, so glaubte sie damals, wohl in diesen ihren vier Wänden sterben wollen würde, folglich die verbliebene Lebenszeit mit möglichst viel ungestörtem Schlaf zu verbringen gedächte.
Außerdem grün wie die Streifen in Italiens Flagge, in Kenias Flagge, was das anging, wenngleich sie natürlich wisse, dass für die beiden Flaggen erstens unterschiedliche Grüntöne verwendet worden seien und diesen zweitens unterschiedliche Symboliken zugrunde lägen, ersteres Grün etwa gehe auf eine fixe Idee der Jakobiner zurück, die, beeindruckt von der französischen Revolutions-Cockade, das italienische Volk vor die Wahl gestellt hätten, und das italienische Volk habe sich eben für Grün, das Naturrecht, Gleichheit, Hoffnung und Freiheit, entschieden, wohingegen Kenias Grün schlichtweg die savannische Vegetationsvielfalt repräsentiere.
Sie habe, gibt sie zu, nicht in Betracht gezogen, jedenfalls nicht in diesem Moment, höchstens, und nicht einmal da sei sie sicher, hinterher, dass ihr Gegenüber irgendetwas von Vexillologie, Flaggenkunde, verstehen würde, wohl aber, dass ihm der Besitz ebendieser Augen, für den, wenn überhaupt, nur seine Eltern etwas konnten, im Leben einiges erleichtert habe, das Davonkommen mit vergessenen Hausaufgaben zum Beispiel, die Schmierereien an der Turnhallenwand, an Herbstnachmittagen verbrochen und, weil er zu eitel war, um sein Kürzel nicht darunter zu setzen, ihm nächstentags vom Rektor halbernst zur Last gelegt, dann die Suche nach einer Partnerin in der Hochzeit jugendlicher Hormonflüge, kurz, das da im Schädel des Mannes seien Augen gewesen, nach denen sie, seufzt sie, früher und bisweilen noch heute oft gesucht, in die sie sich bereitwillig verliebt hätte, eigentlich noch immer verlieben könne und es zugegebenermaßen ein Stückweit getan habe in jener Situation, ohne Absicht und Angst sei sie in die Vorstellung abgeglitten, zurück, tatsächlich, in die grün betürte Wohnung auf die Couch im Wohnzimmer, nur diesmal eben nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Mann gegenüber, der, nach gut der Hälfte ihrer Zeit im weißen Raum, zwar ein wenig müde gewirkt hätte, die Spannung seiner Lider sei nachlässig geworden und die Fältchen im Winkel näher zusammengerückt, so, als sei er drauf und dran, bei einem Film, der ihn seit Längerem verloren habe, einzunicken, er den Impuls aber unterdrücke, um ihr, die den Film, den alten, zuvorderst ausgesucht hätte, mit Meryl Streep und Clint Eastwood, einem erstaunlich natürlichen Leinwandpaar, wenn man bedenke, dass die beiden gut zwanzig Jahre auseinander geboren wurden, dazu an entgegengesetzten Küsten Amerikas mit verschiedenen kulturellen Ausprägungen, und sie habe sich gefragt, wie lange der Andere, der gerade mit dem Einschlafen kämpfte, sein Kopf sank langsam, im Sinken näherte er sich ihrer Schulter, sich wohl noch mit der stillen Übelnahme begnügen würde, dass auch sie ein paar Jahre früher zur Welt, ergo auch länger in den Genuss ihrer Abgründe und Wunder gekommen sei, viel mehr Zeit gehabt habe als er, sich Koordinaten zuzulegen und in diesen einzurichten, denn manchmal, wenn sie von einem Abendessen mit Freunden nachhause spazierten, nicht selten, sie zumindest, beschwipst, da stellte sich so ein Ausdruck auf seinem Gesicht ein, der zu fragen schien, warum sie sich mit einem wie ihm überhaupt abgebe, ihm hingebe, schließlich war sie täglich von Menschen umgeben, deren Geschichten und Ansichten viel eher den ihren entsprachen, und mit denen sich zu unterhalten viel weniger Rücksichtnahme auf intellektuelle Leerstellen erforderte, ganz zu schweigen von seiner Einwärtskehrung, wenn das Gespräch einen bestimmten Punkt erreichte, überschritt, dieser Ausdruck, der, ja, war in manchen Nächten eine regelrechte Anklage, warum sie ihn nicht endlich anschreie, längst angeschrien habe, weil seine Versuche, mit ihr mitzuhalten, dermaßen armselig und durchschaubar waren, weil durch das ewige Vor und Zurück, vor zum Bessernwollen, zurück zu Selbstanklage und Verzicht, doch niemand etwas gewann, und zuletzt, weil sie ihm die Benennung niemals abnehmen konnte, so gerne sie es täte, das ging durch ihren Kopf, während jener des Mannes auf ihre Schulter, die jetzt ganz sanft berührt worden sei, und zwar von einer Hand, die keinem von ihnen gehört habe, sondern der Dame in Bluse und Uniform, sie habe sich zu ihr hinunter gebeugt und sie gebeten, die Kopfhörer abzunehmen, vom Stuhl aufzustehen, denn die Zeit, denn fünfundvierzig Minuten seien nun um, länger dürfe man in der Installation leider nicht, obwohl sie verstehe, wie intensiv das Erlebnis für einige werden könne, dürfe man leider nicht verbringen, da hinter der Tür schon die nächsten Besucher warten würden auf ihre Chance, einem Unbekannten in diesem Raum, weiß und klein, gegenüberzusitzen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at