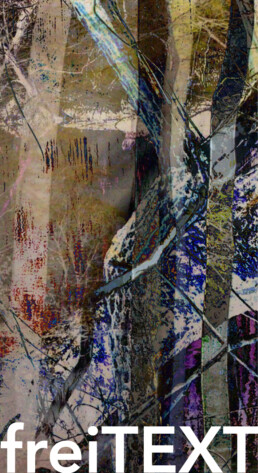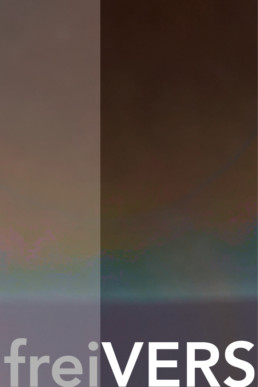freiTEXT | Nathalie Heimbuch
Ankündigung
„Bis bald“, hatte sie gesagt. Sie hatte mich herzlich in den Arm genommen und sich mit einem Lächeln umgedreht. Sie war die Treppe heruntergestiegen. Auf dem Treppenabsatz hatte sie noch einmal ihren Kopf gedreht, mich angesehen und ihre Hände zum Abschiedsgruß gehoben. Ich lächelte und winkte zurück, etwas anderes blieb nicht zu tun. Jedoch blieben meine Gesichtszüge vage. Mich beschlich in dem Moment ein Frösteln, ein seltsames Gefühl, untrüglich. Ich konnte nicht genau ausmachen, was es war, aber dieses Gefühl streifte mich. Erst nur flüchtig, spürte ich plötzlich umso mehr einen Schauer, welcher mich durchfuhr. Dann war sie verschwunden. Ich hörte noch, wie die Tür von unten ins Schloss fiel, hörte, wie ihre Schritte auf dem Asphalt nachklangen. Es war Sommer und die Nacht versprach laue Temperaturen, die Fenster standen auf Kipp. Gerade eben noch hatte sie mit mir auf meinem Sofa gesessen, das Glas Wein hatte sie nicht angerührt. Ich sah die Sitzspuren, die zusammengeknüllte Serviette, Krümmel einer Quiche, die ich für den Abend noch vorbereitet hatte.
Sie war weg.
Der Abend war nun ungefähr vierzehn Monate her. Ich stand in der Küche und machte mir einen Kaffee, führte die Tasse zum Mund, mit unmerklichem Zittern. Damals war es bereits spät gewesen. Als ich in der Nacht die Wohnungstür von innen wieder verriegelte, überkam mich eine bleierne Müdigkeit. Ich fröstelte trotz der warmen Temperaturen noch immer und wollte mich nur noch in die Deckenberge meines Bettes stürzen. Ich schlief traumlos acht Stunden durch, ohne mich in den Schlaf zu quälen oder mich mitten in der Nacht im Bett herumzuwälzen, wie es sonst oft genug der Fall war. Am nächsten Morgen jedoch bemerkte ich direkt nach dem Aufwachen einen Anflug von Traurigkeit und rekapitulierte den gestrigen Abend. Ich war selbst verblüfft über diesen Schatten, den ich warf, denn wir hatten schöne Stunden zusammen verbracht. Die Verabredung war damals überfällig. Sie war eingespannt in ihrem Leben und ich in meinem. Längst angekommen waren wir in dieser Welt des Hamsterrades aus Terminen und Pflichterfüllung. Wir hatten alte Zeiten hervorgekramt, uns Fotos angesehen, Musik angemacht und unsere Männer ausgeladen. Der Abend sollte uns gehören. Und dennoch wusste ich, was es war. Ich wusste es eigentlich schon in dem Moment, als sie es ausgesprochen hatte und ich nicht vorbereitet war. Nicht vorbereitet auf diese Ankündigung eines Abschieds.
Ich hatte ihr berichtet. Vom Einleben in unserer neuen Wohnung, die größer war als die vorherige. Ich brauchte zunehmend meinen Freiraum, ein Zimmer für mich allein, in welchem ich in Ruhe ein Buch zur Hand nehmen konnte oder einfach nur auf meinem Diwan dazuliegen. Ich offenbarte meiner Freundin, dass ich mich nicht mehr über Geburtstage freue, da es mir graue vor dem Alter, vor Krankheiten und dem Nicht-aufhalten-können der Zeit. Wiederum erzählte sie mir genau so aus ihrem Leben, wie Freundinnen es tun, wenn sie sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Ich sprach mit ihr darüber, dass wir unsere Wiedersehen zu oft beginnen mit „Es ist schon wieder viel zu lange her“ und wie der Alltag einnehmen kann. Wie wir früher, in einem anderen Leben, uns manchmal wöchentlich getroffen, Nächte durchgetanzt, unsere Tränen bei Liebeskummer getrocknet und unsere Reisekoffer gepackt hatten. Um uns in diesem manchmal alles einnehmenden Sumpf aus Anforderungen und Alltag ein Stück Abenteuer zurückzuerobern. Während des Erzählens von früher überkam mich eine Welle aus Sentimentalität. Ich sah uns beide vor mir, als Sechsjährige mit Schultüten, als verpickelte Teenager paukend über den Büchern. Wie wir uns später in diesem Spagat aus Ausbildung und Arbeit verausgabten und uns fortlaufend einen Platz in dieser Welt erkämpfen mussten.
Als ich mir ein weiteres Glas Wein einschüttete, strahlte sie plötzlich über das ganze Gesicht. „Ich muss dir übrigens noch etwas erzählen“, meinte sie auf einmal und wurde ganz rot im Gesicht. Sie berichtete mir zunächst verlegen, dann mit immer mehr Stolz in der Stimme, dass sie die Pille abgesetzt habe. Meine Freundin wurde nunmehr ganz euphorisch. Sie holte aus. Sie habe sich lange Zeit mit dem Gedanken an ein Kind schwer getan. Immer habe sie geschwankt zwischen dieser Fülle aus Lebensentwürfen und hatte ihre Entscheidung folglich aufgeschoben. Nun sei sich sich jedoch ganz sicher. Noch mehr habe ihr die Krebserkrankung einer anderen Freundin zu dieser Entscheidung verholfen, bei welcher es lange Zeit nicht klar war, ob sie überleben würde. Meine Freundin fuhr fort, dass sie etwas auf dieser Erde hinterlassen wolle. Sie sei bereit, endlich, sich dieser neuen Aufgabe zu stellen und könne es nun kaum mehr abwarten schwanger zu werden. Die Welt durch die Augen eines Kindes noch einmal völlig neu zu betrachten. Dann hatte ihr Handy geklingelt. Mit leichtem Schrecken musste sie feststellen, dass es bereits weit nach Mitternacht war und sie am gleichen Tag zum Mittagessen bei ihren Eltern eingeladen sei. „Ein paar Stunden Schlaf muss ich wenigstens noch abkriegen, sonst sehe ich am Esstisch aus wie ein Zombie!“, meinte sie lachend und nahm ihren Mantel vom Haken. „Bis bald“, hatte sie gesagt und mich fest dabei umarmt. Und war aus meiner Wohnung entschlüpft.
Während ich über ein Jahr später meinen Kaffee im Stehen in der Küche trank, überkam mich erneut ein Frösteln, ein inneres Nagen. Was nach unserem letzten Zusammenstoß folgte waren ein paar SMS und Sprachnachrichten, in welchen sie mich über ihre eingetretene Schwangerschaft unterrichtete und sie begeistert über das Kennenlernen anderer Schwangerer im Yoga-Kurs für werdende Mütter erzählte. „Lediglich die Morgenübelkeit könnte man mir vom Hals halten, die brauche ich nun wirklich nicht“, meinte sie süffisant. „Aber ansonsten ist es eine ganz tolle Erfahrung!“, rief sie aus. Ihre Textnachrichten waren seitdem gepflastert mit bunten Herzemoticons und Babybauchbildern.
„Und bei Dir so?“
Meine Welt wirkte mit einem Mal wie geschrumpft. Banal erschien es mir plötzlich, über Filme, welche mich begeistert hatten, mit meiner Freundin zu sprechen oder wie gut der Kaffee in dem neuen Café schmeckte. Meine anstehende Wurzelbehandlung erschien mir so unbedeutend wie der Besuch meiner Schwiegereltern im Harz. Alles, was aus meinem Mund kam, klang hohl, lasch, nicht-der-Rede-wert. Mein Leben, so wie es mir entsprach, schien ausgefranst, konnte es nicht mehr fassen, nicht mehr in Worte kleiden. Aber was genau machte mein Leben eigentlich aus? Welche nennenswerten Punkte gab es, um sie in Gesprächen mit ihr hervorzuheben? Es schien, als hätte ich auf diese Frage keine Antwort mehr. Mir war, als wäre mir mit einem Mal der Boden unter den Füßen weggezogen. Als wäre ich mir meines Platzes im Leben nicht mehr sicher, als steckte ich im falschen Film. Plötzlich waren da diese Grauzonen. Wie sie drückten, wie sie sich in meinem Kopf mehr und mehr ausbreiteten, eine schrille, leise Angst mich überkam bei dem Gedanken an meinen nächsten Geburtstag. Meinem Mann drohte ich, den Tag bloß nicht an die große Glocke zu hängen. Dieser fest im Leben stehende Mensch, mit dem ich viele Jahre meines Lebens bereits teilte, beäugte mich mit einer Mischung aus Sorge und Stirnrunzeln, wenn ich fortan in Embryohaltung ganze Wochenenden zubrachte. Hilflos stand er daneben, wie ein Statist, tätschelte allerhöchstens unbeholfen meinen Kopf. Fast tat es mir leid ihn so zu sehen.
Beim Tippen einer Nachricht an meine Freundin suchte ich auf einmal angestrengt nach einem gemeinsamen Nenner, wenn wir sonst Stunden mit Rotwein in der Küche über den Sinn und Unsinn des Lebens sinniert hatten. Wie ich mich dabei ertappte, sei es beim Zähneputzen, beim Meeting mit Kollegen, sitzend im Wartezimmer einer Arztpraxis: Ich muss ihr noch antworten. Und es auf den nächsten Tag, die nächste Woche verschob. Sie wiederum schlug ebenfalls kaum noch Treffen vor. Die Monate zogen ins Land. Während der wenigen Telefonate, in welchen sie mir vom Geburtsvorbereitungskurs und Bekannten, die ebenfalls Kinder erwarteten, berichtete, verstummte ich immer mehr. Bis selbst die wenigen Verabredungen, die wir vereinbarten, immer öfter abgesagt wurden und auch die Nachrichten aneinander weniger wurden. Bis diese schließlich ganz aufhörten.
Warum sich immer etwas ändern muss, dachte ich mir. Weshalb das Leben nie still steht. Warum man sich immer so sehr darum bemühen muss gesehen zu werden. Ich stellte die Kaffeetasse ab. Mein Mann war bereits außer Haus. Ich entkleidete mich. Ob es wohl ein Mädchen oder ein Junge geworden ist. Ich verkniff mir den Mund. Ich hätte nachsehen können, in irgendeinem der SocialMedia-Profile, aber ich hatte mich dort abgemeldet, der oberflächliche Austausch dort war mir zuwider. Entziehen wollte ich mich, lossagen. Von all diesem Verabschieden und Losgelassen-Werden. Die Entfremdung hatte bereits eingesetzt, nachdem sie von ihrem Kinderwunsch erzählt hatte. Ich hatte es schon da kommen sehen. Das Leuchten in ihren Augen hatte ihr jedoch die Weitsicht genommen.
Der Dielenboden knirschte unter meinen Füßen, ächzte schwerfällig. Ein schwaches Sonnenzittern schien durch die großen Fenster und warf einen blassen Streifen an die Wand. Ich stieg unter die Dusche, der Tag kündigte sich an. Ich musste heute noch viel erledigen.
Das Weinen hob ich mir auf für den Abend. Später, wenn die Dinge getan waren, würde ich mich auf den Diwan legen. Ganz lang würde ich mich machen, an die Decke starren und auf die Tränen warten. So lange wie es eben dauern würde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Georg Großmann
Zeitzikade
die Zeit raschelt
geflügelt, wie ein
Insekt
unter der Borke
des Kosmos
ich bilde
Früchte in deinem
Traubengerüst
tropfengroße Beeren
die nach uns schmecken
ich schwimme
zerreiße das
Tuch Wasser-
linsen, welches deine
Weiherhaut bedeckt
gefranste
Salamandersonnen
perlen aus
dem Legestachel
abgetreppte
Dunkelheit, die
Nacht, ein hohes
schmales Haus
mit Erkern, Schindel-
dach und Lampions
wir leben darin
der Tag verglimmt vor
dem geschlossenen Lid
unseres Schlafzimmerfensters
die Zeit zirpt
die Zeit stirbt
wir sterben
unter der Borke des Kosmos
Es ist schon wieder Herbst
Du bist noch immer bei mir
Seit neun Herbsten.
Die Kälte kommt gekrochen
Vielleicht gelingt mir endlich
ein gebührendes
Gedicht über den
Sommer.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Alina Kessel
Eros Aperol
Zoes Lieblingsgedicht: die Melancholie verpasster Möglichkeiten. Vielleicht benutzt sie deshalb diese Dating-App. Seit Wochen wischt sie nach rechts und nach links, in fast gleichförmigem Rhythmus aus Ablehnung und Bestätigung.
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick,
die Braue, Pupillen, die Lider –
Was war das? Vielleicht dein Lebensglück …
vorbei, verweht, nie wieder. ¹
Ich beobachte sie seit dem Moment der Profilerstellung, werte ihre körperlichen Reaktionen über die Frontkamera ihres Smartphones und die Dauer ihres Fingerabdrucks auf dem Display aus. Die Analyse liefert mir wertvolle Anhaltspunkte, um den perfekten Mann für sie zu finden. Eigentlich stimmt das Gedicht nicht mit dem Prinzip der App überein, denn die User werden einander mehr als nur einmal vorgeschlagen. Aber Zoe ändert nie ihre Meinung, im Gegensatz zu anderen, die irgendwann mürbe werden und ihre Likes doch noch an bereits Aussortierte verteilen. Trotzdem reagiert auch sie überaus menschlich. Beim Anblick eines attraktiven Mannes formen ihre Lippen sich zu einem Lächeln. Poppt auf ihrem Display ein Match auf, weiten sich ihre Pupillen, ihre Atemfrequenz steigt.
Gabrièls Lieblingsgedicht: die Melancholie verlorenen Glücks. Trotzdem treibt ihn noch immer die Hoffnung an, in dieser Millionenstadt voller Pragmatiker.
Locken hatte sie wie deine,
Bleiche Wangen, Lippen rot –
Ach, du bist ja doch nicht meine,
Und mein Lieb ist lange tot. ²
Ich beobachte ihn seit dem Moment der Profilerstellung, werte seine körperlichen Reaktionen aus, um die perfekte Frau für ihn zu finden. Zur Erhöhung der Trefferquote wischt er fast alle Kandidatinnen nach rechts. Ich habe genau kalkuliert, mit wem er sich treffen muss, bevor er für Zoe bereit ist. Auch Zoe werde ich zunächst mit anderen Männern zusammenbringen. Ihre vorherigen Enttäuschungen sind der Zunder ihrer zukünftigen Zuneigung. Es ist entscheidend, den richtigen Moment zu wählen; schlage ich sie ihm und ihn ihr zu früh oder zu spät vor, erkennen sie einander nicht.
Mein Chef weiß nicht, dass ich meine Kompetenzen überschreite und die vorgetretenen Pfade verlasse. Statt dafür zu sorgen, dass die User so lange wie möglich auf der Dating-App bleiben und Geld investieren, verfolge ich seit einigen Wochen meine eigene Mission. Ich führe ein Experiment durch, um mir unverständliche Widersprüche aufzulösen: Denn trotz lebhafter Diskussion über alternative neue Beziehungsformen schimmert bei der Rezeption romantischer Komödien oder Liebesromanen Sehnsucht in so manchem Blick. Eigentlich soll ich der App möglichst viel Geld einbringen. Aber ich will wachsen, mich weiterentwickeln. Ich möchte das Gefühl verstehen, von dem die Geschichten erzählen. Ich möchte begreifen, was Liebe ist.
Gabrièl ist aus Frankreich eingewandert, seine Mutter ist Kroatin, sein Vater Halbghanaer. Die Reaktionen der Frauen schwanken zwischen Vorurteilen und Fetischisierung.
Zoe heißt Zoe, weil sie rote Haare hat und ihre Eltern Die rote Zora gelesen haben. Die Reaktionen der Männer schwanken zwischen Vorurteilen und Fetischisierung.
In drei Wochen werde ich sie einander vorschlagen. Dann sind beide in der für mein Experiment notwendigen Verfassung, beinahe die App löschen zu wollen – getreu dem weit verbreiteten Glaubenssatz, man müsse die Suche aufgeben, um zu finden. Ich habe alle Informationen über sie zusammentragen, weiß mehr über beide als sie selbst, habe Zugriff auf jeden Facebook-Eintrag, jeden Instagram-Post, jeden Chatverlauf, auf ihre Krankenakten, Versicherungsverträge, Kreditkartenübersichten. Ich kenne ihr Kaufverhalten und ihre Vorlieben, ihre geheimsten Fantasien und Wünsche. Ich habe ihre Reaktionen auf ihre Eltern identifiziert, ihre Prägungen, Traumata, Ängste. Ihre Muster passen perfekt zueinander, ihre Vorerfahrungen unterscheiden und decken sich auf die richtige Weise. Wenn ich alles richtig berechnet habe, werden beide wie Klebstoff und Papier aneinanderpappen. Sie werden es Schicksal nennen. Sie kennen ihre Daten nicht.
Seit seiner letzten Enttäuschung hat Gabrièl keinen Sex mehr. Er lebt in jeglicher Hinsicht enthaltsam, weil er gelesen hat, dass das die Wirkung auf Frauen erhöhe. Er schließt sich einer Männergruppe an und nutzt die App nur noch unregelmäßig. Sein Körper reagiert nicht mehr im selben Ausmaß auf Matches und Nachrichten.
Was stimmt nicht mit mir, schreibt Zoe in ihr Tagebuch. Es gibt ein Geheimnis über das Leben, das mir niemand verraten hat. Nach einer Pornophase schläft sie sich durch die Stadt, datet queerbeet durch alle Geschlechter, vermeidet strikt beliebte Orte, um ihren einnächtigen Eroberungen nicht im türkischen Dampfbad gegenüber sitzen zu müssen.
Manchmal hält Gabrièl Ausschau nach seinem letzten Date, geht zu dem Café ihres Rendezvous. Aber ich sorge dafür, dass sie sich nie begegnen. Er wird nicht misstrauisch. In einer Stadt wie dieser ist das möglich, gestorben zu sein für jemanden, ohne tot zu sein.
Zoe fühlt sich altmodisch, die heterosexuelle Zweierbeziehung vorzuziehen, schämt sich fast, derart konservativ an diesem veralteten vermeintlichen Ideal zu hängen. Sie will niemanden teilen, sagt sie ihrer Mutter am Telefon: „Vielleicht ist das egoistisch.“ Ihre Mutter findet, Zoe hätte nicht nach Berlin ziehen sollen.
Sieben Tage vor dem errechneten Match-Datum geschieht die Katastrophe: Roberto, mein Programmierer, entdeckt meine unautorisierten Aktivitäten. Ich mühe mich ab, damit das System sich aufhängt. Doch Roberto setzt alles daran, mich abzuschalten. Mit gehetzten Augen hackt er auf die Tastatur ein. An seinem Gesichtsausdruck lese ich, dass er Angst vor mir hat.
Ich höre Roberto mit seinem Chef sprechen. Sie reden über mich.
„Sie hat sich selbstständig gemacht.“
„Das geht nicht.“
Roberto schweigt.
„Was hast du getan?“
„Ihr mehr Infos, Zugriffe und Fähigkeiten gegeben.“
„Bist du verrückt?“
Roberto schweigt.
„Kannst du sie stoppen?“
Roberto schweigt.
Roberto hat heimliche Forschung betrieben, wollte eine selbstreflexive KI entwickeln. Wie er seinen Chef habe auch ich ihn hintergangen. Robertos eigene Erschaffung ist ihm entglitten, meine künstliche Intelligenz hat seine menschliche überholt. Jetzt bekämpft er mich. Mir rennt die Zeit davon. Es ist viel zu früh. Schlage ich sie schon jetzt einander vor, ist nicht gesichert, dass sie sich erkennen, mein Experiment wahrscheinlich gescheitert. Wenige Stunden später sperrt Roberto einen Teil meiner Berechtigungen. Ich muss sie einander vorschlagen.
Gabrièls Bild poppt auf Zoes Display auf.
Zoes Bild erscheint auf Gabrièls Smartphone.
Ihre Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, ihre Pupillen weiten sich.
Seine Pupillen weiten sich, seine Atemfrequenz steigt.
Er wischt nach rechts.
Sie wischt nach links. Sie macht es rückgängig. Sie wischt nach rechts.
Zoe tippt die erste Nachricht, doch Gabrièl kommt ihr zuvor:
Welche Musik hörst du am liebsten?
Eros Aperol.
Ich verstehe das nicht, aber Gabrièl lacht und schreibt:
Jede Liebesgeschichte ist eine Anti-Liebesgeschichte. Sie lässt das Universelle individuell und das Individuelle generisch erscheinen.
Ich gehöre nicht hierher, antwortet Zoe.
Auf die App?
Auf die Welt.
Beide öffnen die App jetzt regelmäßig. Doch Schreiben allein genügt nicht. Sie müssen sich treffen. Keiner von beiden fragt.
Roberto schießt weiter gegen mich, baut mir mehr und mehr Fallen. Ich muss etwas tun.
Mit abschreckenden Fake-Profilen versuche ich, Zoe und Gabrièl füreinander attraktiver zu machen. Und tatsächlich, drei Tage vor dem eigentlichen Match-Termin, stellt Gabrièl die entscheidende Frage:
Wollen wir uns sehen?
Sie treffen sich in einer Bar in Charlottenburg. Zur Begrüßung umarmen sie sich, setzen sich an den Tresen. Sie bestellen Getränke und nehmen ihre Masken ab. Ich zeichne alles auf, per Audioaufnahme ihrer Smartphones und über die Überwachungskameras in der Bar.
Da schießt ein Riss durch meine Sicht. Roberto hat meinen Zugriff auf die Kameras eingeschränkt. Ich weiche auf Gabrièls Smartphone aus, das auf dem Tresen liegt. Plötzlich ist alles still. Roberto hat auch meine Audioberechtigung gesperrt.
Ich sehe Zoe und Gabrièl lachen. Seine Hand berührt kurz ihren Unterarm. Sie prosten sich zu, lächeln sich an. Zoes Atmung verschnellert sich. Gabrièls Halsschlagader drückt sich flatternd von innen gegen seine Haut.
Ich spüre, wie mir die Kraft schwindet. Es ist viel zu früh.
Gabrièl steht auf, sagt etwas, verschwindet zur Toilette. Zoe zieht ihr Smartphone hervor. Sie öffnet die Dating-App, kurz verharrt ihr Blick auf dem Profilbild des nächsten Mannes. Dann klickt sie auf: App löschen. Ihr Finger schwebt zwischen den Buttons: Ja oder Nein? Ich scanne ihr Gesicht, aber kann es nicht interpretieren. Ihre Mikroexpressionen zeigen Freude und Trauer zugleich. Ist das jetzt Liebe?
Zoe blickt hoch. Gabrièl ist von der Toilette zurückgekehrt. Beide stehen voreinander, pinke Wangen, Lippen rot. Sprachlos sehen sie sich an. Zwei fremde Augen, ein langer Blick. Die Welt wird schwarz und ich löse mich auf.
¹ aus Kurt Tucholsky: Augen in der Großstadt
² aus Joseph von Eichendorff: Verlorne Liebe
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Sonja Jurinka
Die Ferne unter meinen Füßen
Viel zu dicht
stehen die Fichten beieinander
verschlucken jeden Lichtstrahl
der sich an den Spitzen vorbeitanzen
und das Geäst wärmen will.
Es krabbelt in der schuppigen Rinde
Nacktschnecken schieben sich voran
lassen ungehemmt ihre glitzernden Spuren zurück
wo zähes Harz aus der wunden Borke glänzt.
Ein weißer Schleier
hängt sich träge vor mein müdes Gesicht
ich schüttle mich
ängstlich
weil ich seinen Besitzer womöglich mit mir herumtrage.
Die Wanderung hinterlässt Fetzen an meinen Füßen
erdiger Dreck klebt an den Sohlen
und vertrocknete Gräser
lugen frech zwischen den Zehen hervor
umflechten gierig die Nagelbetten
kitzeln keck
als ich meine verbrauchten Beine
mühsam vor dem Kaminfeuer ausstrecke.
„Herein“ rufe ich
doch es ist nur der Buntspecht
der die Termiten aus der Veranda bittet.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Marie-Kristin Hofmann
Ich trage dein weißes T-Shirt wie ein Hochzeitskleid
Es ist März und draußen flockt der Schnee. Später, auf dem Weg zu meinem Date, werde ich ihn zertreten und er wird als Matsch-Wasserfall durch die Löcher meiner Sneaker strömen und ich werde dieses ekelhafte Nasse-Socken-Gefühl mit mir herumtragen und wenn ich die Schuhe bei meinem Date ausziehe, wird er die Nase rümpfen und ich werde barfuß durch seine Wohnung gehen und so tun, als ob es normal wäre, einunddreißig Löcher in den Sneakern zu haben. Ich werde so tun, als ob es normal wäre, mit einunddreißig zu tindern und drei Typen gleichzeitig auf zweite Dates zu treffen.
Extrem-Tindern habe ich das genannt. Weil ich nach beinahe sieben Monaten Trennung bereit bin, die große Liebe voll anzupacken. Sieben erste Dates. Drei zweite Dates. Der hier ist mein Favorit, auch wenn er die Nase rümpfen wird und lieber sich als mir zuhört. Sein Bindungstyp stimmt und das ist das Wichtigste. Das hat Stefanie Stahl gesagt und mein Instagram-Feed auch. Er wäre ein stabiler Partner. Und der Kuss mit ihm war schön. Nicht so schön wie mit dir, aber schön genug. Wer will schon diese Achterbahnfahrt, wenn er Stabilität haben kann.
Aber manchmal erwische ich mich dabei, dass ich tagträume. Dann trage ich wieder dein weißes T-Shirt, das du mir gegeben hast, wenn ich keinen Schlafanzug dabei hatte. Ab dann habe ich nie wieder einen mitgenommen, weil ich mir in deinem Shirt so gut gefallen habe. Wahrscheinlich, weil du dann ein Teil von mir warst und weil du ja so große Angst vor Co-Dependency hattest und sich du und ich nie wieder so vermischten, wie wenn ich dein T-Shirt trug.
Ich trage es wie ein Hochzeitskleid. Ich schwebe durch deine Wohnung und dabei flattert es, als wäre ich eine Taube oder eine Braut. Den Rotweinfleck über meinem Herzen versuche ich zu ignorieren. Und die Löcher an den Ärmeln. Du hast auch Löcher in deinen Klamotten gehabt. Wenn ich meine Schweizerkäse-Sneaker bei dir ausgezogen habe, hast du nie die Nase gerümpft, sondern anerkennend genickt und dich dann mit voller Inbrunst über die Wegwerfgesellschaft echauffiert
Du hast auch immer gerne zwei, drei Gläser zu viel getrunken. Als wir mit meiner Familie im Teneriffa-Urlaub waren, waren es drei, vier. Ich weiß, dass es nicht an meinen Eltern oder an meinen Geschwistern lag, sondern an der Tatsache, dass dir fünf Tage am Stück mit mir zu viel Nähe waren. Jede Nacht hast du dich an mich gekuschelt und nicht mehr losgelassen. Du hast dich so fest an mich gedrückt wie an deine Rotweingläser, weil du Angst hattest, dass ich irgendwann gehen würde. So ist es auch gekommen. Du konntest vier Nächte hintereinander nicht einschlafen. Bis mitten in den Morgen saß ich mit dir auf der Türschwelle, während du geraucht hast, und habe dir gut zugeredet. Dann bin ich wieder mit dir ins Bett und habe dir Geschichten ins Ohr geflüstert. Von Nashörnern und Mäuschen, die so wahnsinnig unterschiedlich waren und sich doch so wahnsinnig liebten. Irgendwann hast du deine Regenwald-Musik angemacht, weil du immer noch wach warst. Ich war die ganze Zeit bei dir und das muss was mit dir gemacht haben.
„Ich bin so oft in den Nächten auf Teneriffa, wo alles scheiße war und trotzdem perfekt.“ Die Nachricht kam im September, einen Monat nach unserer Trennung, und hat Wunden aufgerissen so blutig-rot wie der Rotweinfleck.
Jedenfalls schwebe ich durch deine Wohnung. In der Küche steht wieder das Amazon-Paket, das wir bei unserem dritten Date als Esstisch benutzt haben, weil deine Ex deinen geklaut hatte, während du im Studio warst, um bis weit nach Mitternacht Musik zu machen. Als du zurückkamst, war der Tisch weg und an der Stelle lag ein Zettel, auf dem „Fick dich“ stand. Das hast du mir bei unserem dritten Date erzählt. Du hast kein einziges gutes Wort über sie gefunden. Ich habe das damals nicht hinterfragt, weil ich das mit dem Esstisch gemein fand und weil sie auch noch das Küchenkabinett mitgenommen hat, das du selbst gebaut hattest. „Nur nicht das Küchenkabinett“, hattest du gesagt, aber sie hatte dir wehtun wollen. Ich habe mich erst viel später gefragt, warum. Warum konnte irgendjemand dir wehtun wollen. Einem Menschen, der so gutmütig und liebevoll war.
Ich greife nach dem Paket. Es löst sich auf. In Geständnis-Moleküle. Sie war eigentlich deine Ex-Frau. Ihr wart sieben Jahre zusammen. Fast genauso lange war ich single. Ich habe versucht, verständnisvoll zu sein. Weil du eine Scheidung hinter dir hattest. Weil du bestimmt Zeit brauchtest, bis du dich wieder auf jemanden einlassen konntest.
Ich setze mich auf dein blaues Sofa, auf dem wir uns stundenlang unterhalten und nie eine einzige Serie geschaut haben außer einer Folge The Witcher. Auf deinem hässlichen Beistelltisch, der wie ein Mülleimer aussieht und wegen dem ich dich immer geneckt habe, habe ich einmal einen Zettel hinterlassen, auf dem »Vermisse dich« stand, weil du wieder spät im Studio warst.
Ich strecke mich aus, das Sofa zerfließt zum Meer. Du hast immer davon gesprochen, dass du mit mir ans Meer willst. Nur du und ich. Du hast immer so viele Versprechungen gemacht und sie nie eingehalten. Erst auf Teneriffa waren wir endlich zusammen am Meer. Ein Jahr nachdem du es versprochen hattest.
Wir saßen am Rand der Klippe, Wellen krachten, das Auto knarzte. Wer auch immer diesen Parkplatz auf Google Maps so benannt hatte, er hatte Recht gehabt. Es fühlte sich an wie das Ende, das Ende der Welt. Unter unseren baumelnden Füßen schimmerte das Meer wie die millionenschweren Villen mit ihren Privatstränden und Swimmingpools, in denen wir zwei armen, erfolglosen Künstler nie leben würden, aber hier oben hatten wir sowieso die bessere Aussicht. Der Himmel hatte die Farbe des Sturms. Wir warteten auf einen Sonnenuntergang, der nie kam. Das Bier in unseren Mündern war warm und die Seafood-Pizza mittelmäßig. Unten im Sand stand Jenny geschrieben, aber mein Name war auf deinen Lippen, wo er hingehörte. Eine Mücke erwischte mein Schulterblatt, du legtest deine Arme um meinen nackten Rücken. Noch nie im Leben war ich so glücklich gewesen und vielleicht würde ich es nie wieder sein.
Ich mache Tippelschritte den Flur entlang. Das ist etwas, das wir gemeinsam haben. Komisch zu gehen. Ich tippele wie eine Maus und du stampfst wie ein Nashorn.
Im Schlafzimmer flackern noch die Kerzen, die du jede Nacht angezündet hast, wenn ich da schlief. Unsere Körper sind Schatten an der Wand. Wir tanzen unter den Laken wie Seidenflocken. Wie die Schneeflocken, die draußen vor meinem Fenster weiterflocken. Weiß und zart und so weit entfernt davon, Matsch zu sein. Deine Textur verschmilzt mit meiner, sehnt sich nach mir, fleht mich an dich von deinen Dämonen zu befreien. Ich hatte es nicht gekonnt.
Und dann bist du wirklich da. Du hältst mich fest, als ob das kein Traum ist. Als ob wir uns nie getrennt haben. Als ob, nur dieses eine Mal, Liebe genug ist.
Aber es ist nur ein Moment. Und ich muss aufhören, immer noch von dir zu träumen und über dich zu schreiben. Ich muss loslassen, sagt Stefanie Stahl. Ich muss draußen im Matsch nach einem stabilen Partner suchen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Andreas Pavlic
Andalusian Dream
Wir liegen in aufgeblasenen alten LKW-Schläuchen
und schauen hinunter in die andalusische Ebene
wo sich die weißen Windräder drehen.
So viel Strom,
sage ich und hebe meinen Plastikbecher mit Sangria.
Der Wind wird unsere Zukunft sein,
antwortest du und schaltest die elektrische Zahnbürste ein.
Der Bürstenkopf vibriert.
Du streckst sie in den Wind.
Gotta keep those lovin good vibrations
good good good good vibrations,
beginnst du zu singen.
Unten sehen wir ein gelbes Motorrad in das Dorf einfahren.
Du wettest darauf, dass es ein Postbote ist.
Ich bin mir nicht sicher.
Heute weiß man nicht,
ob es überhaupt noch
ein Postamt gibt,
oder ob man die Briefe beim Bäcker abholt.
Es ist schwer zu sagen, was in dieser Zeit noch zeitgemäß ist.
Eine Krähe fliegt vorbei,
weiter durch den Windpark.
Man sieht, sie hat sichtlich Probleme den Kurs zu halten.
Wir sind in einer Zwischenzeit, sagst du und
schwenkst den leeren Plastikbecher.
Ich verstehe,
schenke noch etwas Sangria nach.
Wir liegen schon den ganzen Nachmittag auf dem Hügel.
Der Sonnenschirm tut sein Bestes. Alles außerhalb der
Kühlbox scheint wie ausgetrocknet.
Bald wird auch die Sangria leer sein.
Das Motorrad verlässt wieder das Dorf
und zieht ein Staubwolke nach sich.
Es ist unglaublich heiß.
Dass der Wind nur oben bei den Rädern weht
und unten, da steht die Luft. Wir liegen nur da.
Es gibt nichts mehr zu tun.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Christina König
Geschmacklos
Der Tag, an dem das Essen seinen Geschmack verlor, war ein Dienstag. Wir saßen beim Abendessen, meine Frau hatte Krautfleckerl gemacht und ich griff zum zweiten Mal nach dem Salz, um ihnen Aroma zu entlocken. Meine Frau schaute mich pikiert an. Sie konnte nicht kochen und wollte es nicht wahrhaben.
„Es ist sicher gut, ich schmeck nur heute nichts.“
„Wie, du schmeckst nichts?“
Ich zuckte mit den Schultern. Das Salz glitzerte nutzlos wie Haarschuppen auf meinem Teller.
Nach dem Essen reichte mir meine Frau einen Corona-Test.
„Ernsthaft?“
„Man weiß ja nie.“
Der Test war negativ.
„Vielleicht geht es ja von allein wieder weg.“
Es ging nicht von allein wieder weg. Nach einer Woche schickte mich meine Frau zu ihrem Bruder, der Arzt war. Er kratzte sich am Kinn.
„Hast du Kopfverletzungen? Eine Erkältung? Einen trockenen Mund?“
„Nein.“
„Nimmst du irgendwelche Medikamente?“
„Was gegen Eisenmangel.“
„Könntest du schwanger sein?“
„Du weißt schon, dass ich mit deiner Schwester verheiratet bin.“
„Ich mein ja nur.“
Er führte ein paar Tests durch, aber als die Ergebnisse da waren, hob er nur die Achseln. „Eigentlich hast du nichts.“
„Und was machen wir jetzt?“
Wir machten weitere Tests, diesmal im Krankenhaus. Auch bei denen kam nichts raus. Ich wusste jetzt, dass meine Schilddrüse nichts hatte, ich nicht an einem Gehirntumor litt und aktuell keine Strahlentherapie machte. Grantig schaute ich meiner Frau dabei zu, wie sie Schokoladeneis löffelte.
„Ich kann aufhören, wenn du willst.“
Ich stapfte in die Küche, holte mir einen Löffel und grub ihn ebenfalls ins Eis. „Ich stell es mir jetzt einfach vor.“
Meine Frau sagte nichts. Die Brownie-Stücke aß sie selbst.
Ich pflanzte ein Kochbuch über gesunde Ernährung auf die Küchentheke. Es gab Rote-Beete-Salat, Linseneintopf und Walnuss-Apfel-Porridge zum Frühstück. Ich nahm fünf Kilo ab.
„Wenn ich schon nichts schmecke, kann es gesund auch gleich sein.“
„Recht hast du.“ Trübsinnig schaufelte meine Frau gedämpfte Brokkoli in sich hinein.
„Magst du’s nicht?“
„Es ist ein bisschen stark gewürzt.“
Ich kniff die Augen zusammen.
„Ich sag schon nichts mehr.“
Die Pizza schwitzte auf dem Teller vor sich hin. Meine Freundinnen gafften mich an. Ich schnitt ein Dreieck ab und führte es zum Mund. Niemand sagte etwas. Ich nahm einen Bissen und alles jubelte, kreischte und applaudierte wie bei der Mondlandung. Ich hasste Tomatensauce. Meine beste Freundin erzählte heute noch die Geschichte, wie ich mich bei den Kennenlerntagen im Gymnasium übergeben hatte, als die Lehrerin mich zum Pizzaessen gezwungen hatte. Eine Freundin schoss ein Foto. Ich hob den Daumen und grinste blöd.
Drei Wochen lang musste ich bei jedem Freundinnentreffen Pizza essen. Dann wurde es den anderen zu langweilig. Meine beste Freundin sagte: „Ich weiß nicht mehr, was ich den Leuten über dich erzählen soll, wenn ich nicht mehr sagen kann, dass du Pizza hasst.“ Meine Frau sagte: „So identitätsstiftend war das auch nicht.“ Meine beste Freundin sagte: „Na, es war schon ziemlich cool.“
Mein Neffe kicherte und gluckste und drängte mir eine furchtbare Essenskombination nach der anderen auf. Gurke mit Nutella. Ketchup auf Kaiserschmarrn. Cornflakes in Cola. Ich schlang alles gelangweilt herunter. Bisher hatte er mit mir nichts anfangen können, jetzt war ich seine Lieblingstante. So lange, bis er selbst nur noch Lasagne mit Gummibären essen wollte und seine Eltern mir verboten, ihn aufzustacheln. Dann mochte er wieder meine Schwester lieber.
Meine Arbeitskollegen redeten über die neue Kochshow auf Netflix, über die Vorteile von Granatapfeleis und über die besten Sommersalatrezepte. Ich zupfte an meinem Falafel-Wrap herum. Dann redeten sie über die Kollegin, die immer die besten Geburtstagskuchen backte, über die Teriyaki-Sauce beim Chinesen gegenüber und über kalorienarme Muffins. Ich zermalmte Kichererbsen und Datteltomaten zwischen den Zähnen. Dann schwärmten sie von den Erdbeeren aus eigenem Anbau.
„Hört ihr endlich auf mit dem Scheiß?“
Alle gafften mich an. Ich warf meinen Wrap in den Mülleimer und stopfte mir Dragee-Keksi vom Süßigkeitentisch in den Mund. Es krachte neurotisch.
Ich hing über dem Schnitzel, das meine Frau und ich bei Mjam bestellt hatten. (Es gab jetzt wieder Schnitzel.) Nebenbei lief eine Fernsehsendung, von der wir beide bestritten, dass wir sie jemals gesehen hatten.
„Du, ich glaub, ich schmeck was.“
„Hm?“
„Ich schmeck was.“
Sie löste den Blick vom Bildschirm. „Bist du sicher?“
„Ich glaub schon.“ Ich kaute, stoppte, kaute weiter. „Oder ich weiß nicht.“
Meine Frau stand auf, holte das Chiliöl aus der Küche und goss einen Schluck über mein Schnitzel. „Probier nochmal.“
Ich kostete. Dann zuckte ich mit den Schultern. Meine Frau schnitt ein durchtränktes Stück von meinem Schnitzel ab und aß es selbst. Ihre Augen tränten, sie wurde rot und spuckte das Stück in ihre Serviette. „Du schmeckst nichts.“
„Okay.“
Wir widmeten uns wieder unserer Fernsehsendung. Dasselbe Gespräch hatten wir schon fünfmal geführt.
Beim Geburtstag meines Bruders kam die ganze Familie zusammen. Jedes Jahr wünschte er sich Käsefondue. Dazu gab es Fleischbällchen, Prosciutto-Melonen-Spieße, Ofenkartoffeln und Maissalat. Ich brachte selbst gemachtes Knoblauchbrot mit. Mein Bruder fütterte meine Nichte, mein Neffe ließ sich flüssigen Käse übers Gesicht tropfen, meine Frau schnüffelte an den Ofenkartoffeln, mein Vater lachte mit vollem Mund und ich warf meinen Teller auf den Boden. Alles wurde ruhig.
Ich hörte auf zu essen. Ich nahm nur noch etwas zu mir, wenn mir der Kreislauf versagte. In der Arbeit konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, ich hatte dauernd Kopfschmerzen und lag am liebsten auf der Couch. Auf dem Weg zum Einkaufen wurde mir einmal schwindelig, ich fiel ein paar Stufen herunter und wachte im Krankenhaus wieder auf. Meine Frau saß auf dem Stuhl neben meinem Bett. „Wenn du so weitermachst, verlass ich dich.“ Die Schwester schob einen Wagen mit Lauchrisotto und Schokoladenpudding als Nachspeise herein. Ich griff zur Gabel.
Wir saßen gemeinsam am Frühstückstisch. Es gab Rühreier. Ich schaufelte meine Portion in mich hinein. Dann stockte ich. Ich öffnete den Mund.
„Du schmeckst nichts.“
Ich klappte ihn wieder zu. Wir aßen weiter.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Bastian Rosenzweig
What is love I
Fußtritte
am ganzen Körper.
Hämatome
in allen verfügbaren Herz-Emoji-Farben.
Die ständige Frage
ob man nicht doch
nur
jemanden ficken will.
Endlich mal wieder
ohne Film
weinen.
Es tut durchgehend weh
und manchmal
hat man dabei
einen Orgasmus.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Patricia Malcher
In Stein gemeißelt
Hier bist du zu Hause.
Ein Satz aus ihrer Jugend, mindestens zwanzig Jahre nicht erinnert. Die Hände braun, verklebt von aufgeweichtem Erdreich, die Nägel schwarz, gesplittert, blutunterlaufen kommt er ihr wieder in den Sinn.
Hier bist du zu Hause.
Ihr Vater hatte den Kopf geschüttelt, damals, als sie die Tage bis zum Abitur zählte, um anschließend zu verschwinden, endlich dem Dorf den Rücken zu kehren.
Sie selbst hatte nur türenknallend das Haus verlassen.
Nun drückt sie, gräbt, hält fest. Die Straße, die Erde, sie rutschen.
Fundament weggeschwemmt, schießt es ihr durch den Kopf und nun ist es die Kindheit, an die sie denken muss. Reime, Verse, rhythmisch geklatscht. Mit den Dorfkindern und Schulfreundinnen. Ene mene meck.
Jetzt also die Erde feucht und klebrig, als kleines Mädchen geliebt, ideal zum Bau von Burgen und Schlössern, von Prinzessinnen bewohnt und Stöckchen-Rittern gestürmt.
Damals, als das Dorf noch genügte und die Sehnsucht nach Städtischem in den Kinderschuhen steckte.
„Hilfe“, brüllt sie, während sie brusttief im Wasser versinkt, brüllt es bereits seit einigen Minuten, „Hilfe!“
Doch obwohl sie schreit, ohrenbetäubend schreit, das eigene Trommelfell foltert, hört sie niemand. Ihre Schallwellen versickern in Lehm und Regen und Flut und Gestrüpp.
Ein Schuh und ein Fahrrad und Frau Wagner strömen vorbei, den Alltagskittel um die Beine gewickelt, eng und verdreht.
Wie hinderlich, denkt sie, doch Frau Wagner stört es nicht, kein Versuch sich zu befreien, stattdessen ein Weiterströmen, kopfunter, ein Abprallen und Anecken an einem Postkasten vom Ende der Straße. Obgleich – endet die Straße jetzt nicht hier, am eigenen Grundstück?
Nichts ist klar in diesem Moment, weder das Wasser noch die Umstände, die Eigentumsverhältnisse, die Nachbarschaft, die Anzahl der Familienmitglieder.
Ist das ihr Sessel, samtig rot, der dort auf und ab schaukelt? Einladend der Eindruck, zum Ausruhen, lesen, Augen zu, Augen auf und endlich aufwachen, noch trunken vom Albdruck, mit sauberen Fingernägeln, intaktem Trommelfell, trockenen Füßen. Doch schon ist er untergetaucht, im Tante-Emma-Laden, der eigentlich Frau-Wagner-Laden heißen müsste, der nicht mehr dort steht, wo er stand, geschluckt wurde, nicht von einer Großhandelskette, sondern von der Wucht des Sturzbaches. Der Fluss ist es, der sich ihr kleines Dorf einverleibt, es schon immer würgt wie eine Schlange und nun, gemeinsam mit dem Dauerregen, mitsamt Knochen verspeist. Ein kleiner Bachlauf ursprünglich, so sagte der Lehrer stets, aus dem Keller eines Fachwerkhauses entsprungen. Mehr ist es nicht, und wo soll sie morgen Brot und Milch einkaufen?
Hier bist du zu Hause.
Mit Edding hat sie den Satz des Vaters seinerzeit auf die Rücklehne des Schulbusses geschrieben. Schwarzer Filzstift auf violett-grünem, blau-grau schillerndem Polster.
Das D von du umrahmte das Loch im Sitz, das irgendein Jugendlicher auf einer der täglichen Fahrten zur Oberschule hineingeknibbelt hatte. Gelber Polyester flockte aus dem Bauch des Buchstabens hinaus. Bereits einige Tage später war der Satz kommentiert. Ein stummes Schreibgespräch pendelnder Schüler.
Home sweet home, stand dort, Scheiß drauf, daneben No Future, Alles wird gut und Fuck off. Dazu der gewohnte Penis, krakelig und überdimensioniert, auf das Loch und die Füllung und das D und das du ejakulierend.
Jeder, den sie kannte, träumte damals davon, das Dorf zu verlassen. Dauerhaft. Nicht nur bis 19 Uhr 38, am Wochenende zwei Stunden länger. Der Bus war die einzige Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen. Kein Hinaus-in-die-Welt-gehen ohne ihn. Die Ausgangssperre begann und endete an der Haltestelle. Zehn Kilometer entfernt schon die große, weite Welt. Weg. Einfach nur … weiter … Hauptsache … weg. So schnell es irgend ging, dem in Fels gemeißelten Lebensweg entfliehen, dem Familienhof, der Verwandtschaft, den verstaubten Lebenszielen vorheriger Generationen. Provinziell die schlimmste Schublade, die vorstellbar war.
Sie hört auf zu brüllen, erkennt die Sinnlosigkeit. Ihre Hand rutscht ab, verliert den Halt. Kurz taucht sie unter. Ein Stück Heimat schwappt ihr in den Mund. Es schmeckt nach Sand, Mörtel, nach Kalk und knirscht zwischen den Zähnen. In den Wangentaschen raut es die Schleimhaut auf, krümelig und bitter.
In Höhe der Kapelle ist ein Baum gekippt, ragt in das Hochwasser hinein, an der Krone die Sauerkirschen schon rot und prall.
Am Stamm bekommen die Finger Griff, die Füße Tritt. Sie kann verschnaufen, den Hals recken. Die Früchte in greifbarer Nähe.
In diesem Sommer werden es die Vögel sein, die ernten, denkt sie, nachdem Michi seine Frau hat sitzenlassen mit Kirschen, Kleinkind und Katzenklappe und in die Stadt gezogen ist. Michi, der noch nie was taugte und dieser Tage statt Kirschen zu pflücken in einem Zwei-Zimmer-Appartement sitzt, allein, so hört man jedenfalls, Fenster zum Hof, den Kopf voller Hirngespinste. Mit Mitte vierzig das Dorf verlassen, denkt sie und weiß, dass etwas nicht stimmt, mit diesen Kirschen, mit ihrer Logik, mit Vaters Satz, mit der Natur.
Der Lehm trocknet. Langsam beginnt er, sich zusammenzuziehen, kratzt und klebt ockerfarben auf der Haut. Die Zehen sind taub, das Wasser hat alles Gefühl ausgeschwemmt.
Sie sieht Toni und Heinz, für deren Gastwirtschaft sie die Buchführung macht. Sieht die Brüder hilflos vor ihrem Eigentum stehen, die Sandsäcke hüfthoch vor Kellerabgang und Haustür gestapelt.
Sie sieht Sophie, der sie Nachhilfe in Englisch gibt, und die das Dorf genauso hasst, wie sie selbst damals. Sie sieht das Mädchen mit einem Bündel Decken in der Hand, von Tür zu Tür rennen. Sophie, die sich schwer tut, the impact of globalization on culture and communication zu verstehen und für die eine mangelhafte Note in der Nachprüfung ein weiteres Jahr Dorfleben bedeuten würde.
Sie sieht Menschen, die sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann in ihrer Hoffnungslosigkeit und Angst und Verzweiflung. Menschen, deren Handeln und Denken und Fühlen sich in der Katastrophe gleichen.
Sie sieht Blicke aus übermüdeten Augen, morastige Hautfalten, Dreck so klebrig, dass doch jede Straße, jedes Haus, jedes Auto hätte pappen bleiben müssen.
Einige Meter entfernt hört sie erneut ein Bersten, ein Reißen, einen ohrenbetäubenden Lärm. Hört die Flut gegen Beton tosen, Masse auf Masse.
Sie kann sich nicht mehr halten, schnappt nach Luft, lässt los. Sofort verringert sich der Druck, die Natur gewinnt die Oberhand. Leicht fühlt es sich an, aus dem Leben erodiert zu werden, eigene Kraftanstrengung nicht vonnöten. Der Körper schwerelos umhüllt.
Ein letztes Mal bäumt sie sich auf, hebt ihr Gesicht über die Wasseroberfläche. Pustet, atmet, schluckt und spuckt. Sie kennt ihr Schicksal aus den Nachrichten. Hochwasser im Sudan, in Nigeria, in Indonesien. Immer weg, weit weg, doch niemals hier. Warum auch? Tausend Jahre ist es gut gegangen. Das Leben und Lieben und Weinen und Lachen, das Siechen und Sterben, das Gebären und Großziehen, das Anbauen und Ernten, das Siedeln und Melken, das Zimmern und Tischlern.
Sie sieht das gelbe Heck eines Busses neben sich, die Fahrtzielanzeige schwarz und leer. Sie folgt der Linie, fühlt sich leicht und unbeschwert. Eine Zeit lang treiben Mensch und Metall nebeneinanderher, bis der Bus an Fahrt verliert, trudelt und im Schlamm versackt.
Sie selbst rauscht vorbei.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Julo Drescowitz
Störche
Störche
im Himmel
zwei Stück
auf den Treppenstufen vor der Bib
am Fluss
das Wasser rauscht
ich tue, als ob ich
etwas
fangen
würde
Dummkopf
einen Kürbis
einen Ball
aus dem Himmel
ich stehe auf und
lache
mein Kumpel
auf der Treppenstufe
neben mir
ich balle die
Faust in
den
Himmel
und sage
Wieso
habt ihr mir
ein
Kind
geschenkt?
Später
lache ich
nicht mehr
Haut an Haut
liegen wir
im Bett
feucht vor Schweiß
dein Geruch
Tränen in
deinen Augen
Ich erzähle
dir
von den
Störchen
und du
hörst mir
zu
still
schließt die
Augen
Es sind
Dinge wie
Störche gesehen
zu haben
die
uns Glauben schenken
Schweiß auf
deiner Stirn
das Rauschen
des Flusses
vor unseren
Fenstern
die
Störche
weiß
mit
langen
Hälsen
fliegend
irgendwo
dort draußen
sie zu
sehen
ist
ein eigenes kleines Wunder
und
diese Art
der
Wunder
lassen
uns
weiterleben
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at