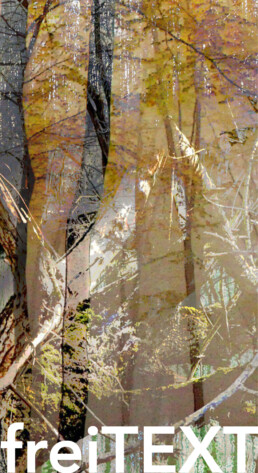freiTEXT | Katharina Forstner
Regentinnenschaft
Die Königin frauscht waltet regiert:
108 m² Wohnfläche und einen kurzgemähten Rasen
zur Miete. Die zahlt sie an den Mann.
Die Königin besitzt: einen Thermomix einen Vibrator ein Auto. Den Thermomix besitzt sie auf der Kücheninsel, den Vibrator in der Sockenschublade, das Auto unter dem Carport. Die Königin fährt SUV. Das Schwarz glänzt in der Sonne, die Katze liegt auf der Motorhaube.
Die Königin weiß, dass sie glücklich ist. Ich bin glücklich, denkt sie
als sie in den Wagen steigt. Die Katze flüchtet beim Schlagen der Türen. Das Auto schnurrt aus der Einfahrt. Die Abendnachrichten säumen den Weg in die Arbeit.
Die Königin pflegt: 25 Wochenstunden für 1700 brutto auf der Neurologischen.
Dazu braucht sie: orthopädische Schuheinlagen gegen den Hallux Valgus. Eine junge Kollegin für die Eingaben am PC. Eine Tafel Schokolade für die Seele.
Hier dauert die Nacht zwölf Stunden und 24 Betten lang. Auf dem Heimweg wird sie zweimal angehupt: Die Ampel ist grün.
Die Schlüssel klimpern. Die Schüsseln klirren. Trockenfutter rieselt. Die Königin duscht und stellt sich nicht auf die Waage. Im Spiegel betrachtet sie Bauch und Haaransatz. Sie ist weiß gekrönt und muss bald nachfärben. Ihr Körper ist ein halbes Jahrhundert alt. Er hat eigene Zeitrechnungen erschaffen: 25 20 17 Jahre seit dem Urschrei. Das ist jährlich wert: Gutschein für drei Mal Wäsche aufhängen. Gutschein für einen Tag nicht lästig sein. Gutschein für einmal essen gehen. Die Königin wurde zur Mutter gekrönt.
Diese Krone ist mein Glück, sagt sie zum Spiegelbild und legt sich ins leere Doppelbett.
Die Königin hat gelernt sich zu kümmern um: drei Kinder zwei Katzen einen Mann. Den ist sie losgeworden. Jetzt hat sie einen anderen. Den neuen König statt dem alten.
Zu Mittag wird der neue König nach Hause kommen, deswegen schläft die Königin nur bis zwölf und wärmt das Essen. Um halb eins schreibt sie dem Mann: Wo bleibst du so lang?
Wo warst du so lang? Das Essen ist schon kalt geworden. Setz dich nieder. Ich nehme den kleineren Knödel. Der ist mir zerfallen. Willst du noch einen Schöpfer? Die Soße ist nichts geworden, zu viel Schlagobers erwischt. Hast du eh genug gehabt? Noch einen Kaffee? Kuchen habe ich auch noch.
Der Mann nimmt Platz auf der Eckbank und das Besteck in die Hand. Einen Bissen vom ganz gebliebenen Knödel. Er nimmt gerne. Er nimmt Liebe wie einen Blumenstrauß.
Die Königin gibt gerne. Das macht sie glücklich. Du machst mich glücklich, sagt sie dem Mann und springt auf um den Geschirrspüler auszuräumen.
Jetzt setz dich mal hin, sagen die Kinder immer zu ihr. Bleib doch am Tisch. Wenn sie mal da sind zwischen ihren Aventuiren.
Die Königin ist ihr Leben lang gelaufen: dem Läuten der Patienten nach, auf Eltern- – korrigiere – Müttersprechtage, zum Hofer zum Spar zum Fußballturnier laufenden Siebenjährigen zuschauen.
Der Mann steht auf und geht gemütlich: wieder in die Arbeit die Enkel besuchen seinem Freund Haus bauen helfen. Das Kaffeehäferl lässt er stehen.
Die Königin putzt schrubbt tuscht sich die Wimpern. Spricht mit den Katzen. Die Katzen sprechen nicht zurück. Bückt sich im Schlafgemach des Sohns nach Unterhosen und sagt: Das letzte Mal räume ich hier auf. Das Schlafgemach spricht nicht zurück. Ruft bei der Tochter an und erwischt nur die Mailbox. Die Mailbox spricht nicht zurück. Der andere Sohn hebt ab und will zum Essen kommen, morgen. Die Königin wird gebeten. Der Königin wird gedankt. Der Sohn spricht von seinen Weihnachtswünschen. Die Königin spricht nicht zurück.
Sie liest gießt sprießende Tomaten. Der Schlauch und die Augen tropfen.
Die Königin wartet: dass der Mann zurückkehrt die Kinder sie besuchen die Himbeeren reif werden
wartet: dass es heimkommt, ihr Glück.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Simon Gottwald
nevermore
Da fliegen die Worte, rabenschwarz auf grauem Papier. Seit Stunden steht der Mann auf der Brücke und lässt sie aus einem schier unerschöpflichen Vorrat auf die Straße regnen.
Das Neonlicht der Reklame schneidet ihnen die Flügel ab, scheint es.
Wir sind doch alle Rabenkinder unglücklicher Eltern.
Wagen fahren keine mehr; die Polizei hat den Verkehr umgeleitet. Schaulustige stehen in dicken Trauben an den Absperrungen. Manche schütteln den Kopf, als hätte die Fassungslosigkeit ihr Genick gelockert. Andere heben eines der herbeigewehten Flugblätter auf, runzeln die Stirn, nachdem sie es überflogen haben, und werfen es wieder weg.
Der Mann will mit niemandem sprechen. Solange die Beamten auf Abstand bleiben, ist er eine Schatulle aus Schweigen. Jedes Mal, wenn sie sich ihm nähern, droht er, zu springen.
Fröhlich leuchtende Bildschirme reproduzieren die Szene unendlich, wie gegeneinandergestellte Spiegel. In der Menge diskutieren die Menschen, was der Mann da wohl mache. Eine Werbeaktion, meint einer, das ist ein Protest, weiß ein anderer, wogegen, er zuckt mit den Schultern.
Eine brechende Eierschale gibt zwei Welten frei. Manchmal ist das Nest geflochten aus einander verschlingenden Schlangen oder gebaut aus glühenden Kohlen. Das ist dann Pech. Mit fremden Flügeln kann man nicht fliegen.
Wo andere mit Schmuck oder Tand vollgestopft sind, bergen manche Schatullen eine Spieluhr, die eine seltene oder eine bekannte Melodie spielt, berührt man sie nur vorsichtig.
Vor grauem Papier ist der Asphalt kaum noch zu sehen. Ein Schottergarten aus Worten liegt auf der Straße.
Aus den Menschenmassen steigt eine Stimme auf. Jemand erkennt den Mann. Das ist Narcissus Hyde, sagt er. Der Name springt von Mund zu Mund, schlüpft in kleine Tastaturen und tänzelt durch die Luft wie ein Irrlicht.
Werbeaktion, wiederholen jetzt andere, Kunst, widersprechen einige. Zerknitterte Flugblätter werden als Beleg für beide Thesen weitergereicht.
Der Pelikan nährte seine Jungen von seinem eigenen Fleisch.
Haben Sie auch gehört, was man neuerdings über ihn sagt, wispert jemand. Ich kenne ihn gar nicht, lautet die Antwort. Alles nur Gerüchte, wird ergänzt, alles nur Gerüchte, bis es Beweise gibt. Das ist er gar nicht, mischt jemand sich ein, Sie verwechseln ihn.
Wie hauchdünne Spiegel aus Licht sehen die Zettel aus. Sie stürzen, als wäre das Papier zu schwer für sich selbst. Vielleicht sind es auch die Worte auf ihnen, die sie nach unten ziehen, oder die Gedanken, zu denen diese sich verschlungen haben.
Verstehen Raben, was sie sagen, wenn sie menschliche Worte verwenden?
Und wie ist das eigentlich mit Menschen?
Was halten Sie davon, fragt einer seinen Nebenmann. Muss der das von da oben machen, antwortet der. Nein, ich meine das hier, sagt der Erste und zeigt ihm ein Flugblatt, auf dem ein Schuhabdruck aus Straßenschmutz prangt. Die Linien sind deutlich zu erkennen.
Frechheit, so etwas noch zu verteilen, meint der Zweite.
Der Erste knüllt den Zettel zusammen und wirft ihn weg.
Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein‘ Fuß, hat ein‘ Zettel im Schnabel, von der Mutter ein‘ Gruß.
Unermüdlich regnet das Papier, so, als würde der Mann aus der Unendlichkeit schöpfen. Man ist sich nicht einig, ob er wirklich Narcissus Hyde ist. Man diskutiert über die Zettel. Inzwischen haben die Menschen festgestellt, dass auf jedem einzelnen etwas anderes steht. Manche hat er sogar von Hand geschrieben, sehen Sie mal, das kann er gar nicht alles alleine gewesen sein, warum denn nicht, die Handschrift ist eine ganz andere, sehen Sie das nicht, nein das ist die gleiche, sie verändert sich nur, weil er so viel geschrieben hat.
Wissen Sie, ich glaube, ich habe mich geirrt, so etwas würde Narcissus Hyde nicht schreiben, doch ich denke schon, waren Sie nicht eben noch der Meinung, dass …
Wir sind alle Rabenkinder. Über unzählige Generationen lässt unsere Geschichte sich auf ein einzelnes gesprenkeltes Ei zurückverfolgen, aus dessen dampfender Ursuppe das Leben entstand. Flossen, Beine, Flügel und Arme differenzierten sich aus.
Ein in Plastik erstarrtes Fossil, Spiegel einer in Öl gemalten Welt. Irgendwann werden Städte, Beton und Abgase nur noch als unverständliche Albträume existieren.
Der Mann, der vielleicht jenen Namen trägt, von dem keiner der Zuschauer weiß, ob er ein Pseudonym oder der ihm von seinen Eltern gegebene ist, sieht auf die Menschen herab. Es könnte Enttäuschung sein, was sich auf seinen Zügen abzeichnet, oder kaum verhohlener Ekel. Manche der Menschen halten seinen Gesichtsausdruck für einen der Neugierde, andere bemerken gar nicht, dass er ein Gesicht hat.
Ein älterer Mann in den hinteren Reihen keift wütend vor sich hin, wobei er so sehr mit dem Kopf zuckt, dass die über die Glatze gekämmten langen Strähnen sich lösen und wild vom Haarkranz abstehen. Unglaublich, dass der den Verkehr so beeinträchtigt, teeren und federn sollte man den, ruft er. Manche stimmen murmelnd zu, anderen missfällt die Forderung offensichtlich. Vielleicht denken sie an die Lebensbedingungen in den Legebatterien oder daran, dass die Dinosaurier Federn hatten.
Nachdem er stundenlang Worte in die Stadt entlassen hat, beginnt der Mann, die Kartons von der Brücke zu werfen. Noch immer fast randvoll, platzen sie unten mit lautem Knall auf und ergießen sich über das Zettelfeld.
So fasziniert sieht er den fallenden Kartons nach, so erleichtert nimmt er den Aufprall jedes einzelnen zur Kenntnis, dass man denken könnte, dieses Finale sei der eigentliche Zweck der Inszenierung und alles andere sei nur eine belanglose Fingerübung gewesen.
Der Polizei entgeht nicht, dass der Mann sie nicht mehr beachtet, dass er nichts anderes als die Kartons und die aus ihnen schwemmenden Zettel wahrnimmt.
Zwei Polizisten rennen auf einen Fingerzeig zu dem Mann und stürzen sich auf ihn. Er wirft gerade einen Karton, als sie ihn packen und ihm die Arme auf den Rücken drehen wie brechende Rabenschwingen. Obwohl er sich mit aller Kraft wehrt, haben sie ihn rasend schnell zu Boden gebracht und fixieren seine Hände.
Er gibt keinen Laut von sich. Röhren schütten Neonlicht über der Szene aus wie verdorbenes Saatgut. Die Polizisten heben den Mann vom Boden auf und stellen ihn auf seine Füße, als wäre er eine Vogelscheuche. Sein Gesicht glänzt, als würde er stark schwitzen.
Lieber Vogel, fliege weiter, nimm die Welt mit und noch mehr, nie wieder werd ich heiter, denn das Leben ist schwer.
Keiner der Zuschauer hat gesehen, wie er es geschafft hat, sich aus dem festen Griff auf seinen Schultern zu befreien, keiner, wie er die Fesseln an seinen Handgelenken gelöst hat. Auf einmal steht er auf der Brüstung und breitet die Arme aus. Dann legt er den Kopf in den Nacken, atmet einen Sonnenfleck aus und gibt dem Himmel einen Kuss.
Die Beamten können ihn nicht fassen, er ist wie in Öl gehüllt, seine Haut wie ein Panzer gegen die Welt.
Melodie im Bauch, gefüttert mit der Würmer Weisheit, jedes Wort ein telepathisches Tentakel, und Odin fehlte ein Auge.
Am nächsten Morgen rollt kein Verkehr, obwohl die Absperrungen nicht mehr da sind, die Schaulustigen verschwunden.
Die einzige Erinnerung an den Vorfall sind die Papierstreifen, mit denen die Vögel ihre Nester auspolstern.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Emil Fadel
Schlick
„Ich finde, wenn man auf das Wasser schaut, und nur auf das Wasser, dann sieht es fast aus als wären wir am Meer“, hatte er gesagt und sie hatte kurz nachgedacht und ihm dann zugestimmt, denn es sah wirklich so aus. Die Wellen, die an den Strand spülten, die kleinen Tang- und Algenfelder, die in den Wogen auf- und niederschwappten, die träge blaue Masse, die sich vor ihnen erstreckte – das alles hätte genauso gut auch das Meer sein können, in einer Lagune an der Adria, oder an einer der südfranzösischen Küsten. Aber es war trotzdem nicht das Meer, sondern der Gardasee, und da, wo normalerweise der Horizont das Wasser berührt, ragten Bergmassen in den Himmel. Sie nahm seine Hand und zeigte ihm, wie er sie halten konnte, um das gegenüberliegende Ufer zu verdecken, dann war es noch viel einfacher, nur das Wasser zu sehen, das Meer.
Wenn sie jetzt die Hand über das andere Ufer hält, dann sieht sie auch nur noch das Wasser, aber wie Meer fühlt es sich trotzdem nicht an. Der See ist trüb und schlickig und hat sich weit zurückgezogen, nur noch die Verfärbungen an den Steinen zu ihren Füßen lassen noch erahnen, wie hoch das Wasser einmal gestanden hat.
Es war ihr erster gemeinsamer Sommer gewesen, sie hatten eine ganze Weile hin- und herüberlegt, wo sie hinfahren wollten, aber weil es zu viele Orte gab, die sie gerne entdecken wollten, weil sie beide zu viel Rücksicht auf die Wünsche des jeweils anderen nahmen, waren sie zu keinem richtigen Schluss gekommen. Schließlich hatte eine ihrer Kolleginnen ihr den Gardasee empfohlen, weil sie oft als Kind mit ihren Eltern dorthin gefahren war, „da gibt es anscheinend auch einen tollen Vergnügungspark“ hatte sie ihm erzählt, direkt als sie an diesem Tag von der Arbeit nach Hause gekommen war. Das hatte ausgereicht, um ihn zu überzeugen und zwei Wochen später saßen sie in seinem Mitsubishi Eterna, der nach vier Jahren irgendwie immer noch neuem Plastik roch, und fuhren die Brennerautobahn hinunter. Sie waren beide vorher noch nie in Italien gewesen und sprachen so gut wie kein Wort Italienisch, aber er meinte, dass das schon kein Problem werden würde.
Sie hat kein Gefühl dafür, wie lange sie am Ufer gestanden hat, als nun der Hotelmitarbeiter hinter sie tritt und sie in holprigem Englisch darauf hinweist, dass den Gästen des BuonviaggoSpa von Seiten der Hotelleitung nicht empfohlen wird, sich längere Zeit im Freien aufzuhalten, jetzt, wo die Brände so nah sind. „Lasciami stare“, sie winkt ärgerlich ab und er verschwindet wieder, wahrscheinlich ein wenig überrascht darüber, dass diese offensichtliche deutsche Touristin mit dem Sommerkleid und dem Strohhut ihn plötzlich auf Italienisch anfährt. Natürlich weiß sie, dass er eigentlich recht hat, ihre Lungen brennen schon und ihr Hals ist ganz wund von dem scharfen Rauch, der hier überall in der Luft liegt. Aber ihr Zimmer mit der Lüftung und der Klimaanlage ist ihr noch viel mehr zuwider als hier draußen zu sein. Hotelzimmer können sich ganz schön furchtbar anfühlen, vor allem wenn man alleine ist.
Das kleine an der Durchfahrtsstraße gelegene Hotel, in dem sie nach langem Suchen abgestiegen waren, trug den Namen CASABLANCA in schönen, großen Lettern auf dem Dach und alles daran fühlte sich auch genauso an – auch für jemanden, der noch nie in Casablanca gewesen war. Ihr Zimmer war winzig und gefliest und von einer eigenartigen Kühle erfüllt, als sie eintraten und die Koffer auf die Betten warfen, um direkt unter die Dusche zu springen und den Schweiß der Fahrt loszuwerden. In der Ecke stand ein alter klappriger Ventilator, der sich sichtlich Mühe gab, die Luft im Raum in Bewegung zu bringen. Die Betten waren steinhart, als sie die Koffer nach der Dusche beiseiteschoben und auf den schneeweißen Laken miteinander schliefen und hinterher sagte er: „Willkommen im Urlaub“ und sie lächelte still in sich hinein, während er einschlief und der Ventilator in der Ecke vor sich hin ratterte.
Über ihrem Kopf ertönt aus der Ferne ein Rattern, das langsam lauter wird und als sie hochsieht, ist es ein Helikopter der Feuerwehr, der mit hoher Geschwindigkeit und nach unten gesenkter Nase über den See eilt, um am Berghang gegenüber eine große Ladung Wasser auf die Flammen fallen zu lassen. Sie sieht zu, wie die Wolke aus Tropfen auf die glühenden Skelette der Bäume niedergeht, wie eine gewaltige Dampfwolke aufsteigt und wie der Hubschrauber abdreht, um die nächste Ladung zu holen. Sie sieht auch, dass es nichts nützt. Die gelöschte Stelle lodert immer noch an vielen Punkten und hinter der anderen Flanke des Berges zeugen Rauchsäulen davon, dass sich weitere Brände nähern. Kopfschüttelnd geht sie einige Schritte am Ufer entlang, die Haufen von Tang, die der Sturm an Land gespült hat, vorsichtig übersteigend. Das Hotelpersonal gibt sich normalerweise Mühe, den Strand von allerlei Treibgut freizuhalten, aber seitdem man ohnehin nicht draußen sein soll, wurden die Säuberungsarbeiten eingestellt.
Das Seeufer in der Nähe ihres Hotels war malerisch, aber ziemlich überfüllt, weil direkt angrenzend ein großer Campingplatz lag, der jeden Morgen pünktlich um zehn eine gewaltige Menge badesüchtiger Wohnwagenbewohner aus seinen Pforten quellen ließ. Dennoch verbrachten sie die ersten Tage fast ausschließlich dort, im Wasser planschend wie Kinder, auf den heißen Steinen in der Sonne schwitzend, die Strandtücher nur als notdürftige Unterlage gegen den harten Untergrund, oder im Schatten der Bäume ruhend. Es war wunderbar. Sie war vorher nur an der Nordsee gewesen und hatte das ziemlich furchtbar gefunden, er hingegen hatte schon immer das Meer geliebt, und trotzdem fanden sie beide, dass das hier irgendwie genau richtig war. In diesem Sommer verliebten sie sich also nicht nur ineinander, sondern auch in den Gardasee.
„Der See stirbt“, denkt sie bei sich. Er liegt auf dem Totenbett und sie besucht ihn ein letztes Mal. Im nächsten Sommer wird es keinen Urlaub mehr hier geben, zumindest nicht für sie. Ohnehin ist es dieses Jahr einfach nicht mehr dasselbe gewesen, mit all den Bränden und ohne ihn. Es ist das erste Mal gewesen, dass sie alleine irgendwohin fahren muss, das erste Mal seit dreißig Jahren. Inzwischen ist sie am Ende des begehbaren Bereiches angekommen, hier endet der Strand – oder das, was davon übrig ist – und die Klippen beginnen, ins Wasser zu greifen. Hier an dieser Stelle haben sie gestanden, als sie ihm den Trick mit der Hand und dem Ufer gezeigt hat. Damals hat er gelacht und sie in den Arm genommen und ihr ins Ohr geflüstert, dass er sich so sehr auf diesen Sommer mit ihr freut und auf alle anderen Sommer, die danach noch folgen werden. Jetzt ruht er in der kühlen, dunklen Erde eines deutschen Friedwaldes und es wird kein Sommer mehr mit ihm folgen und vor ihren Füßen liegt der vertrocknete Kadaver einer Möwe, ein sandverkrustetes Elend, aus dem an allen möglichen Stellen Federn und grätenartige Knochensplitter ragen.
„Ich freue mich auch so sehr“, sagte sie und zerzauste sein von der Sonne hell gebleichtes Haar. Und zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte es sich auch so an, als würde sie es wirklich meinen, wenn sie das sagte.
Sie sieht den toten Vogel noch eine Weile an, dann dreht sie sich um und beginnt, den Hügel zurück zum Hotel wieder hinaufzusteigen. Oben kommt ihr schon ein Hotelmitarbeiter entgegengelaufen, genauso freundlich und gesichtslos wie der erste – oder ist es gar derselbe? Sie ist sich nicht sicher – und informiert sie, dass soeben ein Erlass der örtlichen Tourismusbehörde eingegangen ist. Das Hotel wird evakuiert. Die Brände kommen zu nah. Sie lassen sich nicht löschen. Der Ort wird aufgegeben. Kurz überlegt sie, was sie tun soll, und für einen Moment ist da die Verlockung, einfach zurück in ihr Zimmer zu gehen, sich aufs Bett zu legen und auf die Flammen zu warten. Dann fängt sie sich wieder und folgt dem emsig vorauseilenden Jungen in der Hoteluniform. Bei der Eingangspforte des Hotels bleibt er stehen und fragt, ob sie noch ihr Gepäck aus dem Zimmer holen möchte, der Shuttlebus könne solange warten. Sie dreht sich noch einmal um, sieht auf den See und strafft dann die Schultern. „Lascialo bruciare.“ Soll es doch brennen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Marie Menke
Mutter im Wind
Sie schaffe es nicht rechtzeitig, sagt meine Mutter am Telefon, als sie zu Besuch kommt. Ihr doppelter Espresso seien maximal eineinhalb, sie bestelle noch einen.
Wo sie denn sei, frage ich.
Im Café am Rathaus.
Ich gebe das Rathaus in Google Maps ein. Elf Minuten zu Fuß.
Eigentlich liege ihre Verspätung an der Sonne, fügt meine Mutter hinzu.
Ich wühle in meiner Tasche. Ohne Creme ließ sie mich früher nicht einmal in den Garten.
Ob sie Lichtschutzfaktor 50 dabei habe, frage ich.
Ja, ja, antwortet sie, die Vokale so kurz, ich kann hören, wie sie abwinkt.
Dann könne sie ruhig durch die Sonne laufen, sage ich.
Es sei gerade so schön, sie könne noch nicht los, sagt sie.
Ich sei aber schon da.
Ich könne ja rüberkommen.
Als meine Mutter beschloss, mich zu besuchen, schrieb ich meinem Bruder, er müsse mitkommen. Weil ich nicht sicher war, ob er verstand, rief ich gleich danach an, und damit er sah, dass ich es ernst meinte, schaltete ich die Kamera ein.
Andernfalls würde Mama verloren gehen, sagte ich, sich von den Zeugen Jehovas anquatschen lassen, ins falsche Flugzeug einsteigen oder sich im Reisebüro über den Tisch ziehen lassen. Ich machte mir Sorgen.
Niemand buche mehr im Reisebüro, entgegnete mein Bruder.
Mama schon.
Ich beobachtete, wie es in seinem Kopf ratterte.
Sie sei doch erwachsen.
In der letzten Zeit sei sie manchmal wie ein Kind.
Mein Bruder grinste verschmitzt.
Ob er also dabei sei, fragte ich.
Er nickte.
Es gibt viele und keine Cafés am Rathaus. Viele in dem Viertel drumherum, keine in der unmittelbaren Umgebung.
Doch, doch, sagt meine Mutter am Telefon, ob ich denn noch nie im Rathaus gewesen sei.
Ich verneine.
Was ich denn an den Samstagabenden mache?
Ich gebe erneut das Rathaus in Google Maps ein und lasse mir den Weg zur gleichnamigen Kneipe ausgeben. Dreizehn Minuten zu Fuß.
Da könne sie mir entgegenkommen, sagt meine Mutter.
Ich muss daran denken, wie sie mir nachts entgegenkam, wenn ich als Jugendliche betrunken nach Hause lief.
Wo ich denn sei, fragt sie.
Am Rathaus, antworte ich.
Mein Bruder durfte nicht mitkommen.
Unsere Mutter gluckste vergnügt, als sie auf einer selbstgedrehten Videobotschaft erklärte, dass sie allein fliegen würde. Sie habe viel gearbeitet dieses Jahr, sie habe Lust auf Abenteuer, sie habe sich Zeit mit ihrer Tochter verdient. Damit sie keinen Punkt vergaß, las sie von einem wiederverwendeten Einkaufszettel ab.
Auf dem Korbstuhl neben ihr saß mein Vater, hatte keinen Text zugewiesen bekommen und grinste verschmitzt.
Er würde dafür mit meinem Bruder ins Stadion gehen, schrieb er anschließend. Damit Timon nicht enttäuscht sei.
Später erfuhr ich, dass mein Bruder die Karten längst gekauft hatte.
Weit kommt meine Mutter trotz dreifachem Espresso nicht. Ich finde sie neben der Rathaus-Kneipe, die Hände auf den Griff ihres Rollkoffers gestützt, dunkelrote Jack-Wolfskin-Jacke, ein Rock aus Leinen. Für den Kindergarten nähte sie mir auch so einen. An den Füßen trägt sie Sandalen aus schwarzem Leder mit einer türkisen Schnalle. Für den Urlaub gekauft, vermute ich, den Krampfadern zum Trotz.
Ihre Gestalt ist schmal und etwas schief, aus der Entfernung sieht sie aus wie eine Fahne im Wind und ich habe Angst, dass sie weggeweht ist, wenn ich blinzle. Als sie mich umarmt, fühlen sich ihre Arme dünn wie Streichhölzer und ihre Begrüßung wie ein Zuhause an.
Auf dem Weg zum Hotel biete ich an, ihren Rollkoffer zu ziehen, und sie gestikuliert, um mich davon abzuhalten. Ich schiebe sie samt Koffer sanft auf den Fußgängerweg, dann mich auf die Seite der Autos. Sie begutachtet die rosa Häuserfassaden zu ihrer Rechten und geht bei Rot über die Straße. Als sie vor ihrem Hotel auf mich wartet und ich auf der anderen Straßenseite auf die nächste Grünphase, ist sie atemlos, aber hält sich den Bauch vor Lachen über meine Vorsicht.
Die Frau an der Rezeption kann keine Buchung auf den Namen meiner Mutter finden.
Ob sie eine Buchungsbestätigung habe, fragt sie.
Meine Mutter verneint.
Die müsse sie aber bekommen haben.
Meine Mutter erinnert mich daran, dass es meine Idee war, im Internet zu buchen.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Meine Mutter gluckst wieder, etwas weniger vergnügt. Die Webseite habe sie aufgefordert, sich für einen Newsletter anzumelden, das habe sie nicht gewollt, da habe sie das Internet einfach geschlossen, vielleicht läge es daran.
Was sie dann gemacht habe, will ich wissen.
Nichts, antwortet meine Mutter. Sie habe ja kein zweites Hotelzimmer buchen wollen.
Die Frau an der Rezeption holt ein Formular aus einer Schublade und nimmt die Buchung auf.
In ihrem Zimmer möchte meine Mutter sich kurz hinlegen und schläft prompt ein. Ich lege mich neben sie und schreibe meinem Bruder, dass sie gut angekommen sei. Er schickt einen Daumen hoch-Emoji zurück.
Nach dem Aufwachen sind ihre Pupillen klein und die Falten um ihre Augen tief. Sie sagt, sie wolle nicht, dass ich später allein nach Hause fahre und bezahle mir lieber das Taxi. Ich erwidere, dass ich ständig allein Straßenbahn fahre. Sie trinkt aus meiner Metallflasche, sagt, das Leitungswasser sei schlecht, und verschwindet im Bad.
Bevor wir gehen, wasche ich ihr mit Daumen und Spucke einen Zahnpastarest von der Wange. Als ich klein war, gab sie vor, von dem Weiß meiner Zähne geblendet zu werden, wenn ich besonders lange putzte. Ihre Haut fühlt sich weich unter meinem Finger an und riecht aus der Nähe nach Lavendel.
Sie frage sich, ob ihr das bei Vorstandssitzungen auch passiere, aber niemand sich traue, sie darauf hinzuweisen, sagt sie.
Ich vermute es.
Wir gehen die Einkaufsstraße herunter, sie schaut in alle Fensterläden und ich hake mich unter, damit ich sie nicht verliere. Im Restaurant verkaufe ich ihr billigen Rotwein mit Zitronenlimonade und Eiswürfeln als lokale Spezialität. Zu meiner Überraschung schmeckt ihr die süßliche Schorle, aber nicht der Dip, der mit Brot als Vorspeise serviert wird. Aus der Bauchtasche um ihre Hüfte holt sie ein Glas Bio-Kichererbsen-Aufstrich aus dem Reformhaus, öffnet die Dose und tunkt eine Scheibe hinein.
Ich trete unter dem Tisch gegen ihr Schienbein und sage vorwurfsvoll, sie könne nicht ihren aus Deutschland mitgebrachten Aufstrich auf den Tisch stellen.
Sie habe ihn ja nicht auf den Tisch gestellt, sagt meine Mutter und hält ihn mir hin.
Ich lehne ab.
Traust du dich nicht, was?, sagt sie und kichert.
Als der Kellner fragt, ob wir getrennt oder zusammen zahlen, schweige ich.
Meine Mutter holt ihre Geldbörse aus der Bauchtasche und ich sehe die umgetauschten Scheine, sehe, dass der Kellner sie ebenso zählt, und sage, sie solle mit Karte zahlen.
Umständlich hält meine Mutter die Karte an alle Seiten des Lesegeräts.
Ob sie einen Beleg bräuchte, fragt der Kellner.
Ich nicke.
Meine Mutter schüttelt peinlich berührt den Kopf. Sie vertraue dem Kellner, sagt sie zu mir.
Darum gehe es nicht, sage ich.
Meine Mutter lächelt beschämt, nickt dann doch, zwinkert dem Kellner zu und sagt, para mi marido.
Der Kellner stellt ihr einen Beleg aus und lacht über die deutsche Frau in der Regenjacke, die Reisekostenabrechnungen bei ihrem Mann einreicht.
Ich frage mich, ob er ihr ansieht, dass es eine Lüge ist, aber bin zu verblüfft, um zu fragen.
Auf dem Weg nach draußen weht der Nachtwind unter ihren bodenlangen Rock. Ich habe noch nie so schmale Fußgelenke gesehen, denke ich. Meine Mutter wippt bei jedem Schritt, winkt dem Kellner von draußen zu, er winkt zurück.
Vor der Tür erklärt sie mir, dass ich sie nicht zurück ins Hotel bringen müsse.
Ob sie mobile Daten habe, frage ich.
Was das sei, will sie wissen.
Ich beschließe mit ihr zu gehen.
Sie könne sich durchfragen, sagt sie noch, sie haben das früher bei Reisen immer so gemacht.
Ich höre nicht hin und erkundige mich stattdessen besorgt nach ihrer Hüfte.
Oma und Opa hätten sie damals auch mal im Ausland besucht, sagt meine Mutter.
Ich frage, ob es inzwischen einen Termin für die Operation gebe.
So eine Reise sei damals sehr aufregend gewesen, sagt sie.
Im Hotelzimmer funktioniert das Licht nicht. Es dauert, bis meine Mutter versteht, dass ihre Türkarte eingesteckt sein muss, damit der Kreislauf funktioniert. Dann macht sie sich daran, die Klimaanlage einzustellen. Ich sitze auf der Bettkante und suche im Handy nach der nächsten Straßenbahn nach Hause. Neun Minuten zu Fuß, dreizehn in der Bahn, nochmal drei zu Fuß.
Es sei schön, allein zu schlafen, sagt meine Mutter und legt ihr Nachthemd auf das Kopfkissen.
Ich würde mich gerne danebenlegen, um neben ihr aufzuwachen, wie früher, wenn mein Vater verreist war.
Ich sage, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass sie zuhause nie allein schlafe.
Mein Taxi sei da, sagt sie.
Ich habe keins bestellt.
Meine Mutter hebt die Jalousien vor dem Fenster mit dem knochigen Zeigefinger an. Ich aber, sagt sie stolz.
Zum Abschied ist ihre Umarmung flüchtiger als ihre Begrüßung es war.
Ob ich sie morgen früh wieder abhole, fragt sie, die Stimme hell vor Aufregung, als ich die Türklinke schon in der Hand halte.
Ich schmecke Anti-Falten-Creme auf meinen Lippen, nachdem ich ihr einen Kuss auf die Wange drücke.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Barbara Rieger
An windstillen Tagen
Seit ich aufgehört habe zu rauchen, schlafe ich schlecht.
Ich finde keine Worte, nur einen toten Vogel vorm Haus.
Die Babykatzen der Nachbarin beginnen unsere Terrasse zu erkunden. Mein Kind versucht sie wieder zurückzutragen. Eine nach der anderen, immer wieder.
Mit dem Fahrrad überfahre ich oder überfahre ich fast eine Schlange. Als ich umdrehe und nachschaue, ist nichts mehr von ihr zu sehen.
Am See. Mein Kind und ich, im Hintergrund ein Schwan. Es ist nicht so idyllisch, wie es aussieht.
Das Kind öffnet die Haustür, um die Katze hereinzulassen und steigt in die Innereien eines Vogels.
Ich versuche zu verstehen, wie ein Gartenschlauch funktioniert.
Seit ich nichts mehr rieche, träume ich auch nicht mehr. Oder kann mich nicht an die Träume erinnern.
Auf der Terrasse zwischen den Babykatzen der Rest einer Schlange.
Ich fühle mich heimatlos und notiere: Ist der Tod ein sicherer Ort?
Am See mit Freundinnen. Die mit dem größten Rucksack und dem Kind bin ich.
Ich stelle mir vor, dass du aus dem Gebüsch kommst mit einer deiner Frauen und wir alle gemeinsam über das Wetter reden.
Eine Freundin filmt, wie eine der Babykatzen eine Schlange fängt und vollständig verzehrt.
Meine feministischen Freundinnen interessieren sich nur theoretisch für mein Kind. Praktisch versuchen sie es zu ignorieren.
Ich halte die Tränen zurück und notiere: Das ist Stoff!
No one fucks as hard as a writer.
Seit ich aufgehört habe zu masturbieren, weiß ich nicht mehr, wie du aussiehst.
Tut mir leid, mein Lieber. Das waren keine Metaphern.
Manchmal lese ich noch Bücher, die ich mit dir teilen möchte.
Seit ich am Land wohne, sehe ich keinen Sinn mehr darin, mich zu schminken.
Schau, da sitzt ein Vogel.
Der fliegt gar nicht.
Der Fluss führt so wenig Wasser wie noch nie. Ich notiere: Wenn alles früher austrocknet als gedacht.
Ich sage alles ab und nenne es Burnout-Prävention.
Der Vogel ist wieder da. Aus seinem Gefieder fallen Insekten. Er lässt sich fangen, wir halten ihn über eine Schüssel Wasser, er öffnet immer wieder den Schnabel. Wir bringen ihn in Sicherheit vor den Katzen.
Im Freibad. Mein Kind und ich im Wasser. Es ist so idyllisch, wie es scheint. Zuhause bemerke ich die durchgescheuerten Stellen an meinem Bikini.
Mein Mann würde eine Schaufel nehmen. Aber ich denke nicht, dass der Vogel die Nacht überleben wird.
Seit ich nicht mehr trinke, kann ich den Anblick von Trinkern nicht mehr ertragen.
Nur mich selbst kann ich nicht ad acta legen.
Wir begraben den Vogel im Wald.
Ich zähle die Traktoren, denen ich ausweichen muss.
Alle Amselweibchen sehen gleich aus.
Manchmal, an windstillen Tagen, vermisse ich dich.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Suse Schröder
Mehlmottenmonate
In Hildes Aufgang plärrt und scheppert es nun auch tagsüber. Alle sind zuhause, aber nicht bei Hilde. Um das Alleinsein zu beenden, rührt sie Teig, backt ihn sandgolden, deckt den Tisch mit dem Sammeltassenservice, schlägt die Sahne, bevor sie sich setzt und einige Minuten nur schaut. Dann klingelt sie bei Frau Meyer. „Was wollen Sie?“, fragt die und legt die Kette vor. „Ich habe Selbstgebackenes. Wollen Sie?“ – „Stell ein Stück vor die Tür. Gern auch für meinen Mann.“ – „So kommen Sie doch!“ – „Nein, Du!“ Hilde setzt sich allein an die Kaffeetafel, lädt Kuchen auf die Teller, schenkt Kaffee ein. Dann schmatzt sie los, wechselt zwischen den beiden Gedecken hin und her, um das Gespräch am Laufen zu halten, um zu vermeiden, dass sie eine ist, die Selbstgespräche führt. Trotzdem strudelt sie in eine Einsamkeitswoge hinein, entscheidet sich aber aktiv zu werden. Sie hängt ihr Plakat in der Nachbarschaft aus: „Nicht mobil, aber in Bewegung! Treffpunkt: Fenster zum Innenhof, diens- und donnerstags 15:30 Uhr zur gemeinsamen Ertüchtigung. Hilde Straub“. Zwei Tage später winkt sie zur vereinbarten Zeit einer im gegenüberliegenden Fenster.
Gemeinsam kreisen sie Arme und Hüften, heben Beine und strecken sich. Hilde ist begeistert, bleibt aber am darauffolgenden Donnerstag allein, sortiert stattdessen alte Briefe, beschriftet Kassetten neu, sieht Ordner durch. Als sie den Papiermüll zum dritten Mal herunterbringt, bemerkt sie, dass ihr alles zu still ist und die Nachbar*innen zu laut. Dass, wenn alles anders ist, sie auch anders sein sollte. Sie packt ein paar Sachen und zieht in die Laube. Diese ist noch winterfest verrammelt. Bei Hubertus qualmt ein Laubfeuer. Hilde weiß, wenn er etwas zu teilen hat, kommt er vorbei. Umgekehrt nie. Seit dreißig Jahren.
Sie saugt den Geruch der vergilbten Gardinen ein, riecht Terpentin, muffige Polster, vergangene Sommer. Mit einem Lächeln tritt sie an den Vorratsschrank, richtet das Foto von Heiner. Nach einjähriger Trauer hat sie sich berappelt, wiegt fünf Kilo weniger und ist froh, keine der alten Schachteln zu sein, die sich in Kreuzworträtseln versenkt oder auf verwandtschaftliche Anrufe wartet. Heiners Habe bewahrte sie im Kopf und Herz.
Am ersten Laubenmorgen setzt sie sich steif mit brühendheißem Tee auf die Hollywoodschaukel, sieht sie Stachus. Zwischen Weg 3 und 5 umarmt der eine Süßkirsche. Drei Mal grüßt sie ins Leere, ehe er zurückwinkt. „Was machen Sie hier? Stachus, richtig? Von der Tanzschule Wohlgefallen?“, ruft sie und geht zum Zaun. Er nickt: „Stimmt. Ich warte auf meine Verabredung.“ – „Zum Tanz?“ – „Geht Sie das etwas an?“ – „Ich bin einsam. Lange leere Wochen liegen hinter mir.“ – „Gewahren Sie Abstand!“ – „Und Sie Anstand!“ Hilde entfernt sich, den Blick stur auf Stachus gerichtet. „Lassen Sie das!“, ruft er und Hilde winkt ab: „Warten ist nicht verboten.“
„Auf was warten Sie?“ – „Auf Ihre Verabredung. Dann sind Sie nicht allein.“ Sie schaut noch ein bisschen, bevor sie sich ihr Buch nimmt, Tee nachschenkt, beim Nachbargrundstück das Gartentor, Schritte stapfen und tippeln hört. Sie tritt an die Grenzhecke. „Hallo?“, ruft sie durchs Blattwerk hindurch. Ein rotgelockter Kopf, eine winkende Hand und zwei Worte schieben sich aus der Laubentür: „Ja! Saisonstart.“ Hilde versteht, ist sich für den Abend selbst genug. Am nächsten Morgen ruft es von der anderen Heckenseite: „Hallo?“ Mit Brötchenkrümeln am Mund wieselte Hilde hinzu: „Ja?“ „Abstand ist sicherer, aber schauen Sie mal, weiter rechts…, noch ein Stück…“ Hilde folgt, greift nach einer Blechbüchse, die wie ein Zylinder auf einem Zaunpfeiler sitzt. „Sie müssen straff ziehen“, ruft es aus der Laubentür. Hilde geht rückwärts, bis sie ins Polster sinkt. Die Strippe straff, die Büchse am Ohr. „Agent Uri hier. Die Glibberschleimschranke öffnet sich nur durch herzhaftes Lachen. Erzählen Sie einen Witz“, scheppert es in der Büchse. Hildes letztes Büchsentelefonat liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. „Nicht schon vorher lachen“, funkt Uri. Hilde holt Luft: „Also! Kommt ein Pferd in die Bar. Fragt der Wirt: Was machst Du für ein langes Gesicht?“ – „Hä?“, fragt Uri. Hilde hört ein Gackern: „Habt ihr Hühner?“ – „Superwitz. Nein! Das ist meine Mutter. Sie lacht gern laut.“ – „Zweiter Versuch! Was ist orange und hat einen Rucksack?“ Hilde hört es klatschen, eine rollende Büchse auf Terrassenbeton. Durch die Hecke sieht sie einen dürren, blassen Jungen auf allen Vieren: „Eine, eine Wander… Wanderine“, ruft Uri. „Der ist unschlagbar. Die Schranke ist geöffnet. Nähern Sie sich bitte langsam.“ Hilde schiebt eine Himbeerranke zur Seite. Uri hat Sommersprossen auf den Armen, auf den zerzausten Haaren eine Papierkrone. „Super! Jetzt weiß ich, mit wem ich die Welt rette. Wenn Sie Unterstützung oder Superkräfte brauchen, Sie wissen, wie Sie mich erreichen!“, ruft er und verschwindet in der Laube.
Zur Dämmerung klappern im Nachbargarten Teller. Hilde greift zum Telefon: „Agent Uri?“ – „Agent Uri hört.“ – „Monsteralarm. Gerade schlafen sie. Aber morgen früh wollen sie mit Komplimenten gefüttert werden. Ich brauche Sie!“ – „Alles klar! Wir schaffen das! Nachti!“ Hilde sendet ein Taschenlampensignal zur Nachbarlaube, setzt sich zum Abendbrot. In der Gaslampe knistern Nachtfalter. Sie schlemmt griechische Konserven, Weißbrot, Olivenöl. Zum Apfelmuskochen gönnt sie sich ein Glas Rotwein, schläft danach tief.
Die Komplimentenkanonade trifft Hilde nach dem Aufstehen. Nach dem letzten Kompliment ruft sie: „Bravo!“ und schiebt eine große Schale Apfelmus unterm Zaun durch. Uri verneigt sich: „Frau Hilde, wir sind ein tolles Team.“ In großen Happen schmatzt er das Mus, reibt sich den Bauch. Hilde verbeugt sich ebenfalls. Die nächsten Stunden wechseln zwischen Tee, Apfelkompott, Buch, Nickerchen und Stachus. Diesmal umarmt er eine Pflaume. Diesmal horcht er am Holz, reibt sanft mit der Wange über die Borke. Als Hilde fragt: „Likörchen oder kommt Ihre Verabredung gleich?“, dreht er sich abrupt um. „Nein, die ist schon da“, antwortet er, streichelt die Rinde und erklärt: „Die mögen das“, ehe er die Augen schließt und das Gesicht zurück an die Baumhaut legt, ehe er doch nach einem Likör greift. Auf den Grillrost legt Hilde an diesem Nachmittag eine Bratwurst und einen Grillkäse mehr. Stachus entscheidet sich für die Wurst, schlingt sie herunter, leckt sich Senfreste aus dem Schnurrbart, tanzt eine Pirouette. „Das könnte was werden“, sagt er und wirft Hilde Kusshände zu. „Mit uns?“ Hilde greift sich den Grillkäse.
Abends ist Hilde die erste: „Verstehst du, was hier passiert?“ Uri antwortet: „Na, wir sind hier und ganz nebenbei erledigen wir Monster.“ – „Ja, aber was ist mit unserem Alltag? Du musst doch lernen und spielen. Vor allem spielen.“ – „Stimmt. Ich finde Frau Hilde, Sie sollten uns regieren.“
Als im Nachbargarten die Lichter ausgehen, klaubt Hilde kleine Geschenke aus dem Vorratsschrank, dem Bücherregal und der Spielekiste. Mit Strippe und Leiter schleicht sie zur Weggabelung, behängt Äste und Zweige.
Morgens schleicht Stachus um die Bäume. „Finger weg!“, mahnt Hilde und treibt damit Uri ans Büchsentelefon. „Unordnungsmonster haben sich über die Bäume hergemacht.“ – „Frau Hilde, ich habe Höhenangst.“ – „Macht nichts, Uri. Ich halte unten die Stellung.“
Uri tritt aus dem Gartentor. Ganz krumm geht er. „Du schaffst es!“, ruft Hilde und Stachus drückt beide Daumen. In den Bäumen glitzert und flattert es. Uris Augen leuchten und flackern zugleich. Hilde wartet an der Weggabelung. Ein Wind zieht auf. Eine Raupe fällt ihr auf die Schulter. „Nur Mut, Uri.“ Er umkreist die Bäume, schaut, staunt: „Wie eine Treppe.“ Langsam kriecht er hinauf. Hilde holt einen Korb mit Papierkrone und Himbeerlimonade, wirft ein Strippenende hinauf und befestigt das andere am Korb. Gierig schlürft Uri die Brause, ehe er sich die Krone aufsetzt und die Schätze birgt. Hilde ist stolz, die hinzugeeilte Mutter stolzer. Stachus klatscht: „So, meine Damen! Umarmungen und Nähe braucht‘s. Wollen Sie auch mal? Das tut gut. Beiden!“ Und wirklich, Uris Mutter wirft sich richtig an den ihr zugewiesenen Baum.
Hilde geht zurück in die Laube, kehrt mit gezuckerten Erdbeeren in Kondensmilch und einem Schnaps zurück. Auch den nimmt die Mutter begeistert entgegen. Hubertus schaut, was sie dort treiben, schenkt sich einen ein und eine Runde Blechkuchen aus. „Wir haben gewonnen!“, ruft Hilde, als Uri sich den Stamm hinunterrutschen lässt. Sie lacht viel dieser Tage, weint abends im Bett. Aber es sind die wenigen Abende, die, an denen sie noch einmal aufsteht, sich ein Kompott gönnt, Oliven oder eine Konservenbüchse mit Champions und Parmesan. Für diesen Sommer fühlt sie sich gewappnet.
Nach sechs Wochen holt sie ein paar Sachen aus ihrer Wohnung. Lebensmittelmotten und die Meyer begrüßen sie im Hausflur. „Hast du auch welche?“, fragt die. „Nein, Frau Meyer, ich habe rechtzeitig meine Vorräte verbraucht“ und dreht ihr eine lange Nase.
Abends prostet Hilde in die Runde ihrer Lieben, während die Nachtfalter in den Teelichtern verglühen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anika Hoffmanns
Wachgang
Ich bemerkte es nicht sofort. Ich vermisste ohnehin nur eine Person in diesen Tagen. Die Anwesenheit oder das Fehlen anderer nahm ich kaum wahr.
In dieser Zeit sprach ich manchmal über Tage mit niemandem und ging wenig vor die Tür.
Ich bildete mir ein, ich würde die Situation besser verstehen, hätte ich es schneller bemerkt. Aber das stimmte vielleicht nicht.
Das Internet war ausgefallen, und ich konnte weder meine Eltern noch meine Schwester telefonisch erreichen. Schließlich begann ich doch, mir Sorgen zu machen.
Zu meinen Eltern war es ein kurzer Fußweg, fünf Minuten, wenn man sich beeilte, zehn, wenn man langsam ging.
Es war April, und der Stadtpark und die Felder waren frisch und grün und die Wolken weiß wie Schaum. Die Windräder standen still. Etwas stimmte nicht.
Eine ganze Menge Autos standen auf der Straße, doch die Motoren waren aus. Die Ampel schaltete auf grün. Niemand fuhr. Niemand hupte.
Ich blieb stehen. Ich drehte mich einmal um meine eigene Achse. Ein Vogelschwarm stob aus einer Baumkrone in den Himmel. Das Flügelschlagen kam mir laut vor. Auf einer Bank am Rand des Stadtparks lag eine Frau und schlief. Die Vögel weckten sie nicht. Sie war zu ordentlich gekleidet, um auf einer Bank im Stadtpark zu schlafen. Kurz fragte ich mich, ob sie tot war, aber ihr Brustkorb hob und senkte sich in regelmäßigen Abständen.
Auf der Straße war sonst niemand. Nur die insgesamt zehn Autos standen an der Ampel hintereinander. Von meiner Position aus konnte ich die Menschen, die darin saßen, nicht sehen. Ich ging näher heran. Dabei wählte ich erneut die Nummer meiner Schwester. Sie hob nicht ab. Bei meinen Eltern sprang nach wenigen Sekunden der Anrufbeantworter an.
Der Fahrer des ersten Autos in der Schlange war ein Mann um die sechzig in einem weißen Hemd und grauer Hose. Sein Kopf lehnte an der Fensterscheibe. Er schlief. Da, wo sein Mund der Scheibe am nächsten war, beschlug das Glas. Ich traute mich nicht zu klopfen.
Das junge Pärchen im nächsten Auto kannte ich vom Sehen. Auf dem Rücksitz stand eine Babyschale, in dem ein Neugeborenes lag. Die Eltern hielten sich an den Händen. Sie atmeten gleichmäßig, die Augen geschlossen. Ich sah, dass die Pupillen der Mutter sich unter den Lidern bewegten. Kondenswasser rann die Scheiben hinunter.
Ich ging jedes Auto ab. Alle schliefen. Wieder und wieder sprang die Ampel im Wechsel auf Grün und Rot.
Ich wandte mich um und folgte der Straße, die am Stadtpark entlangführte. Ich erreichte die Wohnsiedlung, in der meine Eltern wohnten. Ich drückte auf die Klingel. Ohne zu warten schloss ich die Tür auf. Ich rief in den Flur und die Treppe hoch. Nichts rührte sich.
Meine Mutter lag auf der Couch im Wohnzimmer. Sie hatte sich in eine Decke gewickelt. Ihre Hände lagen auf ihrem Bauch. Ich stupste sie an. Sie machte ein murmelndes Geräusch und drehte sich von mir weg.
Ich rief nach ihr, erst leise, dann ungehaltener. Ich rüttelte an ihrer Schulter. Sie wurde nicht nicht wach.
Mein Vater lag vollständig angezogen auf dem Teppich im Schlafzimmer. Er lag kerzengerade, als hätte er sich absichtlich auf den Teppich gelegt. Neben ihm stand der Staubsauger. Ich schaltete ihn an. In einer jähen Anwandlung hielt ich die Düse an seinen Pullover, dann an sein Ohr. Er wachte nicht auf.
Der Mülleimer in der Küche roch schlecht. Fliegen umschwirrten ihn.
Ich schrieb meiner Schwester eine kurze Nachricht. Seit Tagen hatte mir niemand mehr geantwortet. Es war mir nicht aufgefallen. Ich wartete seit Monaten nur auf Nachrichten von Johannes. Es kamen keine.
Ich wählte verschiedene Nummern. Nach langem Zögern wählte ich auch Johannes’ Nummer. Eine Computerstimme erklang, die sagte, die Nummer sei nicht erreichbar. Mir wurde schlecht.
Die Stille im Haus war bedrückend. Ich schaltete das Radio ein, doch es ertönte nur Rauschen. Ich schaltete auf CD um. Die ins Leere drängende Musik erschreckte mich. Ich machte sie wieder aus.
Aus dem Kühlschrank nahm ich mir einen Erdbeerjoghurt und aß ihn. Dann lief ich zurück zur Straße. Neun Autos standen an der Ampel. Ich war mir sicher, dass es eben zehn gewesen waren. Ich sah über die Schulter, dann ging ich schnell zurück nach Hause. Die letzten Meter rannte ich.
Ich stand am Fenster in der zweiten Etage und sah hinaus. Überall waren dunkle Fenster. Der Abendhimmel war blau und weit. Die Wolken hatten sich verzogen. Lange sah ich in den Himmel und hielt Ausschau nach Flugzeugen. Es kamen keine.
Ich fragte mich, ob es Autounfälle gegeben hatte.
Flugzeugabstürze, Brände.
Ich fragte mich, ob die Schlafenden verhungern oder verdursten würden.
Meine Augen brannten. Ich legte mich ins Bett und deckte mich zu. Dass ich nicht mehr aufwachen könnte, bereitete mir keine Sorgen. Ich hatte seit Monaten nicht mehr richtig geschlafen.
Allmählich begehrte ich den Schlaf so verzweifelt, als wäre er eine Person.
Ich schaffte es, leicht wegzudämmern, indem ich mir vorstellte, Johannes läge neben mir. Ich stellte mir vor, wie sein Körper sich anfühlte. Später lag ich mit Herzrasen im Dunkeln. Es war besser als sonst. Normalerweise hielt mich die Vorstellung wach, dass er in diesem Moment mit seiner neuen Freundin schlief.
Am folgenden Morgen nahm ich mir das Auto mit dem Pärchen und dem Baby vor. Ich nahm das Baby aus dem Sitz und drückte es an mich. Es roch sauber, nach Mensch und Muttermilch. Nachdem ich eine Weile zugehört hatte, wie es leise atmete, legte ich es zurück.
Ich kniff den Vater in den Arm. Er schnarchte auf. Ich hielt der Mutter die Nase zu. Ihr Mund öffnete sich, ansonsten geschah nichts. Ich schrie ihr ins Ohr. Es kam mir falsch vor. Es kam mir vor, als würde der Schrei weit fort getragen. In den Autos blieb alles still. In den Sträuchern am Straßenrand raschelte es. Ich floh nach Hause und setzte mich in mein Auto. Ich verriegelte die Türen von innen.
Für den Weg ins Stadtzentrum brauchte ich lange. Nahezu jede Straße wurde von Autos blockiert. Ich traute mich nicht auszusteigen. Ich sah es auch so. Ich fuhr auf Gehwegen und Mittelstreifen. Manche Menschen lagen im Gras neben den Geh- und Radwegen, aber nie darauf. Einmal musste ich umkehren, weil ordentlich abgestellte Fahrräder mir den Weg versperrten.
Die Straße, in der Johannes wohnte, lag in gleißendem Mittagslicht. Gegenüber bellte ein Hund, ansonsten war alles ruhig.
Ich schlüpfte durch die Terrassentür, von der ich wusste, dass sie immer offen war. Ich schloss die Augen, um mir vorzustellen, dass ich erwartet wurde.
Er lag in seinem Bett. Ihm zugewandt schlief eine zierliche blonde Frau. Ihre Köpfe waren nur Zentimeter voneinander entfernt. Er trug ein T-Shirt und Boxershorts. Sie war nackt. Ich trat gegen das Bett.
Auf dem Boden lag ihre Kleidung. Ich fand ihre Handtasche im Wohnzimmer und darin die Geldbörse mit ihrem Pass. Sie lebte im Nebenort. Ich kannte die Straße nicht.
Es kostete mich Mühe, sie anzuziehen. Noch schwieriger war es, sie hochzuheben. Ich ließ sie auf den Boden sinken und griff unter ihre Achseln. Sie stöhnte leise. Ich zog sie in den Flur. Als ich sie endlich die Treppe hinunter und in den Sessel im Flur gehievt hatte, brauchte ich eine Pause.
Die Küche war unaufgeräumt und stank. Ich wusch die Töpfe und Pfannen in der Küche ab und stellte die Spülmaschine an. Im Kühlschrank lagen zwei Nackensteaks.
Mit dem Fleisch ging ich zum Haus gegenüber. Der Hund stand hinter der Gartentür. Als er mich sah, begann er gegen die Tür zu springen. Das Fenster daneben war gekippt. Ich ließ das Fleisch durch die Lücke ins Innere fallen. Im Laufschritt ging ich zurück.
Es dauerte noch eine weitere Stunde, bis sie schließlich in meinem Auto auf dem Rücksitz lag. Ich schwitzte. In der Küche trank ich ein Glas Wasser, dann machte ich mich auf den Weg. Ich fuhr über die Landstraße. Einmal hielt ich an, um einen schlafenden Polizisten zur Seite zu ziehen, der quer über dem Mittelstreifen lag. Nach kurzem Zögern öffnete ich das Holster und nahm die Pistole heraus. Sie wog schwer in meiner Hand.
Links und rechts von der Landstraße war Birkenwald. Lichtpunkte tanzten auf dem Asphalt. Mit dem Auto im Rücken stand ich lange da und starrte in den Wald. Ich zielte, schoss aber nicht.
Systematisch fuhr ich die Straßen im Nebenort ab. Am Abend hatte ich die richtige gefunden. Es war ein Haus mit sechs Parteien und einer Bank im Vorgarten. Ich probierte verschiedene Schlüssel aus, bis ich den richtigen fand.
Die Wohnung befand sich im zweiten Stock. Ich zog sie an den Achseln die Treppe herauf. Am liebsten hätte ich sie im Treppenhaus liegengelassen. Ich tat es nicht. Ich schleifte sie durch ihre Wohnung ins Schlafzimmer, ohne mich umzusehen.
Auf dem Rückweg regnete es. Ich dachte an die Frau auf der Bank im Park. Ich widerstand dem Drang zu weinen. Zuhause duschte ich, dann stieg ich erneut ins Auto und fuhr zu Johannes.
Die Spülmaschine brummte. Durch die Küche war frische Luft gezogen. Es dämmerte.
Ich ging die Treppe hoch. Ich legte mich neben ihn. Ich besah und befühlte jeden Zentimeter seines Gesichts. Angst, dass er aufwachen könnte, hatte ich jetzt nicht mehr. Es wurde Nacht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Clara Leinemann
everyday business
Eine Frau bückt sich, um ihren Schlüssel von der Straße aufzuheben, eine andere fährt auf dem Fahrrad an ihr vorbei. Eine Frau zupft ihr Kopftuch zurecht, wieder eine andere sucht nach etwas in ihrer Tasche. Ihr entgegen läuft eine weitere Frau, sie telefoniert, die Stimme scharf, die Brauen zusammengezogen. Eine Frau macht kleine Schritte, ihrem Rollator hinterher. Eine Frau sitzt in einem Café und schlägt die Zeitung auf, eine andere fragt sie nach etwas Kleingeld. Eine Frau schiebt einen Kinderwagen, eine Frau tritt gegen ein umgekipptes Straßenschild, eine Frau wirft den Kopf in den Nacken und lacht laut auf, ein tiefes, kehliges Lachen, eine Frau neben ihr muss auch lachen. Eine andere Frau läuft an ihnen vorüber, schaut in ihr Handy, folgt einem blauen Punkt in ihrer Kartenapp, runzelt die Stirn, sieht sich um, läuft weiter, über eine Ampel, hält Ausschau nach Straßenschildern und bleibt schließlich vor einem Hauseingang stehen. Sie schiebt sich ihre Sonnenbrille ins Haar, sucht das Klingelschild ab, klingelt und wird kurz darauf eingelassen. Im Treppenhaus wendet sie immer wieder ihren Kopf ins nächste Stockwerk, besieht die Türen und bleibt schließlich stehen, vor einer Wohnungstür, die offen steht und in einen großzügigen Flur führt. Die Frau schiebt sich langsam durch die Tür, tritt in den Flur, ihre schmutzigen Turnschuhe auf dem sauberen Dielenboden. Bücherregale ziehen sich bis unter die Decke, ein Sideboard, Marmor, darauf Kunst. Kunst auch an den Wänden. Ein Kronleuchter. Niemand, der sie empfängt, aber hinter einer offenstehenden Flügeltür, durch die ein schmaler Lichtstrahl in den Flur fällt, ist eine Männerstimme zu hören, fest, tief, bestimmt.
Die Frau lässt die Wohnungstür hinter sich offen stehen und läuft den Flur hinab, schiebt die Flügeltür vorsichtig auf, der Lichtkegel erweitert sich und umschließt sie dann völlig, sie steht in einem tageshellen Wohnzimmer, Couches, ein langer Tisch, mehr Kunst und Kunstbände, ein großer, mittelalter Mann, der an der Tischkante lehnt, eine Hand darauf abgestützt, ein Bein locker über das andere gelehnt, er telefoniert und wirft der Frau einen kurzen Blick zu, hebt erfreut die Brauen und bedeutet ihr, einen Moment zu warten.
Die Frau lächelt höflich und bleibt im Türrahmen stehen, den Blick gesenkt, sie wartet geduldig, während der Mann sich in Bewegung setzt und beginnt im Zimmer auf und ab zu laufen, seine Sätze mit ausschweifenden Gesten zu untermalen, wobei er zwischendurch einen Blick zu ihr rüberwirft, doch weniger auf eine verbündete, als auf eine beobachtende Art. In der großen, teuer eingerichteten Wohnung sieht sie wie ein Versehen aus, ihre Jeans ist abgeschnitten, sie hat blaue Flecken an den Beinen, ihr Top ist kurz und gibt den gepiercten Bauchnabel frei. Ihr Haare sind lang und sie trägt eine Cap ohne Logo. Sie lehnt sich an den Türrahmen.
Der Mann legt auf, legt das Handy auf dem Tisch ab und sagt, Entschuldigung, sieht sie dann ein paar Sekunden lang an, bevor er mit großen Schritten auf sie zugeht. Hi, ich bin Mirco. Mirco Werner. Er grinst auf eine eindringliche Art. Hi, sagt die Frau und gibt ihm die Hand, die er länger als nötig festhält. Er blickt an ihr herunter, durch ihr Top sind ihre Nippel zu sehen, sie fängt seinen Blick auf und lächelt höflich. Also, sagt er und reibt die Handflächen aneinander. Dann kommen wir wohl direkt zum... Geschäftlichen? Beim letzten Wort zwinkert er ihr zu. Sie hebt die Schultern, nickt und sagt, klar.
Gut, er deutet mit der Hand auf eine weitere Flügeltür, bitte, sagt er, das Schlafzimmer ist dort. Sie geht vor ihm, er legt ihr auf dem Weg zwei Fingerspitzen in den unteren Rücken, als würde er sie führen, öffnet über sie hinweg die Tür zum Schlafzimmer, wobei sein Brustkorb sich dicht an ihre Schulter drängt. Sie läuft weiter, ins Schlafzimmer, bleibt vor dem Bett stehen, und sieht sich etwas unsicher um. Das Bett ist weiß bezogen, die Wände kahl, die Fenster mit dünnen weißen Vorhängen behangen. Auf dem Nachtisch steht neben einem Glas Wasser ein eingerahmtes Foto, auf dem Mirco mit einer Frau zu sehen ist, beide strahlen in die Kamera, Mirco wirkt noch etwas jünger, als er es jetzt ist. Er stellt sich neben sie, legt die Hände zusammen und sein Blick fährt wieder an ihr herunter, als er leise sagt: Ich habe sowas noch nie gemacht. Sie sieht ihn erstaunt an, wirklich nicht? Er schmunzelt in sich hinein, seine Festigkeit von eben ist von ihm abgefallen. Er macht einen Schritt auf sie zu, meine Frau, sagt er und korrigiert sich dann, Exfrau, meine ich, ist gerade erst ausgezogen, und ich – er seufzt ein mal kurz, ich bin seitdem so unruhig. Er schaut sie an, schaut aufs Bett, sie lächelt noch immer, doch hinter ihren Augen schwindet die Geduld, ich fühl mich so einsam sagt er, und sie nickt langsam, er kommt ihr näher, sein Mund öffnet sich schmatzend, sie schluckt, er atmet hörbar ein, sie tritt einen Schritt zurück, sieht zu ihm auf, ihre großen Augen fragend, sie sagt: Wo, äh, ist denn dieser Lattenrost?
Mirco Werner ächzt und stöhnt, er braucht eine Weile, um den Lattenrost aus der Kammer zu holen, zu der eine kleine, fast unsichtbare Tür in der Ecke des Schlafzimmers führt. Es klemmt fest zwischen Staubsauger, Wischeimern und Kisten. Er zerrt es heraus, dabei rutscht sein Hemd aus seiner Hose und ein Stück seiner Hüfte ist zu sehen. Die Frau steht noch immer an der selben Stelle und sieht ihm zu. Als er den Lattenrost, zusammengerollt und mit einer Schnur verbunden, aus der Kammer befördert, stellt er ihn vor ihr auf und sagt, hier, hier ist er. Ich wollte einen neuen, wie gesagt, ich bin so unruhig, kann nicht schlafen, ich möchte alles neu machen, alles – sein Blick flackert kurz zu dem Foto auf seinem Nachttisch. Ich möchte einen Neuanfang, sagt er und die Frau vor ihm nickt wieder, sagt, Sie wollten 10 Euro dafür haben, oder?, und holt einen Schein aus ihrer Hosentasche. Er sieht kurz verwirrt zwischen ihrem Gesicht und dem Schein hin und her und sagt dann, Weißt du was, ich schenke ihn dir, ich brauche ja keine 10 Euro, dabei lacht er, als wäre es absurd, dass er überhaupt überlegt hatte, Geld zu nehmen. Sie zuckt mit den Schultern und sagt, cool danke, steckt den Schein zurück in die Tasche. Dann würde ich mal wieder los. Sie nimmt den Lattenrost hoch und er folgt ihr, durchs Wohnzimmer, Richtung Flur, und fragt sie, ob sie gern lese. Sie antwortet im Gehen, manchmal, und er sagt ihr, er sei Autor, und ob sie schon mal etwas von ihm gelesen habe, woraufhin sie verneint und er sagt, er könne ihr Freikarten für eine Lesung verschaffen, was sie dankend ablehnt, und als sie an der Wohnungstür angekommen sind, dreht sie sich noch einmal um und sagt, Danke noch mal für den Lattenrost, schönen Tag noch, während sein Blick, inzwischen kühl und aufmerksam auf ihr ruht. Sie wartet, ein, zwei Sekunden auf eine Antwort, und als keine kommt, wendet sie sich um, und in diesem Moment sagt er: Ich möchte doch mein Geld haben. Die Frau muss unwillkürlich auflachen. Mirco Werner sieht sie trotzig an und streckt die Hand aus. Gib mir meine zehn Euro. Sie sieht ihn an, amüsiert und gleichzeitig verunsichert. Okay, sagt sie und während sie den 10-Euro-Schein wieder hervorzieht, sagt Mirco Werner, er würde doch den Lattenrost seiner Frau, Exfrau, keiner dahergelaufenen – er sucht nach dem richtigen Wort und spuckt es ihr dann entgegen – Nutte schenken. So nötig habe er es nicht. Sie sei ja noch nicht mal so hübsch, dass sie das Recht hätte, dermaßen eingebildet zu sein. Die Frau sieht ihn nicht an, während er ihr den Schein aus der Hand nimmt, sie sieht ihn gar nicht mehr an, verlässt wortlos die Wohnung, läuft zum Treppenabsatz und er sieht ihr nach, das Gesicht wutverzerrt, wie sie die Stufen hinab läuft.
Draußen auf der Straße nimmt sie ihr Handy aus der Hosentasche und wählt eine Nummer. Hier ist Emma, sagt sie nach ein paar Sekunden. Ich hatte gerade meinen allerschlimmsten Ebay-Moment aller Zeiten. Sie klemmt das Handy zwischen Ohr und Schulter, hebt den Lattenrost an und läuft die Straße runter, vorbei an einer Frau, die mit einem Hund spazierengeht, einer Frau, die ein Regal durch eine Haustür trägt, einer Frau, die breit lachend über die Straße läuft, einer anderen Frau entgegen, die beiden umarmen sich herzlich und eine ruft: Yeah Baby!
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sven Beck
Frau Fröhlich
Von außen betrachtet waren Fröhlichs ein nettes, unauffälliges Ehepaar und wer nicht über anständigen Geruchs- und Hörsinn verfügte, konnte das glauben. Glücklicherweise lebten sie in der ausgestorbensten Straße des Dorfes – nur in der anderen Reihenhaushälfte wohnte eine Familie. Meine Familie. Bis ich sechs war, teilte ich ein Zimmer mit meiner Schwester. Mit acht hatte ich ein eigenes. Da musste es angefangen haben mit den Geräuschen. Sie schwappten durch die Wand aus dem Nachbarhaus. Ich hörte sie, wenn ich im Bett lag.
Gekocht habe ich, für alle, rief Herr Fröhlich, für die ganze Gesellschaft.
Einmal, kreischt die Frau: Und immer noch willst du Dank.
Ich kann mich nicht erinnern, dass der kam.
Weil ich die restlichen dreihundertwasweißichwieviele Tage dein verdammtes Essen mache, Rudi!
Ich zwing dich nicht, bei mir zu sein, Magdalena. Ich zwinge dich nicht, bei Gott!
Seine Stimme dröhnte. Ich dachte nicht viel. Nur: Wie kann man so leben. So laut.
Geh! Wenn du gehen willst, geh!
Vielleicht sollte ich das.
Dann mach, verdammte Scheiße!
Klatschen. Drei, vier Mal. Dann war Ruhe. So ging das öfter, auch meine Schwester hörte es. Wir erzählten es Mutter. Es hielt vom Schlafen ab.
Mutter legte sich die Hand auf den Mund und tuschelte Vater zu. Sie riefen im Ordnungsamt an, Vaters Arbeitsstelle. Sie erklärten die Situation und erbaten sich einen spontanen Urlaubstag. Mutter zitierte drei Freundinnen zur Hilfe. Dieses Vorhaben ging nur gemeinsam. Am nächsten Morgen klingelte die Haustür und Vater verteilte Handschuhe und Maler-Anzüge. Zuerst schraubten sie die Betten auseinander. Dann schoben sie die Möbel um. Sie hievten und zogen, drückten und pressten, bis die Zimmer leer waren: meins und auch Klaras. Zum Schluss tauschten sie alle Möbel mit ihren eigenen aus und strichen unsere neuen vier Wände weiß. Es war lange dunkel, als Mutter ein Tablett heißen Tee brachte und sich bei allen bedankte.
Den Rest, sagte sie, schaffen wir allein.
Und als sie die Tür hinter den Helferinnen schloss: Was bin ich froh, dass die Kleinen jetzt woanders schlafen.
Umso schwerer für sie: Mit ihrem leichten Schlaf schreckte sie auf bei jeder Kleinigkeit. Dann lag sie da und machte sich einen Kopf: Übers Schreien. Übers Klatschen. Über den morgigen Tag – wie viele Stunden ihr blieben. Sie war überwacht, dachte an den Notruf, Frau Fröhlich, Gerechtigkeit. Sie zögerte, haderte und gewöhnte sich doch letztlich an alles.
Eines Nachts aber wurde es so laut, dass wir Kinder sie wieder hörten. Sogar bei der Hundertjährigen gegenüber ging das Wohnzimmerlicht an. Eine halbe Stunde später blinkte blaues Licht in hellen Streifen an meine Decke. Daraufhin hörten wir lange nichts.
Ein paar Monate später war Herr Fröhlich gestorben.
Damit hatte niemand gerechnet. Weder ich noch Klara noch Mutter noch Vater, nicht einmal Frau Fröhlich. Zumindest beteuert sie das, sagte Mutter.
Sie wäre selbst schockiert gewesen, sagte Frau Fröhlich. Wie sie vom Friseursalon nach Hause gekommen wäre und ihren Rudi auf dem Sessel liegen sehen hätte. Wie er dann nichts gesagt hätte. Einfach tot gewesen wäre. Wohl was am Herzen.
Das glaube ich nicht, sagte Mutter.
Warum, fragte ich.
Mutter seufzte, überlegte und sagte: Sven, ich denke, er hat sich totgetrunken.
Warum, sagte ich wieder, aber darauf wusste sie keine Antwort. Auch Frau Fröhlich wusste sie nicht.
Klara saß auf der Bettkante und starrte an die Tapete. Ich setzte mich zu ihr. Wir saßen eine Weile. Dann umarmte ich sie. Wir weinten nicht.
Früher, als Klara und ich im Gartenstreifen einen Ball kickten, stand er am Zaun. Er rauchte.
Wisst ihr, begann er, ich war auch mal Spieler, ein ganz großer war ich, das war… lass mich überlegen… 98 muss das gewesen sein! 1998, Mensch, bin ich alt. Im Waldstadion war das, 40.000 Menschen, kannst du dir das vorstellen?
Klara staunte und flüsterte mir etwas zu.
Wäre da nicht diese Knieverletzung gewesen, sagte er und trank einen Schluck Bier. Dann ging er die Verandatreppe hoch ins Wohnzimmer und widmete sich dem Fernseher: Richterin Barbara Salesch, Hör mal, wer da hämmert und wie sie alle hießen.
Gerade zeigten sie Auf Streife. Er dachte: Es muss wohl schon Nachmittag sein.
Wie viele Stunden hatte er? Zwei? Vier? Eine Weile würde sie außer Haus sein, das gab ihm Zeit. Zeit, Geheimbierkästen zu sortieren, Geheimschnäpse zu leeren, Geheimschubladen nachzufüllen. Alles musste man geheim halten bei dieser Frau. Und er müsste etwas essen, das auch. Nicht viel, ein Stück Kalbsfleisch, Zwiebeln, aber er müsste es selbst machen und etwas übrig lassen, das würde sie erwarten. Oder aber, er beseitigte nach dem Kochen alle Spuren, putzte blitzeblank, aber wie würde er sich dabei vorkommen, dachte er und verschob die gesamte Frage, indem er sich eine Zigarette aus der Schachtel nahm und sie sich im Türrahmen anzündete. Die Position war ausgeklügelt, hier konnte er einerseits verfolgen, was der Bildschirm ihm anbot, andererseits den Rauch an die freie Luft blasen, sodass sie es später nicht riechen würde. Waren die eigentlich echt, diese Fälle? Wahrscheinlich nicht. Aber sie spiegelten die Wahrheit wider, darum ging es, dachte Herr Fröhlich, echt kam auch er sich schon lange nicht vor.
Frau Fröhlich sah man selten. Um acht Uhr stieg sie ins Auto und um acht Uhr parkte sie ein. Obwohl sie im Salon Sechs-Stunden-Schichten hatte, blieb sie länger weg und machte Überstunden. Unbezahlt. Zu sich selbst sagte sie:
Das glaubt mir kein Mensch, kein Mensch glaubt mir das. Und: Die würden mich für verrückt halten. Oh, Gott, oh, Gott.
Wenn sie die Treppenstufen zur Haustür nahm, war ihr Blick angespannt und bevor sie den Schlüssel drehte, atmete sie tief durch. Einmal beobachtete Mutter sie durchs Badezimmerfenster, sah, wie sie volle Einkaufstüten aus dem Kofferraum lud und rief:
Guten Abend, Frau Fröhlich! Kann ich helfen?
Das ist lieb. Sie sind ja selbst beschäftigt mit den Kleinen.
Sind Sie sicher? Ich kann wirklich schnell raus!
Ach das bisschen hier, das kriege ich schon –
Hin, wollte Frau Fröhlich sagen, aber eine Gurke fiel vornüber. Und was machte Frau Fröhlich? Sie beugte sich zur Gurke hin, vergaß kurzerhand das Dutzend andere Lebensmittel in ihren Armen, und munter kullerte und purzelte es heraus: Lauchzwiebeln, Kochkartoffeln, Blattspinat und so weiter. Die Sauerei war angerichtet.
Ich komme!, eilte Mutter, ohne eine Antwort abzuwarten. Frau Fröhlich weinte. Einige Minuten lang schluchzte sie in allen möglichen Tonlagen und die überforderte Mutter stand da. Holte Toilettenpapier. Umarmte. Wartete:
Ist ja gut, sagte sie: Ist ja gut.
Und sie erfuhr es: Nämlich, dass Herr Fröhlich ein Trinker war der ganz üblen Sorte, und ja, dass er sie wohl auch, so deutete Frau Fröhlich es an, geschlagen hatte. Und sie – weiß Gott warum, war eine nette, talentierte, und, das sah Mutter in den Tränensäcken, dem feuchten Lächeln darunter, den zaghaften Versuchen, zurückzustreichen, liebenswürdige Frau, die sich das eben einfach antat.
Wenn Frau Fröhlich Haare schnitt, gab sie sich alle Mühe, nicht daran zu denken, was ihr Gatte tat. Sie wollte unbedingt, sie klammerte sich an den Wunsch, dass es ihr von Herzen egal wäre, wenigstens einige Stunden lang, wenigstens jetzt. Denn im Grunde war es das. Sie käme zurück, wenn sie zurückkäme und dann würde sie sehen: Wenn nichts passiert war, wozu all der Stress. Und wenn doch? Wenn doch? Dann würde sie sich früh genug damit beschäftigen, dachte Frau Fröhlich. Obwohl, so richtig dachte sie es nicht, denn diese Gedanken kamen und gingen seit Jahren, sie kannte sie auswendig und hatte schon lange keine Kontrolle mehr darüber. Sie lächelte einem jungen Mädel durch den Spiegel zu und tastete nach der gezackten Schere.
Und die Schule? Gehst du noch zur Schule? Meine Güte, ich kann das gar nicht mehr einschätzen…
Noch ein Jahr. Das Mädchen lächelte: Dann bin ich fertig.
Frau Fröhlich rückte ihren Kopf mit den Zeigefingern um einige Zentimeter aufwärts. Das war ein gutes Alter. Das Buffet, aus dem sie Konversationshäppchen wählen konnte, war unermesslich. Man musste nur ein paar Fetzen wie „Erfahrungen machen“ reinwerfen und freudig plätscherten die Träume.
Du hast ja alle Zeit der Welt, sagte sie und dachte, dass sie das auch gedacht hatte, damals. Jetzt war sie weg, die Zeit. Vor fünf oder zehn Jahren, war sich Frau Fröhlich sicher, hatte der liebe Gott sie verlassen. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt. ‚Die ganze Sache‘, wie sie ihre Ehe vor Freundinnen (den wenigen, die sie noch hatte) betitelte, ließ es nicht anders zu. Wenn man mit einem Alkoholiker zusammenlebt, passiert etwas Seltsames: Alles andere beginnt zu verschwinden. Die Trinkerei wird von seinem Problem zum gemeinsamen Problem zum einzigen Problem, ohne dessen Lösung nichts geht. Gehen darf.
Es war schon oft so, dass er gelobt hatte, trocken zu werden. Er würde sich schließlich auch wünschen, dass es anders wäre. Er verfluchte sich und hasste sich. Er hatte Angst, dass sie ihn verlassen würde. Sie habe auch ein Recht auf Leben, sagte sie und er wusste, dass es stimmte.
Magdalena.
Er liebte Magdalena.
In der schweißgemoderten Stickluft einer örtlichen Turnhalle waren sie sich begegnet. Zusammen hatten sie Stangen für Volleyballnetze abgesteckt, beim offenen Training der Ü25. Er hatte eine hellbraune Lederjacke und kurzes, schwarzes Haar. Sportstudent im sechsten Semester. Im ersten Blickaustausch hatte keiner der beiden etwas Besonderes gesehen.
Nach der Stunde, mit der Gruppe im Gasthaus, waren beide bis zum Ende geblieben. Die Woche darauf und darauf auch wieder. Etwas an ihm sagte: Ich bin auf deiner Seite. Das gefiel ihr. Als die Lokaltüren schlossen, begleitete er sie den ganzen Weg. Irgendwann lud sie ihn hinauf. Ein Jahr darauf hatten sie geheiratet.
Magdalena.
Manchmal war er noch da, der Funken. Natürlich war er alt geworden, körperlich alt: Unter der Brust zählte sie dreizehn senkrechtgezogene Dehnungsstreifen. Am linken Oberschenkel drei, am rechten vier. Aus den Fusseln, die sie in ihrem Bauchnabel fand, hätte sie pro Monat zwei Socken stricken können. Trotzdem: Wenn er sein Shirt auszog, Jeans und Unterhose abstreifte, sich zu ihr legte, sie bedeckte, umarmte, ihren Hinterkopf küsste und sagte: Es tut mir leid; wenn er dann weinte, war alles vergessen. Frau Fröhlich liebte ihn. Sie müsste es einfach schaffen irgendwie… koste es auch ein ganzes Leben. So war die Liebe, dachte Frau Fröhlich und sagte:
Schon okay. Pscht, pscht… Schon, okay.
Er hatte es versucht.
Er ging von sich aus hinaus zum Einkaufscenter, spazierte, genoss die frische Luft. Der Wind. Sogar die Menschen, die ganzen Menschen. Kinder waren auf die Welt gekommen, Familien hergezogen. Alte Freunde saßen vor der Schänke, lachten über ihn oder zogen Fratzen. Herrn Fröhlich war das egal, es gab nur eins, das zählte: Veränderung.
Ich kann das, dachte Herr Fröhlich, ich kann das und ich werde es beweisen. Der Spargelverkäufer auf dem Center-Parkplatz sagte:
Du hast Glück, der Chef ist gerade gekommen. Warte ein bisschen, ich hole ihn her.
Und Herr Fröhlich wusste, dass es Schicksal war, aber er sagte:
Ein glücklicher Zufall.
In aller Knappheit schilderte er seine Notlage: nur vorübergehend und Erfahrung im Einzelhandel und voll motiviert und Verstärkung für ein tatkräftiges Team und so weiter. Der Vertrag war unterschrieben, an Ort und Stelle. Zuhause genehmigte er sich ein Glas. Eins. Nicht zwei, nicht drei, ein einziges. Augustiner-Hell. Ich habe es mir verdient, dachte er, ich habe den ersten Schritt gemacht, das war richtig. Bald werde ich zu den Anonymen Alkoholikern gehen, alles zu seiner Zeit, ich werde Hilfe suchen bei Gott, ich werde mich entschuldigen. Ich schulde es dem Leben. Ich habe mir so oft den Tod gewünscht, nicht nur aus Spaß, nicht nur einmal, ich habe es ernsthaft versucht, ich ging wie ein lebender Toter, das alles hat jetzt ein Ende, dachte Herr Fröhlich und nahm einen kalten Schluck und spürte, wie die kleinen Bläschen seinen Gaumen kitzelten und die herbe Note auf der Zunge und stieß leicht auf und musste fast darüber lachen, wie wenig Aufmerksamkeit er in all der Zeit dem Geschmack dieses Zeugs geschenkt hatte. Helles war viel zu wässrig! Hatte er anderes im Haus? Nein. Überhaupt, Bier war ja was! Der Gourmet in ihm war verloren. Er ging in den Keller, kam mit einer Flasche Rotwein wieder hoch und Frau Fröhlich stand fassungslos im Türrahmen. Was er sich denke. Ob er den Job habe. Immerhin. Gekocht? Ob er überhaupt verstehe, was er ihr damit antue, mit dieser Flasche. Ob er auch nur die geringste Ahnung davon habe. Ob sie ihm vollkommen egal sei.
Was diese Frau wieder für einen Aufstand machte.
Das war das erste Abend, an dem er sie schlug.
Es war noch hell draußen, als Frau Fröhlich, drei Tage nach dem Tod ihres Mannes, in der Einfahrt im Hof parkte. Sie schloss die Tür des stillen Hauses auf, zog Schuhe und Mantel aus, kochte Bohnen, briet Speck, aß auf, spülte ab und dann saß sie da. Immer noch hell. Fünf Uhr am Nachmittag. Vom Wohnzimmer her roch es nach Bier.
Zwei Tage war sie nicht zur Arbeit erschienen, zwei Nächte hatte sie geweint. Heute hatte sie wieder Haare geschnitten. Als sie sich, nach ihren vollbrachten sechs Stunden, die Tasche über die Schulter geschwungen hatte und sich verabschieden wollte, war ihre Chefin verdutzt: Willst du schon gehen?
Ist ja vorbei.
Keine Überstunden?
Kriege ich die bezahlt?
Bezahlt?
Bezahlt.
Aber das haben wir doch immer so gemacht. Na, dass die… freiwillig waren.
Frau Fröhlich nickte langsam: Gut, sagte sie: Dann ist immer jetzt vorbei.
Wenn Klara und ich abends im Garten waren, sahen wir Frau Fröhlich nun allein auf der Terrasse. Wir kickten uns den Ball seltener zu. Wenn wir es taten, schüttelte sie den Kopf über uns, als würde sie von einem Elf- und einer Neunjährigen erwarten, erwachsen zu werden. Wir sprachen nie mit ihr, einmal beschwerte sie sich bei Mutter über die Lautstärke. Die wiederum war überrascht, wie ausgewechselt sie wirkte; ein bisschen Trauer hing ihr aus den Augen, aber die Haut war röter und ihre Gangart befreiter. Plötzlich waren Gartenzaungespräche möglich. Zuerst über das Wetter, Kommunalpolitik, Sportvereine. Irgendwann erzählte Frau Fröhlich, dass auch sie sich mal eine Familie gewünscht hatte. Zwei Kinder wollte sie haben, einen Jungen und ein Mädchen. Sie lächelte verlegen und wischte sich die blondierten Strähnen aus der Stirn: Aber das Schicksal hat es nicht gut mit ihr gemeint.
Mutter lud sie zum Mittagessen ein, während wir in der Schule waren. Da sprudelte es aus Frau Fröhlich heraus.
Die erste Einladung in ein neues Wohnzimmer seit acht Jahren. Die Gewalt, die sie erlitten hatte, die Liebe, die sie verschenkte, die Angst, die sie hatte, ihren Mann zu verlassen. Die tiefe Erschütterung, als dieses Ereignis, Tod durch Alkohol, wirklich eingetreten war. Die Verwunderung, dass die Welt weiterging.
Auf seiner Bestattung, sagte sie, während sie in ihrer Kaffeetasse rührte, waren fünf Menschen. Ich. Meine Freundin. Drei Saufkollegen.
Und die Trauerarbeit?
Fangen wir nicht davon an.
Als Mutter in der Küche eine neue Kanne aufgoss, stach sie plötzlich ungeduldiges Mitleid. Sie sah in dieser fünfzigjährigen Frau, auf dessen Oberarm ein Herz-Tattoo sich in Schreibschrift faltete, auf einmal ein hilfloses Kind. Wie konzentriert sie aussah, wenn sie zuhörte, wie sorgfältig sie ihre Sätze sagte. Wie nervös sie war.
Sagen Sie mal, wie geht es denn jetzt weiter?
Weiter?
Na, da fällt doch was weg, nach so einem… Ereignis. Sie müssen es nicht wissen, aber… Irgendwie will diese Lücke schließlich gefüllt werden.
Frau Fröhlich sah aus dem Fenster: Nein. Nein, das weiß ich wirklich nicht.
Wir sahen sie Rasen mähen. Pflanzen gießen. Möbel putzen. In ihrer Einfahrt stapelten sich Wanduhren, Fotokalender und Deutschland-Flaggen, Mini-Kühlschränke, Zeitschriftenhalter und Zigarettenstopfmaschinen. Wir durften alles nach „Brauchbarem“ durchstöbern, bevor die Müllabfuhr es verlud. Wir hatten nichts gefunden.
Der Hausputz beschäftigte sie lange. Zähe Flecken tauchten auf, braune und gelbe. Trockene, klebrige weiße. Als sie die kleine Kachel abnahm, die zum Abflussrohr der Dusche führte, entdeckte sie einen halbvollen Flachmann. Es wurde warm. Der Sommer kam und sie war fertig.
Sie ging ins Café unseres Dorfes. Saß unter den Schirmen, nach Feierabend und bestellte Kaffee. Die Gespräche der anderen kreisten um Politik. Da waren die Einwanderer, da war die Globalisierung, da war die Hauptstraße oben, wo sie jetzt Fahrradwege hinpflanzen wollten. Die halbe Spur beschlagnahmten sie dafür. Dabei fuhr doch eh kaum jemand Fahrrad. Je später der Abend, desto lustiger wurden sie. Erzählten Geschichten aus ihrer Vergangenheit, lästerten über Arbeitskollegen, verfluchten die Städter. Tranken Apfelwein.
Sie setzte sich zu ihnen. Nicht von sich aus. Ein Mann in ihrem Alter, mit Sportjacke und Jeans, hatte sie gefragt.
Auch ein Glas?
Ach, ne.
Ach, komm.
Danke, wirklich.
Ich lad dich ein.
Ist gut.
Also, Prost.
Prost.
Im nächsten Monat erlebte Mutter Frau Fröhlich glücklich und seltener. Wieder kam sie erst nachts nach Hause: Gut für sie, dachte Mutter und widmete ihr keine weiteren Gedanken. Sie fühlte sich erleichtert. Sollte sie leben lernen.
Es war Herbst, als sie ihr mitteilte, dass sie ausziehen würde.
Wohin?
Zu Björn.
Björn Ralfschmitz.
Sie kennen sich?
Mutter zögerte. Sie dachte daran, wie Vater von Ralfschmitz‘ Eskapaden erzählte, der Unruhe, die er in seinen Stammtisch brachte, dem Rausschmiss, der irgendwann folgte: Lose, sagte sie.
Also dann, sagte Frau Fröhlich lächelnd.
Viel Glück.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Mario Schemmerl
Wo ich hin muss, damit du nicht verschwindest
Im Bett, vor dem Einschlafen meine Hand in ihre zu legen ist beruhigend. M. fühlt sich warm an und meine Einsamkeit verschwindet ein wenig. Vor ihr gab es keine Person, mit der ich das konnte. Jede Nacht verbrachte ich alleine in meinem Bett. Bücher waren meine Gesellschaft. Am Nachtkästchen lagen ein paar und manchmal auch neben mir im Bett. Ich habe Romane über Liebe und Krieg gelesen. Wenn ich nicht imstande war das Brennen in meiner Brust mit Literatur zu besänftigten, oder die Glut zwischen den Seiten beheimaten konnte, hielt ich es nicht mehr in meiner Wohnung aus und stieg zu späten Uhrzeiten in das Auto. Fuhr ohne ein Ziel über Landstraßen in die Dunkelheit der Nacht. Es war mir egal wohin, ich fuhr Schleifen über die Dörfer, bis ich einen Knoten zog und wieder zuhause ankam. In derlei Stimmung verfallen mied ich die Stadt. Dort zogen mich die Lichter zu sehr an. Damals hatte ich schon genug Nächte an Bars oder in Diskotheken hinter mich gebracht, um zu wissen, wie es am nächsten Morgen mit mir aussah und vor allem, wozu ich im Stande war. Am Land gab es nur ab und an einen Baum, einen schönen großen alten Stamm, von dem ich mir ausmalte, wie es wäre in ihn zu krachen. Diese Ausfahrten liegen eine Zeit zurück und M. jede Nacht neben mir.
Zwillinge kennen keine Grenzen, der Tod ist nur ein weiterer Verbindungsstrang. Und alles hängt an deinem Verlust, und die Angst, immer weniger damit zu tun zu haben, gefühlt nicht mehr an dich gekettet zu sein. Versuche ich gerade dir ein Denkmal zu erschreiben? Ein normales Leben wäre schön, aber das existiert nur mit dir, und jetzt, Jahre nach deinem Ableben, ohne dich, fühlt sich nach wie vor wenig normal an. Wir waren 15. Der Aufbruch des Lebens startete und plötzlich stirbst du einfach. In diesem Augenblick ließ ich von der Jugend ab und rutschte wie ein fetter Erwachsener, die Badehose in die Arschritze geklemmt, an der Kindheit vorbei.
Ich habe wieder neue Kollegen. Ein paar von ihnen habe ich von dir erzählt. Du liegst mir eben auf der Zunge und dein Name auf meinem linken Unterarm ist auch noch da. Meistens geht es um die Zeit ohne dich und nicht um das, was du erlebt hast. Meist schauen mich die Menschen, denen ich von meinem toten Zwillingsbruder erzähle, betroffen an, werden still oder sagen sowas wie: jeder hat sein Packerl zu tragen. Ja das stimmt, jeder hat seine Geschichte, sag ich dann. Ich werde schweigsamer, was dich betrifft. Gebe weniger von dir preis, dadurch weniger von mir. In der alten Firma war ich irgendwann sehr offen zu einigen Menschen. Hatte aber bald das Gefühl, dass sie nichts verstanden von dem, was ich sagte. Ich setze mich lieber hin und schreibe ein verdammtes Buch, auf das jeder Zugriff hat. Über alles zu schreiben ist mir während des Schreibens nicht peinlich. Aber danach, wenn ich es lese, frage ich mich, ob ich dir gerecht geworden bin. Meine Gedanken sind schwer, bis jemand wie H., mein Sitznachbar in der Literatur-Akademie sagt: „Wie geil ist es jung zu sein.“ Er gehört zu den ältesten in der Runde, ist introvertiert und überraschte mich mit einem Instagram-Video, in dem Jugendliche wie aufgedreht zu Techno-Musik tanzen. H. wiederholt den Satz und ich sage, ja, du hast recht. Ich denke an all die jungen Menschen, die so missverstanden werden von Leuten wie mir, die vergessen haben, wie es ist, einfach nur jung zu sein, geil zu sein auf Spaß und das Leben.
Fortgehen ist für mich ein Graus geworden. Nach der ersten Weihnachtsfeier mit meinen neuen Kollegen war wieder so ein Abend. Anscheinend bin ich einer von den Typen, die man nach dem Essen fix mit einrechnet. Ab dem zweiten Bier geht’s, obwohl ich kaum noch Bier trinke, weil es mich aufbläht und mir am nächsten Tag davon übel wird. Die Zeiten, in denen ich stolz mit den besten Trinkern mitgehalten habe, sind vorüber. Ich muss mich zwingen nicht um 20 Uhr einen lautlosen Abgang anzutreten und rutsche mit den Leuten mit. Zugegeben, es war ganz lustig, bis dann wieder dieses Lied einsetzt. Mit dieser Melodie endet etwas von dem, was ich gerade bin. Sofort bin ich in der Jugend. In der Zeit, die ich großteils ohne dich verbracht habe. Mit 15 wuchs in uns eine Hoffnung, die uns verhieß, dass es nun endlich losgehen wird, dass sich endlich etwas anbahnt. Und dann bist du weg, einfach so. Verdammt nochmal, wo befindet sich meine Seele, während mein Körper übertrieben und tollpatschig auf der Tanzfläche dazu tanzt. Bei deinem Begräbnis hat G. den CD-Player bedient, die Techno-Musik abgespielt, und genau dieses Lied war eines davon. Bei Gigi D’Agostino hat er so viel geweint, und alle meinten später, dass er das großartig gemacht hat. Ich habe keine Träne vergossen bis wir, die Familie, dein Begräbnis als erster verlassen haben. Dieses Lied wird heute noch todsicher immer gespielt, wenn ich in einer Disko wie dieser lande.
Unsere Erwartungshaltung an die bescheuerten Tage waren niedrig, aber mit dem Einbruch der Nacht und den Techno-Sounds, die wir in unserem Zimmer abspielten, wummerte die Fassade der Ödnis von uns ab. Obwohl du wegen deiner Erkrankung keinen Alkohol trinken sollst, hast du das Fortgehen geliebt. Unsere Eltern meinten, ich muss auf dich aufpassen, das hat unsere Mutter auch zu G. gesagt, weil ihr beiden bald nur noch zu zweit unterwegs wart. Ich bin mir sicher, dass er das gut gemacht hat, weil er dasselbe wollte wie du, jung sein. Tanzen und trinken ohne Rücksicht auf Verluste. Unsere ersten Erfahrungen haben wir im Wohnzimmer gemacht. Gerade einmal 14 Jahre waren wir, als wir gemeinsam mit Leuten von unserer Klasse herausfinden wollten, ob das auch stimmt, was man sich erzählt. Der Kellner hat wirklich nicht nach unseren Ausweisen gefragt und uns unsere ersten Getränke in einem Lokal serviert. Wir tranken Flügerl, die einfach nur süß waren und dachten, das ist es also. Immer öfter schafften wir es an Alkopops wie Eristoff Ice zu kommen. Bald auch zu den stärkeren Eristoff Black oder Red. Wir haben uns gestylt um gemeinsam im Hof oder im Park mit unseren Schulkollegen zu trinken. Gel in die Haare geschmiert, die Spitzen aufgestellt. Du hast sogar deine Vordersträhnen blondiert und G. hat einen draufgesetzt, indem er sich einen Kranz machte und spitz aufstellte. Wenn er sie nicht hochgelte, sah er wie ein Streifenhörnchen aus. Bald erfuhren wir vom Eastside in der Stadt. Du hast zu mir gesagt, sag einfach, dass du 1985 geboren bist, dann geht das schon. Ich hatte irrsinnige Angst, dass ich der einzige bin, der nicht reinkommt, weil ich so jung aussah und keine Strähnen hatte. Aber alles war, wie du prophezeit hast. Eigentlich waren wir ziemliche Proleten, eben Jugendliche unserer Gegend, wir trugen, was angesagt war. Smog- und Fishbone-Kleidung, eine Eastpak-Gürteltasche. Ziemlich heftig aus heutiger Sicht, aber wir hatten Spaß. Man wird dem, was man gut findet, ähnlich, es ist eine aufregende Zeit, man strebt nach vorne, aber nicht zu sehr, weil man im Augenblick leben möchte. Ich habe mich unwohl gefühlt, und du hast dein Element gefunden. Ein paar Mal hattest du noch die Gelegenheit, Party zu machen, meist mit G., weniger mit mir. Ich war dir irgendwie hinterher, obwohl ich vier Minuten älter bin als du. Im Bett, in unserem Zimmer, hast du mir erzählt, wie es ist ein Mädchen zu küssen, es zwischen den Beinen zu berühren und ich konnte nicht fassen, dass du das alles weißt. Ich war so weit weg davon und du schon so mittendrin.
Jetzt kann ich von meinem ersten Zungenkuss erzählen. Er war mit Alice. Sie zog mich aus einer Dorfdiskothek raus. Ich glaube, G. und J. waren dabei und sie hatte noch eine Freundin bei sich. Alice war die Schüchterne und die andere, ich habe ihren Namen vergessen, die Wilde, auf die es J. abgesehen hatte und nichts daraus wurde. Alice hatte ein Piercing zwischen Unterlippe und Kinn, obwohl sie erst 16 war, genauso alt wie ich. Ich weiß noch, wie süß ich sie fand. Sie hatte blonde Haare und lebte in Neuseeland. Sie verbrachte ihre Ferien in Österreich bei ihrer Oma, die sie an diesem Abend auch bald abholen würde, was wohl auch der Grund war, warum sie reagierte und mich aus der Disko zog. Sie reagierte, weil sie spürte, dass ich die Chance nicht erkannte, absolut nicht mit der Gunst des Augenblicks umgehen konnte. Wiedermal spielten sie diesen Gigi D’Agostino und da bin ich einfach nur traurig und böse auf die Welt. Im Freien, in einem dunklen Winkel, waren meine Hände in ihrer Hose, auf ihren Pobacken gelandet und dort vereist. Ihre Haut zu spüren, ihre Zunge in meinem Mund und meine in ihrem, zu fühlen, wie sehr sie es wollte, hat Gigi gekillt. Wir verabredeten uns ein paar Mal zum Kinogehen. Wir waren immer schüchtern, und immer war ich nervös, ob sie auch so schön aussehe, wie ich sie in Erinnerung habe, und ich fragte mich immer, ob wir uns wieder küssen und ob ich sie wieder halten darf. Wenn uns keine Zeit mehr blieb, ihre Oma sie bald abholte, dann fanden wir einen Platz, an dem wir uns küssen und streicheln konnten. Einmal hatte sie eine Freundin mit und ich G. Sie hat überhaupt nicht zu ihm gepasst, wenigstens konnte ich ihm Alice noch einmal zeigen – dass es jemanden gibt, den ich küssen kann. Bald musste sie nach Hause fliegen. Ich habe mich nicht mal ordentlich von ihr verabschiedet. Wir haben uns E-Mails geschrieben, sie hat mir Fotos gesendet. Einmal hat mich sogar ihre große Schwester angerufen, mit der ich mich auf Englisch unterhalten musste. Ich malte mir aus, wie es mit Alice sein kann, dort in Neuseeland, das ist ein gutes Land, das sagen alle. Ein paar Mails später erschien immer öfter ein Junge neben ihr. Er war sportlicher und reifer als ich. Bald ein schwarzweißes Bild mit einem Böhnchen, schlafend in einer Wolke. Ich sagte, ich freue mich für sie, und unser Kontakt endete damit. Wohin hätte es mich im Leben getragen, wäre ich nicht so kaputt gewesen und du da um mir Ratschläge zu geben.
Es gab keine Mädchen mehr, die mich rauszogen, mich auswählten. Die Leichtigkeit wich wie die Aufbruchstimmung. Mein erstes Mal war eine Peinlichkeit, nicht weil ich versagte, sondern weil es sich wie Selbstmissbrauch anfühlte und ich ein paar Scheine auf ein Nachtkästchen legte. Ich sehe sie vor mir, und möchte kein weiteres Wort darüber verlieren. Ich habe an dieser Tür geläutet. Und alles war anders, als ich mir es vorstellte. Ich war 17, und zu jung dafür, hatte aber das Geld parat. Ich wusste nicht, was geschieht, ich zog mit und war schlussendlich froh erfahren zu haben, wie das läuft. Ich hatte keinerlei Anziehung verspürt, es war völlig automatisiert und ich konnte jahrelang nicht den Weg zu einem gesunden körperlichen Austausch finden. Meine Einsamkeit war ab einem gewissen Zeitpunkt von mir gewählt. Ich wollte nichts Schönes erleben, nichts was du nicht auch konntest. Niemand kann verstehen, was Gigi D’Agostino mit mir anrichtet. Wenn man das Lied hört, alle tanzen, alle sind jung, und ich denke an dein Begräbnis und G. Vater hat uns eine schwarze CD gebrannt. Am Cover ist dein Gesicht in blauen Farben. Ich weiß nicht, was er dabei empfand, aber ich habe von Joan Didion Blaue Stunden gelesen, und erkenne die Symbole der Traurigkeit darin. Vielleicht hat er auf ein Gefühl gehört, das du ihm gegeben hast. Ließ sich davon leiten und damit etwas von Bedeutung entstehen. Ich spüre dich auch, und ich glaube, dass es ok ist von dir zu schreiben und auf diese Weise über unser Leben zu berichten. Es ist gut zu wissen, was einen kaputtmacht, welcher Schicksalsschlag einem das Leben erschwert, denke ich.
An einem Tiefpunkt angekommen, habe ich mir fest vorgenommen kein Tastenwichser zu bleiben. Nicht so eine Person, die nur ein fiktives Sexualleben hat, keine echte leidenschaftliche Beziehung kennt. Als ich so einsam war, mich nicht berühren lassen konnte, chattete ich viel und fand unter anderem eine Frau in meinem Alter, die ähnlich veranlagt war wie ich. Wir unterhielten uns nicht über unsere Seelenzustände, wir hatten Cybersex und Telefonsex. Sie hat damit angefangen und wir hatten an freien Tagen mehrmals am Tag etwas gemacht. Wir schickten uns auch obszöne Bilder und Videos. Sie meinte, sie stehe auf Körperflüssigkeiten und vor allem auf Sperma in ihrem Mund, sie wäre ein Succubus, ein weiblicher lüsterner Dämon, der sich einen Mann sucht um alles aus ihm rauszusaugen, ich werde schon sehen. Auf ihren Fotos war ihre Neigung zum Dunklen gut erkennbar, sie gefiel mir sehr gut. Ihre Worte waren bald meine Gedanken. Sie schockierte mich damit, und ich dachte nur, hurra, jetzt gehöre ich endgültig zu den Perversen. Irgendwann werde ich sie besuchen, habe ich gesagt, sie richtig rannehmen. Wir hatten schon einen Tag ausgemacht, sie meinte nur, endlich, sie rasiere sich gleich überall und hat auch schon ihrem homosexuellen Bruder von mir erzählt, der sich für sie freut endlich einen gescheiten Typen kennengelernt zu haben. Ich fühlte mich geschmeichelt, hatte aber bis zur Abfahrt eindeutig zu viel gewichst, so dass ich absolut keine Lust mehr dazu hatte und die Verbindung abbrach. Außerdem wären es mindestens zwei Stunden Fahrt gewesen. Ich wollte kein Tastenwichser sein, aber am schlimmsten war für mich die Realität der Berührung, der ich mich auf keinen Fall aussetzen wollte. Ich habe ihre Nummer blockiert und gelöscht, damit ich nicht auf blöde Gedanke komme. Ich denke heute an sie und finde es schade, dass wir uns nie im echten Leben begegnet sind.
Gestern habe ich am Abend M. einiges erzählt, was sie nicht von mir wusste, weil ich es ihr nicht zumuten wollte, weil ich es mir nicht zumuten wollte. Sie meinte, wir sollten über unser Sexualleben sprechen, da es zurzeit sehr stockt. Schweigsam hörte sie zu, wie ich ihr erzählte, dass ich oft dafür bezahlt habe mit einer Frau zu schlafen, und wenn nicht, ich es nur im Rausch konnte und dann sehr exzessiv. Dass mir alles, was mit Berührung zu tun hat sehr schwer fällt, ich keinen normalen Werdegang, wenn man es so nennen will, durchlaufen bin. Manchmal hatte ich monatelang keine Berührung, frönte einzig der Selbstbefriedigung, bis der Penis zu sehr schmerzte und ich die Abgründe des Internets satt hatte. Jetzt zögere ich weiter zu denken, den alten Tagen und was darin liegt zu folgen. So schlimm es erscheinen mag – oder vielleicht ist es für manche gar nicht so schlimm – ich muss dorthin, sonst verschwindet etwas von mir, was auch dich beheimatet, denn es wäre nie geschehen. Vielleicht verforme ich sogar mein Leben, würde ich alles dem Vergessen hingeben. Auf eine Weise, die dich ungeboren macht. Wenn ich es nicht tue, nicht darüber schreibe, dann bin ich nichts mehr und selbst nicht auf die Welt gekommen. An manchen Tagen ist das eine verlockende Vorstellung, aber was wäre die Konsequenz einer solchen Auslöschung? Dein Tod und deine Erlebnisse wären sinnlos, wie auch meine Scham und ihre urheberische Kraft der Schande. Ich muss weiter vordringen in die Erinnerungen, sonst gäbe es Alice und M. nicht. Das ist meine Identitätsfrage. Wer bin ich? Ein Zwilling? Noch immer? Darf ich leben? Oder bin ich sogar verpflichtet dazu, es so intensiv wie möglich zu gestalten? Aber, ich fühle mich doch am wohlsten, wenn nichts oder wenig geschieht. Dabei kann ich mich auch am besten hinwenden und schreiben. Habe ich ein Loch gestopft, reißt auch schon das nächste auf. Das ist wie mit den Unterhosen und Socken, die werden alle kaputt, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die haben früher länger gehalten.
M. und ich finden es beide schön auf der Couch einzuschlafen, während die Sonne durch die halbaufgedrehten Jalousien in die Wohnung strahlt. Meist brauchen wir einen zweiten Versuch um richtig zu liegen. Ihr schmerzt entweder eine Schulter oder das Genick, und ich bin ungelenk und mag es nicht, wenn mir was auf der Hüfte liegt, besonders auf dem rechten Hüftknochen. Wir fühlen uns manchmal alt, obwohl wir erst über 30 sind. Ein Singer-Songwriter-Lied baut eine gefühlvolle Stimmung auf, in der wir halb einschlafen, halb wachen, uns mit den Klängen in einen Frieden fallen lassen können. Meine Hand ist auf ihrem Gesäß oder auf ihrem Bauch, oder unter ihrem Leibchen auf einer Brust. Ich kann sie von der Seite ansehen, wenn ich die Augen aufmache, sehen, wie schön sie ist, oder an ihrem Hals riechen, wie ich es am liebsten tue. Oder einfach in ihre dichten schwarzen Haare sehen, die einem die Luft rauben können, wenn sie über einen baumeln. Ich habe eine halbe Erektion, spüre die Begierde, die mich durchdringt. Denke an unsere Zeit, in der wir jeden Tag nackt aneinander geschmiegt waren, es wie wild trieben, andauernd die schweißgetränkte Bettdecke wechseln mussten. Denke an die Waschmaschine, die Dusche, die Küchenzeile, den Esstisch, den Boden, ihren Ellbogen, ihre Achseln, ihr Geschlecht vor meinem Gesicht und ihren Gesichtsausdruck, wenn ich in ihr war. In diesen Augenblicken habe ich kein Verlangen nach Sex, noch bin ich bedürftig, ich fühle mich ihr ganz hingegeben und ich fühle sie mir hingegeben, aus freien Stücken, auf liebevolle und zärtliche Weise.
Das wollte ich dir erzählen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at