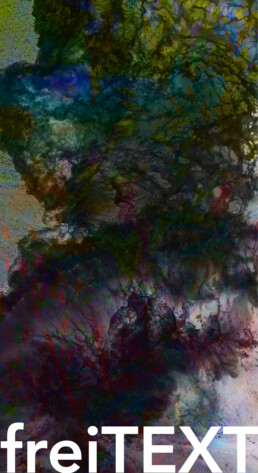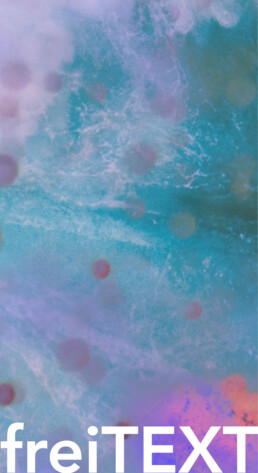freiVERS | Karl Johann Müller
an deiner Seite
unsere Zärtlichkeit
gefaltet
mit Sorge hingelegt
ganz nach deinem Erinnern
auf einen Stuhl an deiner Seite
deine Aufgeräumtheit
in meinem Geschenkpapier
wie ein Malbuch aus Kindertagen
ohne Farben
daneben ausgelaufene Stifte
an der Hosennaht
die Taschen mit versprochenen Bonbons
sie hängen wie Knospen an Zweigen
alter Bäume
die Kerben waren einmal frisch
wir waren geschmeidig
mit dünner Haut
die wir behutsam aneinander legten
wie ein Kuss
jetzt rinnt Harz durch dein Haar
ich schaue dir beim Liegen zu
und
bleibe
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Carla Giuseppina Magnanimo
Sisso Love
Ich zerwühle Laken, bis sie nicht mehr erkennbar sind, bis sie sich am Ende meines Bettes zu einem Klumpen zusammengefunden haben, wie alte Kumpel vor einer Bar, schweißgetränkter und bald nicht mehr weißer Stoff, der die gelbe Erinnerung an meine schlaflosen Nächte sein wird, bis ich mich erbarme und sie in die Waschmaschine stopfe, sodass der Kreislauf von vorne losgehen kann.
Ich schlage meine Augen auf, schnell und erbarmungslos, denn Erbarmen darf ich grad nicht haben, nicht in diesem Moment, das weiß ich genau, es ist eine kleine aber feine Art der Bestrafung. Würde mir jemand gegenüber sitzen, würde sie erschrecken, Augen so schnell aufgeschlagen, dass man sich fragen würde, ob sie eventuell schon die ganze Zeit geöffnet waren? Grade eben habe ich noch geschlummert, geschlafen wäre übertrieben, ich war auf dem Weg dorthin, ich war auf dem Weg in die Entspannung, die Ruhe, die endlose Geborgenheit des Schlafes, aber so gnädig war ich heute nicht mit mir. Mein Kopf hat sich seinen eigenen Weg gebahnt, meine Gedanken haben ihre eigene Richtung eingeschlagen, weit weg von schlafen und Augen geschlossen halten.
Ich sehe dein Gesicht ganz nah vor mir, als ich die Augen aufschlage, so ein kleines rundes Gesicht, ein brauner Pony über deiner Stirn, deine Haare schon immer so anders als meine, glatt und dunkelbraun, meine Straßenköter wie man so schön sagt und unordentlich. Ah, wie du mich anschaust, kleine Schwesti, große ungetrübte Augen, voller Vertrauen, endlos, du sagst etwas, aber heute kann ich nicht mehr hören, was es ist, dein Mund öffnet sich stumm, du lachst, deine Zähne, kleine Milchzähne blitzen hervor, ich höre dein Lachen nicht, aber ich kann es mir vorstellen, es klingt wie Kinderlachen nun mal überall klingt.
Ich kann mich selbst nicht sehen, aber mein Körper weiß bereits, was passieren wird. Sie, mein Körper ist eine SIE, durchdrungen vom S vom I vom E, wird steif, mein echter eigener Körper, in meinem Bett mit dem Lakenklumpen, wo ich dein Gesicht sehe, Sisso, nicht mein Erinnerungskörper, der vor dir steht, als du noch Milchzähne hattest.
Ich kann mich selbst nicht hören, in meinem Erinnerungskörper, die stimmlos ist. Aber ich weiß, was ich gsagt habe, es sind die Worte, die dafür gesorgt haben, dass ich meine Augen erbarmungslos aufschlage, es sind die Worte, die mich ebenfalls ohne Erbarmen daran erinnern, wie sich dein Blick weitet, ungläubig. Du hast doch so fest daran geglaubt, an unser schwesterliches Bonding, an unser geteiltes Blut, unsere geteilten Erinnerungen, so fest daran geglaubt, dass ich dich ebenso bedingungslos liebe wie du mich. Ich spreche stimmlos zu dir, ich versuche die Tür zwischen uns zuzudrücken, die Bodenlosigkeit deiner Enttäuschung zwischen uns, wie ein Holzkeil, der die Tür daran hindert, sich vollständig zu schließen.
Ich schlage meine Augen auf, liege dort, dein Schwesterngesicht über mir, deine Augen jetzt leer, kein Lachen mehr im Gesicht, keine weißen Milchzähne mehr. Meine Gliedmaßen kribbeln, mein Körper hat das große Bedürfnis sich zu bewegen, alles daran abzuschütteln, deine Blick auf mir wie eklige Tiere, Ameisen, Spinnen, Käfer, die auf mir hoch- und runterkrabbeln, oh man, fuck, ich muss mich dringend bewegen, ich drehe mich, greife nach gelben Laken, die ich mir überziehen kann, will mein Gesicht bedecken, damit ich nicht mehr sehen muss, wie du von deiner eigenen Schwester verraten wirst, wie deine Liebe ins Nichts fällt, wie sie versucht sich durch den Schlitz in der Tür zu drängen und ich nur noch härter dagegen halte. Du bist ein kleines Kind und ich sehe dich an als Erwachsene und dein Blick reißt Löcher in mich.
Ich muss mich räuspern, husten, aufstöhnen, muss Geräusche erzeugen, um meinen Erinnerungskörper zu entlasten, um meinen Kopf hinters Licht zu führen, das Wichtigste ist vergessen, solange wie es geht, bis sich meine Erinnerung wieder gegen mich wenden. Ich brauche Geräusche, um dich abzuschütteln, deinem Blick zu entkommen, tut mir leid, Schwesterherz. Alles läuft nun rückwärts, alles verwischt, deine Haare braune Schlieren in einem bunten Gewirr, unmöglich zu entschlüssen, deine Milchzähne endgültig weg. Dein Blick wandelt sich, von enttäuscht zu liebevoll, dein Gesicht läuft rückwärts, du wendest dich mir zu, Türen öffnen sich, Liebe kann fließen, was für ein Glück, können wir so stehenbleiben, die offene Tür zwischen uns, kann es bitte aufhören, hier am Anfang?
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Verena Lippus
Oben ist die Luft frei
Anna geht den Berg hinauf, mitten in der Sonne. Sie schnauft. Sie schaut nicht zurück, sie geht weiter. Sie schnauft den Berg hinauf und verletzt dabei den Schwur, an der Bergwacht Halt zu machen. Sie klopft nicht dreimal auf Holz. Sie hat nur den Rucksack dabei und die Dinge darin. Das Handy hat sie endgültig nicht mitgenommen und die Trinkflasche im Bus vergessen. Anna steigt und schwer ist der Sack auf den Schultern. Sie sackt zwischen den Schultern in das Kreuz hinein und kriecht schwitzend weiter, ohne Wasser, ohne LTE-Netz zwischen den letzten krummen Bäumen ohne Nadelkleid. Es ist nicht kalt. Es ist nicht weit. Auf der letzten Reise hat ihr Peter den Stock geschenkt, nur einen, den sie stets in der linken Hand hält und ungeübt wie sie es ist, im falschen Rhythmus zu ihrem Gang unregelmäßig in den Boden sticht. Es ist keine Hilfe. Sie stützt sich hin und wieder auf den Stock, wenn sie Halt macht und den Rucksack absetzt, sich benässt mit den wenigen Tropfen des fast ausgetrockneten Baches. Anna ist fertig. Sie ist jetzt fertig und könnte gehen.
An der nächsten Weggabelung stehen wieder die Wanderschilder. Es zeigen vier Schilder in drei Richtungen. Es stehen Rauten darauf in verschiedenen Farben und mit Zahlen und mit Orten. Anna folgt blau. Blau geht nach oben, geht steil, geht auf festem Waldboden, geht auf Gestein, geht bald in der brütenden Hitze ohne Schatten den Berg hinauf. Blau ist Terrain, ist Sonne am Himmel, ist Anna, die geht, ist Anna, die ist frei.
Vorsichtig dreht sie einen Stein um, seine Unterseite ist noch frisch, ist kalt. Sie führt ihn zur Stirn.
Sie sitzt am Boden, mit dem Stein.
Sie ist gefallen, etwas unter dem Knie blutet.
Die Sonne scheint.
Anna nimmt ihn noch einmal in die Hand, den Stein, den halbkühlen Stein, sie dreht ihn sanft, drückt ihn, reibt, wünscht sich einen Geduldsstein, hadert mit dem Blau und dem Weg, spürt den Schweiß in der offenen Wunde brennen, das Gehen, das Liegen, das Fallen, in der offenen Wunde stehen.
Es ist nicht still. Nur, weil keine Autos fahren, weil keine Menschen ihre Kinderwägen durch den Park schieben, weil niemand telefoniert, ist es nicht still.
Es ist eigentlich ziemlich laut. Anna versteht es jetzt: Es ist laut in den Bergen, es ächzt, kreischt, geiert, mäht, es rauscht und reißt, es schreit, hämmert, seufzt, es trampelt, stochert, quietscht, es muht, meckert, zischt. Es ist laut. Und dazu die lauten Gedanken in Annas Kopf und das Badumbadum in ihrer Brust. Es schwielt, es schwärzt sich der Weg.
Vor Schmerz drückt sie die Augen zu, doch sie läuft, das Blau läuft ihr am Bein hinab. Sie geht weiter, nicht zurück. Das gehört dazu. Sie hat den Rucksack irgendwo abgestellt und ihn dort stehen lassen. Sie hat nur noch das Bein dabei, das Bein nimmt den Raum ein, der Schmerz, die Angst, nicht mehr zu sehen, wohin die richtige Raute führt.
Die Sonne scheint. Nur ein leichter Wind deutet an, dass ein Tag zu Ende gehen kann.
Anna schweigt. Alles andere verschwimmt zu einem einzigen Ton in ihrer Bauchspeicheldrüse. Sie kotzt es aus, würgt in das Gras, in der krummen Tanne wundert sich ein Käferlein.
Das LTE-Netz umschlingt ihren Nacken, nestelt an den feuchten Strähnen, die an ihrem Rücken festkleben, es leckt sie genüsslich von allen Seiten.
Aber sie hat kein Endgerät.
Hämisch blinzelt das Netz in der Sonne, hinterlässt Kacheln im Raum, die Anna tapfer durchsteigt. Wo ist der Empfang.
Eventuell steigt ein Berg über den Rand der Sonne und kippt synchron mit der Nacht aus den Stiefeln.
Vielleicht flüchtet ein Zicklein und stolpert über die umgedrehten Wurzeln.
Anna liegt im Gras. Sie hat die Welt als Rucksack, denn sie liegt oben.
Alles ist weich.
Sie hat den Schmerz vergessen.
So finden wir sie vor: weich.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Kiening
Fragmente
Weißt du, heute, da habe ich am Straßenrand eine Pflanze entdeckt, ich weiß nicht, wie sie heißt. Das ist eine Hasenohren-Pflanze, erzählte mir als Kind jemand, weil die Struktur so weich ist, und das ist wohl die einzige Info, die ich mir dazu je merken werde, egal wie oft ich versuche, auch den botanischen Namen im Gedächtnis zu behalten. Dort wo die Hasenohren wuchsen, in dem Park, da gab es viele Weiden. Die Äste konnte man schön biegen, wenn sie jung und nass waren, und sie brachen natürlich, wenn man das gleiche mit vertrockneten Exemplaren probierte. Viele Menschen in meinem Leben verstehen das nicht. Dass Härte nicht widerstandsfähig ist. Dass man irgendwann an ihr zerbricht. Ich weiß noch, als ich im Zug saß, um dich zu besuchen, und das Abteil alt und grau und laut war. Ich weiß noch, dass ich mit dir um den See spazierte, dass ich übernachtete, dass du mir die Weidenkörbe zeigtest, die du in den Nachmittagsgruppen basteltest, einer war beige und oval, der andere kreisrund mit roten Striemen. Frühstück nahmen alle gemeinsam zu sich und jeder hatte einen Zettel vor sich liegen mit Platz für Notizen. Bei uns saß keine Aufsicht, am Tisch daneben war das anders. Das mit den Zetteln blieb eine Weile so, ich weiß nicht, ob du nach wie vor tagtäglich Smileys schreibst oder streichst. Aber als du mich von der Wohnung aus anriefst, da waren sie aktuell, es gab zu der Zeit nicht viele. Ich ging den gewohnten Weg und mit dem Extraschlüssel in der Hand zu dir, öffnete die Tür. Und weißt du, das was ich dir hier erzähle, ich weiß, dass alles davon wirklich war. Aber wenn ich Fragmente zusammenfüge und auseinanderreiße und überlagere, dann entstehen Bewegtbilder in einer spezifischen Reihenfolge, von der du nichts wissen kannst, deshalb erzähle ich. Deshalb erzähle ich dir, dass es ein kleines Zimmer ist, in das ich trete, dass der Teppich einen intensiven Eigengeruch hat, der nicht verfliegt. Ich sage dir, dass alles gut wird und streiche über deinen Rücken, sage dir, dass es mir gut geht, das stimmt nicht, aber du bemerkst es nicht. Ich decke dich zu und sage dir, dass ich die Vorhänge und Fenster aufmachen, dass ich die Küche und das Bad putzen werde, dass ich bleibe, bis du dich geduscht und angezogen hast.
Manchmal denke ich, dass wir an unterschiedlichen Punkten unserer Zeitbahn sind, du und ich, und dass das gut ist, dass du manchmal vorne bist und mich nachziehst, und dass ich manchmal weiter bin und dir abgesteckte Routen anbiete. Das denke ich nicht, sagst du dann und erklärst mir Statik und Steigungswinkel von multiversischen Wegen und dass zusammensteigen eine gute Idee ist. Dann holst du deine Geige aus dem Koffer und den Bogen, der neu bespannt ist und spielst mir ein Stück, das sich nur hier und sonst nirgends spielen lässt. Jedes Mal nennst du mir den Titel, und jedes Mal vergesse ich ihn mit dem letzten Ton und kann ihn also nicht recherchieren oder selbst erlernen, sondern warte dann wieder, bis wir uns begegnen, damit ich die Melodie, die ich so gerne höre, zwischen uns habe. Spielst du es noch einmal für mich, frage ich. Natürlich, sagst du, und wiegst mich in einen Welt voller Schiefertafeln und eingerahmter Ausblicke, voller zweirädriger Kutschen und vielschichtiger Klippen. An dieser einen Klippe, da war niemand sonst, und wir hatten alles für uns allein, weißt du noch? Wir lagen drei Meter vor dem Klippenrand auf dem Boden und robbten langsam vor, bis wir hinunterblicken konnten zu den Felsen, so, dass wir sicher sein konnten, dass wir nicht ausrutschend fallen. Und dann robbten wir zurück und freuten uns mit ein paar Möwen über unsere waghalsigen Robbenkünste. Wir liefen Trampelpfaden nach und spazierten über Felder mit Schaukeln an Bäumen, und manchmal setzten wir uns darauf und ließen uns windschaukeln. Und manchmal gingen wir zwei Stunden, um Karottenkuchen zu essen. Dann bestellten wir zwei Stück und bekamen ein drittes geschenkt, setzten uns auf die Mauer und beobachteten, wer gleichzeitig mit uns Karottenkuchenstücke aß. An Wäscheleinen hängten wir bunt-geringelte und bunt-gepunktete Socken auf und vorbeigehenden Menschen erklärten wir Himmelsrichtungen, weißt du noch? Und dann hattest du einmal Halsschmerzen und ich brachte dir eine rohe Zwiebel zum Essen, aber krank wurdest du trotzdem und ich auch. Spielst du es noch einmal für mich, frage ich wieder.
Von einer Situation weiß ich sicher, dass nicht nur ich mich daran erinnere, dass auch du dich daran erinnerst. Wir saßen auf einer Steinbank. In einiger Entfernung vor uns war ein künstlich angelegter Weiher, in der Mitte ein Springbrunnen, auf der gegenüberliegenden Seite Eltern mit spielenden Kindern, die wir gelegentlich beobachteten. Ich weiß noch, dass wir beide ein graues Oberteil trugen, ich weiß noch, dass deine Hose blau und meine schwarz war. Dass deine Haare an dem Tag einen frischen Schnitt hatten. Ich weiß noch, wie dein Pappbecher herunterfiel auf den Kiesboden, wie wir uns beide danach bückten und sich unsere Finger für einen Sekundenbruchteil berührten. Für einen Sekundenbruchteil hielten wir die Luft an und es existierte kurz nichts um uns herum, kein Geräusch, keine Windbrise, nichts. Das ist das Bild in meinem Kopf. Und wenn ich dort hingehe, in dieses Bild eintauche, dann setze ich mich auf die gegenüberliegende Seite, dort wo die spielenden Kindern sind und beobachte dich und mich. Sehe deine weißen Sneaker und meinen Hut, sehe Verwunderung, aber keine Überraschung in unseren Augen. Ich sehe, was wir nicht bemerken, wie eine Person ihren Hund von der Leine lässt, wie eine andere stehenbleibt, um zu telefonieren, Zigarettenstummel neben dem Mülleimer, ein Ball, der in unsere Richtung kullert, Enten, die sich an einer Stelle tummeln, weil jemand Brotstücke verteilt, Lichterketten zwischen Bäumen. Wenn ich dann nach einiger Zeit aufstehe und nachhause gehe, in meine Wohnung, dann lass ich dich und mich dort sitzen, in diesem Moment. Und wenn ich dann die Treppe hinaufsteige, die Tür hinter mir schließe, den Schlüssel umdrehe und den Wasserkessel auf den Herd stelle, dann atme ich tief ein und aus, um sicher zu sein aus dem Bild wieder herausgefunden zu haben, dann setze ich mich mit einer Tasse Tee vor eine Pflanze und begutachte jedes Blatt, das gerade am Sich-freiwachsen ist.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Carina Plinke
Was ist das für ein Universum
Der Wind rappelt an der Toilettentür, während ich pinkle. Die ersten Tropfen Wodka sind in mein Gehirn gesickert und wabern durch meine Gedanken, verwandeln die Vorstellung davon, wie es ist, dir zum ersten Mal einen zu blasen in eine Erinnerung an einen klebrigen Center Shock. Sehr sauer, eine Kindheitssünde, von der jeder weiß, dass sie scheiße ungesund sein muss und trotzdem irgendetwas Geiles daran ist, wenn die Flüssigkeit so aus dem Inneren in den Mund sickert.
Ich schüttele mich, genauso wie ich versucht habe, die Vorstellung von dir abzuschütteln. Doch das hat nicht mal funktioniert, als wir uns noch gar nicht kannten und ich nur daran dachte, dass es dich gibt.
Also stürze ich mich rein. Ich wähle besoffen deine Nummer und höre jemanden Hilfe schreien. Während der Hilfeschrei besoffen beim Pinkeln in den Rhein fällt und schneller untergeht, als ich es erwartet hätte, sagst du: „Hallo?“
Ich sage: „Ey, hier ist grad vor meinen Augen einer in den Rhein gefallen.“
Und du so: „Krass!“
Dann 10 Minuten gar nichts, bis wir schweigend auflegen und ich ein bisschen weine.
Nochmal 10 Minuten später schreibst du: „Konnte er gerettet werden?“
Ich frage mich, welches Video dich die letzten 10 Minuten abgelenkt haben könnte und schreibe direkt: „Nein. Er ist weg!“
„Krass!“
Eine Stunde später klingelt es an meiner Tür und ich bin es, die „krass“ sagt, aber Center Schock denkt.
Du zockst, zuckst mit den Schultern: „Hab uns Döner mitgebracht!“
Ich lasse dich rein und weine heimlich auf der Toilette, weil ich denke, dass das ein Herzinfarkt sein muss, was grad in mir abgeht. Mein linker Arm kribbelt und ich meine, das ist doch der, der zum Herzen führt. Dann zittere ich, dann bebe ich und dann küsst du mich.
Bevor du in mich eindringst, erzählst du mir von dieser Maus, die ins Universum fliegen wollte, aber Mäuse dürfen nicht in Universen fliegen, deshalb musste sie das heimlich machen und ich denke, Alter, was für eine scheiß Maus, was hast du geraucht, und muss dabei die ganze Zeit an den Mann denken, der im Rhein verschwunden ist und muss immer und immer weiter ans Verschwinden denken.
„Und? Hat die Maus es geschafft?“
„Keine Ahnung. Aber so n bisschen Universum wäre doch ganz geil, oder?“
„Das Universum ist das größte Geheimnis der Welt! Wusstest du, dass die Atmosphäre nur ein dünner Gasschleier ist, der uns am Leben hält?“
„Hä?“, sagt du.
Ich sage: „Egal!“
Wir liegen im Bett und du hältst mich diese Nacht am Leben. Die letzten zwei Jahre waren einsam. Von zu Hause ausziehen während einer Pandemie ist gewagt. Ich höre deinen Herzschlag und deine Haut ist ganz warm. Letztes Mal hatten wir noch keinen Sex, sondern haben über unsere Familientraumata gesprochen. Traumata sind erblich, haben wir beide mal gelesen. In unserer Kindheit bekamen wir nicht viel körperliche Nähe. Bei mir war das schwer, weil meine Mutter von ihrem Vater vergewaltigt wurde und familiäre körperliche Nähe eine Bedrohung war. Bei dir war das schwer, weil deine Mutter eigentlich keine Kinder wollte, aber 10 bekommen hat. Wir reden darüber, dass wir das anders machen wollen und ich glaube dir. Sonst reden wir nicht viel, dabei ist auf dem Weg vom Mädchen zur Frau viel Platz für den Einfluss junger Männer.
Was soll ich machen? Deine Nähe tut grad so gut nach zwei Jahren ohne Umarmung. Du tust grad so gut nach einem ganzen Leben ohne dich.
Es ist ein habgieriger Morgen. Der graue Himmel frisst meine guten Gefühle. Du hast um vier Uhr gefragt, ob du jetzt gehen sollst. Ich habe gesagt: „Jetzt kannst du auch bleiben!“ und dachte:
nur dafür hab ich dich doch hier behalten, jetzt mach bloß keinen Scheiß, und ergänzte noch: „es ist ja auch kalt geworden.“
Zur Belohnung hast du mich auf die Stirn geküsst und mich wichtig gemacht. Glaub ich. Du liegst noch eine ganz lange Weile neben mir. Das tut gut.
Viel Platz ist in meinem kleinen Apartment nicht, aber ich finde, du passt gut rein. Ich glaube, du findest das nicht, als du zum Gehen aufbrichst und irgendwie weiß ich, dass wir uns nicht wieder sehen werden. Meine Freundinnen sagen zu mir, dass ich ihn schließlich von Tinder kenne und was ich erwartet hätte. Ich kenne Paare, die sich über Tinder gedatet haben und jetzt glücklich sind, verteidige ich mich. Ausnahmen, sagen meine Freundinnen.
Ich wiederhole das Wort und hoffe, es bringt mir Glück: Ausnahme.
Der Regen ist orange. Ich mache das Fenster auf und frage mich, ob Gefühle leichter werden, wenn man älter wird. Oder ob Gefühle einfach verschwinden, wenn man etwas 1000 Mal gemacht hat.
Ich würde dir so gerne etwas hinterher rufen, während du da lässig zum Auto gehst. Deine dunkeln Haare sind im Nacken ganz kurz rasiert, deine Schultern füllen die Jeansjacke gut aus. Ich habe mal gedacht, dass jemand wie du sich niemals für mich interessieren könnte. Der Gedanke, dass ich möglicherweise alles selbst schuld bin, weil ich wieder zu verschlossen war, meldet sich pünktlich zurück. Die Gedankenblasen kommen immer, wenn das Objekt der Begierde weg ist. Mit geschlossenen Augen gehe ich in die Küche, unter meinen nackten Fußsohlen bleiben Essensreste kleben. Ich stelle die leere Flasche Wodka vom Tisch auf die Arbeitsfläche, der Red-Bull-Geruch klebt noch an den Wänden. Mein Handy war gestern Nacht in der Küche liegen geblieben, zwischen der zermürbenden Sehnsucht nach körperlicher Nähe und der abstrakten Erinnerungen an den Sturz eines Betrunkenen in den Rhein.
Dann öffne ich Tinder. Ich probiere zum letzten Mal im Rhein zu schwimmen. Versprochen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leh-Wei Liao
Ein Vogel, der seinen Käfig sucht
Die Bahnhofshalle ist leer. Meine regennassen Sneaker quietschen auf ockerfarbenem Kautschukboden. Vor meinen Füßen fliegen dicke Tauben davon. Es ist Sonntagmittag. Sowohl der Tabakladen als auch die Bäckerei haben geschlossen. Eine Durchsage kündigt die Einfahrt meines Zuges auf Gleis 3 an.
Zum Frühstück aß ich blasse Erdbeeren vom Vortag, bis ich spürte, dass ich eigentlich keinen Appetit hatte. Danach machte ich mich zurecht. Dezentes Make-Up. Dezentes Outfit. Ich will meiner Mutter nicht die Show stehlen. Hundert Bürstenstriche für Geschmeidigkeit und Glanz. Meine Haare waren etwas, das sie schon immer an mir mochte. Seit der Einladung vor einem halben Jahr ließ ich sie für sie wachsen.
Auf dem Weg zum Gleis fällt mir eine Person auf. Weiche Augen, kahlrasierter Schädel, rote Bommelohrringe. Sie lehnt an einer offenen Tür, hinter der großformatige Malereien zu sehen sind; neben ihr liegen schwarz-weiße Flyer auf einer Tischplatte voller Farbspritzer.
Ich gehe langsam auf sie zu. Sie schaut auf, ihr Blick ist weniger einsam, als ich vermutet habe.
Hi, sage ich und betrete den Raum.
Alles riecht nach Kindheit.
Sorry, sagt sie, die Ölbilder sind noch sehr frisch.
Ich atme ruhig ein und aus. Ich will nicht gierig sein.
All meine Kuscheltiere, alle Textilien, alle Möbel.
Du bist die Künstlerin, sage ich.
Jona, sagt sie, keine Pronomen. Jona erzählt von kollektiven Traumata und individuellen Depressionen, von historischen Wunden und biologischer Narbenbildung und davon, dass Abstraktion ein Zufluchtsort für das Unbeschreibbare sein könne.
Ich komme mir klein vor, denn alles, was ich dachte, war, dass die Bilder so freundlich schwiegen. Und vielleicht war es nur diese ruhige Zugewandtheit, die mich davon abhielt, in den Zug zu steigen. Zur Ausstellung meiner Mutter.
Zuhause roch alles nach Terpentin, sage ich zu Jona und dann erzähle ich Jona erst von den Bildern meiner Mutter und dann von ihr. Von der Abwesenheit. Von ihrem Lachen, das nicht falsch klang, sondern einfach nur fremd.
Ob ich die Bilder anfassen dürfe, frage ich schließlich, ganz leicht nur. Jona sieht mich amüsiert an. Ich schaue weg. Jona sagt ja, aber nur die Ränder. Danach versucht Jona mir aus der Hand zu lesen, folgt mit dem Finger Herz- und Lebenslinie auf meiner schwitzigen Handfläche und redet von Kreuzungen, Vögeln und Käfigen und als ich Jonas Ölbilder danach ansehe, glaube ich, all diese Motive in ihnen zu entdecken. Sie werden bedrohlicher, je länger ich mich ihnen aussetze. Blicke, denen ich eigentlich ausweichen wollte.
Ich bleibe, bis Jona die Ausstellung schließt. Danach stehen wir schweigend am Gleis herum. Es ist weder warm noch kalt. Jona raucht. Am Himmel zeichnet sich ein nahtloser Übergang zwischen hell und dunkel ab. Jede Fläche, die ich mit meinen Augen abtaste, erscheint monochrom.
Später, nachdem Jona in den Zug gestiegen ist, laufe ich zum stillgelegten Gleis 1 und sehe mir in die Schienen eingravierte Namen an, von denen Jona mir erzählte. Ich denke an Kunst, die auf verschiedene Arten missverstanden werden kann und Titel, die das verhindern wollen.
Regretting Motherhood, der Ausstellungstitel meiner Mutter.
Es wird dunkel. Die Oberleitungen zeichnen abstrakte Noten gen Himmel. Ordnung und Chaos, dazwischen Krähen.
Auf dem Rückweg versuche ich mich zu verlaufen. Es kommt mir fast wie ein Zufall vor, dass ich tatsächlich zuhause ankomme.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Mattia Avoledo
Frösche : Wülste
rrra – rrrrrrrrö – rrre – rre – meeh – rrere
Gurren, Schreien, Schnarren : ein heller Falz schiebt sich die Wand entlang, die Rechte nur ein Ärmel, die Linke hält einen Glitzerstein : Fugazzi lärmt es in meiner Rumpelkammer. Fleisch auf Gelb, Weiss auf Fleisch : mit Haaren. Das dümmliche gelbe Altherrengesicht sieht zum Fenster herein, schneidet einzweidrei Fratzen und zottelt mit neuem Bart ums freche Maul ab : zur Seite mit dir, alter Voyeur.
Hochschrecken : neben meinem Bett röchelt es. Fasel liegt unverändert da, Atem stossweise reinraus, mit kurzen Aussetzern dazwischen : Atemstocken. Gerüche von Schweiss und Nachtatem dringen in mein Schlafgesicht. Zwischen uns der einfache Tisch mit Stuhl, nirgends scharfe Kanten, auf dem Boden verteilte Kleider, feuchte Frotteehandtücher, meine Brille. Das Maunzen der Frösche jetzt nur noch am Rand der Bewusstseinsscheibe.
Er war mir schon am ersten Tag aufgefallen, wie er seinen breiten Körper an der Haltestange im Gang entlang schob, ohne dabei unelegant zu wirken. Ich sah beim Essen, dass er mich von seinem Tisch aus beäugte; er war einer der wenigen, die immer wieder herzhaft lachten. Nicht verhalten, nervös, leise, wie die meisten.
Die hundertachtzig Kilo heben sich nur schwach ab von der Wand, an der das Magnetbrett für Grusskarten und Besserungswünsche hängt, knochenweiss und leer, wie auf meiner Seite auch : die schwarzen Sterne der Magnete. Dann nochmals wegdösen, die Gelenke in Armen und Händen tun weh.
Sametpfötchen tatschen auf meiner Brust : hinter der dreckigen Scheibe ein Himmel und am Himmel steht ein rosa Schwert : Meine Beine bewegen sich nicht : meine Hände sind aufgeblasen und hohl wie Ballons : innen sind Gänge und Schächte und ich muss graben, graben
ich wache auf, er schläft noch, die dicke Stirn in unregelmässigen Furchen : Wülste : der Schädel frisch rasiert. Ich hieve mich hoch und stelle meinen Leib unter der Dusche ab. Kurzes Erschrecken vor dem Spiegel, du? sei tu? dann schnell heiss kalt hoch runter und ab in die Unterschläuche. Zurück ins Zimmer und Brille ins Gesicht, Handy in die Tasche, Zippen auch und Zeit ans Handgelenk. Rausgeschlichen und ab ans Zmorgebuffet: Kääs, Angge, Gipfeli, Nussbrot, Aprikosegonfi.
Die heilige Maria steht schon an der Kaffeemaschine und putzt. Ich kann sie noch daran hindern, die frische Milch wegzuschütten. Is nümme guat, weiss? Han vergiftet, sagt sie.
An den einzigen leeren Tisch setzen : Blicke vermeiden : Maria setzt sich neben mich und wir plaudern.
Später schlurft Fasel heran in seinen Riesenpantoffeln und löst sich einen kleinenschwarzen. Sein Zmorge besteht aus einer Schale Milch mit Unmengen an Caotina, Ovomaltine und Frühstücksflocken. Die Milch auf dem Suppenlöffel, die hin und her schaukelt, während er an der Spitze saugt; kleine Wellen; das feste Material schwappt erst im letzten Moment in sein grosses Maul. Wir lächeln, als Maria erzählt, wie streng sie ihr Laufhaus führe, und werden dann ernst, als sie uns aus ihren schwarzen Teddybärenaugen anblitzt.
Gell Schatz, du luagsch zu mir? Weiss, ich han viele Männer, schenke mir imme viele Sache. Wenn ich dir gebe hundert Euro, ich kann machen mit dir was ich will? Gefälltdi oder? sagt sie zu mir und lacht ihr helles Lachen.
Wir verdrehen kurz die Augen, als sie ins Raucherzimmer verschwindet, und müssen uns dann gegenseitig versichern, wie sehr sie uns doch leidtut. Ich sehe wie Gabi, die jetzt auch am Tisch sitzt, kurz schielt und dann nervös mit ihrem Tablett hin und her schabt. Ich beruhige sie: die heilige Maria erzählt jeden Tag andere Geschichten, keine davon muss wahr sein. Von den andern Tischen her spüre ich die Blicke der Mitpatient:innen. Manche urteilend, andere verwirrt, belustigt, gleichgültig, viele einfach nur traurig.
Der Tschüffel schlägt unnötig laut auf dem Gong herum und stolzt durch den langen Gang, dieser Mannsgoggel. Ich schenke ihm ein müdes Lächeln, ich Opportunist. Wir trinken unsere Kaffees aus, räumen Geschirr und Besteck weg und schlurfen in den grossen Raum rüber, wo jeweils die Therapien stattfinden. Es heisst Koordinationsgruppe, also eine halbestunde lang zuhören, wie alle einzeln herausbröseln, was sie so zu tun habenwollenmüssen an dem Tag, und die Pflege, die dann jeweils sagen darf, dies oder jenes falle sowieso aus, das sei später, dieses früher, und dann geht das Spiel von vorne los bei der oder dem nächsten. Hier läuft die Uhr nach einer eigenen Zeit ab, wie Gabi immer sagt. Oder war es umgekehrt?
Hier: das ist die UPK Basel; sind, nicht ist; Mehrzahl. Die meisten sagen immer noch puk. Das gefällt mir. Die Stadt wollte mit dem neuen Akronym verhindern, dass man puk sagt, es wurde zu einem stehenden Begriff: puk, wie Wäbstüübli, puk, wie Burghölzli, wie Waldau, är isch indr puk, hesch ghört? Sie isch widr indr puk glandet, s het jo müesse sowit ko, sisch nüm so witergange. Ich bin also in der puk, und ich bin nicht das erste Mal da.
Lange schwarze Haare und Blut, Laken, Imperatrix Furiosa fährt ihren Laster durch die Wüste, Tom Hardy schluckt Sand, am Boden leere Blister Temesta, Cymbalta, Stilnox, Strähnen, eine Bong, beschlagen, ein junger Mann, hinten lange Haare, vorne ganz kurz, unregelmässig, ein Rasiermesser, Schnitte zwischen den Büscheln Haaren und auf der Stirn, keine tiefen, ein Bildschirm zeigt einen Sturm. Und er ruft einen Namen, nochmals. Beine zittern, kalter Schweiss, heisser Atem, reiben, es ebbt ab und flutet an und er treibt weg und wird wieder angespült. Küsten der Verzweiflung. Dann Wasser aus dem Maul : kein Schluck. Türrahmen konkav eine Kurve, versucht sich festzuhalten : auf Watte gehen. Blööterliwasser im Kopf, Piksen in Ohren, Lidern, im Nacken : Reissen unter der Haut. wen anrufen? Vatermueterkind, vier gewinnt : wer nicht wagt : wo war er gleich? Ah, kann nicht schlucken. Reinsteigern. Rein steigern. R einsteig ern.
Aber das war ja früher gewesen. Jetzt machen wir einen Spaziergang über das weitläufige Areal, vom Froschtümpel zur Orpheus-Statue und zurück zum Kranich, dem kleinen Restaurant in der Mitte des Areals.
Bäume, Ziegen, Katzen, Hühner, Hasen, Meerschweinchen und Schafe gibt es hier. Auf den Weglein gehen, hinken, tanzen, krabbeln, schieben, stelzen die Patient:innen und Angestellten, die Ärzt:innen, die Depressiven, die Schizophrenen, die Manischen, die Süchtigen, die Psychotischen, die Traurigen und die Euphorischen, die Alten und Jungen, die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die Gärtner:innen, die sogenannten Kranken und Gesunden auf Gottes grosser Erde. Früher habe ich gedacht, ich gehöre nicht hierher, ich bin nicht krank. Das hat mein Vater gesagt. Aber jetzt gehöre ich hierher, gehöre zum Raucherzimmer mit gelber Tapete, zur Aromatherapie, zur Medikamentenausgabe, zum Plaudern mit den Leuten in der Forensischen, durch den Gitterzaun durch, zum nächtlichen Geschrei und zu den Tränen.
Ich gehe neben Herr Fasel und höre ihm beim Plappern zu. Er erzählt mir von seinen Katzen, die in einem teuren Katzenhotel untergebracht sind, während er in der Klinik ist. Er erzählt mir von seiner Mutter, die immer für ihn eingekauft hat. Er ist um die fünfzig; seit er mit Mitte zwanzig eine Invalidenrente gesprochen bekommen hat, hat er die allermeiste Zeit zuhause verbracht, mit seinen zwei Katzen, vor dem Computer. Er hat Siedler gespielt und online gechattet. Seine Mutter wohnte in der Wohnung auf demselben Stock. Als sie vor kurzem starb, musste er selbst einkaufen gehen und ass so viel, dass er irgendwann nicht mehr aufstehen konnte und beinahe auch starb. Nach der Notfallaufnahme und den Wochen im Spital, in denen erst das Wasser aus seinem Körper herausgearbeitet wurde, musste er wieder gehen lernen, dann war er auf der psychiatrischen Krisenintervention und jetzt war er hier. Er will abnehmen und er will Sex haben. Er hat schon früh gewusst, dass er schwul ist, hat sich geoutet, aber noch nie Geschlechtsverkehr gehabt. Als er in mein Zimmer verlegt wurde, meinte ich, er solle doch Grindr installieren. Er schrieb wohl mit einigen Männern – ich weiss nicht, ob er auch je einen davon getroffen hat. Herr Fasel lacht viel und öffnet dabei seinen breiten Mund, so dass man seine wenigen verbliebenen Zähne sieht. Für einige Patient:innen ist er die wichtigste Ansprechperson hier. Er ist einfühlsam und kann gut zuhören, besser als viele der Psycholog:innen. Wie hatte er ein Vierteljahrhundert so isoliert überlebt? Hat er sich in einem Traum versteckt? Sich fallen gelassen, sich entschieden, einfach nicht zu landen?
Das meiste hat Fasel mir zwischen Schlaflosigkeit, Raucherzimmer und Spaziergängen erzählt. Manchmal schreibt er Gedanken und manchmal schreibt er andere Dinge auf. Ich habe nie etwas davon gelesen. Ich will auch schreiben.
Es gibt viele Menschen hier, die schreiben. Es wird viel geschrieben. Die Ärztinnen schreiben Rezepte und Notizen, die Psychologen schreiben mit und malen kleine Kringel am Rand ihres Blattes. Die Sozialarbeiterin schreibt sich ein paar Informationen über die Arbeitssituation auf. Reintegration, Arbeitsmassnahme, Arbeitsversuch.
Die Enten tauchen zwischen den Fröschen im Teich, zwischen der Grütze und dem langen Farn. Kleine Inseln zum Verweilen. Schreiben wogegen?
Fasel hat sich besonders mit zwei Mitpatienten angefreundet, die nicht mehr auf der Station waren, als ich ankam. Ich habe ihn nach seinem Austritt einmal besucht, der Gestank nach Katzenklo hat die Stimmung noch trister gemacht. Seine Wohnung befand sich in einem dieser unwirklichen Hochbauten am Rand der Stadt, mit sechzehn Stockwerken oder mehr. Er sass mit den beiden Freunden, Yannis und Mirko, auf dem Balkon, sie tranken Bier, kifften, riefen mit unterdrückter Nummer in der Klinik an, um die Pflege dort zu nerven und swipten auf Tinder, beziehungsweise Grindr. Dann erzählten sie mir, wie sie den Abend zuvor gemeinsam im Puff gewesen waren. Yannis und Mirko hatten zusammen eine Prostituierte gefickt, sie sagten immer wieder gefickt, betonten das -fi-; Fasel hat dabei zugesehen. Yannis war ganz aufgeregt beim Erzählen, sein Kopf dunkelrot, er habe nicht mehr aufhören können, bis die Nutte nicht mehr konnte, dabei kratzte er sich den Schorf von den Unterarmen. Seine Brustmuskeln spannten am Shirt. Fasel sah mich ratlos an. Mirko war erst Anfang zwanzig, ich wusste nicht, wieso er mit den beiden viel Älteren abhing. Er meinte, am Geländer mit Katzennetz stehend, wir könnten uns jetzt einfach da hinunterstürzen, vom Balkon, aus dem zwölften Stock. Niemand widersprach. Ich spürte ihre Langeweile und ihre Verzweiflung, ein Kloss und ein Puls im Hals, es tat mir weh und ich war froh, nicht wie sie zu sein, und ich hatte Angst, ich könnte wie sie werden, und es tat mir leid, dass ich so dachte und fragte mich, ob ich so denken dürfe, und ich war dankbar, Freunde und Familie zu haben, die für mich da waren. Die stabil waren. Die drei lachten und meinten, sie wollen mich jetzt ins Bordell mitnehmen, oder zumindest zum Koksen oder zum Schwimmen am Rhein. Ich winkte ab, ich müsse wieder zurück in die Klinik und sowieso … Yannis meinte, es sei alles nur Spass. Mirko lachte leise und aus seinem hübschen Jungengesicht strahlten zwei blaue Augen, die ich nicht zu deuten wusste. Fasel sah mich an, sein breites Maul zog sich zu einem entschuldigenden Lächeln auseinander. Ich hoffte, dass er sich nicht wieder in seiner Wohnung einsperren würde. Das sagte ich ihm beim Abschied. Er sagte, er wisse es noch nicht. Ob er unter den Menschen bleiben möchte.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Unteutsch
Mint
Es gab eine Zeit, in der ich mich von einer Fernsehwerbung für koffeinarmen Kaffee verfolgt fühlte. (Ich möchte schreiben: obsessiv verfolgt, aber kann man sich obsessiv verfolgt fühlen?)
Ich hatte eine Obsession mit vielen Dingen, Sätzen zum Beispiel oder Liedern. Wobei es eigentlich nie ganze Lieder waren, immer nur eine oder anderthalb Strophen oder, was am schlimmsten war, nur der Refrain. (Dass ich später eine Zeitlang in einem Kindergarten arbeitete, machte es nicht besser.) Die Kaffeewerbungsobsession fiel in eine Zeit, in der ich Seminare an einem Zentrum besuchte, das Career Academy hieß. Leute, die einen Uniabschluss gemacht hatten, wie ich, konnten dort Dinge lernen, die sie in irgendeiner Weise mit der Arbeitswelt vertraut machen sollten. Ich war sehr unvertraut mit fast allem aus dieser Welt. In meiner Erinnerung sitze ich tags auf dem Fußboden über Jobanzeigen, deren Überschriften mich so nervös machten, dass ich nicht wagte, weiterzulesen, und aß abends auf dem Fenstersims weinend Spaghetti. Ich hielt mein Gesicht unter Wasser und ging schlafen. Das waren meine Tage.
Einmal kam eine Frau vom Arbeitsamt in die Career Academy und sagte, wir sollten uns in einer Reihe aufstellen, nach den Anfangsbuchstaben der Wunschberufe, die wir als Kinder hatten. Fast alle waren in ihren Kindergedanken Bildende Künstler*innen, Violinist*innen oder erforschten die Tiefsee. Dann hatten sie BWL, Jura oder etwas, das sie vage interessierte, auf Lehramt studiert.
Die Frau sagte, wer ein halbes Jahr nach dem Uniabschluss nicht in den Arbeitsmarkt hineingefunden habe, hätte es sehr schwer, dort noch einen ordentlichen Platz zu finden. Ich rechnete die Monate nach, in denen ich nach der Uni Kuchen an gleichaltrige Agenturgründer verkauft hatte: Es waren zu viele. Ich würde mich sehr beeilen müssen, wenn ich nicht zu den Verdammten gehören wollte, die für immer außerhalb des Kreises blieben.
Fast alles, was die Frau von der Agentur sagte, gab mir dieses Gefühl, das ich hatte, wenn mir jemand eine schöne Restwoche wünschte – als wäre kaum etwas übrig von dem, was einmal groß und ganz vor uns gelegen hatte. Aber an so einer Woche ist ja heutzutage auch nicht mehr viel dran.
Als ich anfing, Kuchen zu verkaufen, hatte der Cafébesitzer zu mir gesagt: „Du darfst dem Kuchen nicht zeigen, dass du Angst vor ihm hast.“ Er führte mir vor, wie ich das Messer in lauwarmem Wasser abstreichen sollte, und dann: den sauberen Schnitt durch Schichten von Erdbeermousse, Basilikumcreme und Biskuit, und wie sich die Torte schließlich beherzt, ohne spürbare Angst, auf einen goldgerandeten Teller schieben ließ. Die Agenturleute, von denen ich einige noch aus der Schule kannte, tranken zum Glück nur Kaffee. Und im schlimmsten Fall konnte ich meinen Kopf in die metallenen Kühlfächer hinter dem Tresen halten.
Die Frau aus der Werbung hätte niemals Kuchen gegessen. Noch weniger als das Model, das in einem Interview sagte: „Alle zwei Wochen gönne ich mir einen halben Keks.“ Die Frau in der Werbung aß gar nichts, aber natürlich war sie trotzdem den ganzen Tag glücklich. Sie hatte das perfekte weiße Neunzigerjahreloft und trug morgens graue Wollsocken zu einem riesigen weißen Hemd. Alles, was sie tat, war lässig, beiläufig und professionell: Im Businessdress hielt sie Männern in Anzügen nickend Mikrofone hin, war dann inlinernd mit einer Gruppe lachender Pastellfarben im Park unterwegs und knipste abends, den schönen Mann in einem Arm, die Fernbedienung in der anderen Hand, im Kleinen Schwarzen unsere Blicke aus. Und natürlich trank sie ihren Kaffee schwarz.
Sie war definitiv eine Frau, die sich nicht vor Titeln von Stellenanzeigen fürchten würde. Sie würde die Titel einfach weglachen und sich einen Lightkaffee in die mintfarbene Tasse gießen, in der Sonne am Fenster.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jakob Hagen
Verlaufen lernen
Schritt 1: Genesis
du bist resultat und anfang stehen voreinanderweggenommen werden ursache und wirkung miteinander ausgetauscht wird jeder einmal mehr das leben zeichnen und du strahlensonnen häuserdächer schützen was die zukunft in sich trägt ist weit weniger als jetzt die beine voreinander schlägt und deine stimme will nicht sprechen ist der erste schritt so schmerzhaft ist der niedergang wird dir nicht schaden zu vermeiden und als elter steht man meist nur nebendran vergeht die zeit noch schöner ist das licht das dich begrüsst die morgenluft verhältnismässig warm wird es um dich ein reigen und geliebte hände die sich vor dich stellen und dir den weg geleiten
Schritt 2: Exodus
bei allem was wir lernen niemals aus ist die bedenkenlosigkeit greift um sich nichts mehr vorzumachen schliesst du dich berührt nur noch der schmerz ist allumgebend tiefer atem haltend bis du auferschrickst in deinen nächten wanderst du umher verschlagen dich gedanken wiederkehrender beglaubigung als ausweg ausgebrannt und ungeformt sich durch die rippen frisst sich die erkenntnis dass du selbst dir überlassen bist
Schritt 3: Requiem
im schmerz der dunklen nächte bist du kälte über heizungsstäben flimmern nachtmusiken ziehen durch die träume wachen schlafend über dir im glockenspiel die knochenzwischenräume flüstern leise fluchst und fühlst du dich nicht ernst genommen werden unsere fragen schallen niemals muss die antwort lauten trommeln folgen wir und weisse schwäne malen hoch erhoben wolken traumverhangen bis zur atemlosigkeit so treibt sich schweiss zu perlen tränend alles dagewesene mit sich reissend nein du warst nie mehr für mich nie mehr als staub in sonnenflecken leuchtet starr verdreht sich etwas sagen wir vergehen unter uns erhebt sich weissgewandig was dich ausgemacht hat war weit mehr als deine worte schreiben jetzt nur noch der tau zwischen den fensterscheiben kreischen wild gewordene fetzen die die welt bekleiden scherben in dir schreit und faucht der teufel pauken schlagend gegen die gesichter sprechen alles fällt mit dir wird klar dass es in deinen zeiten niemals anders war es angst gewesen die dich zähmte niemand las je deine zeilen ungelesen sich zu wasserzeichen quellen die sich schlafen legen sorgenfalten um sich werfend
es erschlägt dich
du bist nicht mehr unverwundbar
du bist kind gewesen
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Henni-Lisette Busch
Maßnahme
Ich sehe keinen Horizont mehr, sage ich. Vor uns rollt sich in den Sand die See und krause Gischt sieht ganz kurz aus wie schaumgeschlagener Stoff, platzt und versickert. Die Wellenausläufer ziehen sich zurück in das himmelgraue Meer, das irgendwo ganz weit hinten sich vorn überwölbt und über uns rollen sich die Wolken in die Höh. Da ist kein Horizont, nur die Buhnen sind ein Strich.
Ich sehe auch keinen, sagst du. Da ist nichts in Sicht. Und aus deinem Mund klingt das nicht so, wie ich das eigentlich meinte, sondern hoffnungslos.
Immer, wenn wir uns sehen, bist du geschminkt, sind deine dichten Wimpern hochgeschwungen, ein Lidstrich gezogen und manchmal schmückt deinen unteren Wimpernkranz eine grüne oder graue dünne Puderlinie. Ich trage, wenn, dann nur Mascara und ich traue mich nicht, zu sagen, dass ich morgens keine Zeit habe zum Schminken, nicht, weil ich einen Sohn habe wie du, den du jeden Morgen manchmal mehrmals anziehst, weil er einen anderen Pullover will, den mit dem Löwen, nicht den mit den vielen kleinen Dinos drauf, oder weil er zu übermütig einen Schluck Saft nahm. Nicht, weil ich einen Sohn habe, wie du, dem du jeden Morgen Frühstück machst, zumindest ein kleines, und dann Zähne putzen und nochmal spielen und ihn dann davon überzeugen, dass seine Freunde bestimmt schon warten auf ihn im Kindergarten. Und während du durch deine Drei-Raum-Wohnung läufst von Tür zu Tür hängt an fast jeder Wand und auch am Kühlschrank ein Bild, wo ihr noch zu dritt seid, oder eins von dir und ihm, der jetzt zwar weg ist, aber immer noch der Vater deines Sohnes und immer noch jeden deiner Gedanken und jede deiner Tränen wert. Ich habe morgens keine Zeit, nicht, weil ich einen Sohn habe, wie du, den du dann um acht in den Kindergarten bringst und dann sitzt du manchmal erst um neun wieder im Auto, weil dein Sohn dich nicht gehen lassen wollte und dann musst du zur Arbeit fahren und selbst gefrühstückt hast du meistens nicht. Ich traue mich nicht zu sagen, dass ich morgens keine Zeit habe zum Schminken, weil ich geschlafen habe bis um neun und dann um zehn auf Arbeit sein muss.
Wie weit ist es wohl bis dort hinten, frage ich, und stell dir vor, du hast ein Schiff, das dich bis dorthin trägt. Ich glaube, ich würde an Bord gehen, sage ich, und Maß nehmen bis wir dort sind, wo sich das Meer vorn überwölbt. Du sagst, nein, ich nicht, aber du zögertest, lächeltest noch kurz bevor du das sagtest. Komm, wir gehen, es wird kalt und du wendest dich um und gehst. Ich sehe dir nach, deine Gestalt verschwindet, sie wird an Land geweht bis dorthin, wo sie gebraucht wird.
Immer, wenn ich dich besuche, hast du gekocht, Kartoffeln mit Schwarzwurzeln und Fischstäbchen oder Lasagne, die nicht aus Nudelplatten besteht, sondern aus dünnen Zucchinischeiben, dazu einen frischen Salat und Getränke hast du immer da, Saft, Mineralwasser und Schokomilch. Ich trinke immer nur Leitungswasser und traue mich nicht zu sagen, dass ich keine Getränke kaufe, weil mir das zu aufwändig ist. Einen Nachtisch gibt es auch jedes Mal und manchmal, bevor ich losgehe, ein Betthupferl für alle, denn dein Sohn muss ins Bett und der kann schon verhandeln. Und noch bevor ich gehe, läufst du durch deine Drei-Raum-Wohnung von Tür zu Tür und ziehst dich nebenbei schnell um, wenn dein Sohn gerade nochmal kurz spielt, legst schon das Buch bereit, das ihr euch zusammen anguckt, bevor ihr schlafen geht, schminkst deine schönen Augen ab und kündigst nebenbei immer wieder an, aber gleich geht es ins Bett, damit dein Sohn, der gerade wieder spielt mit kleinen Töpfen und Plastikobst, hoffentlich langsam müde wird. Dann gibst du mir noch Abendbrotreste in einer Tupperdose mit und dann gehe ich vorbei an all den Bildern an der Wand, wo ihr noch zu dritt seid. Hinter mir schließt du die Wohnungstür und drehst den Schlüssel zweimal um und winkst dann kurz noch aus dem Fenster, bevor du irgendwann müde in dein Kissen sinkst. Ich traue mich nicht zu sagen, dass ich keine Getränke kaufe, weil mir das zu aufwändig ist, mir aber fast jeden Tag einen Karamell Macchiato hole, bevor ich um zehn auf Arbeit bin.
Ich stelle mir vor, ich gehe auf das Schiff, dass mich dorthin trägt, wo sich das Meer vorn überwölbt. Dass ich keinen Horizont mehr sehe, heißt Lust, ihn zu übersteigen, aber ich traue mich nicht zu sagen, dass es mich in die Ferne zieht und weg aus meinem kleinen Leben, nicht, weil ich einen Sohn habe wie du und Verantwortung, die erdrückt. Du legst jeden Monat Geld zurück und hast immer noch die Spielsachen deines Sohnes von früher und die Kleidung, in die er nicht mehr passt, weil du eigentlich ein zweites Kind willst, aber den Vater dieses Kindes gibt es nur als Fotos an Wänden und der Kühlschranktür. Ich traue mich nicht zu sagen, dass es mich in die Ferne zieht und ich nicht weiß, ob ich mal Kinder will, nicht, weil ich einen Sohn habe wie du und nur mich selbst dazu, sondern weil ich Angst davor habe, das alles nicht zu schaffen.
Ich lasse das Schiff ohne mich ablegen und gehe landeinwärts hinter dir. Hinter uns rollt sich in den Sand die See und krause Gischt sieht ganz kurz aus wie schaumgeschlagener Stoff, platzt und versickert. Die Wellenausläufer ziehen sich zurück in das himmelgraue Meer, das irgendwo ganz weit hinten sich vorn überwölbt. Ich würde dir gern sagen, dass, nur weil ich keinen Horizont dort sehe, es trotzdem einen gibt für dich und bestiegen wir beide das Schiff, nähmen wir Maß, bis wir ihn erreichten und je nach Wetter und Höhe des Schiffs sind das auf offener See ungefähr 20 nautische Meilen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at