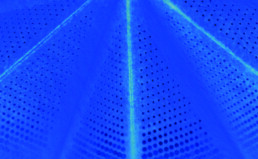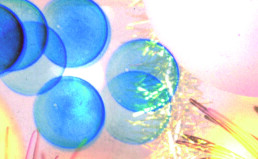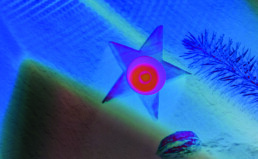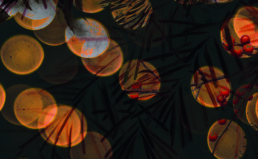23 | POEDU: Emmy
Glitzerbonbons
Es gibt Bonbons,
die glitzern und funkeln
und sie leuchten sogar im Dunkeln.
Wenn ich sie in den Mund nehme,
schmecke ich die zarte Creme
und dann bin ich plötzlich
an einem anderen Ort.
Einmal stand ich sogar im Hort!
Manchmal ist man auch
in einem anderen Land.
Ich bin vorher immer schon gespannt!
Ihr glaubt es mir nicht?
Dann schreibt doch
euer eigenes Gedicht!
.
Emmy (11 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe kam diesmal von Sabine Schiffner:
Erstelle ein Gedicht für ein Türchen von einem Adventskalender, den Du Deiner/m besten Freund:in schenken willst. Mach ihr/ihm also ein Geschenk aus süßen Worten. Schreibe über Deine Lieblingssüßigkeit, oder denk Dir doch einfach eine neue Süßigkeit aus, eine lustige, eklige, oder eine Zaubersüßigkeit.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
22 | Jutta Schüttelhöfer
Jetzt
im Schatten der Zeit
steht dieses Haus
wartet auf seinen Anstrich
lass uns die Wände mit Mut streichen
und die Böden mit Erinnerungen auslegen
unsere Verletzungen setzen wir
auf die Bank in der Diele
und daneben am Fenster
ist noch Platz für alles
was hätte sein sollen
.
Jutta Schüttelhöfer
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
21 | Marie Menke
Handschuh in Handschuh
Auf Weihnachtsmärkten küsst es sich gut, sagst du.
Ich entgegne dir: Der Glühwein ist mir zu bitter.
Auch auf meiner Zunge?
Ich probiere davon und nicke. Auch auf deiner Zunge.
Wir bahnen uns durch die Menge, Handschuh in Handschuh, und ich erhasche im Vorbeigehen einen Blick auf unsere roten Wangen, wie sie sich spiegeln in der Weihnachtskugel, ganz oben in der Zweigkrone eines Tannenbaums, o Tannenbaum. Ich würde deine Hand gerne loslassen, aber möchte dich nicht verlieren.
Ich kauf dir ein Lebkuchenherz, sagst du.
Ich entgegne dir: Die sind mir zu süß.
Darf ich dir was anderes schenken?
Ich stecke meine Hände in die Taschen.
Von den Lichterketten der Buden wachsen Eiszapfen zu uns herunter. Mir läuft die Nase, mein Atem zeichnet sich weiß wie Zuckerwatte in der Winterluft ab und die Waren glitzern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, dabei mag ich keine Geschenke von Männern, auch nicht von solchen, die ich liebe, erst recht nicht von dir.
Ich schaue dich schniefend an, deine Augen groß wie die des Nussknackers, und stecke meine linke Hand mit meinem zusammengeknüllten Papiertaschentuch darin in deine Jackentasche. Meine Finger wandern in das Innere deines Handschuhs, legen sich auf deinen Handrücken und reiben sich an dem kratzigen Fell, eine geschenkte Wärme, für die ich nicht einmal einen Glühweinkuss eintauschen musste.
.
Marie Menke
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
20 | Karl Johann Müller
Schlittenhundewetter
Schneespuren
von Kufen und Füßen
in seinen Pfoten
die Weite
die Kälte im Fell
und das Gefühl
für Norden
Freiheit auf Zuruf
das Geschirr
an den Schultern
vorbei an
lastgebeugten
Kiefern
über eisgekrönte
Seen
durch frostgeformte
Landschaft
wenn sich Flocken
häufen
und der Blick
ins Weiße geht
laufen die Beine
auch blind
.
Karl Johann Müller
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
19 | Mona Gnan
Resteessen
Die letzten Tage im Jahr, vor allem die zwischen Weihnachten und Neujahr, fühlen sich immer ein wenig an wie Resteessen. Man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll, also wirft man sie einfach alle in einen Topf und versucht, das Beste daraus zu machen. Und entweder wird es das beste Gericht, das man je gekocht hat, aber nie wieder genauso hinbekommen wird, oder die schlimmste willkürliche Lebensmittelakkumulation, die man einfach nur durchstehen muss. Die Chancen stehen fünfzig zu fünfzig. Ich bin keine Mathematikerin, aber diese Rechnung müsste erfahrungsgemäß stimmen und ist somit empirisch belegt.
Ständig wird man dabei begleitet, beim Resteessen kochen und Restetage leben. Begleitet von der Nostalgie, über all das Schöne, was im vergangenen Jahr passiert ist und der Erinnerung an das, was vor Kurzem noch gewesen und leider schon vorbei ist. Begleitet von der Melancholie darüber, was man jetzt mit den Resten anstellen soll und dass es überhaupt nur noch Reste vom Jahr sind, die übrig geblieben sind. Begleitet von der Reflexion, zu welchem Mensch man geworden ist. Begleitet von dem Anspruch, wer oder was man in naher und ferner Zukunft zu sein hat.
In diesen Tagen, und eigentlich auch schon in der Vorweihnachtszeit, ist es morgens am winterlichsten, abends am süßesten und alles dazwischen ist irgendwie etwas staubig. Ungefähr so staubig, wie Kurkuma schmeckt. Der Sommer ist auch staubig, aber schön staubig, denn da glitzert der Staub in der Sonne und schwebt in der warmen Luft langsam vor dem offenen Zimmerfenster auf und ab, wie eine Qualle im Meer. Ich mag nicht einen einzigen Gedanken an den vergangenen Sommer in meinen Kopf lassen, denn dann schmerzt die Melancholie zu sehr. Der Winter glitzert auch, aber künstlich. Lametta, Weihnachtsdeko, die Lichterketten auf dem Weihnachtsmarkt und die Beleuchtung in den Fußgängerzonen. Schon lange habe ich keinen Schnee mehr glitzern sehen. Die Welt schrumpft, wenn es schneit. Das ist meine liebste Eigenschaft am Schnee. Alles wirkt auf einmal klein und weich und überschaubar. Er erinnert mich dann irgendwie an die Probleme anderer Menschen, denn die wirken von außen betrachtet auch immer kleiner, als sie für diese Menschen selbst eigentlich sind und sowieso wirken sie kleiner als die eigenen Probleme. Ich frage mich, wann das letzte weiße Weihnachten war, das ich miterlebt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich frage mich, warum der Winter für mich jedes Jahr weniger weihnachtlich und immer mehr wie ein Resteessen wird.
Wie viele Tassen hattest du schon? – Drei, wieso? – Nur so. Bist du bei einer vierten dabei? – Ja, aber nur wenn ich deine Tasse bekomme. – Warum? – Die Farbe von deiner ist schöner. Und meine hat einen angeschlagenen Rand. Und ich habe dieses Jahr noch gar keine Weihnachtsmarkttasse mitgehen lassen. – Von mir aus.
Das künstliche Glitzern hängt in den Schaufenstern und klebt in den Schädeldecken der Menschen wie dieser Streuglitzer, den man früher auf die mit Klebstift überzogenen Kindergeburtstagseinladungen gestreut hat. Der Glitzer macht Weihnachtsvorfreude und wird in der Sekunde vom rauen, trockenen, kalten Nordwind aus den Köpfen der Menschen gepustet, in der der zweite Weihnachtsfeiertag vorbei ist. Ein kleiner Abschiedsgruß vom Weihnachtsmann. Der Nordwind macht ihre Gedanken genauso rau und trocken und pragmatisch, dass sie aus den Resten des Weihnachtsessens ein improvisiertes Abendessen machen wollen und den traurigen Nikolaus aus Schokolade im nächsten Frühjahr einschmelzen, um den Geburtstagskuchen mit Schokoglasur zu dekorieren. Und die einzelnen Glitzerflitter und Funkelkörnchen, die hartnäckig an der Schädeldecke hängen bleiben, machen sie beim reflektierten Aufräumen in ihrem Kopf nostalgisch.
Eigentlich ist das gar kein Klauen, man bezahlt ja Pfand für die Tassen. – Ich will aber, dass es sich ein bisschen so anfühlt.
Irgendwie hast du auch an Glanz verloren, übrigens. Irgendwie hat alles an Glanz verloren, mit der Zeit. Ich habe versucht, dich künstlich zum Glänzen zu bringen, aber das war mir dann doch zu kalt. Mit dir zusammensein fühlt sich an wie ein ewiger Herbst ohne Winter und eigentlich hört sich das gut an, denn das heißt, dass alles für immer bunt ist. Die Schneekönigin in Narnia hat mir als Kind Angst gemacht, denn solange sie regiert hat, gab es in Narnia einen ewigen, schneereichen Winter ohne Weihnachten. Ein jahrelanger Winter und kein einziges Weihnachten. Mit dir zusammensein fühlt sich an wie ein ewiger Herbst ohne Winter und eigentlich hört sich das vielversprechend an, denn das heißt, dass alles für immer bunt ist, aber es gibt eben auch kein Weihnachten. Es gibt keine Steigerung, kein Ziel und kein Ankommen und irgendwann ist auch der bunteste Herbst ausgebleicht und die leidenschaftlichste Aufbruchstimmung kapitulierend. Warum sind wir so schnell an den Punkt gekommen, an dem wir uns Geschichten doppelt erzählen? Als wären wir zwei zusammen schneller als unser eigenes Leben. Wir leben dem Geschichtenerzählen nicht schnell genug hinterher. Warum sind wir so schnell an den Punkt gekommen, an dem wir uns Geschichten doppelt erzählen? Ich glaube, ich habe gerade ein Fünkchen Glitzer gefunden, das noch im Innern meiner Schädeldecke klebt.
Warum gibt es eigentlich Weihnachtsmärkte, die über Weihnachten hinausgehen? – Kommerz! – Naja, wir unterstützen ihn ja auch, schließlich sind wir gerade hier. Fühlst du dich denn noch weihnachtlich? – Ich will gar nicht darüber nachdenken.
Früher habe ich deine Nachrichten ausgepackt wie ein Praline. Ich habe sie langsam und bewusst geöffnet, genüsslich gelesen und es so lange ausgereizt, mich an ihnen zu erfreuen, bis ich schließlich zurückgeschrieben habe und sie und meine Freude an ihnen aufgebraucht waren. Naja, so ganz stimmt das nicht, denn so viel Selbstbeherrschung hatte ich noch nie. Aber sie haben sich jedes Mal besonders angefühlt und sie gaben mir jedes Mal ein kleines Hoch. Ich habe Angst, dass ich meine Gefühle zu schnell durchgefühlt habe. Da liegt noch so viel Leben vor mir – habe ich schon alles verbraucht, die ganze Intensität und die ganze Palette, oder kommt da noch was?
Als ich heute durch die Fußgängerzone gelaufen bin, habe ich mit einem Kescher meine Gedanken zusammengefangen, sie mit der bloßen Hand aus dem Netz geholt, festgehalten und ausgiebig betrachtet, während sie in meiner Hand zappelten. Wirklich erwischt habe ich aber nur einen, die anderen sind mir zu schnell entkommen. Ich hielt ihn in der bloßen Hand, den kleinen Gedanken, und betrachtete ihn und erkannte ihn wieder, denn es war ein ganz besonderer Gedanke. Einer, den du mir gegeben hast und er heißt: Warum komme ich nie auf die Idee, dass andere Menschen auch unsicher sind?
In dem Moment, in dem ich ihn wiedererkannt habe, ist er mir entronnen. Dann habe ich den Kopf gehoben und meine eigene Reflexion im Schaufenster einer Boutique gesehen, die ausschließlich äußerst geschmackvolle skandinavische Mode und Accessoires verkaufte. Als ich meine Reflexion in diesem Fenster sah, kam ich mir vor, als würde ich niemals dazugehören. Ich, mit vor Kälte geröteter Nase, von der Luftfeuchtigkeit krausen Haaren und talgig glänzender Haut, könnte nie zu diesen ästhetischen Wesen, umgeben von ästhetischen Gegenständen gehören. Selbst die Luft, die sie atmeten, schien ästhetischer zu sein als die Luft, die ich atmete. Die Wesen erinnerten mich an das Mädchen, das ich früher in einem Skiurlaub kennengelernt hatte. Ich war etwa sieben Jahre alt, sie vielleicht neun oder zehn. Sie trug einen blütenweißen Schneeanzug mit goldenen Streifen, hatte farblich passende Skier und einen farblich passenden Helm und besaß ein eigenes Klapphandy in rosa. Ich trug den alten Anorak, den mein großer Bruder und nach ihm mein Cousin schon getragen hatten und farblich zusammengewürfelter konnte man sich eine Siebenjährige nicht vorstellen.
Jetzt sah ich das siebenjährige Mädchen in der Schaufensterreflexion, das jetzt groß war und dunkel gekleidet, und sie wünschte sich, dass der Gedanke zurückkommen würde. Ich konnte nicht glauben, dass diese Menschen, diese Fabelwesen in diesem goldenen Fenster, jemals auch nur eine Sekunde ihres Lebens unsicher sein könnten – oder umgekehrt: Ich konnte nicht glauben, dass ich jemals nachhaltig und langfristig selbstsicher sein könnte und ehrlich gesagt kann ich es noch immer nicht glauben. Am schönsten bin ich sowieso nur in zwei Situationen: Wenn ich mich betrachte, wie Gott mich geschaffen hat, nämlich mit minus dreikommafünf Dioptrien, wenn ich mich gar nicht mehr so genau erkennen kann, weil ich eine Sehschwäche habe, und im Winter, wenn es draußen nicht so grell ist und früh dämmrig wird. Schatten stehen mir wohl gut, vielleicht fühle ich mich ihnen deshalb so verbunden. Dieser Gedanke passt so gar nicht zu den ästhetischen Wesen in diesem magischen skandinavischen Schaufenster. Diese Wesen essen sicher niemals Resteessen, sondern immer nur frisch gekochte, inhaltlich abgestimmte, authentische Mahlzeiten oder das, was Fabelwesen eben essen. Ich frage mich, was Fabelwesen an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr machen.
Hast du mir überhaupt zugehört? – So halb. – Du bist schon wieder am Grübeln, das merke ich dir doch an! Du hattest genug Glühwein für heute, glaube ich. – Ich glaube, ich habe eine Sinnkrise. – Die hast du jedes Jahr. Und noch mehr, wenn du Glühwein getrunken hast. – Weihnachten ist schon vorbei und es hat noch nicht einmal geschneit. Ich wünsche mir Schnee. Wenn Schnee liegt, dann schrumpft die Welt. – Was? – Wenn Schnee liegt, dann schrumpft die Welt, weil – Wir gehen jetzt nach Hause, du gehst schlafen und morgen ist vielleicht alles ein wenig einfacher. – Nein, ich glaube, dieses Mal habe ich wirklich eine Sinnkrise. – Hast du nicht. Keine Sorge, das ist nur die normale Winterdepression, die sich als Sinnkrise tarnt.
.
Mona Gnan
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
18 | Anne Büttner
Kotzende Pferde
127 zu 82. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Alles in Ordnung. Nicht perfekt, aber total im Rahmen. Wirklich. So, wie ein Lebensmittel ja auch nicht direkt mit Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums verdirbt, gilt das auch für den optimalen Blutdruck und ihn, Frederik Ganser, Eigentümer des aktuell 127-zu-82ers.
Ein guter Wert. Etwas hoch vielleicht, aber noch lang kein Grund, sich zu beunruhigen. Jedenfalls nicht vor der zweiten Messung – also in frühestens dreieinhalb Minuten. Einmal schafft er den Song inzwischen eigentlich immer. An guten Tagen auch öfter.
There's a weight that's pressing down / Late at night you can hear the sound
Er würde erstmal so sitzenbleiben. Ganz ruhig, sich nicht bewegen und methodisch atmen, um den Wert nicht weiter in die Höhe zu treiben. Noch war ja alles im Rahmen. Bloß nicht reinsteigern. Einfach souverän atmen, den Song hören, erneut messen. Nochmal 127 zu 82 wäre okay. Nicht optimal, aber okay. Eventuell müsste er dann noch ein drittes Mal messen.
Keinesfalls okay wäre ein Ausreißer. Da bräuchte es dann keiner weiteren Messung. Da hieß es Schlüssel nehmen und los: Bördingstraße bis Mehlfelder, dann bis Kreuzung Jessener, scharf links auf die Eimsbühler, weiter bis Mullenberger, hoffen, dass die Schranke oben war, dann gleich in die Helmkötter, dort dritte links und die Auffahrt hoch bis zum Haupteingang.
Für Parkplatzsuche bliebe da keine Zeit. Nur Tasche vom Rücksitz schnappen und direkt durch zur Notaufnahme. Auf jede Minute käme es dann an.
Sollten sie ihn dieses Mal dabehalten, würde er sich noch Sachen bringen lassen. Eventuell von Hannah. Obwohl, lieber nicht. Andererseits … Nichts, worüber er sich jetzt schon den Kopf zerbrechen sollte. Noch war ja alles offen. Wirklich. Jetzt bloß nicht ins Denken kommen. Methodisch atmen war gesagt. Und langsam eiiin (haltenhaltenhalten)… uuund wieder aus (21,22,23) …
There's a fear I keep so deep / Knew its name since before I could speak
Frederik Ganser ist schon viel besser geworden im Atmen. Nicht mehr dieses stümperhafte Rumgeatme. Viel kontrollierter, viel eleganter, manchmal fast schon beiläufig: Gerade so, als sei es normal.
… und wieder eiiin (haltenhaltenhalten) uuund auuus. Sehr gut geatmet. Genau wie im Tutorial. Immer auf den Rhythmus achten. Nur ein unkonzentrierter Moment und schon würde ihn das Denken packen. Und mit dem Denken die Gewissheit, dass es dieses Mal soweit wäre. Dieses Mal wirklich.
Schon seine Geburt stand unter keinem guten Stern: Nicht mal ein Jahr nach Tschernobyl und nicht mal 1.700 Kilometer davon entfernt, erblickte Frederik Ganser mit ein paar Gramm zu wenig, möhrchenbreifarbener Haut, leicht gelben Augen und einem Nachnamen, nach dem ein ebenso seltenes wie schwieriges Syndrom benannt ist, etwas zu früh das Licht des Kreißsaals im Sophien-Klinikum.
Nach ein paar Tagen auf Station konnten seine Eltern ihn mit ein paar Gramm mehr und einer Gelbsucht weniger endlich nach Hause holen. Aufnahmen aus jener Zeit zeigen, dass sie sich vorstellen konnten, dass Frederik gut in einem Stubenwagen neben ihrem Bett würde schlafen können. Wie sich jedoch herausstellte, schlief Frederik die ersten Monate so gut wie gar nicht und später so gar nicht gut. Was weder am Stubenwagen noch am Standort lag, wie die Gansers nach unzähligen Versuchsanordnungen erkennen mussten. Die dringend benötigte Unterstützung kam überraschend: und zwar von The Alan Parsons Project mit „Don’t answer me“. Meist schlief Frederik schon während der zweiten Strophe ein.
Aaaaah Aaaaah Aaaaah Aaaaah
Eines dieser unbeschwerten Kinder, so ein Kind war Frederik nicht. Frederik war immer schon vorsichtiger, angestrengter irgendwie. Und auch blasser als, keinesfalls so rosig wie andere. Oder so sorglos. Nie wäre er auf die Idee gekommen, die Nachbarskatze zu streicheln oder Tante Lissys Dackelwelpen. Wer weiß, woran die überall geleckt hatten oder mit ihrem Fell entlanggestreift waren. Frederik befürchtete Schlimmstes. Auch wenn er damals nicht wusste, was genau das sein könnte. Ständig begleiteten ihn Ängste, ihm könnte Furchtbares widerfahren. Ihm oder seinen Eltern. Was wäre, wenn sie sich mit irgendwas ansteckten und plötzlich nicht mehr wären? Was dann? Wie sollte das denn gehen? Das ging doch gar nicht!
Wieder und wieder mussten die Gansers ihrem verängstigten Sohn versichern, so richtig mit großem Ehrenwortschwur, dass das nicht passieren würde. Dass sie aufpassten und dass Tiere, selbst Tauben, mit ausreichend Abstand oder einem geschlossenen Fenster dazwischen, wirklich keine Keime übertragen können. Und ja – die andere Straßenseite oder das Dach des Nachbarhauses sind ausreichend Abstand. Und nein – da musste man nicht die Luft anhalten oder vorbeirennen oder sich extra lang die Hände schrubben, wenn man eine gesehen hatte. Nicht mal, wenn sie tot war. Solang man sie nicht angefasst hat. Und nein, richtig großer Ehrenwortschwur mit Schleife und Knoten, das hatte er nicht. Würde er nie tun. Und dann küsste Frederiks Mutter zum Beweis, wie sicher sie war, seine Handflächen.
They know my name cause I told it to them
Neben Katzen, Dackeln und Tauben bereiteten Frederik damals vor allem Spatzen Sorgen. Genauer: die Spatzengruppe. Insbesondere deren Anführer, Gregor Barthels. Sobald er mitbekommen hatte, wie sehr Frederik sich vor Angespeicheltem und Sandverschmutztem, vor Dreckverklebtem, vor Pfützen, Matsch, Spinnen, Regenwürmern, Insekten, vor ungewaschenen Händen und nahezu allem anderen ekelte, suchte Gregor ständig seine Nähe.
Und immer hatte er etwas Ekeliges dabei, das er ihm vorhielt oder entgegenwarf.
Was im Kindergarten begann, setzte sich in der Schule fort. Manchmal wäre es Frederik lieber gewesen, wäre er einfach gar nicht beachtet worden. Aber irgendein Gregor Barthels fand sich immer, der bestimmte, dass Frederik mitspielte: und dann am liebsten bei Spielen wie Pest & Cholera. Während die anderen lediglich wegliefen, um nicht abgeschlagen zu werden, rannte Frederik Ganser in den Pausen buchstäblich um sein Leben.
But they don't know where and they don't know when / It's coming
Irgendwann passierte das, wovon seine Eltern überzeugt waren, dass genau das irgendwann passieren würde: Es verwuchs sich. Plötzlich hörten Frederiks Ängste auf. Keine Sorgen mehr, unbewusst tierkeimbehaftete Reifen parkender Autos zu streifen. Kein Grübeln mehr darüber, versehentlich ein totes Tier angefasst oder irgendwie, durch die Kanalisation vielleicht, schädliche Dämpfe oder anderes Giftiges, vermutlich Taubiges, eingeatmet zu haben oder unbemerkt von einem todbringenden Insekt gestochen worden zu sein. Von einem Tag auf den anderen keine Fragen mehr nach Krankheitserregern, Infektionswegen und Übertragungswahrscheinlichkeiten. Kein permanentes Rückversichern, kein manisches Kontrollieren, kein übertriebenes Händewaschen und auch kein ständiges Luftanhalten mehr.
Als hätte es das alles nie gegeben.
Frederik Gansers Jugend roch nicht mehr nach Reinigungstüchern, Handdesinfektion und Übervorsicht, sondern nach Sportsocken, Fastfood, Nikotin, Pfeffi und Möglichkeiten. Und später, so ab dem dritten Semester, nach Zuckerwatte und Keksteig: Hannahs Duft.
Hätte er ihn sich tätowieren lassen können, er hätte es sofort gemacht. Am liebsten direkt nach dieser Abrissparty, auf der sie sich kennenlernten. Als es eigentlich um „nur noch austrinken und eine rauchen noch und dann aber wirklich los“ ging, stand Hannah vor ihm. Drückte ihm ein neues Bier in die Hand, stieß mit ihm an und meinte, sie hätte eine Wette verloren.
Worum es bei der Wette ging, verriet sie Frederik nicht. Weder an dem Abend noch später irgendwann. Ihm war das egal. Er war froh, dass er Teil des Einsatzes war und vor allem darüber, dass sie verloren hatte.
Oh, when, but it's coming
Warum dann alles wieder so kam, wie es kam, konnte er sich selbst nicht erklären. Weit über 200 verschiedene Kopfschmerzarten unterscheidet die Internationale Kopfschmerzgesellschaft. WEIT ÜBER 200! Das kann man nachlesen! Ebenso, dass über 90 Prozent aller Erkrankungen primäre Kopfschmerzen sind, meistens Spannungskopfschmerzen oder Migräne. ÜBER 90 PROZENT! Und alles, das zu wenig an Schlaf und Bewegung, das zu viel an Prüfungsstress und Kaffee, wirklich alles sprach dafür, dass es auch bei ihm genau das war: Spannungskopfschmerz. Und trotzdem: Ein Befund musste her. Ein Bild. Irgendwas Offizielles, das Frederik seiner schlimmsten Befürchtung entgegenlehnen konnte. Am besten sofort.
Hannah hatte ihn zum Klinikum gefahren. Ihn beruhigt. Und recht gehabt. Dasselbe, als der Kopfschmerz weg war, dafür das Kribbeln da und sie ihn auf sein Drängen hin zur Neurologie fuhr. Ein andermal dann in die Gastroenterologie: Obwohl er eigentlich gar keine Magenschmerzen mehr hatte, aber trotzdem auf Nummer sicher gehen wollte. Trotzdem auf Nummer sicher gehen wollte er auch beim Augenarzt. Und beim Dermatologen. Und in der HNO-Klinik. Ebenso, als es er einen Termin in der Pneumologie vereinbarte und kurz darauf in der nächsten, weil gravierende Symptomlosigkeit ihn doch stark am unauffälligen Befund zweifeln ließ.
Je öfter Hannah ihn begleitete, je öfter sie ihn beruhigte, je öfter die Befunde seine schlimmsten Befürchtungen entkräfteten und ihre Vermutung bestärkten, desto unverstandener fühlte Frederik sich. Vom Termin in der Kardiologie, den er sich aufgrund zwar einmaliger, aber umso eindeutigerer Abweichung hatte geben lassen, hatte er Hannah erst gar nicht erzählt. Mitbekommen hatte sie trotzdem, dass, so sagte sie es, doch wieder irgendwas sei. Ob er glaubte, sie bekäme nicht mit, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Dass er genau das ja auch befürchte und das deswegen jetzt endlich auch mal kardiologisch eingeordnet haben wollte, hatte er geantwortet. Und falls das nichts brachte, dann eben nochmal neurologisch, pulmologisch, angiologisch und was diagnostisch eben noch alles notwendig oder möglich sei. Dass er schon wüsste, was sie sagen wollte. Trotzdem. Er wollte das jetzt endlich abgeklärt wissen. Und zwar ernsthaft.
If some night I don't come home / Please don't think I've left you alone
So sehr Frederik sich vornahm, sich abzulenken, so wenig gelang es ihm. Die Bibliothek, Spaziergänge, Wald, Park: zu ruhig. Die Mensa, Partys, Kino, WG-Abende: zu unruhig. Sport: zu riskant. Prüfungen: zu egal. Hannah: zu unsensibel. Nur wenn er im Behandlungszimmer saß und hörte, dass es „keinerlei Auffälligkeiten oder Grund zur Besorgnis“ gäbe, löste sich Frederiks Anspannung kurzzeitig.
Dass sie so nicht weitermachen könne und auch nicht mehr wolle, hatte Hannah gesagt. Dass sie es nicht ertrage: Seine Versessenheit, seinen abwesenden Blick, sein Desinteresse an allem und allen, sie eingeschlossen, all das ertrage sie einfach nicht mehr.
Hannah war es, die ihm die Therapie nahelegte. Frederik war es, der sie nach zwei Terminen abbrach, nachdem ihm dieser Dr. med. ein paar Tabletten mitgegeben hatte, die Frederik erstmal bis zur nächsten Sitzung nehmen sollte. Verpackung oder Beipackzettel gab es nicht. „Und zwar ganz bewusst nicht“, wie dieser Dr. med. betonte. Als ob Frederik nicht in der Lage wäre, anhand der Informationen auf dem Blister im Handumdrehen herauszufinden, dass das Medikament bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff nicht angewendet werden durfte. Und bitte wie hätte dieser Dr. med. eine solche Überempfindlichkeit ausschließen können? Nicht mal Frederik selbst konnte das! Statt ihm zu helfen, gab ihm dieser Facharzt, das muss man sich mal vorstellen, ein FACH-ARZT (!), also irgendetwas, das er noch rumliegen hatte. Wahrscheinlich sogar abgelaufen. Etwas, das bei 1 bis 10 von 1000 Behandelten einen Krampfanfall verursachen kann. Etwas, dessen mögliche Nebenwirkungen wie Fieber, Desorientiertheit sowie steife, zuckende Muskeln sich vereinzelt bis zum Blutdruckabfall steigern und sogar zu lebensbedrohlicher Verkrampfung der Atemmuskulatur, sprich, zum Tod, führen können! Na danke auch!
Dafür, dass Frederik nicht mehr hingegangen war, hatte Hannah sogar Verständnis. Kein Verständnis hatte sie allerdings dafür, dass er nicht irgendwo anders hinging. Wo er sich doch sonst auch immer eine Zweit-, oftmals sogar eine Drittmeinung einholte.
The same place animals go when they die
Getrennt hat sich letztendlich Frederik. Dass er sich wünschte, so unbeschwert und naiv zu sein wie sie, hatte er gesagt. Dass er ihr Therapiegerede einfach nicht mehr ertrage. Dass er gar nicht wüsste, was die bringen sollte – er litte ja nicht an Gesprächsbedarf. Und seit wann sie eigentlich einen Abschluss in Psychologie habe? Was er jedenfalls nicht habe, nicht mehr, sei die Kraft, ihr, damit sie endlich aufhörte, zu nerven, vorzugaukeln, dass alles in Ordnung sei und er gesund. War er nun mal nicht.
Dabei macht er alles nur Machbare: richtet sein Ernährungs- und Schlafverhalten nach Gesundheits-Apps aus und seine Tage nach Stressvermeidung. Nimmt alle nur erdenklichen Untersuchungen wahr, häufig sogar als Selbstzahler. Versuchte es mit Yoga. Atmet, wann immer und so gut es ging nach Techniken, die er bei Onlinekursen kennengelernt hatte. Kontrolliert seine Vitalwerte so oft wie nötig und so selten wie möglich: alles mit Qualitätsgeräten vom Testsieger. Studiert regelmäßig die Warnhinweise und Rückrufaktionen auf der Website des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, um schnellstmöglich handeln zu können. Was hieß: Schlüssel nehmen und los. Achtet auf seine Körpersymptome und noch stärker auf seine Intuition. Statistik hin oder her. Ohnehin ein Begriff, den er neben „Übervorsicht“, „Wahrscheinlichkeit gegen Null“ und „Restrisiko“ nicht mehr hören kann. Frederik merkt doch, wenn etwas nicht stimmt. Er denkt sich das doch nicht aus.
Oh, when is it coming? / Keep the car running
Frederik kann es schlagen hören … hämmern … rasen. Okay. 7 mal 14 minus Klammer auf 56 plus 19 Klammer zu. Puuuuh. Mathe. Punkt vor Strich. Minus vor Plus. Erst die Klammer, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Verdammt, wie war das denn nochmal?!
Das bringt doch nichts! Wer auch immer dazu geraten hatte, sich in Momenten wie diesen mit Rechenaufgaben abzulenken, hatte ganz sicher nie Momente wie diesen erlebt. Wie alt sind nochmal die letzten Bilder? MRT? CT? EKG? Blutbild? Drei Monate? Vier? Noch älter?
Stimmt schon, dass alle Aufnahmen und Werte zum Zeitpunkt der Untersuchung unauffällig waren und noch im Normalwertbereich. „Zum Zeitpunkt der Untersuchung“! „Noch“! Und jetzt komm ihm nochmal wer mit Mathe oder ruhig bleiben! Genug jetzt. Da stimmt etwas nicht. Und zwar ganz gewaltig nicht. Frederik Ganser kennt seinen Körper. Er merkt doch, wenn da was nicht in Ordnung ist. Von einem 127-zu-82er lässt er sich nicht täuschen.
Stichwort: Atypisch. Stichwort: Restrisiko. Stichwort: unklare Genese. Stichwort: vor Apotheken kotzende Pferde. Stichwort: Warum kommen Sie erst jetzt damit?
Nein! Wozu noch das Songende abwarten und Zeit mit der zweiten Messung verschwenden. Jetzt hieß es, Schlüssel nehmen und los: Bördingstraße bis Mehlfelder, dann bis Kreuzung Jessener, scharf links auf die Eimsbühler, weiter bis Mullenberger, hoffen, dass die Schranke oben war, dann gleich auf die Helmkötter, dort dritte links und die Auffahrt hoch bis zum Haupteingang. Auf jede Minute kommt es jetzt an.
.
Anne Büttner
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
17 | Verena Dolovai
lebkuchen im sonnenbad
die glasur glänzt wie
regennasses gras
tropft vom tisch
du wischst
die schokolade weg
verwirrt
irren wir durch die jahreszeiten
war schon winter?
fragt das kind
die katze im sommerkleid
schnappt nach insekten
die zu dicht
in der luft tanzen
wir atmen ein
blasen unsichtbaren hauch aus
das frühe dunkel
hüllt den tag ein
drinnen
glühen unsere wangen nicht
.
Verena Dolovai
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
16 | POEDU: Ari
Ein Maoam
Ein Maoam
klebt vorwärts oder rückwärts
dir die Zähne zusammen und dann
hängts am Gaumen und trotzdem
schmeckts lecker, egal
in welchem Türchen es steckt,
es klebt!
.
Ari (8 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe kam diesmal von Sabine Schiffner:
Erstelle ein Gedicht für ein Türchen von einem Adventskalender, den Du Deiner/m besten Freund:in schenken willst. Mach ihr/ihm also ein Geschenk aus süßen Worten. Schreibe über Deine Lieblingssüßigkeit, oder denk Dir doch einfach eine neue Süßigkeit aus, eine lustige, eklige, oder eine Zaubersüßigkeit.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
15 | Claudia Dvoracek-Iby
„Die gerade Linie ist gottlos“
– Friedensreich Hundertwasser
wir biegen und wir knicken wir formen unser lineares Leben
zu einem kompakten Viereck um und alles scheint nun
geregelt alles scheint nun geordnet sogar eine Sonne scheint
zu scheinen in unserem kantigen Sein denn vom oberen
vom rechten Eck ausgehend strömt kontinuierlich Wärme in
unseren Raum und gerade deshalb erscheint es uns unrichtig
dass nachts immer einer von uns laut weinen muss dass
nachts immer einer von uns abwegige Wörter rufen muss
Wörter wie Wellen Winter Berge Schnee
.
Claudia Dvoracek-Iby
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
14 | Valeska Stach
Der Mann mit der Falte
Ich sehe ihn aus dem Hauseingang stolpern und die Straße hinuntereilen. Am Abend würde ich ihn vielleicht wieder mit einem Buch auf dem Sofa sitzen sehen, durch die nur halb zugezogene Gardine, oder am Küchentisch mit einer Zigarette. Und einem Glas Wein. Oder beidem. Er würde traurig aussehen, wie immer, wenn ich ihn am Tisch oder auf dem Sofa sitzen sehe. Nur wenn er aus dem Haus eilt und die Straße hinunter zur U-Bahn oder zum Späti an der Ecke läuft, da sieht er nicht mehr ganz so traurig aus.
Er sagt, er wolle keine Beziehung, er habe dafür gerade keinen Platz im Leben. Ja, und ich, ich habe keinen Platz in meinem Bett, denke ich und tippe mit dem Fuß immer wieder gegen das Stuhlbein. Er lacht. Wieso ich denn eine Beziehung wolle, mein Leben sei doch gar nicht dafür eingerichtet. Ich würde doch auch viel herumreisen wollen. Das könne man auch mit Kindern, sage ich und weiß nicht, ob ich mir selber glauben soll. Ich gebe ihm eine Kopfmassage und er stöhnt ein paar Mal zu viel dabei. Sein Blick ist auf die Ecke mit der Falte in der Wand gerichtet. Ich sage, das sei eine Therapie und später, dass wir heute Abend keinen Sex haben werden. Er sagt, das sei gut zu wissen und will dann plötzlich schlafen gehen. Ich gehe nach Hause und stelle mir vor, dass gar kein Platz in seinem Bett ist für zwei Körper. Dass einer immer halb von der Matratze rutscht. Das Bett ist bestimmt genauso schräg wie die Wand mit der Falte. Am nächsten Morgen bedankt er sich für die gemeinsame Nacht und ich frage mich, warum er dabei den Betreff der E-Mail so rätselhaft kryptisch formuliert. Meine Freundin fände er auch gut, sagt er. Bei ihr versucht er es später bestimmt auch noch.
Der Mann mit der Falte in der Wand ist auch der Mann mit den Haaren. So nennen sie ihn. Diejenigen ohne Haare, oder die, mit nur wenig Haaren. Man kann die Hand in seine Haare stecken und sie verschwindet darin. So voll sind sie. Blond. Gewellt. Weich. Wie Wüstensand. Sie hassen ihn dafür, sagt er und lächelt.
Der Mann mit den Haaren mag keine Badewannen, zumindest fehle ihm nichts ohne Badewanne. Man könne auch einfach monatlich in die Sauna, ins Dampfbad oder ins Salzbad gehen. Ich stelle mir vor, wie er nackt auf einer Holzbank sitzt und die Hitze einatmet. Und dass er sich dabei fühlt wie in der Wüste. Das ist kitschig. Der Mann mit den Haaren, die aussehen wie Wüstensand, hat einen Hang zum Kitsch in meinem Kopf. Ich entschuldige mich, dass ich zu spät bin. Er antwortet, „nicht schlimm“ und ich könne ihm ja mal wieder eine Kopfmassage geben.
Der Mann mit der Falte in der Wand hat spontan Zeit für ein Abendessen. Oder Kuscheln, zu dritt, wie er schreibt. Sorry, Missverständnis, meine Freundin ist gerade im Urlaub. Aus dem Abendessen wird ein Kaffeetrinken. Wir sitzen wieder an der Straße, an der Ecke, an der die Tram vorbeifährt und laut neben den Tischen um die Kurve biegt. Ich löffle Milchschaum aus meinem Kaffeeglas und schaue ihn von der Seite an. Ich erzähle ihm, dass ich wisse, was Kuscheln für ein Synonym für ihn sei, dass ich das eingetragen habe, in mein Wörterbuch, damals. Er lacht. Tatsächlich. Das hatte er vergessen. Ach so, nein, das hätte er nicht gemeint. Aber es sei auch keine schlechte Idee. Er meine nur, wir müssten üben, falls es im Winter keine Heizung mehr gibt.
Ich stelle mir vor, wie der Mann mit der Falte in der Wand Pizzateig ausrollt und wie sich dabei immer wieder eine Falte in der Fläche abzeichnet, auf dem Teig, der beim Plattdrücken unter der Küchenrolle weg knickt, sich an einer Stelle überlappt und so eine kleine linienartige, aber plastische Erhöhung in der sonst glatten Masse abbildet. Der Mann mit der Falte in der Wand drückt die Falte im Teig nach unten, aber sie bleibt dennoch sichtbar, bäumt sich auf, schnellt nach oben, lässt sich nicht wegretuschieren. Er rollt mit dem Nudelholz erneut über die Stelle, aber die Falte bleibt im Teig. Tief in die Oberfläche hineingedrückt wirkt sie noch fester, noch unbeweglicher, noch unvermeidbarer.
Die Falte im Pizzateig ist nach dem Backen knusprig und kracht im Mund.
Der Mann mit der Falte in der Wand hat spontan Zeit für ein Mittagessen. „Es ist warm“, sage ich und wir sitzen draußen, wo neben uns wieder eine Straßenbahn vorbeifährt. Nicht nur die Straßenbahn fährt an uns vorbei, Menschen auf Lastenrädern und normalen Fahrrädern fahren an dem Tisch, an dem wir sitzen, vorbei. Und sie winken uns. Oder vielmehr winken sie ihm, dem Mann mit den Haaren und er winkt zurück und die Haare wippen dabei kurz, die Haare, in die man die Hand hineinstecken und verschwinden lassen kann. Der Mann mit den Haaren erzählt mir von der Frau, die er seit zwei Monaten trifft. Dass sie darüber nachdenken, zusammenzuziehen, darüber nachdenken, Kinder zu bekommen. Das ging schnell, sage ich. Dabei führe ich dünne, mit saurer Salatsoße benetzte Mangostreifen zu meinem Mund und sauge sie ein. Wir bekommen von der Bedienung zwei Schokoladenherzen geschenkt. Sie sind in rote Aluminiumfolie gewickelt. Der Mann mit der Falte isst sein Herz und knüllt das Papier zu einer kleinen Kugel, die er über den Tisch rollt. Ich streiche meines auf dem Tisch glatt und forme ein neues Herz daraus. Das flache, plattgedrückte Herz hat kleine Krisselfalten in der roten, metallenen Oberfläche.
Ich stelle mir vor, wie der Mann mit der Falte versucht, die Falte in seiner Wand wegzubügeln, jeden Abend, vor dem Schlafengehen. Und wie die Falte doch immer wieder aus der Tapete quillt. Ich stelle mir vor, wie er trotzdem immer und immer wieder mit der Hand über die gewellte Fläche fährt, bis sie glatt ist. Für einen Moment.
.
Valeska Stach
.https://www.mosaikzeitschrift.at/tag/Sigune-Schnabel
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: