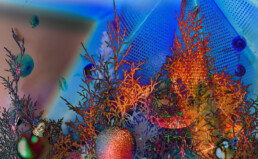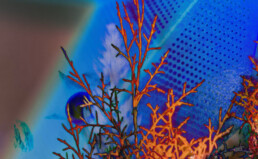16 | POEDU: Wanda & Marie
Wunschliste II
Ich wünschte, ich wäre ein Vogel.
Ich wünschte, dann könnte ich alles sehen.
Ich wünschte, ich wäre eine Giraffe.
Ich wünschte, dann könnte ich ganz weit gehen.
Ich wünschte, ich wäre ein Krokodil.
Ich wünschte, ich lebte im Nil.
Ich wünschte, ich wäre eine Maus.
Ich wünschte, dann wäre ein Loch mein Zuhaus.
Wanda, 8 Jahre alt
***
Ich wünschte.....
Ich wünschte, es gäbe kein Mathe als Schulfach
Ich wünschte, meine Schule wäre in unserem Dorf
Ich wünschte, es gäbe nicht so viele französische Vokabeln
Ich wünschte, ich wäre eine Artistin im Zirkus
Ich wünschte, es gäbe keinen Klimawandel
Ich wünschte, meine Eltern hätten eine Konditorei
Ich wünschte, es gäbe weniger Ferien
Marie, 11 Jahre alt
***
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder.
Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
Dieser Impuls kam von Anke Bastrop:
Poesie und Wünschen sind fest miteinander verbunden, und zwar das ganze Jahr lang. Genau genommen kennt das poetische Wünschen keinen Raum und keine Zeit, keine Bedingungen und keine Grenzen. Stellt euch also vor, euer Wünschen wäre ganz frei. Alles, einfach alles dürft ihr sagen … natürlich auch eure Herzensdingwünsche – alles ist erlaubt ...
>> mehr POEDU-Texte auf mosaikzeitschrift.at
>> zum Bestellen: POEDU – das Buch und POEDU – das zweite Buch
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
15 | Sonja Grebe
Provinzmond
Klirrend kalt, wolkenlos. Der runde Mond strahlt wie Flutlicht vom Himmel. So stechend hell, dass die Dinge Schatten werfen und sie selbst in scharfer, quarzweißer Klarheit hervortreten, überscharf; ich betrachte entfernte Häuschen durch die Lupe aus gläserner Luft und kann jede Dachpfanne einzeln glitzern sehen. Dunkel schimmern das Gefieder der Krähen, die in der Pappel schlafen, die nassen Steine im Bach, Flaschenscherben an der Regiobus-Haltestelle, Isolatoren an Weidezäunen, Misteln, Hagebutten, die Bugwellen eines Kanalschiffs. Im Weltall-Licht entziffere ich, was mir die Risse und Teerflicken der Landstraße buchstabieren. Das Licht glasiert ausgeblichene Schilder, „Zum Dorfkrug“, „Änderungsschneiderei“, „Schlachterei und Partyservice“, „Spielhalle“, es löscht oder verbläut Farben, es versilbert die Nachtstunden der Füchse, Feldmäuse, Kleinkinder und wem sonst noch mit Uhrzeigern nicht geholfen ist. Alles gleißt still. Unterm Mond wird alles überdeutlich und zugleich unbeschaulich. Der kirschrote Rahmen des leeren Kaugummiautomaten glänzt tollkirschdunkel, die Nietbolzen der Kanalbrücke sind metallische Käferpanzer, der Horizont ist ein Streifen Magnetband. Gartenschaukeln, Bänke, Jägersitze, ein Bauschutt-Container (5 Kubik), Strommasten, Storchennester, die örtliche Motorsirene, der rostige Baukran, freistehende Bäume sind jetzt Skulpturen, rätselhafte Kultobjekte. Die Strahlung ergießt sich in die flächige Weite, sie sickert hinab zu den Knollen und Engerlingen in der Erde, drängt hinein in die Höhlen der Tiere und auch in die Häuser, Boote und Autos der Leute, sie erfasst alles, kennt alles persönlich. Mich genauso. Der Mond sieht mich spazieren gehen. Der Mond sieht mich einen Stein aufheben, von dem ich kurz glaubte, er würde atmen. Da rauscht ein VW Passat – heraldisches Gerät dieser Region – um die Kurve und spuckt Musik. Soweit kein Ereignis. Aber die Musik, die jetzt an mir vorüber schwallt, kommt hier sonst nie vor: 54-46 was my number höre ich Toots & The Maytals singen. Mondweiße Wildschweine würden mich weniger verwundern. „Solche Leute gibts hier?“ Der Mond blinzelt nicht mal. „Wie lange weißt Du schon davon?“, frage ich ihn vorwürfig.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
14 | Karl Johann Müller
nach den Farben der Raureif
im ersten Raureif Bilder meines Sommers
sie spiegeln mein Erinnern an neulich
eine flüchtige Sonne hat sie in den Farben
des Herbstes auf wandelnde und bald
fallende Blätter gezeichnet
die sich im Sinken dem Vergehen nähern
lautlos tropfen sie als Zeichen des Verfalls
von der Gleichmäßigkeit des Zeitenwindes
beständig geschaukelt auf einen Boden
der den Schnee schon auf sich fallen sieht
und du
die du wie ich die Falten zählst im Gegenlicht
des tagsüber tauenden Raureifs
du hast dir dein Haar schon gebürstet
wie ich
wenn die Kälte kommt
möchten wir schön sein
farbig und prächtig wie die Laubbäume
im Oktober
unsere Gedanken sind geerntet
gekeltert
unsere Haut färbt sich dem Ende zu
wo kein Frühling mehr wartet
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
13 | Dominik Kohl
Robben
Plötzlich war da ein Kopf im Wasser.
Schwarz gerundet, glänzte
Verlängerung, die fleckigen Steine
verknüpften treibend Algen. Tauchte
unter unter Riffel Oberflächen, wo
Wind ging. Zerriebene, zerstoßene Stücke
Muscheln lagen herum. Ein Stück
weiter wieder derselbe Schädel
oder ein anderer dehnte die Spannung der Wellen.
Kompakter Körper, unsichtbar, streckte sich schnell,
später. Noch einmal
am Ufer. Ebbe. Windstöße
an Stirn. Zusammengeballt das Meer, du
warst nicht allein. Weiter unten
die schräggefallene Seite der Berge.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
12 | Laura Kind
Schwestern
Wind kommt auf. Ich spüre die Steine unter den Sohlen, das Salz auf meinen Lippen. Das Licht bricht sich in den Kristallen und verbrennt meine Lippen, bis sie kleine Bläschen bilden. Doch das ist später. Jetzt schmecke ich noch das Salz und fühle den Wind, die Erde unter den Füßen. Der Weg ist eng und ich muss ausweichen, als wir von einer Gruppe Wandertouristen überholt werden. „Amis“, sagt Jasna und ich nicke, was sie nicht sehen kann. „Michigan“, sage ich und denke, dass ich noch nie in den USA war. Ich schaue an mir herunter, auf meine Tchibo-Sporthose und die Meindl-Wanderschuhe. Dann hefte ich den Blick wieder auf den Rücken der Schwester. Sicher setzt sie einen Fuß vor den anderen. Ihr Schritt ist zügig und ich muss mir Mühe geben mitzuhalten.
„Alles okay da hinten?“
„Alles okay.“
„Komm, wir machen eine Pause.“
„Nicht nötig.“
Sie muss sich nicht umdrehen, damit ich ihre Zweifel im Gesicht sehen kann, die hochgezogenen Augenbrauen, die gerunzelte Stirn. Sie ist die Sportliche von uns beiden, egal wie viele Kilometer ich joggen gehe und wie viele Kilos ich abends nach der Arbeit im Gym stemme. Jasna läuft vorneweg und ich laufe hinterher. Ihre Füße finden ohne Zögern den nächsten Stein und ich setze meinen Fuß auf genau dieselbe Stelle. Manchmal gehe ich extra einen schwierigeren Weg, um nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Doch meist wirft mich das dann ein paar Meter nach hinten und Jasna muss auf mich warten. Die Sonne bricht durch das Geäst und sprenkelt den Weg vor mir mit zuckenden Lichtern. Der Rosmarin wächst hier in üppigen Büschen. Der Oleander leuchtet im Staub. Ab und an blitzt das Blau des Meeres durchs Grün.
Ich spüre, wie meine Waden krampfen. Mein BH-Träger reibt schmerzhaft über einen Mückenstich. Es war Jasnas Idee, diesen Urlaub zu machen. Dabei haben wir eigentlich genug zu tun. Die Wohnung muss ausgeräumt werden und das kann dauern. Der Vater war ein Sammler. Er hat alles Mögliche konservieren wollen: Korken, Zuckertütchen aus Cafés, in denen er mit Mutter war, alle Ausgaben der Zeit. Doch Jasna hat darauf bestanden: „Jetzt, wo wir nur noch zu zweit sind. Da wäre das doch gut für uns, meinst du nicht?“, hat sie gesagt. Ich höre noch ihre aufgesetzte Fröhlichkeit durch den Telefonhörer. Das ist ihre Stimme, wenn sie sich selbst überzeugen will, wenn sie mir und sich sagen will, dass alles in Ordnung ist. Und dann ist es meine Aufgabe schnell einzustimmen, um das zu bestätigen. „Okay“, habe ich gesagt und meine Stimme nahm den Klang ihrer an und wir sagten beide „Schön.“, und legten auf.
Der Weg wird immer steiler. Die Sonne steht höher am Himmel und brennt mir im Nacken und auf der Kopfhaut. Ich hätte einen Hut mitnehmen sollen. „Willst du meinen?“, hat Jasna im Hotel gefragt, bevor wir losliefen. Ich musste nicht antworten. Die Schwester wusste auch so, dass ich ablehnen würde. Jasna wirft mir einen Blick zu. „Ganz schön anstrengend, was?“ Sie blickt mich dabei fröhlich an und sieht überhaupt nicht angestrengt aus. Mein T-Shirt klebt an meinem unteren Rücken. Ansonsten ist alles trocken: Der Staub unter meinen Fußsohlen, das Geäst, wie es knackt, wenn ich es zur Seite schiebe, meine Kehle, denn ich habe natürlich zu wenig Wasser eingepackt.
„Hier ist es.“ Meine Schwester steht auf einem Plateau und deutet mit dem Finger auf den Abgrund. „Schön, nicht wahr?“ Die Felsen schneiden scharf in den blauen Himmel, der über dem Azur des Wassers verblasst. Gewaltige Wassermassen schlagen gegen die Steilküste, doch hier oben ist nichts davon zu hören. Der Wind legt sich über meine Ohren, verschließt sie vor jedem Geräusch. Mit der nächsten Böe verliere ich kurz das Gleichgewicht. Die Angst vor dem freien Fall ist ein kraftvolles Lehnen gegen den Wind, verzögert um eine halbe Sekunde, die mich vor mir selbst erschrecken lässt.
Jasna steht direkt neben der Abbruchkante. Der Wind wirbelt ihre Haare durcheinander, so dass ich ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen kann, wie damals, kurz bevor wir ins Meer sprangen. Ich erinnere mich an den Sog, der an meinen Beinen, an meinem ganzen Kinderkörper riss, spüre noch die Strömung, die mich herumwirbelte, als wäre ich kein Kind, sondern bereits Schaum geworden. Ich erinnere mich an die Angst, die sich in mir breitmachte, mir den Atem nahm, ebenso wie das Wasser. Ich sah die Schwester, die das Wettschwimmen gewonnen hatte, natürlich hatte sie das, und die jetzt zum Strand schwamm. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist das Gesicht des Vaters, in das ich Wasser spuckte.
Jasna blickt mich jetzt erschrocken an. „Vorsicht!“, ruft sie. Dann zieht sie mich zu sich. „Du musst aufpassen!“ Ich schüttele den Kopf. „Ist doch alles gut“, doch mein Herz klopft in der Kehle, so dass sich die Worte ganz dünn machen müssen, um am Herzen vorbeizukommen. „Nichts passiert.“
Jasna holt tief Luft. „Weißt du, ich habe keine Lust, dass du auch…“
„Was?“
„Wir sind nur noch zu zweit.“
„Und was ändert das?“, will ich sagen, aber ich zucke nur mit den Schultern und laufe an der Schwester vorbei. Auf dem Geröll rutsche ich ein paarmal weg, verlangsame meine Schritte aber nicht. Am Ende des Weges bleibe ich stehen. Ich setze mich auf einen Stein und blicke auf den Hafen. Die Schiffe liegen sanft schaukelnd nebeneinander. Der Wind hat sich beruhigt. Das Wasser liegt wie ein ausgebreitetes blaues Tuch vor mir, nur dann in Falten geworfen, wenn jemand mit seiner teuren Yacht in den Hafen steuert.
Ein Schatten läuft über den Weg und bleibt vor mir stehen. „Deutscher“, sagt Jasna.
Ich betrachte den Mann, der seine Jolle in den Hafen fährt. „Vielleicht“ sage ich.
„Kommst du mit schwimmen?“
Ich schüttele den Kopf und stehe auf. Dann gehe ich zum Hotel und packe meine Sachen.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
11 | Kerstin Hatzi
Glitzer im Gesicht
Schillern ist ein schwaches Verb, sagst du. Und ich nicke, obwohl wir beide etwas vollkommen anderes meinen.
Das ist eine Geschichte, die Sie so oder so ähnlich schon tausendmal gehört haben. Aber man glaubt ja immer, man selbst sei etwas Besonderes, oder?
Also: ICH
Ich bin in einer Stadt, die sehr nah an der Stadt ist, die einmal meine war. Ich bin in einer Stadt, die oft als pittoresk oder malerisch, manchmal auch nur als charmant beschrieben wird. Ich lasse mich davon nicht beirren. Denn: Es ist eine Stadt wie für mich gemacht. Eine mit der genau richtigen Anzahl an Menschen, zu viele, um ganz zu verschwinden, zu wenige, um nie wieder aufzutauchen. Eine mit ausreichend Gassen, um sich zu verlaufen und einer Sprache, die ich nicht spreche. Ich bin seit elf Tagen in dieser Stadt und war noch nicht beim Amt. Habe bisher keinen Supermarkt von innen gesehen, die Wohnung nicht eingerichtet, mit niemandem so etwas wie ein Gespräch geführt. Aber ich habe ein Café gefunden, eines mit durchgesessenen Polstermöbeln und Plastikblumen am Tisch, wo es immer irgendwie nach Rauch und Frittierfett riecht, obwohl keine Speisen serviert werden. In diesem Café trinkt nie, wirklich nie jemand Kaffee, sondern nur Bier und Wein und wenn gar nichts mehr geht, dann einen Kurzen.
Und so sitze ich jeden Abend in dem Café, das eigentlich eine Bar ist, und trinke ein Glas Wein, rauche, schreibe und frage mich: Bin ich jetzt offiziell Autorin oder nur ein Klischee?
Und DU…
Du sagst: Du hasst Menschen, aber liebst deine Freund:innen.
Du isst seit fünf Jahren kein Fleisch, aber Leberkässemmel einmal im Monat muss einfach sein.
Du findest Montage schmecken salzig und Donnerstage sind blau.
Du kannst das Meer nicht riechen und schwitzt nur an der Nase.
Du rechnest mit deinen Fingern und kannst bis heute kein Rad schlagen. Und es ist dir egal.
Du bist lieber laut als leise. Zu spät als zu früh. Zu viel als zu wenig. Mehr Bauch- als Kopfmensch.
Du liest Romane nie, wirklich nie zu Ende, aus Prinzip, sagst du und funkelst mit deinen grünen Augen, die manchmal blau, manchmal grau sind.
Manchmal glaube ich, alles über dich zu wissen. Jeden Schritt und jeden Atemzug vorhersehen zu können.
Aber wo du jetzt gerade bist, was du tust, denkst oder fühlst, das weiß ich nicht.
Also: ICH
Liege da, Arme und Beine von mir gestreckt, liege da und starre an die Zimmerdecke, liege da und schwitze in mein Leintuch, liegt einfach da, in diesem, meinem Zimmer, das sich fremd anfühlt, in dieser, meiner Wohnung, die noch kein Zuhause, in der Gerüche noch nicht vertraut, Geschichten noch nicht Einzug gehalten haben.
Mein Blick wandert durch den Raum und bleibt an meinem Leben hängen, das in 6 Umzugskisten, 2 Koffer und 4 Ikea-Tüten passt. Vor zwei Wochen und drei Tagen in der hintersten Ecke des Zimmers abgestellt, seit zwei Wochen und drei Tagen nicht mehr angerührt.
Schreibtisch, Klappstuhl, Schrank, Bücherregal, das ohne Bücher eigentlich streng genommen nur ein Regal ist. Alles an seinem Platz, alles so wie es die Mieterin vor mir verlassen hat. Nur die feine Staubschicht, die ist neu.
Als ich meiner Mutter vor drei Tagen am Telefon von dem Umzug erzählte, nannte sie ihn ein „mutiges Projekt“. Ich wollte sie korrigieren. Wollte einwerfen, dass es sich hierbei um nichts Geringeres als um mein Leben handelt. Aber ich schwieg. Für meine Mutter ist seit der Scheidung alles ein Projekt: Töpferkurs, Darmreinigung, Mutterschaft. Mein Vater war nicht zu erreichen. Also schrieb ich ihm eine SMS, schrieb, dass ich raus musste, aus der Wohnung, der Stadt, sogar aus dem Land. Er antwortete per Mail. Schrieb, ihm tue das alles schrecklich leid für mich, aber, und das müsse er jetzt auch mal sagen als mein Vater, er müsse sagen, dass ihn das alles nicht wundere, eine Expertin für das Leben sei ich schließlich noch nie gewesen.
Und DU…
Wenn du lachst, bebt der ganze Körper. Die Mundwinkel ziehen nach oben, die Nasenlöcher weiten sich, die Augen werden zu schmalen Schlitzen. Wenn du lachst und prustend deinen Kopf nach hinten wirfst, wenn du lachst und mit den Händen auf deine Schenkel klopfst, drehe ich mich beschämt zur Seite.
Wenn du einen Raum betrittst, nimmst du ihn ein. Du machst das nicht absichtlich. Aber du machst es und bist in Sekundenschnelle mit allem eins. Mit jedem Menschen, jeder Zimmerpflanze, jedem Molekül. Wenn du einen Raum betrittst und in deinem Element bist, alles und jeden in dich aufsaugst, raubst du mir die Luft zum Atmen.
Also: ICH
Ich sitze in dem Café, das eigentlich eine Bar ist, und scrolle mich stundenlang durch alte Fotos am Handy. Ich sehe diese Frau, Anfang/Mitte Dreißig.
Die Frau isst Döner, vegetarisch, aber mit Zwiebeln, viel Zwiebeln
und trinkt Cola, nicht light, sondern normal.
Die Frau reist allein durch Vietnam und streichelt Esel in Marokko
Sie gewinnt im Backgammon
und zockt im Casino
Die Frau knutscht Fremde
und tanzt barfuß in Clubs
Sie trägt Glitzer, oft und viel Glitzer im Gesicht.
Und ich erkenne die Ähnlichkeit, ich kenne die Frau, aber ich weiß, ich kann das nicht sein. Ich kann das nicht sein, weil ich weiß, was ein Foto nicht ist:
ein Abbild,
ein Ausschnitt,
ein Dokument der Wirklichkeit.
Ich sitze in dem Café, das eigentlich eine Bar ist und schreibe in mein Notizheft. Ich schreibe: Was es bedeutet zu gehen, Doppelpunkt. Ich schreibe:
Du wirst nicht essen.
Du wirst nicht schlafen.
Du wirst nachts Geister jagen.
Du wirst nicht eine, sondern 20 Hände brauchen, die dich halten und die ersten Meter tragen.
Du wirst in dich zusammenfallen und immer weniger und weniger, aber alle werden sagen: Gut sieht sie aus.
Du wirst nicht alles, aber das meiste in Frage stellen.
Aber am Ende wird es besser sein.
Weil ich nicht Schritt halten kann
und du eine 5er Pace hast.
Weil ich neben dir immer ein bisschen weniger Feministin bin
und du immer nur du.
Weil ich irgendwann mehr sein möchte als nur eine Aneinanderreihung von Möglichkeiten
und du doch nur in deiner Inkonsequenz konsequent bleibst.
Und dann erinnere ich mich wieder, an den Moment:
Drei Tage bevor ich die Wohnung, die Stadt, ja sogar das Land verlassen musste.
Wir stehen im Badezimmer. Es ist schon hell, wir waren noch nicht im Bett, wir haben wie so oft die Tanzfläche zu spät verlassen.
Schillern ist ein schwaches Verb, sage ich und nicke. Schaue in den Spiegel. Sehe meine grünen Augen, die manchmal blau, manchmal grau sind. Sehe die kleinen Schweißperlen auf der Nase. Sehe zu viel Farbe, zu viel Glitzer, zu viel von dir. Nur mich – mich sehe ich nicht.
Das ist eine Geschichte, die Sie so oder so ähnlich schon tausendmal gehört haben. Das ist eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich oder ganz anders zugetragen hat. Und ich denke mir, ich will das niederschreiben. Will mich aufs Papier bringen. Neu verfassen. Aber ich finde den Ausdruck nicht. Alles schon gesagt.
Und trotzdem weiß ich irgendwie: Ich bin noch nicht auserzählt.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
10 | blumenleere
relativ spaet doch noch eltern geworden
der wunsch zog sich durch turbulente jahre
zwischen reisen & frust arbeit selbsterfahrung
wohinter langsam meine komplexe erloschen
aber keine chance ihn real werden zu lassen
kein mensch der bereit dazu gewesen waere
bis ploetzlich nach dem zenit des erbluehens
eine alles veraendernde begegnung liebe halt
die karten neu mischend das leben umformte
gerade als unmerklich schon mein rueckzug
einsetzte & ich mehr & mehr begann eigene
einstmals beschrittene wege zu reflektieren
statt andre zu erfinden & dadurch zu finden
ja genau & nun wohnen wir zwei zusammen
mit ebenso vielen aeuszerst jungen kindern
das groeszte uns vorstellbare glueck welches
allerdings zugleich saemtliche unsrer nischen
fuer ruhe sowie akkumulierte zeitraubende
leidenschaften hobbies faulenzen dezimiert
o tagtaeglich konstatieren wir ein schwinden
unsrer kraefte & blicken durchaus mit furcht
gen zukunft werden wir es wirklich schaffen
ihnen zaertlich & stabil hilfestellung rueckhalt
& auch einfach zahllose schoene erinnerungen
zu ermoeglichen oder lasten wir ihnen buerden
auf hindernisse & tiefergehende verletzungen
narben denen sie irgendwann dann erwachsen
ohne ihre schuld rechenschaft zu tragen haben
sicher only time will tell vorweg jedenfalls
nutzen wir das angebot kultureller erguesse
& feiern innen halb blosz ueberzeugt auszen
die maske der verstellung ihretwegen zeigend
was die sozialen ueblichkeiten uns massenhaft
einfloeszen in der hoffnung solche tradierten
gefaengnisse & zwaenge zumindest huebsch
genug auszuschmuecken dass sie sie vielleicht
eine geraume weile lang fuer freiheit halten
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
9 | POEDU: Jonne & Karline Schlumperbein
Jonnes Wunschgedicht für Nono
...
Ich wünschte, ich hätte eine Torte.
Ich wünschte, es wäre Omas Nusstorte.
Ich wünschte, ich wäre so klein, dass ich durch ein Schlüsselloch schlüpfen kann.
Ich wünschte, ich wär so groß, dass ich gegen den Wolkenpalast stoßen kann.
Ich wünschte, ich könnte fliegen.
Ich wünschte, ich hätte eine Rüstung, mit der ich durch Lava tauchen kann.
Ich wünschte, dass alle Menschen das können, was ich kann.
...
Jonne, 5 Jahre alt
***
Der Wunschzettel
Ich wünschte, ich könnte mir alles kaufen, was ich will.
Ich wünschte, die Werbung wäre für immer still.
Ich wünschte, ich könnte mich teleportieren.
Ich wünschte, ich würde niemals verlieren.
Ich wünschte, die Welt wäre ohne Plastik.
(Das wär' fantastic!)
Ich wünschte, ich könnte ein Jahr im Swimming Pool bleiben
und jeden Tag einen Wunschzettel schreiben.
Ich wünschte, ich hätte ein eigenes KINO!
Ich wünschte, ich hätte ´nen handzahmen Dino.
Ich wünschte, es gäb keine Kriege.
Ich wünschte, dass ich fliege.
Karline Schlumperbein, fast 8 Jahre alt
***
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder.
Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
Dieser Impuls kam von Anke Bastrop:
Poesie und Wünschen sind fest miteinander verbunden, und zwar das ganze Jahr lang. Genau genommen kennt das poetische Wünschen keinen Raum und keine Zeit, keine Bedingungen und keine Grenzen. Stellt euch also vor, euer Wünschen wäre ganz frei. Alles, einfach alles dürft ihr sagen … natürlich auch eure Herzensdingwünsche – alles ist erlaubt ...
>> mehr POEDU-Texte auf mosaikzeitschrift.at
>> zum Bestellen: POEDU – das Buch und POEDU – das zweite Buch
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
8 | Sigune Schnabel
Aufbegehren
Ich schreibe ein Gedicht aus Stille
und aus Schlaf.
Den Herbst leg ich hinein
und letztes Grün.
Durch mein Zimmer geht der Winter.
Schnee fällt auf den Teppich
und Wind fegt in die Küche.
Ich bin das Haus.
Der Herbst ist schon vorbei.
In meiner Kammer schlägt ein Herz
die Nacht entzwei.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen:
advent.mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
7 | Jutta Schüttelhöfer
Der Ententeich
Ihre Schritte knirschen auf dem leicht abfallenden Schotterweg. Sie geht langsam, vorsichtig, um nicht erneut zu stürzen. Vor einer Woche gab es ein paar frostige Nächte. Da hat sie in der Dunkelheit früh morgens auf dem gefrorenen Boden den Halt verloren. Ihr rechtes Knie ist noch immer blaugrün verfärbt. Aber zimperlich war sie nie. Sie zwingt sich trotz Schmerzen in Bewegung zu bleiben.
Sie ist jetzt 94. Inzwischen ist sie immer zu früher Stunde auf den Beinen. Ihre schmerzenden Knochen treiben sie zeitig aus dem Bett. Früher liebte sie es auszuschlafen. Manchmal begann ihr Tag erst zur Mittagszeit. Aber das ist lange her. Wenn sie nun morgens noch vor der Dämmerung allein in ihrer Wohnung hockt und neben ihrem eigenen Atem bloß das Ticken der Küchenuhr die Stille durchdringt, verlässt sie zuweilen bereits in der Dunkelheit das Haus, um nicht in tiefer Einsamkeit zu versinken. Die Geräusche des anbrechenden Tages außerhalb ihrer Wohnung verleihen ihr ein Gefühl von Lebendigkeit, das sie drinnen allzu oft vermisst.
Heute hat sie jedoch eine Weile gebraucht, bis sie das Haus verlassen konnte. Ihre Schlüssel lagen nicht am vorgesehenen Platz auf der Flurkommode. Seit über 30 Jahren wohnt sie hier. Seither liegt ihr Schlüsselbund, wenn sie nicht unterwegs ist, immer in der kleinen Keramikschale auf der alten Kommode aus Mahagoniholz. Bloß heute nicht! Über eine halbe Stunde suchte sie vergeblich danach, ohne eine Erinnerung zu haben, wann sie diesen das letzte Mal in der Hand hatte. Mehr zufällig fand sie ihn schließlich auf ihrem Nachttischchen.
In letzter Zeit passiert das öfter. Gegenstände verschwinden und tauchen plötzlich an Orten wieder auf, wo sie sie sicher niemals hingelegt hat. Erklären kann sie sich das nicht. Inzwischen hat sie allerdings aufgehört, über diese Seltsamkeiten nachzudenken. Sie möchte nicht kostbare Lebenszeit mit Grübeleien verschwenden. Zumal ihr alle diese Vorkommnisse bisher ein Rätsel geblieben sind. Ganz egal, wie lange sie darüber auch sinnierte.
Der scharfe Wind weht ihr eisig ins Gesicht. Es sind höchstens ein bis zwei Grad über null, denkt sie und zieht sich die Wollmütze tiefer in die Stirn. Am Ententeich setzt sie sich auf eine Bank. Stehen kann sie nicht mehr lange, denn nach wenigen Minuten protestieren ihre Knie. Auch das Laufen fällt ihr schwer und die Strecke ist mittlerweile, obwohl der Park nicht weit von ihrer Wohnung entfernt ist, eine kleine Herausforderung für sie. Trotzdem kommt sie oft hierher. Sie liebt die Ruhe, besonders am frühen Morgen.
Langsam durchdringt die Feuchtigkeit der zum Teil mit Moos überzogenen Holzbank den dünnen Stoff ihrer Hose. Normalerweise hat sie eine Plastiktüte als Sitzunterlage dabei, doch auch die scheint heute auf mysteriöse Weise verschwunden zu sein.
Die Enten hocken schlafend an der Uferböschung. Ihre Schnäbel tief im dichten Gefieder vor der Kälte geschützt. Die Brötchentüte knistert, als sie sie aus ihrer Handtasche zieht. Ein paar Enten drehen die Köpfe in ihre Richtung. Sie schüttet die Krümel auf den Rasen und sieht zu, wie Leben in die Gruppe kommt. Eine Weile beobachtet sie, wie die Tiere sich auf das Futter stürzen. Dann lässt sie ihren Blick staunend über den See gleiten, als betrachtete sie ihn zum ersten Mal in ihrem Leben.
Sie genießt die Ruhe, lauscht auf das Schnattern zu ihren Füßen und fragt sich, warum sie diesen wundervollen Ort nicht schon früher einmal besucht hat. Als die Sonne hoch über dem Park steht, sitzt sie noch immer auf der Bank. Wenn sie sich doch nur erinnern könnte, wo sie zuhause ist.
Das Advent-mosaik begleitet dich mit ausgewählt schönen Texten durch die Vorweihnachtszeit.
Jeden Tag kannst du ein neues Türchen öffnen: