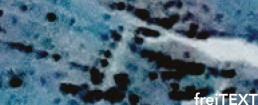freiTEXT | Simone Scharbert
MIMOSEN
unsere stirn ein neigen
wir atmen entwegt
nähe also konzentrierte haut
nervenzweige rastern die luft
wir hören spüren wir lauschen
sind staunen sind halt sind
lose nastisches gewebe warten
auf reiz gegebene bewegung
legen schulterblätter sacht
auf falten einander
wehen im arm
Simone Scharbert
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Helene Ziegler
Zeitlupe
Die Uhr macht tick und tack und tick und tack und tick und tack den ganzen Tag. Doch worauf warten wir? Warum leben wir? Warum sind wir hier, auf dieser Welt, die jeder von uns Heimat nennt - wir sind doch alle nur Menschen, denen die Zeit davon rennt.
Der Wecker erklingt und der Tag beginnt. Die Kleidung ist grau, die Augen sind leer, es ist lange her gelacht zu haben. Spaß und Freude gibt’s nicht mehr, denn wir laufen alle mit, in einem Strom von dem wir denken, dass er uns Halt gibt, uns liebt – uns aber eigentlich nicht verdient.
Jeder trägt auf den Schultern seine eigene Last, keiner hat mehr Rast, weil du einfach zu viele Verpflichtungen hast. Denn die Zeit bleibt nicht stehen und du musst weiter gehen.
Ich kann es nicht verstehen, warum wir Menschen uns das antun, wir werden gegen Gefühle immun. Kalt und verloren – einsam und erfroren.
Der Mensch verliert, ist irritiert, da sein Kopf nicht kapiert, was draußen passiert. Sind wir überhaupt noch Menschen? Nein, denn was ich tagtäglich sehe und tagtäglich tue, ist nicht mal menschenähnlich.
Wir sind alle wie ein Computer programmiert, praktisch auf´s Leben trainiert. Gerne würd ich in einer Welt wie dieser noch sagen können „Ich bin immer noch ich“, aber das stimmt nicht. Angepasst, zugeschnitten - gebe ich jeden Tag die gleiche Vorführung, zur selben Zeit am selben Ort und ich kann nicht fort. Keiner kann sich befreien aus dem Bann, aus dem Bann der Zeit, niemand hält sie an. Und wenn man einfach nicht mehr kann, hält unser Herz dann an. Die Zeitlupe beginnt und während die Zeit so schnell verrinnt, verweht das Leben im Wind.
Wir alle sind gleich-berechtigt zum Leben, doch du lebst und hast für´s Leben keine Zeit. Bist frei um zu leben, frei um zu sein - doch in der Menge allein.
Wir sehen Probleme, wo keine sind. Versuchen zu erklären, wofür es keine Gründe gibt. Versuchen zu verhindern, was man nicht verhindern kann, es gibt nun mal Dinge, die man nicht ändern kann. Aber der Mensch denkt, mit Denken kann er alles erreichen, der Zeit, dem Tod, dem Leben ausweichen.
Jeder ist nach außen isoliert, das ist eine Schutzmaßnahme aus Angst, Verzweiflung, Selbsthass. Also warum sind wir nun hier? Letztendlich werden wir doch sowieso verlieren, das Leben verlieren, weil unsere Herzen erfrieren.
Die Uhr tickt munter vor sich hin, wir sind alle in diesem verdammten Kreislauf drin. Jeder schiebt alles vor sich her, aber das will ich nicht mehr. Wir tun nichts, reden davon wie´s sein soll aber nicht ist – bis unsere Zeit dann abgelaufen ist. Klammern uns an etwas, was unsere Seele zerfrisst – bis unsere Zeit dann abgelaufen ist.
Versuch es wenigstens, immer weiter zu gehen, ohne zurück zu sehen. Achte nicht nur auf die Zeit, denn die bleibt sowieso nicht stehen. Lass dir nur nicht von der Zeit das Leben nehmen.
Helene Ziegler
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Jonas Linnebank
der baum ist sinnlos
gestorben der stift
ist sinnlos die schrift
sinnlos zerlaufende
tinte auf dem weißen tod
die form ist tot
verbraucht das ich
ist tot der nächste
vers ist tot
sinnlos verbrauchte zei-
len in schwarz
in den tod gesprungen
die melodie ist
zu ende dazwischen
ist leere zeit
der rhythmus ist
verloren ungewiss
tot vielleicht keiner
sucht niemand findet
etwas dahinter
die tür bleibt
verloren ungesucht
verschlossen der sinn
ist tot schlußendlich
vergessen die suche
verloren
vermessen
und tot
Jonas Linnebank
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Martin Piekar - Teil 3
Wolkenformstationen
III
Weißes Blatt nebst grauer Wolke
Ich glaube, ich werde einen Papierflieger losschicken
Wohin ich sehe ist es eine Jahreszeit
Wohin ich sehe ist es grau
Wir sehen heut Abstellgleis aus
Ob das Grau sich auflösen lässt
Ich liege ganz stark auf dem Rücken
Ich liege ganz stark auf feuchter Erde
Der Papierflieger kann ein Loch reißen
Grau kann nur von weißem Papier
Zerklüftet werden. Ich reiße mich
Zusammen und liege ganz stark.
Ich will jetzt nicht aufstehen
Ciemno heißt polnisch dunkel oder finster
Ciemnota ist
Die Beschränktheit. Deckendes Dunkel
Ich fürchte
Auch im Rückwärts-
Oder Krebsgang könnte niemand
Erahnen wo das Himmelgrau anfängt
Oder aufhört. Deckgrau; so unlicht
Der Zustand, wenn man
keinen Schatten wirft
Wenn die Füße letzte Verbindung
Zur Welt sind
Wenn.
Martin Piekar
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Martin Piekar - Teil 2
Wolkenformstationen
II
Kein Passwort erlaubt mir
Hier mehr oder weniger
Wohnen, wie du mich nimmst
An diesen Ort
Der unter anderen Wolken mein Bett war
Covern uns mit Decken
Weil wir das Lied vom Tempel kennen
Er stürzt schon noch ein. Keine Angst
Ein Schaf. Eine Ente. Ein Hase
Weil ich weiß, wie die Kehle verkieselt
Am morgen Schlucken, ein Schotterweg
Da wir erst zu viel tranken und
Dann gemeinsam zu wenig. Als wir schliefen
Wurden wir erst wir
Unter jenen Wolken
Gehaben sich
Kondensstreifen wie Lehren
Wir sind nightlos
Von der himmelweiten Immigration
Von einem Menschen
In den Andern
Als Wanderer raste ich bei dir und
Die Wolke vor unserem Morgen
In den wir starren (werden)
Sieht aus wie deine Fickpalme
In mir ist es willig
Dir endlich zu sagen
Dass deine Fickpalme Poesie ist.
Martin Piekar
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Martin Piekar - Teil 1
Wolkenformstationen
I
Ich habe heute hochgeschaut
Häufig Eigenwarnung: könnte kitschig werden
Aber dort warst du
Du warst natürlich nicht da, aber es war du
Wir beide haben geschrieben, schreiben
Ins Blaue hinein. Du wirst so oft
Vom Himmel aufgelesen
Ich habe nur mein U-Boot-Bewusstsein
In den Wolken. Wo du nichts zurechthämmern
Kannst. Fatal den Formen
Fatal das Formen ausgeliefert
Als ich aufs Erwachsensein hinschrieb: Früher
Heute: fühle ich mich kleiner als
Seit du mir erzähltest
Wenn du in die Wolken
Schaust mit Celan –
Sich selbst regnend
Sich einsehen –
Und nicht nur an deinen Stern denkst
Sondern, dass unter seinem
Deine Dichtung auch mal ruhen darf.
Für Alexandru Bulucz
Martin Piekar
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Marina Büttner
Tschador
Sie setzt sich auf den Platz direkt gegenüber
ganz in schwarz, ich sehe ihr Gesicht, ein junges
Mädchen, trotzig, eigentlich ein Jungengesicht -
wäre sie einer, säße sie breitbeinig.
So fällt ihr schwarzer undurchdringlicher Schleier
lose über den Körper, der schemenhaft bleibt,
behandschuhte Hände tippen unverwandt
Buchstaben - versehentlich berührt ihr Fuß
kurz den meinen - sie schaut erschrocken auf,
ihre Augen sehen traurig aus.
Marina Büttner
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Daniel Ableev
Über die Schallplattenindustrie
Jeder von uns ist ein Limitier. So neigen wir etwa allzu gern dazu, bei passender Gelegenheit dieselbe alte Schallplatte aufzulegen, wobei nicht nur Inhalte, sondern auch konkrete Formulierungen invariabel daherkommen.
Eine meiner Lieblingsschallplatten, die ich gern in so manchem Zusammenhang zum Beschränktesten gebe, ist die Erwähnung und Schilderung jener bemerkenswerten Stelle in „Sin City“ von Robert Rodriguez (ein Stück Filmkunst, das, mit Ausnahme des geringen Substanzgehaltes, so ziemlich vollkommen ist), in welcher der von Elijah Woods gespielte Kevin mit viehischer Geschwindigkeit und -meidigkeit auf den Eindringling Marv reagiert, indem er ohne Zeitverzögerung zum hyperagilen, hinterfotzigen Angriff übergeht. Die Szene ist in ihrer kompromisslosen, präzisen Darstellung von Über- bzw. Unmenschlichkeit geradezu verstörend-pervers.
Eine andere Schallplatte von mir ist die, dass ich selten von einem Film so positiv überrascht war wie von Zack Snyders „Watchmen“. Nach der anschließenden Lektüre des Comics sah ich mich zwar gezwungen, dieser 1:1-Umsetzung mit etwas Skepsis zu begegnen, aber für sich genommen ist das, zusammen mit „Mystery Men“, „Scott Pilgrim“, „Tarntrumer’s Riege“ und der Realfilm-Serie „The Tick“, sicher der originellste Superheldenfilm aller Zeiten.
Im Rahmen einer weiteren filmbezogenen Schallplatte breche ich ganz gern eine ordentliche Lanze für „Terminator 3“, die überraschend gelungene Fortsetzung zu dem Überklassiker von 1991.
Daniel Ableev
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Katrin Theiner - Teil 2
Landschaft zum Verschwundensein (Auszug 2)
Dies ist Teil 2 - für Teil 1 aus der Vorwoche hier entlang.
Ich hatte es dunkel gelassen. Laute Schritte im Flur. Die schrille Stimme der Tante, die Hinweise abfeuerte: Seit elf Stunden, Sportschau, Herztabletten, Waffe weg, Vorstandstreffen. Männerstimmen um sie herum. Hundegebell. Arminius winselte. Sie gingen ums Haus, durch den Garten, über die Beete. Sie gingen weiter über die Felder zum Waldrand. Ihre Taschenlampen warfen weiße Lichtschleifen zwischen die Bäume. Ich zog die Gardinen zu, machte die Nachttischlampe an, operierte meinen Finger mit Nadeln. Ein Holzsplitter tief unter meinem Nagel. Später Polizei. Die Tante weinte, suchte Fotos von dem Herrn Onkel, den eh jeder kannte. Es klopfte. „Jan-Carl? Die Herren wollen dich sprechen.“ Hatte nix gesehen. Keine Ahnung. War nicht da. In der Schule. Hatte Musik an. In der Nacht sah ich meine Eltern im Traum. Wir saßen auf einer Decke im Freibad. Meine Mutter im Bikini, in einem anderen Bikini als die anderen Mütter. Mein Vater mit Lederjacke und Sonnenbrille, ein Bier in der Hand. Ich war nackt, ein hellblauer Schwimmring um die Hüften. Weißes Eis floss über meinen Bauch. Ich hatte schon früh verstanden, dass wir anders waren. Nicht schlechter, anders. Meine Eltern sahen anders aus, ich sah anders aus, hieß anders. Ich mochte das, mochte nicht die dicken Mütter deranderen Kinder, mochte die Rippen meiner Mutter, die langen Finger, die bunten Nägel, die mir Pommes in den Mund steckten, nachdem sie sie kalt gepustet hatte. Mein Vater setzte mich auf seinen Schoss. Mein Po klebte an seinem Bein. Überall Eis. Ich hab’s getan, Papa. Ich hab’s getan. Er strich mir über den Kopf. Is’ gut Junge. Ich muss nach Weiterstadt. Iss dein Eis.
„Komm runter. Ich kann das nicht sehen“, sagte ich zu Olga, streckte meine Hand zu ihr und griff mit der anderen ihren weißen Stiefel. „Hast Schiss, dass ich falle?“, lachte sie, lehnte sich weiter über die Brüstung des Hochstuhls und schaute mich auffordernd an. „Mann, krieg dich ein“, sagte sie. Sie kletterte runter zu mir, biss mir ins Ohr und inhalierte meinen Rauch. „Und? Wo liegt er?“ „Irgendwo dahinten“, sagte ich und schnippste Glut ins schwarze Dickicht. „Kann man jetzt nicht sehen. Zu dunkel.“ „Wie war das, den Alten zu killen? Geil, oder?“ „Will ich nicht drüber reden.“ “Komm. War geil, oder?“ „Ja, geil. War geil. Du bist geil. Lass uns zu dir gehen.“ „Geht nicht. Mein Alter...“
Der Herr Onkel hatte mir zum sechsten Geburtstag ein Sprengnetz geschenkt. „Ich nehm dich mit zum Frettieren“, sagte er, hielt mir die Maschen, in die ich mir einen Fußball gewünscht hätte, vor die Nase und lachte hustend. „Da wird uns das Ungeziefer nicht entkommen, Carl.“ Ich hatte mich im Dickicht verschanzt, traute mich nicht, die Ohren zuzuhalten. Wie hätte das ausgesehen? Ein Jägerkind, dem das Krepieren der Hasen zu viel war. Ich versuchte, mein Trommelfell zu ewegen, Druck zu verlagern, die Ohren innerlich zu verschließen, schaute knapp an meinem Onkel vorbei, wie er vor dem Bau lungerte und durch die Netzmaschen die zappelnden Tiere an den Ohren hielt. Zuhause war der Geburtstagstisch gedeckt. Folie lag über der Spanplatte in der Garage. Handschuhe und Messer, Skalpelle in Bechern, Flaschen mit Säuren. Der fleischige Hasenkörper umgekrempelt, wie eine alte Socke. Die Pfoten steckten noch im Fell. Die seien noch nichts für mich. Unter dem Tisch der Eimer. Der Eimer für die Innereien, an denen ich mich würde bedienen dürfen. Ich wollte verschwinden, aufgelöst sein. Ich wollte, dass er meinen richtigen Namen sagte. Ich wollte weinen, weg sein, wollte kotzen, die Unterhose gegen eine trockene tauschen, schreien. Versager. Wenigstens töten müsstest du doch können.
Sie kam mit zwei Freundinnen, küsste mich nicht, blieb außerhalb meiner Jacke, die Arme verschränkt mit forderndem Blick.
„Sag’s ihnen, J.C.! Sag ihnen, dass du den alten Wedekind umgelegt hast.“
„Hab ich.“
„Hast du nicht. Mein Alter und die anderen Bullen haben heute Morgen seine Leiche aus dem Wald gezogen. Kopfschuss.“
„Ja, war ich.“
„RAF oder was? Man Olga, der hat dich voll verarscht.“
Die Ellenbogen verschränkt gingen sie lachend weg, schauten sich nicht mehr um.
Halali, der Herr Onkel ist tot. Männer im Haus. Stiefelschritte. Stimmen. Suizid. Gewehrträger stehen Spalier. Dazwischen der helle Sarg aus Fichte. Das Jagdhorn wird geblasen. Es wird salutiert. Die Tante dahinter, wirft Sand, eine Rose. Und ich, ein Freigänger, weil der Wächter tot war. Er und ich, nicht länger verschwunden.
Katrin Theiner
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Katrin Theiner - Teil 1
Landschaft zum Verschwundensein (Auszug 1)
Der Herr Onkel war tot. Den Mund voll brauner Fichtennadeln, den Bart auch, als hätte er einen zu großen Löffel Suppe in sich hineingeschaufelt, bei dem die Nudeln zwischen seinen Lippen wieder rauskamen. Oder als hätte er vor Hunger seine eigenen Bäume gefressen und war an Rinde, Harz und Zapfen erstickt. Die Tannenschonung hatte angefangen ihn zu beerdigen, warf Sand auf seinen muffigen Kompostsarg aus Ästen und Laub, aber bevor der Wald den Grabstein setzen konnte, den letzten Spruch aufgesagt hatte, und der Herr Onkel hätte es verabscheut, das Gefasel um Himmel, usw. usf., hätte geschrien, mit Gott und so hätten nur Arschkriecher was am Hut, und bevor die Bäume hinter der Lichtung an der Grabstätte für immer für Ruhe sorgen konnten, hatte ein Waldarbeiter seine Leiche in moosgrünen Gummistiefeln im Unterholz entdeckt.
Seit er verschwunden war, mit Hut, Stiefeln, Flinte und Korn, hatten mich die hellbraunen Erdklumpen seiner fehlenden Schuhsohlen angeglotzt. Wenn ich abends lautlos reinschlich, den Schlüssel an den Nagel in der Diele hing, stierten sie von der Fußmatte zu mir, als wollten sich mich warnen. Als wären sie dabei gewesen. Aus den Kopfhörern unter meinem Hoodie kam ihr und mein Lied. Dabei ein Schauer wie kriechende Tiere auf meinem Rücken. Sonst hörte ich nichts, kaute schnell den Rauch unter das Kaugummi und blickte auf seinen Dreck am Boden. Als wollte mir der Herr Onkel jetzt noch zeigen, was er von mir hielt. Als wollte er mich daran erinnern, nicht in Freudentränen auszubrechen, die ich unter meiner Kapuze hätte verstecken können oder als Trauertränen würde tarnen müssen. Halt dich zurück, bis man mich gefunden hat, elender Flegel, Sohn eines Verbrechers, und vergiss heute mal, dass du immer alles vorher weißt, sagte mir der pulverige Dreck seiner Füße und zerstaubte in der Rille zwischen Matte und Tür.
Die Tante, nur Tante, ohne Frau davor, trug brav ihre Schürze und kochte weiter die drei Portionen. Sie wollte angerichtet haben, wenn der Herr Onkel nach Hause kam. Eine Portion für sich, die sie nicht anrührte, eine Portion für mich, eine Portion für den Herrn Onkel. Steckrübeneintopf, Hühnerfrikassee, Grünkohl mit Mettendchen, Rouladen, die Arminius aus Mitleid, weil die Tante in seinem Winseln Trauer vermutete, mit Senf und Gurken fressen durfte. Nein, nein, wenn das der Herr Onkel wüsste. Mit erhobenem Haupt streute die Tante Sand auf die Platten vor dem Haus; er hätte es so gewollt, hätte gewollt, dass sie blieb, wer sie war, Haltung bewahrte, Contenance, Contenance, mit gespanntem Haar über den Ohren und straffer Knotenkontur am Hinterkopf, dass sie die Nachbarn über den Zaun grüßte, sich nichts anmerken ließ und man ihren festen Schritt weiter auf dem Gehsteig zur Bushaltestelle hörte.
„Hast’n aufgeknüpft, oder was? Du Freshmaker.“
„Fresse man.“
„Haste, ne? Hast ihm schön das Fell über die Ohren gezogen. Schön mit Messer und Gabel seine fette Wampe zerteilt.“
„Mann Ivo, halt’s Maul. Siehst doch, dass Terror traurig ist. Jetzt, wo der Alte weg ist.“
„...und Olga ihn nicht ranlässt.“
„Mann, fickt euch. Nennt mich nicht so, man. Und kein Wort über Olga. Verpisst euch doch.“
„Mann J.C., Mach dich mal locker, war nicht so gemeint. Warn Witz. Komm. Stunde fängt an.“
Eiszapfen fingen an, die Fenster zu vergittern. Frostiges Unkraut wucherte über die Glasscheiben, verkleinerte den Blick zum Waldrand. Die Tante lief umher durch den toten Waldzoo, den der Herr Onkel im Haus aufgebaut hatte, drehte ihr angelaufenes Eheschmuckstück um die zu groß gewordene Haut ihres Ringfingers, als vermute sie darin einen Kompass, der sie geradewegs zu der letzten Ruhestätte ihres Mannes führen würde und mit der letzten Ruhestätte meinte sie nicht sein Grab. Sie meinte vielmehr einen hölzernen Waldverschlag oder einen Hochstuhl, in dem sie den Herrn Onkel selbst nach Einbruch des Winters und drei Wochen nach seinem Verschwinden sturzbesoffen vermutete. Ihr Gesicht sah gewachst aus, gelblich und blass und traurig, ohne Tränen. Die gab’s nicht. Sie registrierte nicht den Geruch von Rauch in meinen Sachen, mied mein Zimmer, lief unsichtbar durch die unbeheizten Räume, eins geworden mit dem Gedanken, fern der Blicke und wenigstens in ihren eigenen vier Wänden, nicht mehr sein zu müssen als eine aufrechte, absterbende Hülle. Der grüne Wollpullover des Herrn Onkel, den er vor seinem Verschwinden in der Küche abgeworfen hatte, umschlang die Rückenlehne an seinem Platz, zeigte Haltung, die Haltung eines Jägers im Ruhestand, er hielt seinen Rücken gerade, den Rücken eines Kriegsveteranen, eines Waidmanns, eines Präparators, eines Vorstandsvorsitzenden, eines Frühschoppers, eines Schützenkönigs, eines ehrenwerten Bürgers, der sich nie hat unterkriegen lassen, selbst als der eigene Sohn, dieses Pack von einem Mörder, ihm die eigene Brut hinterließ und das Ansehen der Familie beschmutzt hatte. Spuckefarbene Hirschhornknöpfe blitzten mich an. Ich wusste, der Pullover von dem Herrn Onkel würde lange dort hängen bleiben, wie eine Fahne auf Halbmast, die niemand hinablassen würde.
Das Essen der Tante verschlang ich im Akkord. Bloß nicht länger bei ihr sitzen, bloß keinen Verdacht auf mich lenken. Der Blick auf das unberührte Set mit dem Bauernkalender auf dem leeren Platz von dem Herrn Onkel, ließ mich zum ersten Mal denken, ob es in all dem Scheiß nicht vielleicht doch sowas wie einen Gott geben könnte. Denn wie sonst könnte es denn sein, dass ausgerechnet mir so ein Glück, so ein unvorstellbares Glück an Gerechtigkeit passieren konnte, das der Herr Onkel weg war, verreckt war. Er war nicht mehr die gelbgrauen Zahnkronen, die zuerst die Haut der triefenden Fleischkeulen abschälten, um sich dann fest im unteren Gänsegewebe zu verbeißen und es in einzelnen Fasern zerteilt laut schluckend mit Bier hinunterzuspülen. Er war nicht mehr die Tageszeitung, die auf Arminius’ gekrümmtes Hinterteil hinabdonnerte, wenn er versuchte, Krümel unter dem Esstisch aufzulecken. Er war nicht mehr der Schweiß der Tante, wenn sie seinen fetten Arm um ihren Hals schwang, ihn fest im Gürtel unter die Hüfte griff und gegen ihr neues Gelenk gepresst die Treppe hoch ins Schlafzimmer zog. Er war nicht mehr das Lallen, das er wieder und wieder zwischen meine Tapeten warf, meine Mutter sei eine dreckige Nutte gewesen, die einen elenden Terroristen wie meinen Vater nur verdient hätte, und ich, nach einem Dickicht suchend, in das ich mich hätte verkriechen können, wäre längst verreckt, wäre er nicht gewesen, der Herr Onkel. Er war auch nicht mehr im Schuppen zwischen Fell und Holzwolle, Nadeln, Kleber, Fäden und den Messern, mit denen er die Kadaver der frischtoten Tiere aufschälte, sie abbalgte und ausnahm, bis alle Organreste ausgekratzt waren. Er konservierte auch nicht mehr, wirkte nicht mehr dem Fettfraß entgegen, polsterte kein Hautgewebe mehr mit Füllstoff auf und gestaltete keine putzigen Nagetierkörper mehr, in dem er ihre zerteilten Gliedmaßen neu zusammensetzte und sie mit Draht fixierte. Das alles hatte er nun selber nötig. Er war auch nicht mehr das Staubtuch, das die Geweihe putzte, die endlos aufgereihten Totenschädel an der Holzvertäfelung, in der der Bock leise klopft. Ich stellte mir seinen aufgetriebenen Kopf vor, wie er zwischen seinen Trophäen auf einem Holzbrett von der Wand hinabschaut. Hutlos. Das rote Bluthochdruckgesicht mit Schaumstoff ausgestopft, seinen tabakgelbe Schnäuzer, ja den, einfach abrasiert, das schüttere Haar, das früher fuchsrot war, ungekämmt, pomadenlos. Ohne Form. Formlos. Die Tante hatte geschwärmt von ihm, dem Herrn Onkel, hatte gesagt, das Jägergrün und sein rotes Haar, da habe sie nicht wiederstehen können, als sie noch jung war. Meine Trophäe. Er war jetzt meine Trophäe.
Wir waren zu einer Jacke geworden. Zu einem vierarmigen Daunenknäul, in dessen Ärmeln ich ihre zarten Finger hielt. Wir waren ein dickes Winterding an der Schule. Sie und ich. Die große Sensation. Wir waren zu einer Zigarette, zu einem Kaugummi geworden. Zu einem minzigen Stück Gummi, das sie mit ihren spitzen Fingern zwischen meinen Schneidezähnen hervorzog, eine Hälfte abriss, in ihren Mund steckte und die Arme wieder zwischen meinen verschwinden ließ. Ich an Graffiti gelehnt, sie davor, an mir dran, den Reißverschluss meiner Jacke auf ihrem Rücken. In meiner Nase ihr süßes Parfum mit Lolligeruch, ihr Haar an meinem Kinn. Meine neue Welt, mein Versteck, mein Verschwundensein, ein anderes Verschwinden, meine Luft voll von ihr, von ihrem Geruch, den ich auftrinken wollte.
„Was is jetzt?“, saugte Olga gegen mein Hals. Ein Kopfhörer in ihrem, der andere in meinem Ohr. Unser Lied. Wir froren.
„Womit?“
„Deinem Onkel?“
„Nix.“
„Ist er tot?“
„Klar man. Klar ist er tot.“
Ihr Blick zwischen einem dunkel geschminkten Wimpernkreis. Sie küsste mein Kinn, meinen Hals, küsste sich rauf zu meinem Mund, schob ihre Hüfte nah an meine, öffnete mit ihrer Zungenspitze meinen Mund, schmeckte nach Lip Gloss, ihr Kaugummi suchte meins, ich bekam beide Hälften, kaute weiter.
„Woher willst du das wissen? Is doch keine Leiche da.“
„Klar is die Leiche da. Im Wald. Irgendwo. Ich weiß wo.“
„Glaub ich nicht.“
„Glaubst was nicht?“
„Dass du weißt, wo der liegt.“
„Klar weiß ich. Ich war da. War dabei. Zeig ich dir.“
„Wie, dabei?“
„Hab ihn umgelegt.“
„Haste nicht.“
„Hab ich.“
„Will ich sehen.“
Das ist der erste Teil - Wer Teil zwei des Textes sehen will, muss sich auf kommende Woche gedulden.
Katrin Theiner
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at