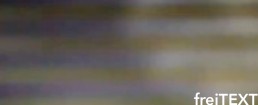freiTEXT | blume (michael johann bauer)
Das Meer
Scheppernd wellen sich wabernde Wolken, der Himmel kreischt, nachtschwarze Herrlichkeit glüht zerfurcht in blitzendem Sekundenbrand und unter dem bedingt zuverlässigen Schutzdach einer semipermeablen Blätterhaube drängen sich zwei Ratlose aneinander, befühlen, vielleicht nervös, die konkrete Hysterie ihrer rasenden Herzen durch klebrig feuchten Stoff, und taumeln schweigend – stehend, lauernd – über lechzend züngelnde Abgründe einer traumatisierenden Flut unverhofft greller Eindrücke, hier, in der relativen Verlassenheit eines schroff gezeichneten, felsenüberwuchernden Waldes, fernab von ihrem Zuhause, dem sie entflohen sind, gierend nach Freiheit, nach Glück. Furchtsam wispern abgewetzte Stimmen wie geborstenes Glas, unnatürlich das Trommelfell scheuernd, ätzende und ätherisch flüchtige Spuren trauernder Tropfen kondensierender Schwallwellen in den sensiblen Gehörgängen der in unmittelbarer Reichweite Lauschenden – welche im Prinzip auf die direkt Involvierten reduzierbar sind – hinterlassend und vergehen, letztendlich, nachdem der jeweils angesprochene Rezipient die, in ihren Modulationen ruhenden Botschaften dechiffriert hat, im kühlen Nirgendwo einer wüst plätschernden Regenhöhle. „Wir haben das Richtige getan.“ „Wir hatten keine Wahl.“ „Die Unerträglichkeit des Alltags hat unsere Flucht unvermeidlich gemacht.“ „Wir dürfen keinen einzigen Schritt bereuen, nachdem der Weg zurück einem waghalsig idiotischen Sturz in ein Meer aus dornigen Augen gleichzusetzen ist.“ „Unsere Lungen keuchen in Atemnot, doch ist der Preis nicht hoch genug, um auch nur eine zaghafte Melodie tosender Reue durch das Gerippe unserer Entscheidungen galoppieren zu lassen, während wir, stumm betend, die Endlosigkeit lebendiger Schmerzen inhalieren.“ „Was ist schon die Bürde sengender Angst verglichen mit dem berauschenden Jubel lustig würgender Selbstständigkeit in den gewaltig pulsierenden Armen einer archaisch anmutenden Natur!“
Der Vorhang lüftet sich und eine sympathisch wärmende Morgensonne induziert, fröhlich strahlend, golden gelassen Zuversicht, beendet die Notwendigkeit, eine Maske verbaler Stärke über einen bitter stachelnden Kern aus sinnlos explodierenden Selbstzweifeln zu ziehen, beleuchtet das pittoreske Panorama einer bergig unterlegten, bildgewordenen Symphonie chronischer Veränderung und die beiden verharren, staunend, im köstlich lieblichen Widerhall eines heilig scheinenden Augenblicks. Erleichterung zaubert mit weit ausgebreitetem Gefieder schillernde Regenbogen sinnlicher Ekstase auf die jugendlich frischen Gesichter der sich angenehm Entspannenden, sodass schließlich, klirrend die finalen Ketten apathischen Erduldens zerspringen und sie sich, engumschlungen die Harmonie ihrer Zärtlichkeiten großzügig und gerne nicht bloß miteinander teilend, mit ungestümem Lächeln und seligem Lachen auf den magisch unschuldigen Lippen, aufmachen, die ihnen noch würzig fremde Schönheit einer sich tänzelnd vor ihnen entfaltenden Sommerlandschaft für sich zu gewinnen und diese, kunstfertig transformiert in einen süßlich flirrenden Reigen luftig schwebender Gemälde, in die empfänglichen Schalen ihrer zukünftigen Erinnerungen zu träufeln. Ausgelassenes Vogelgezwitscher und ein aus der geheimnisvollen Verborgenheit der mit Laub gefütterten Behausungen obskurer kleiner Tiere dringendes Rascheln begleitet den sanften Fluss ihrer Bewegungen akustisch, indes sie sich unaufhaltsam, ohne sich dieser verhältnismäßigen Tatsache bewusst zu sein, dem nahezu vollkommen von wild gedeihenden Ranken bedeckten Eingang eines teilweise verfallenen Steingartens, in dessen Zentrum eine einzigartige Herausforderung ihre baldige Ankunft erwartet, nähern.
Einst, als die Essenz absoluter Einheit alle Dinge durchdrang – eine fundamentale Gegebenheit, die, selbstverständlich, eine unveränderliche, jenseits von Raum und Zeit bestehende Konstante darstellt – und auch der Mensch, an sich, ihre sogar an der Oberfläche und in den verwinkeltsten Ausläufern der Materie erkennbare Omnipräsenz – mithilfe geistiger Leere – noch zu erfassen in der Lage war, lebte hier das erleuchtete Volk der Täler, welches keinen speziellen Namen für sich in Anspruch nehmen musste – kein Klammern an den Wahn einer von wirren Vorstellungen determinierten Identität –, um, ohne es wissen zu müssen, zu wissen, wer es war. Was aus ihm geworden ist, ist ohne Bedeutung, lediglich wenige sporadische, vom Lauf unzähliger Jahre entstellte Relikte eines gelegentlich erschaffenden Daseins bezeugen vage seinen Ruhm auf dem Gebiet bescheidener Weisheit ohne Zweck und ohne Ziel. Der Ort nimmt hierbei die Rolle einer beliebigen Hilfestellung ein, er ist unwesentlich, eine simple Zugangsoption, ein durch das Zusammentreffen gewisser gegenständlicher Umstände – Transkriptionen von Wahrheit in ein diskret anthropogenes Vokabular – zündender Funke, das vermeintlich erloschene Flammenmeer im Inneren der eigenen Verästelungen erneut zu entfachen – das Feuer vollendeter Klarheit spürbar zu machen –, das zu entdecken, was, immer und überall, ist.
Und schon ist sie überschritten, jene imaginäre Grenze, die sich, trotzig, zusammensetzt aus Glaube und Phantasie – und plötzlich ist alles – wie – verwandelt – in der verblendeten Welt der Perzeption. Ein filigran geschuppter Reptilienboden saugt lüstern an den nackten Füßen der sich in ihrer spontan einsetzenden Orientierungslosigkeit verwirrt Ergänzenden, wölbt sich manisch auf, erbricht dunkle Stöße panisch exkrementöser Lava exzentrisch fragwürdiger Konsistenz, höhnisch die Beine der zu wehrlosen Opfern Auserkorenen mit der dumpfen Widerwärtigkeit seines abstoßenden Auswurfs besudelnd – und steht still, ganz so, als wäre nichts geschehen, überlässt die Zwei, in ihrer Vereinigung, dem frivol verzerrten Labyrinth makabrer Assoziationen, eine dämonisch blinzelnde Furcht, die – einen lächerlich stupiden Vergleich aufs Papier schleudernd – weitaus tiefer sitzt als das, in manchen Situationen, schier übermächtige Beben fleischlicher Lust, aus dem eiskalten Refugium ihrer Epilepsie lockend. Zitterndes, hilflos winselndes Elend – kaum haben sie sich von der zynisch durch die heimlichsten Nischen ihrer Psyche echoenden Erschütterung des ersten Schocks erholt, zur Linderung die honiggleiche Idylle des anbrechenden Tages auf ihren zerrüttet gereizten Synapsen verteilt, zerfetzt der gnadenlose Dolch unvorhergesehener Ereignisse die trügerisch behagliche Leinwand harmlosen Schlenderns durch eine milchig satte Köstlichkeit friedlich summender Momente und reißt die empfindlichen Gemüter unserer leidlich unerfahrenen Protagonisten ins blechern schallende Verderben giftig schäumender Poren ominöser Unbeständigkeit. Ehe es ihnen gelingt, auch nur tendenziell zur Ruhe zu kommen und die unangenehm knisternden, ihre zarten Leiber grob malträtierenden Wogen schrecklich intensiver Stimulanzien zu verdauen, sind sie bereits angelangt, im Reich des mystischen Jaguars, der, wie ein behutsam funkelnder Opal, grollend flüsternd, zu ihnen spricht. „Der Pfad der Mysterien ähnelt einer blutroten Orchidee – verziert mit der opulenten Erhabenheit flüssigen Rubins geleitet er die Suchenden hinab in eine Schatzkammer bizarr flatternder Euphorie! Betörende Düfte verbreitend, erblüht ein Mosaik aus adoleszenten Rosen über den kristallenen Kelchen taubenetzter Schläfen! Hinter dem Schleier der Wahrnehmung, jedoch, in der stoisch prahlenden Kluft fremdartiger Unerreichbarkeit, stagniert spröde das Wort, wartet flehend darauf, vernichtet zu werden, den Marmor, den es zornig durchwurzelt hat, zu zersprengen, um in amorpher Vergänglichkeit seine Bestimmung zu erfüllen – und wir, wir lesen, gebannt, im Buch seiner ewigen Manifestationen, aufgewühlt erahnend, dass alles längst ist. Düster, wie Zimt, tobt ein eitriger Scharlachsturm durch die Nichtigkeit unserer Existenz und gebiert wundervoll obszöne Anomalien – möge das Ritual der Trennung und Melange beginnen!“ Nichts. Kein verträumt splitternder Laut tönt fruchtbar hinein in die klebrig exzessiven Ergüsse fanatisch zirkulierender Obsessionen, keine exorbitant wallende, phänomenal farbenprächtige, von aufrichtig stolzen Initiierten flott inszenierte Zeremonie befleckt die keusche Jungfräulichkeit des ins Aberwitzige abgleitenden Szenarios mit dem geradezu göttlichen Ejakulat einer alle Anwesenden aufheiternden Offenbarung - nein, ganz und gar nicht – stattdessen martert eine subtil quälende Atmosphäre schwül erdrückender Erwartung, die, langsam aber sicher, in peinigende Ungeduld umschlägt, die blank liegenden Nerven der partiell unfreiwillig Beteiligten, bis sich, zu guter Letzt, sichtlich verlegen, der Jaguar, wieder, zu Wort meldet. „Eventuell ...“ „Schluss mit dem Rechtfertigungsgejammer, wir gehen jetzt ans Meer!“ Gesagt, getan!
blume (michael johann bauer)
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Claudia Wallner
Verschiedene Welten
Es war warm in der Stube. Die Mutter hatte ihre gepunktete Kochschürze umgebunden und fing langsam an das Abendmahl auf dem Gasherd zuzubereiten. Vater war draußen, um Holz zu hacken, während unser Hund „Schorsch“ vergnügt den Hühnern nachjagte und bellte. Ich war gerade mit Hausübungen beschäftigt, als meine Schwester mit einem Geschenk vor mir stand: „Alles Gute mein lieber Bruder! Ich weiß du hast erst morgen deinen Ehrentag, aber ich möchte dich heute schon beschenken!“ Ich war sehr erstaunt und öffnete das Päckchen neugierig. Es war ein Schlüssel. Meine große Schwester Anna hatte mir also ihr Moped vermacht! Ich war selig vor Freude. Endlich konnte ich überall in der Stadt hinfahren, welch‘ neu gewonnene Freiheit! Ich war glücklich und genoss die Atmosphäre der warmen Stube, eingehüllt von köstlichem Essensgeruch. Ich fühlte mich so wohl im Kreise meiner Lieben und lächelte zufrieden.
Abdul schlug das Buch zu. Um sich sah er nur Zerstörung, Armut und Tod. Er war hungrig und allein. Mithilfe des Lesens flüchtete er sich regelmäßig in Fantasiewelten, die ihn wenigstens kurzzeitig von diesem Elend ablenkten. Ein ausländischer Soldat hatte ihm dieses Buch geschenkt. Es gefiel ihm, aber komisch fand er nur, dass es auf einem anderen Planeten spielte.
Claudia Wallner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Gregor Eistert
Das Kunstprojekt
Auf einmal stand er da, der Container. Mitten auf dem Stadtplatz. Im Laufe des Vormittags hatte sich dann schon eine beträchtliche Menschentraube gebildet aber obwohl viel geredet wurde, wusste keiner so recht, was hier eigentlich geschah. Der Container war kein normaler Baucontainer. Also an drei Seiten schon: Dieses in hellem Grau gestrichene Metall, dass zur Sicherung der Stabilität leicht gewellt war. Die der Kirche abgewandte Seite war jedoch aus Glas. Das ließ dann wieder an einen Zoo, vielleicht an ein Affenhaus denken. Diejenigen, die sich näher herangewagt hatten, sahen, dass der Container keinesfalls leer war. Auf dem Boden lagen einige alte Decken, die allesamt so aussahen, als wären sie von einem Laster auf der A8 abgeworfen und einigen Wochen später von irgendwem wieder eingesammelt worden. An einer der Metallseiten hatte der Container auch einen kleinen Anbau, in den man aber auch von der Glasseite aus nicht hineinschauen konnte, da er mit einem fetzenartigen Vorhang vom Rest des Raumes abgetrennt war. Der Container stand auf mehreren Holzpaletten, so dass sich der Boden des Innenraumes ziemlich genau auf Kniehöhe eines durchschnittlich großen Mannes befand.
Während sich bis zur Mittagszeit immer mehr Menschen am Stadtplatz versammelten, zerstreute sich die Menge während des Nachmittags wieder. Einige Neugierige kamen zwar noch vorbei um sich den Container aus der Nähe anzusehen, aber da sich davor weder ein Schild, noch irgendetwas besonderes darin befand, ließ das Interesse der Passanten bald nach.
Das änderte sich am nächsten Morgen.
„Ist ja unerhört!“ „Das ist wieder irgend so ein moderner Kunst Schaß, den sie von unseren Steuergeldern finanzieren. Wie damals der Hubschrauber.“ „Eine Frechheit ist das!“ „Das geht ja nicht. Das kann man ja nicht machen. Irgendwer muss da was dagegen tun.“ „Ist das überhaupt erlaubt?“
Im Container befand sich jetzt eine syrische Flüchtlingsfamilie.
Das stand jedenfalls auf dem Schild, das jetzt an einer der Außenwände befestigt war. Das Schild war klar und strukturiert designet und gab Informationen über den Inhalt des Containers, über die Herkunft der sich darin befindenden, ihre durchschnittliche Lebenserwartung, die Zahl der Kinder, die sie durchschnittlich zur Welt bringen und ihre größte, natürliche Bedrohung: Der Mensch.
Doch das Schild interessierte die meisten anfangs nicht besonders. Aller Augen waren auf das Kleinkind gerichtet, dass gerade weinend auf die Glaswand zu gekrabbelt kam und mit seinen speichelverschmierten Händen tollpatschig dagegen schlug. Eine dunkelhäutige Frau mit Kopftuch, offensichtlich die Mutter des Kindes, hob es vom Boden auf, wischte das Glas so gut es ging mit dem Ärmel ihres Gewandes sauber und sah sich dann verzweifelt im Container um. Das Kind wurde währenddessen immer unruhiger. Heftige Weinkrämpfe brachen aus ihm heraus. Schließlich ließ sich die Mutter mit dem Rücken zur Glasfront nieder und begann ihr Kind zu stillen. Das war ihr sichtlich unangenehm. Immer wieder warf sie einen verschämten Blick über die Schulter während die Leute draußen ihre Nasen gegen die Scheiben drückten.
Im Container befand sich auch ein Mann, der bis dahin auf dem Haufen dreckiger Decken geschlafen hatte. Jetzt stand er allerdings auf, nahm eine der Decken und versuchte sie schützend vor seine Frau zu halten. Augenblicklich ertönte ein lautes, schrilles Hupen im Container und an der Decke angebrachte Sprinkler ließen es regnen. Verzweifelt versuchte der Mann, seine Frau, das Kind und sich selbst mit der Decke zu schützen, doch der künstliche Regen wurde immer stärker. Erst als er den Stofffetzen entmutigt sinken lies, hörten die Sprinkler auf Wasser zu vergießen. Das versammelte Publikum, das ob des plötzlichen Wolkenbruchs kurz zurückgeschreckt war, drückte jetzt wieder seine Gesichter gegen die Scheiben und versuchten nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, was drinnen vor sich ging. Geräusche drangen nämlich keine aus dem Inneren.
Am frühen Abend, wahrscheinlich so, dass es sich eben für die Nachrichten noch ausgehen würde, war dann auch das Fernsehen zur Stelle.
Kunst. Der Container samt Flüchtlingsfamilie war eine Installation irgendeines belgisch-afghanischen Künstlerpaares. Damit war der Sachverhalt für die Zivilbevölkerung geklärt: Moderne Kunst muss man nicht verstehen. Moderne Kunst ist einfach. Man muss sie nicht mögen oder schönfinden und man muss sie vor allem nicht mit der Realität in Beziehung setzen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Weil finanziert wird das ganze ja sowieso immer von Menschen, die einfach zu viel Geld haben oder, noch besser, vom Staat, der zwar kein Geld hat aber zumindest so tut als ob. Nein, leid tun, müssen einem die Gestalten in diesem Container jetzt nicht mehr, letztendlich haben sie sich ihre Situation selbst ausgesucht. Genauso wie Millionen syrischer Flüchtlinge. Hätten ja nicht herkommen müssen. Keiner hat sie darum gebeten. Sollen sich jetzt nicht aufregen, weil sie in Zelten schlafen müssen.
In irgend einer Late-Night-Talk-Show, so spät, dass sowieso fast keiner mehr zusah, gab dann das belgisch-afghanische Künstlerpaar ein Statement zu seiner Installation ab: „Wir tun uns manchmal sehr leicht damit, etwas so sehr zu abstrahieren, dass wir den Menschen dahinter vergessen. Wenn Menschen fliehen, ist das nicht wie Lotto spielen. Man steht nicht aus seinem bequemen Wohnzimmersessel auf, kauft ein Ticket und hofft das große Los zu erwischen. Menschen fliehen, weil sie müssen. Weil, wenn sich wer zwischen dem sicheren Tod in der Heimat und dem wahrscheinlichen Tod auf einem Schlepperschiff entscheiden muss, wählt er zumeist doch diese klitzekleine Chance, diesen Lichtblick den ihm Europa bietet“.
Gregor Eistert
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Korbach
Minuten bis Sieben
Es gibt nichts mehr zu tun, außer dem Regen dabei zuzusehen, wie er vor ihr auf das Pflaster prasselt, ausufert, zu Pfützen wird. Über dem Platz hängt der Himmel in einem Grau, das gerade dabei ist, schwarz zu werden. Ein paar Frauen in dunklen Regenjacken laufen vorbei, unterhalten sich leise, lachen. Vielleicht Touristen, denkt sie. Sie wartet darauf, dass es sieben wird und sie den Wagen abschließen kann.
In der letzten halben Stunde kommt immer noch jemand. Sie stellt sich das gerne vor, wie dieser jemand vorher in seinem Büro vor dem Bildschirm sitzt. Gleich hab ich Feierabend, denkt er und sein Magen knurrt. Wenn ich mich beeile schaff ich es sogar noch, mir an dem Stand am Platz eine Wurst zu holen. Die Leute, die zu ihr kommen, haben keinen Appetit, haben nicht einfach Lust auf einen schnellen Imbiss oder einen Snack. Die Leute, die zu ihr kommen, haben Hunger. Weil sie den ganzen Tag noch keine freie Minute zum Essen hatten. Weil es niemanden gibt, der zuhause für sie gekocht hat. Für diese Leute steht sie gerne in der Kälte.
"Ist noch Eintopf da?" Wie Perlen liegen die Tropfen auf der Hutkrempe des Mannes, die Brust hebt und senkt sich schnell, als wäre er gerannt. Sie nickt. "Mit oder ohne Wursteinlage?", fragt sie. "Mit, bitte." Der Mann zieht ein Handy aus der Tasche, hält es sich direkt vors Gesicht und beginnt, darauf herumzutippen, während sie die Schöpfkelle in den Topf taucht, dann eine Plastikschale bis zum Rand füllt. "Bitte sehr", sagt sie und streckt dem Mann die dampfende Schale entgegen. Ihr fällt auf, was für schöne Zähne er hat, absolut gerade, absolut weiß. Und silberne Strähnen, die ihm in die Stirn fallen. Es gibt sie also doch noch, die schönen Männer, denkt sie. Selbst hier. Selbst an so einem Abend, an dem man nicht mal einen Hund vor die Tür jagt, wie Jürgen gesagt hätte. "Ich lege die 3,50 hier hin", sagt der Mann und erst jetzt sieht sie die Münzen auf der Ablage. Sie greift danach. "Ja. Danke. Lassen Sie es sich schmecken", spult sie ab. Das sagt sie zu jedem, nicht nur zu den schönen Männern. Sie ärgert sich über sich selbst. Die Uhr schlägt zweimal. Eine halbe Stunde noch.
Sie schaltet den Grill aus, darauf das Fleisch, das sie nicht verkauft hat. Viel ist es nicht mehr, einmal Rind, zweimal Schwein. Heute Morgen hat Marcel sie gefragt, was eigentlich mit den Würsten passiert, die übrigbleiben. Sie hat es nicht geschafft, ihm die Wahrheit zu sagen. "Die verschenk ich meistens", hat sie gesagt. Sie hätte ihm alles erzählen können, er hätte genickt. Meistens isst sie die Würste selbst. Heute nimmt sie die Zange und lässt sie in eine Plastiktüte fallen, eine nach der anderen. Verschnürt sie, so fest es geht. Nein, heute nicht. Nicht, solange noch ein schöner Mann bei ihr an der Theke steht und seinen Eintopf löffelt.
Sie putzt den Rost, kippt die Asche aus dem Grill hinter den Wagen, wischt mit dem Lappen über die Ablage. Der schöne Mann schaut ihr dabei zu oder vielleicht starrt er auch einfach ins Leere. "Wiedersehen", sagt er irgendwann. Lässt klappernd seinen Plastiklöffel in die Schale fallen. "Einen schönen Abend wünsche ich." Einen schönen Abend. Sie versucht, sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal so etwas wie einen schönen Abend hatte. Ihr Kopf bleibt leer. "Ebenso", sagt sie, aber da ist der schöne Mann schon weg. Ein schwarzer Rücken, den der Regen verschluckt. Einen schönen Abend. Sie denkt an ihre Wohnung. An das Treppenhaus, in dem es genauso kalt ist wie draußen. An die Stufen, die sie sich hochschleppt bis zur Wohnungstür. In der Manteltasche nach dem Schlüssel kramt. Jeden Abend muss sie eine gute Stunde mit dem Auto aus der Stadt rausfahren, durch das Industriegebiet, dann hinter der Tankstelle rechts ab, in eine Querstraße. In die Gasse, in der ihre Wohnung liegt, kommt sie mit dem Wagen nicht rein. Rechts von der Eingangstür stapelt sich der Müll in großen grünen und gelben Säcken. Am Ende des Monats wird sie manchmal von dem Gestank geweckt, aber das nimmt sie in Kauf. Sie hätte jede Wohnung genommen. Jede Wohnung ohne Jürgen.
Der Platz ist leer und, obwohl es erst zehn vor sieben ist, löscht sie das Licht. Als letztes nimmt sie die Schürze ab und fühlt sich sofort unwohl. Neben der Baustelle am Rathaus parken ein paar Taxen. Als sie aus dem Wagen steigt, kurbelt einer der Fahrer die Scheibe herunter. Guck nicht so blöd, denkt sie, hebt die Klappe an der Seite des Fahrzeugs aus den Angeln, schließt ab.
In der Spiegelung der Windschutzscheibe sieht sie ihr Gesicht. Rote Backen von der Kälte, die Haare dicht am Kopf und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Keine schöne Frau, denkt sie. Steckt die Hände zwischen die Oberschenkel, bis sie so warm sind, dass sie losfahren kann. Eine Frau wie ich verdient keinen schönen Mann.
Jürgen ist nicht schön gewesen. Seine Beine waren ein bisschen zu kurz. Sein Haar am Hinterkopf schon ganz dünn. Sie kann sich noch an den Tag erinnern, an dem sie den Wagen gekauft haben. Sie haben ihn am Autohaus abgeholt und sind damit direkt auf den Platz gefahren. Jürgen hat das Radio aufgedreht, dann Pinsel und den Eimer mit der Farbe aus dem Kofferraum geholt. Zusammen haben sie "Monis Imbiss" in grün auf die Seitenklappe geschrieben. "Moni, das klingt doch gleich ganz anders als Mona", hat Jürgen gesagt. "Irgendwie sympathischer." Beim Malen lag seine Hand auf ihrer. Ein bisschen wie Hochzeitstorte anschneiden, dachte sie damals.
Sie nimmt sich vor, neue Farbe zu kaufen. Das "i" in ein "a" zu ändern. Sie ist jetzt wieder Mona. Ganz kurz ist sie euphorisch. Mona, ja. Ein neuer Anfang. Dann sieht sie ihr rundes, grinsendes Gesicht in der Scheibe und senkt sofort den Blick. Die Moni, die war eine schöne Frau, denkt sie. Bevor sie und Jürgen den Wagen gekauft haben, ist sie noch putzen gegangen, in der Grundschule direkt an der
Ausfahrt zur Autobahn. Meistens nachmittags, an den Wochenenden auch schon mal den ganzen Tag. Mit ihrem Besen ist sie in Rekordtempo durch die Turnhalle gefegt, durch die Klassenzimmer und Flure, um früher gehen und den Abend mit Jürgen verbringen zu können. Meistens hat sie sogar noch genug Luft gehabt, um dabei zu pfeifen. Putzen hält fit.
Sie dreht den Schlüssel im Zündschloss und fährt auf die Straße, ohne den Blinker zu setzen. Hustet ein paarmal und spürt ein Kratzen im Hals. Kein Wunder bei der Kälte. Sie könnte sich Tee kochen, wenn sie zuhause ist, denkt sie. Macht sie ja sowieso nicht. Sie wird sich mit einem Buch aufs Sofa setzen, es nach ein paar Minuten wieder weglegen und den Fernseher einschalten. Der wird Bilder in den Raum werfen, die die Welt kurz ein bisschen bunter machen. Die sie kurz von der Kälte ablenken, von ihren ungewaschenen Blusen über der Stuhllehne, von den braunen Bananen im Obstkorb. Sie wird den Ton abschalten und versuchen, an irgendetwas Schönes zu denken. An den schönen Mann vielleicht. Ein schöner Mann kann einen über die Stunden retten, wenn man Glück hat. Selbst, wenn man doch genau weiß, dass man nie so einen haben wird.
Jürgen war kein schöner Mann. Er hat die Würste in die Brötchen gepackt, eine Serviette drum. Hat dabei gelächelt, sodass man seine schiefen Zähne sehen konnte. Braun an den Zahnhälsen. Es sagt viel über einen Menschen aus, wie man seine Zähne pflegt, denkt sie. Aber eine schöne Stimme hatte er. Sie kann sie jetzt hören. Ganz klar, als würde er in dem Moment neben ihr sitzen. Ketchup und Mayo sind da drüben. Darf es für die Dame vielleicht noch eine Extrawurst sein?
Sie tritt aufs Gas, obwohl sie schon sieht, wie die Ampel vor ihr auf Rot springt. Jemand hupt und sie fühlt sich gut. Im Feierabendverkehr über rote Ampeln fahren. Ein kleiner Rest Nervenkitzel, der ihr noch bleibt. Sie reißt das Lenkrad herum und biegt in die Querstraße. Hätte gerne, dass die Reifen dabei quietschen, aber natürlich tun sie das nicht. Sie findet einen Parkplatz, bleibt noch eine Weile sitzen und guckt zu, wie der Regen in großen, harten Tropfen auf die Windschutzscheibe trifft. Dann öffnet sie die Fahrertür. Atmet frische, klare Luft. Geht die paar Meter zu ihrer Wohnung und hört entfernt den Verkehr auf der Schnellstraße. Was der schöne Mann wohl gerade macht, fragt sie sich. Wahrscheinlich sitzt er mit einer schönen Frau in irgendeinem italienischen Restaurant und trinkt Rotwein. Deshalb musste er sich so beeilen. So ein schöner Mann, denkt sie, bevor sie die Haustür aufschließt. So ein schöner Mann, der mir Bier kauft, und sich abends neben mir die Zähne putzt. Dann steht sie im Treppenhaus.
Katharina Korbach
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Marina Büttner
Welt am Ende
Die Welt fährt in großen Panzern
davon, die Luft wird dünn
Heckenschützen zielen stumm
Nägel mit Köpfen fliegen herum.
Ein Schrei, ein Kind fällt entzwei,
tosende Stille, betäubender Lärm
keine Gesichter mehr zu erkennen,
Ochs und Esel im Stall brennen.
Am Himmel ein dunkles Rauschen
stotternde Salven, Menschen wie
Dominosteine, zersiebte Gemäuer
heraus ragen blutrote Beine.
Fernab treffen Waffenwünsche ein,
rasch produziert, abgestimmt
von hohem Hause, wer
mit welcher wen masakriert.
Marina Büttner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Christina Gumpinger
Ich holte meine Stiefel aus dem untersten Regal. Band sie zu und zog meine Jacke an. Nahm den Schlüssel vom Brett und schloss die Tür hinter mir. Draußen war es kälter als erwartet. Ich schloss die Jacke bis oben hin und vergrub mein Kinn darin. Ich ging Richtung Straße und bog auf den Weg hinab zu den öffentlichen Toiletten, vorbei daran, hin zum Kreisverkehr und vorbei an den Müllcontainern, bis ich endlich auf der langen Geraden war. Meine Füße waren bereits in dem Automatismus gefangen, der sie immer fort, der Straße entlang, trug. Ich fühlte bereits die Kälte, die leicht an meinen Wangen streichelte. Ich zog die Haube noch etwas tiefer ins Gesicht und legte das rechte und linke Haarbüschel schützend um meine Ohren und den Hals. Meine Füße trugen mich immer weiter fort. Sie trugen mich auch ohne mein Zutun. Meine Willenskraft und die Kontrolle über meinen Körper erschlafften langsam. Dieser war nun fest eingebunden in einen regelmäßigen Rhythmus. In eine Bewegung, die so natürlich war, dass sie mir nichts abverlangte. Sie trug mich vorbei an Landschaften, die ich seit Jahren kannte, die mir aber doch immer wieder neu erschienen. Ein Land, das brach lag, ungeschützt. Wie ich, dachte ich. Risse durchzogen die Erde und halb geschmolzene Schneehaufen hatten zu vereisen begonnen. Trotz der Sonne war es kalt. Noch immer Winter, nicht schon Frühling, wie manch einer sagte. Das Gras neben mir, verbraucht, bräunliches Grün. Ungeschützt gegen Wind und Wetter. Nur wenige Häuser durchbrachen diese Leere.
Wenn man es von oben betrachten würde, ob es dann aussehe wie eine Landkarte meines Herzen? Ein, zwei, drei Lichter in einer weiten Fläche. Täler, Berge, Hänge, Abhänge, auslaufende Straßen, Schotter und Erdhügel. Inmitten ein, zwei Lichter, die leicht flackerten. Schwach und kümmerlich.
Verstümmelt sah sie aus die Landschaft. Obwohl man hier am Land, wohl freier von menschlichem Einfluss war. Verstümmelt war sie jedoch trotzdem. Wenn nicht vom Menschen, dann von Wind und Wetter. Dem Regen, der alles unter Wasser setzte. Langsam und langsam, bis sich Pfützen bildeten, die irgendwann zu kleinen Seen wurden, in denen das Gras leise ertrank. Der Schnee, der alles zudeckte, es bewahrte. Das Eis, das die Erde entzweibrach, von Rissen durchzogen, aufgesprungen an scharfen Kanten. Die Sonne, die es trocknete und die scharfen Kanten zu Waffen brannte, die das Gras erwachen lies, bis kein Tropfen mehr zu sehen war.
Christina Gumpinger
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Hendrik Bloem
Im Laufe des Mais
Ich arbeite im Laufe des Mais die Gebrauchsspuren heraus.
„Davor, wie das klingt, was ich sage, habe ich einfach keine Angst,“
ist so glatt gelogen, wie ungeleckt.
„Man kann nicht dies, das und jenes tun und dann ist man glücklich.“
Das hab ich erst spät verstanden, weil ich spreche kein Phrasisch.
Ich installier ne App fürs Wetter, weil ich den Himmel hier nicht seh.
Was heute für mich Beton ist, war für meine Großeltern
die blickdichte Gardine und die vielen Orchideen.
„Wie soll man das verstehen, wie soll man das verstehn?“
Das Leben ist eine Kunst, die gepflegt werden muss.
„Wie soll man das verstehen, wie soll man das verstehn?“
Was das Leben nicht kann, schafft die Kunst.
Stil ist keine Frage des Alters, sondern des Geschmacks.
Im Laufe des Mais erkennen wir das große Ganze nur noch im Detail.
Tshirtslogan falls sich mal jemand beschwert: Fahr da hin und hau die.
Ich denk nur noch in Tshirtslogans á la 'Fahr da hin und hau die'.
Oder wenn dich etwas stört, einen Sampleknopf zu haben,
mit nur einem Satz: „Fahr da hin und hau die.“
„Wie soll man das verstehen, wie soll man das verstehn?“
Das Leben ist eine Kunst, die gepflegt werden muss.
„Wie soll man das verstehen, wie soll man das verstehn?“
Was das Leben nicht kann, schafft die Kunst.
Das Neue entsteht immer vor dem Hintergrund der Geschichte.
Ein ebenerdiger Balkon ist auch nur ne Mauer vorm Fenster.
Und wenn ich krank bin, geh ich in Geschäfte die ich nicht mag.
In München Stamperl, am Niederrhein Pinneken und in Bielefeld Pinnchen.
Im Laufe des Mais heißt es Schnaps- oder Kurzenglas.
In gewachsenen Labyrinthen verdurste ich erst auf dem Rückweg, also gib Gas.
Vor Lampedusa ertrinken Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa, kein Spaß.
„Wie soll man das verstehen, wie soll man das verstehn?“
Das Leben ist eine Kunst, die gepflegt werden muss.
„Wie soll man das verstehen, wie soll man das verstehn?“
Was das Leben nicht kann, schafft die Kunst.
Hendrik Bloem
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT 2014-15 als eBook
Ein Jahr freiTEXT ist vergangen - es wird Zeit für die große Nachlese. Die Anthologie mit allen Texten aus 52 Wochen freiTEXT ist ab sofort als kostenloser eBook-Download erhältlich.
mit Texten von Thomas Mulitzer, Tobias Roth, Andrea Weiss, Sabine F., Magdalena Ecker, Claudia Kraml, Eva Löchli, Andreas Haider, Madlin Kupko, Dijana Dreznjak, Ingeborg Kraschl, Fabian Bönte, Simone Scharbert, Renate Katzer, Jacqueline Krenka, Karin Seidner, Nico Feiden, Sabine Roidl, Sven Heuchert, Veronika Aschenbrenner, Sarah Krennbauer, Philipp Feman, Matthias Engels, Clemens Schittko, Eva Wimmer, Gerhard Steinlechner, Matthias Dietrich, Christine Gnahn, Eva Weissensteiner, Marie Gamillscheg, Satie Gaia, Lina Mairinger, Jonis Hartmann, Philipp Böhm, Lütfiye Güzel, Kerstin Fischer, André Patten, Katrin Theiner, Daniel Ableev, Marina Büttner und Martin Piekar.
freiTEXT | Markus Streichardt
Im Plastozän
„Vor wie vielen Tagen bin ich gestrandet?“ Er lacht gequält und schüttelt gleichzeitig den Kopf. „Gestrandet, dass mir ausgerechnet dieses Wort einfällt. Absurd. Wäre ich doch an einen Strand gespült worden!“, flucht er durch die Zähne. „Die Überlebenschance wäre nicht geringer, aber das Ende gewiss erträglicher gewesen. Auf einer einsamen dafür paradiesisch schönen Insel, wie man sie sich gemeinhin vorstellt. Feiner weißer Sandstrand und 20m hohe schattenspende Kokosnusspalmen. Aber hier nichts dergleichen. Immerhin ist es bewölkt.“
Die Crewmitglieder schrien wild durcheinander und gaben Anweisungen auf Spanisch. Eine Sprache, die er kaum verstand. Jemand drückte ihm ein mechanisches Mini-Anemometer in die Hand, als wäre er ein Kind, das ein Spielzeug zur Beruhigung brauchte. Und es wirkte tatsächlich. Er starrte weniger verängstigt als fasziniert auf das immer schneller rotierende Flügelrad. Die digitale Anzeige sprang hin und her, von 47 auf 51 Knoten und zurück. Er wusste, dass 20 Knoten ca. 37 km/h entsprechen und begann umzurechnen.
Als das Anemometer 60 Knoten maß, glaubte er, jeden Moment davon zu fliegen. Stattdessen rutschte ihm der Windmesser aus der Hand und über den Boden Richtung Bug. Er stand mit einer Selbstverständlichkeit auf, als wolle er einen alten Schulfreund, der soeben zur Tür her reinkam, freudig begrüßen. Er machte keine zwei Schritte, da wurde das Boot von einer Welle emporgehoben, er verlor das Gleichgewicht, prallte mit dem Rücken gegen den Mast und fiel beim nächsten Wellenschlag kopfüber die Reling.
Als er wieder zu sich kam, lag er zusammengekauert auf einem beigefarbenen Kühlschrank. Die Kühl-Gefrier-Kombination maß genau 180 Zentimeter und entsprach seiner Körpergröße.
Er versuchte sich zu verorten, seine Position zu bestimmen, indem er verzweifelt den Kopf in alle Himmelsrichtungen drehte, ohne irgendein Fixpunkt festmachen zu können. Das Unterfangen war schier hoffnungslos allein wegen seiner Kurzsichtigkeit. Hinzukam, dass er ständig die vom Salzwasser geröteten Augen zusammenkniff. So trieb er für Stunden dahin.
„Ich hätte eher erwartet, von modernen Piraten gekidnappt zu werden.“ Er stellte sich vor, wie er den Millionenbetrag mit einem schwarzen Edding auf ein Blatt Papier schreibt, um dann vor laufender Kamera die deutsche Regierung anzuflehen, den Lösegeldforderungen nachzukommen. „Zwei oder wenigstens eine Million halte ich für angemessen.“ Er lachte.
Es zeigten sich schemenhafte Umrisse einer Art Bergspitze, zumindest ragte etwas Großes aus dem Wasser. Obwohl die Strömung ihn auf direktem Wege dorthin spülte, legte er sich auf den Bauch und begann hektisch zu paddeln. Er kam nur unwesentlich schneller vorwärts und war alsbald erschöpft. Er erschrak und fiel beinahe ins Wasser, als er sich mit der linken Hand in den Plastikringen eines Sixpacks verhedderte. Er befreite sich davon und hielt die Ringe ungläubig vor die Augen. Dann schleuderte er sie plötzlich mit einer ungeheuren Wut zurück ins Wasser. Er bemerkte nun erst, wie viel Plastikmüll um ihn herumschwamm. Neben unzähligen Plastikringen, die einstmals Bier- und Coca-Cola-Dosen zusammenhielten, tummelten sich gepresste Plastikflaschen, löchrige Plastiktüten und Plastikeimer, Kabeltrommeln sowie Zahnbürsten, Einwegrasierer und CD-Hüllen. Er zog angewidert die Hände und Füße aus dem Wasser und rieb sie trocken, als müsse er sich vor einer gefährlichen Krankheit schützen.
Der sich vor ihm auftürmende Berg war zwar eine Insel, glich jedoch vielmehr einer gigantischen Müllhalde inmitten des Nordpazifischen Ozeans. Der Strand war als solcher kaum zu erkennen, er wurde über-, geradezu verdeckt von Abermillionen kleinen und großen überwiegend aschfahlen Plastikstücken mit wenigen bunten Einsprengseln, die in der Sonne matt glänzten. Haushaltsgeräte in allen erdenklichen Größen und Formen ragten wie Pfeiler heraus. Der Kühlschrank, auf dem er saß, reihte sich perfekt ein.
Er wusste nicht, was er tun sollte. Er fingerte an der Schwimmweste, stellte die Lampe an und aus, dann stand er auf und ging an Land. Der Untergrund knirschte und quietschte unter jedem Schritt, als würde er über den Linoleumboden einer Sporthalle laufen.
Auf seinen Streifzügen kartografiert er die Insel. Er kommt auf eine Größe von knapp zehn Quadratkilometern. Im nördlichen Teil gibt es einzig ein paar abgestorbene Plamen, wobei zwei Baumstämme glücklicherweise dicht genug beieinanderstehen, an denen er eine löchrige Zeltplane aufgespannt hat. Sein Lager.
Karge Felsklippen begrenzen den Osten und den Süden und werden hin und wieder von Eissturmvögeln angeflogen. Wenn er dort verbeikommt, versucht er sie durch gezielte Steinschläge zu töten. Die Versuche scheitern jedes Mal kläglich. Der Hunger rumort in ihm, aber er ist noch nicht stark genug, um seinen Ekel vor den an kaputten Leuchtstoffröhren klebenden Rankenfußkrebsen zu überwinden. „Das Abnehmen tut mir gut, ich verfüge über genügend Fettreserven“, redet er sich ein, während er seinen salzverkrusteten Bauch streichelt.
Er ist vor allem durstig, die ganze Zeit. Er trinkt Regenwasser, das sich in Pfützen und Kanistern gesammelt hat. „Immerhin ist es bewölkt, ansonsten wäre ich vermutlich schon verdurstet oder geröstet.“
Im Westen der Insel, wo er an Land ging, konzentriert sich der Großteil des Plastikmülls, der dann vom Wind und Überschwemmungen weiter ins Innere getragen wird.
Er findet Gummihandschuhe und Gummistiefel, von denen er sich das jeweils beste Paar anzieht.
Er findet Plastikboxen mit verrubbelten Etiketten in englischer und spanischer Sprache sowie mit chinesischen und japanischen Schriftzeichen.
Er findet zerbeulte Schwimmbecken voll mit Kinderspielzeug, da drunter Elektroautos ohne Fernbedienung, Powerrangers, von denen manchen ein Arm oder der Kopf fehlt, sowie Giraffen, Elefanten, Büffel, Krokodile, Flamingos, Zebras und weitere Plastiktiere, die in Summe die Artenvielfalt des Berliner Zoos abbilden könnte.
Er findet abgelaufene Kreditkarten, Club-Karten und Bibliotheksausweise. Er kombiniert sie miteinander und bezahlt damit imaginierte Ware oder leiht Bücher aus. Er erfindet Dialoge und alberne Buchtitel wie Der alte Mann und das Plastikmeer oder Der Vierunddreißigjährige, der ohne Schweizer Taschenmesser an Board ging und verschwand. Er lacht.
Er findet ausgetragene Turnschuhe, Tetrapacks, Blechdosen, Styroporreste, mit denen er sein Lager auslegt, Reusen, an Bojen und Seilen saugende Muscheln, Lichtschalterabdeckungen, Kosmetikdöschen und –fläschchen, uralt Röhrenbildfernseher, aber auch das Gehäuse eines modernen Ultra-HD-Fernsehers. „Es ist nicht lange her“, erinnert er sich, „da stand ich selbst noch vor solch einem Modell bei Media-Markt und war äußerst verzückt von der Bildschärfe und dem Detailreichtum.“
Er findet Tausende von Handyhüllen, aber kaum Handys.
Er findet so vieles, nur einen Gefährten nicht. Keinen Freitag.
Er würde gern ein Tagebuch führen und Zeugnis ablegen. „Nur ist Papier leider Mangelware.“ Er lacht. Er lacht viel, seit er hier festsitzt.
„Warum habe ich bloß die Bootstour gebucht?“, fragt er sich immer wieder, obwohl er die Antwort weiß. Nach vier Tagen paradiesischer Eintönigkeit – bestehend aus Schnorcheln und Strandmassagen - war er auf der Suche nach etwas Abenteuer gewesen. Da kam ihm das Angebot plus 15% Rabatt für Hotelgäste gerade recht. Er unterschrieb ohne zu zögern die Verzichtserklärung.
Nachts beginnen Müll und Meer zu leuchten. Planktonorganismen steigen auf und blinken hellblau, sobald sie ausgerechnet mit dem Plastikschrott in Berührung kommen. Überall in den kleinen Buchten blitzt es permanent. Obwohl das Licht kalt ist, gibt es ihm ein Gefühl von Sicherheit. „Und das Schauspiel ist es vielleicht wert gewesen.“ Ohne das es näher zu bestimmen.
„Ich bin noch nicht tot“, murmelt er vor sich hin. Er erinnert sich an das letzte Personalgespräch. Sein Vorgesetzter hatte ihn zunächst für die geflissentliche Arbeit gelobt, um dann mehr Engagement zu fordern. Er kritisierte ihn dafür zu kritisch zu sein. Und die Personalleiterin ermunterte ihn, die strukturellen Veränderungen, die die Firma auf allen Ebenen erfasse, positiv anzunehmen und produktiv zu verwerten. Er schreit trotzig: „Ich bin am Leben.“ Er hält auch diese Aussage für verbesserungswürdig. Er schreit so laut, dass sich die Stimme überschlägt: „ichlebeichleeebeichleeeeeeeebe.“ Sein Vorgesetzter würde diese Einstellung bestimmt begrüßen und stolz auf ihn sein. Er lacht und kann nicht mehr aufhören vor Lachen.
Er entscheidet, dass er seit drei Tagen hier festsitzt. Und die Insel eine Müllhalde ist. Eine Müllhalde, die regelmäßig von Müllmännern angesteuert wird. „Es sind bestimmt ehemalige Fischer“, behauptet er mit voller Überzeugung, „die vom Fang nicht mehr ihre Familien ernähren können und nun Müll vom Festland aufs weite Meer hinaus transportieren. Sie werden bald kommen, vielleicht schon morgen, und mich dann retten. In Deutschland kommt die Müllabfuhr ja auch einmal die Woche.“
Markus Streichardt
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Alke Stachler
auf offenem feld rührt der tag dich, berührt dich wie mit dem kleinen zeh wasser, sodass deine oberfläche durchquert ist von ringen. dieses ist ein dünner ort, fahrige birken, blattgold über allem, moment an moment gefädelt wie schmuck, hier tastet sich etwas. das sonst weit voneinander, das sonst wie pole sich. und du: geh ganz bis zum ende der zweige, der halme, der knappsten stellen, setz noch einen schritt. einen mehr, als würde die luft dich, außer du zweifelst. und zweige: wie die sonne einreißt, oder nein, die sonne rinnt, rinnt wie durch finger, zwischen fingern von etwas größerem hindurch, und schwärzerem. geh weiter und du kommst an eine stelle, die dich, die es, die was mit dir macht
Alke Stachler
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at