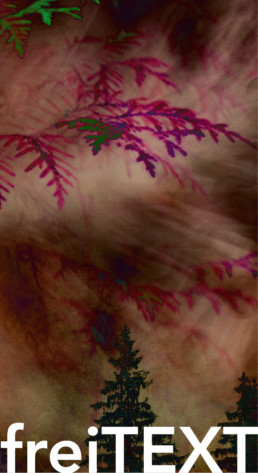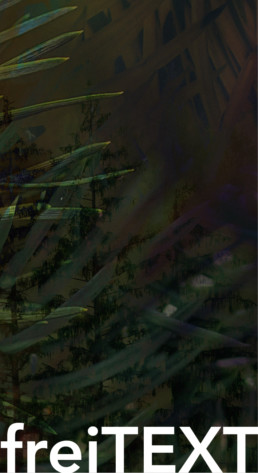freiTEXT | Simone Alber
Sinnlosigkeitsprobleme wirksam bekämpfen
Wenn man von einem Sinnlosigkeitsproblem befallen ist, sollte man nicht am Samstagvormittag zum Edeka gehen.
Ein Sinnlosigkeitsproblem krallt sich grau und schwer im Gehirn fest und wabert einem neblig trüb ums Gesicht herum. Es ernährt sich von der Lebensfreude seines Wirts und saugt ihm den Elan aus den Gliedern. „Wozu das alles.“, flüstert es. „Macht doch eh keinen Sinn.“ Ein Sinnlosigkeitsproblem ist in keiner Lebenslage förderlich, aber es gibt doch Tätigkeiten, die kann man trotz akutem Befall einigermaßen ausüben.
Putzen zum Beispiel ist auch mit Sinnlosigkeitsproblem möglich. Das Sinnlosigkeitsproblem motzt dann zwar: „Wird doch eh wieder dreckig!“, aber wenn es die frisch geschaffene Sauberkeit sieht, wird es ein wenig kleinlaut, und das Gemotze wird leiser.
Keller aufräumen, Steuererklärung machen, einen Pulli kaufen: alles Dinge, die sich trotz Sinnlosigkeitsproblem einigermaßen bewerkstelligen lassen.
Man kann mit einem Sinnlosigkeitsproblem auch relativ entspannt vor dem Fernseher sitzen. Das Sinnlosigkeitsproblem hockt daneben und mault vielleicht leise vor sich hin, aber durch die Fernsehberieselung wird es eingelullt und drängt sich nicht in den Vordergrund.
Richtig empfehlenswert ist Kino. Wenn man einen guten Film erwischt, kann es sein, dass das Sinnlosigkeitsproblem gar nicht erst mit rein kommt. Es wartet draußen, oder es geht schon mal nach Hause, und wenn man Glück hat, findet es den Heimweg nicht, und man ist es für eine Weile los.
Auch Joggen ist eine Möglichkeit, um es loszuwerden. Das Sinnlosigkeitsproblem ist eher unsportlich. Wenn man einigermaßen trainiert ist, kann man ihm davonlaufen.
Wäsche aufhängen dagegen ist nicht empfehlenswert bei akutem Sinnlosigkeitsproblem-Befall. Bei dieser Tätigkeit hockt es einem schwer im Nacken, so, und es flüstert einem ins Ohr: „Schon wieder diese Socken, schon wieder diese Unterhosen. Die hast du letzte Woche auch schon aufgehängt. Und morgen wirst du sie wieder abhängen. Und nächste Woche wieder aufhängen. Und dann wieder abhängen.“
Ja, beim Wäsche aufhängen fühlt sich das Sinnlosigkeitsproblem bestätigt.
Aber samstags beim Edeka, da entfaltet es sich zu seiner ganzen Größe. Da trumpft es richtig auf.
Schon die Tiefgarage ist seine Welt. Es schmiegt sich an die grauen Betonpfeiler, und man atmet es ein mit der kalt-feuchten Luft. Es suhlt sich im schmutzigen Wasser der Pfützen. Im Scheppern der Einkaufswagenräder hört man seine Stimme: „Wozu, wozu, wozu.“ Es quetscht sich mit hinein in den Aufzug. Neben die Aufzugknöpfe hat es einen alten Kaugummi geklebt, der seine Botschaft verbreitet: Hoffnungslos. Trostlos. Sinnlos.
Am Pfandflaschenautomat glotzt es einem aus dem Rohr entgegen, in dem die Plastikflaschen verschwinden und sofort geschreddert werden. Aus den überquellenden Süßigkeitenregalen höhnt es: „Auspacken, fressen, wegwerfen. Plastikschwemme. Karies.“
So richtig wohl fühlt es sich in den Gesichtern der Menschen, die einem auf dem Rollband auf dem Weg nach unten entgegenkommen. Müde, graue Sinnlosigkeitsgesichter mit bitteren Kerben um den Mund. „Und ich, und ich?“, fragen die Gesichter. „Wann bin ich dran? Und wer liebt mich?“ Das Sinnlosigkeitsproblem lässt ihre Leben jämmerlich und klein erscheinen.
Das Sinnlosigkeitsproblem klebt in den ungewaschenen Haaren der jogginghosigen Schlurfeinkäufer und ruft zur Resignation auf: „Wozu die mühevolle Prozedur mit dem Shampoo auf sich nehmen! Übermorgen sind sie eh wieder fettig.“
Kartoffeln, Bananen, Haferflocken, Nutella, Mehl, Spaghetti, Salami, Milch, Eier, Joghurt, Emmentaler. Ja, ja, und dann zum Schluss das Klopapier. Das Sinnlosigkeitsproblem nickt sinnig vor sich hin.
Der Wagen voll, das Überleben wieder für eine Woche gesichert. „So viel Mühe!“, sagt das Sinnlosigkeitsproblem. „Und wozu? Arbeiten, Geld verdienen, Einkaufen, Ausräumen, Einräumen, Kochen, Essen, Spülen. Ein ewiger Kreislauf. Und wozu? Alt werden. Sterben.“
Das Sinnlosigkeitsproblem ist kein angenehmer Zeitgenosse. Und Menschen, die von ihm befallen sind, sind ebenfalls unangenehm. Sie sind meist griesgrämig und schlecht gelaunt. Wenn man etwas von ihnen will, werden sie pampig. Und wenn man nett zu ihnen ist, fangen sie an zu heulen.
Wer ein Sinnlosigkeitsproblem hat, sollte möglichst nicht samstags zum Edeka gehen. Besser ist es, darüber zu schreiben. Schreiben findet das Sinnlosigkeitsproblem langweilig. Das gleichmäßige Flüstergeräusch des Stifts auf dem Papier macht es müde. Und in einem aktiven Gehirn kann es sich so schlecht festkrallen. Irgendwann schläft es ein und fällt ab. Da liegt es dann in seiner ganzen aufdringlichen grauen Hässlichkeit und schnarcht vor sich hin. Dann sollte man ganz leise den Stift aus der Hand legen und sich vorsichtig aus dem Zimmer schleichen. Pssssst! Tür zu!
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Thomas Büch
Erinnerung an eine Insel
1.
Ringemeier saß im Nachtbus und bestand beinah vollständig aus Heimkehr. Dabei entzog sich ihr gerichtetes Existieren durch den Ortswechsel jeder Sehnsucht. In Ringemeiers Vorstellung war die Dunkelheit (von Sternen einmal abgesehen) ein vollkommen durchsichtiges Objekt in den weiß behandschuhten Händen ältlicher Pärchen, welche niemand mehr als Eltern beschrieb. Mag sein, dass Mütter, lange in der offenen Tür stehend und von einer gewaltigen Schafherde umgeben, mit nachtblinden Augen auf die ausbleibende Tochter warten. Mag sein, dass die Probleme beginnen, wenn die gute Erde in all ihrer Kugelförmigkeit sämtliche Grenzen an die Endlosigkeit verliert. Mag sein, dass spät nur eine Kategorie von Zeit darstellt. Ringemeier fuhr nach Hause. Sie war größtenteils keine zwanzig Jahre alt.
2.
Schneidinger liebte für sein Leben an R.'s Haut einzig und allein ihre Muttermaligkeit und obwohl man annehmen darf, dass es sonst niemanden auf dieser Welt gab, dem er ein Gefühl entgegenbrachte, das Zuneigung zumindest annähernd ähnelte, sprach er nie von Haut, sondern immer bloß von Integument, so sehr war er Gefangener einer Sprache, die das Verletzlichsein als Konzept des Miteinanders leugnete. Es kann daher kaum wundernehmen, dass er letztlich sogar in weitaus höherem Maße seiner Sterblichkeit zum Opfer fiel, als dies üblicherweise Angehörigen des männlichen Geschlechts möglich ist.
3.
In dem kleinen, ein bisschen verwilderten Gärtchen unserer Protagonistin lebte aber noch viele Jahre ein Maulwurf mit einem siebenzackigen hellen Fleck auf der Stirn. Sie hätte ihn gerne einmal einem ihrer Besucher gezeigt, nur kamen die immer erst in tiefer Nacht, und musste daher dieses pelzige Ding auch einer sehr überschaubaren Miniaturwelt zugehörig erscheinen, so hätte doch kein Mensch je die zum Gestreicheltwerden geschaffene Geschmeidigkeit seines Fells vergessen mögen oder die glücksverlorenen Quieklaute des Winzlings, wenn er sich am Köpfchen kraulen ließ.
4.
Wir alle sind Teil einer vollkommen linear erzählten Geschichte und falls es uns zuweilen auch so vorkommen mag, als bedürfe unsere Flüchtigkeit eines vielstimmigen Chores von Chronisten, wollen wir gleichwohl nie der Kränkung anheimfallen, sofern uns das Gegenteil bewiesen wird.
5.
Es dämmerte schon sehr zum folgenden Tag hin, als der inzwischen arg ramponierte Bus in die Hofeinfahrt einbog. Zu solch exzentrischer Besuchsstunde hielt sich das Empfangskomitee in engen Grenzen, aber ein paar Schafe standen herum. Manch einer wäre ob der Begrüßung durch spärliche Blöklaute und vereinzelte neugierige Blicke enttäuscht gewesen, Ringemeier indes sprang lachend aus dem Führerhaus, und am Himmel leuchtete der Morgenstern aus dem ungeheuren Licht seiner Möglichkeit.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Achim Stegmüller
Verfolgungen
1
„Ich war nicht immer so allein. Ich hatte mal eine Freundin. Wie ich nach ihr Sehnsucht habe. Wäre ich mit ihr zusammen geblieben, hätte mein Leben einen anderen Verlauf genommen. Ich wäre um die Sonne gekreist und nicht um den Mond. Ich säße nicht andauernd hier im Treppenhaus. Sie hat sich immer einen Hasen gewünscht. Einen kleinen weißen Hasen mit roten Augen. Ich habe diesen Wunsch nie erst genommen. Und dann hat sie mich an dem Tag, als ich ein Referat über Strukturwandel im Ruhrgebiet hielt, verlassen. Ich habe es nicht verstanden. Ich war noch beschwingt vom Lob meines Professors. Sie sagte: Du hast mir keinen Hasen gekauft. Und ich: Was? Sie: Du hast mir keinen Hasen gekauft, und deshalb verlasse ich dich. Ich kann ja nicht ewig darauf warten, dass man mir einen Hasen schenkt.“
2
„Ein weißes Monster verbreitet Angst und Schrecken. Es ist so groß wie zehn Eisbären. Wenn es nur einmal sein Maul so richtig aufreißt, ist schon ein halbes Reisbauerndorf weg. Wer kann, der flieht. Und wohin dieses weiße Monster auch kommt, überall sind die Dörfer und Städte schon verlassen. Das weiße Monster wird immer hungriger! Das Monster stößt auf ein neues Dorf. Alle Bewohner sind über Nacht geflohen, nur ein kleines Mädchen ist vergessen worden. Ein Waisenmädchen, eines aus dem Ausland, mit einer anderen Hautfarbe, eines, das die einfache Arbeit im Stall verrichtet. Und wie das Mädchen am frühen Morgen aufwacht, schaut es in die Augen des Monsters. Sie findet diese Augen nett. Das Monster nimmt sie in seine Pranken und hebt sie hoch in die Luft. Das Mädchen fühlt sich wie eine Königin. Sie zeigt dem Monster die Wasser- und Speichervorräte des Dorfes, damit es sich stärken kann. Und dann geht das Mädchen voraus und das Monster hinterher und wie sie so gehen wird das Monster immer kleiner, wird zu einem Hasen. Und noch bevor sie in der nächsten Stadt ankommen, weiß schon jeder: Das kleine Mädchen hat das weiße Monster gezähmt. Man feiert Feste für das Mädchen und das Monster, baut Tempel für sie, aber sie mögen die Stadtluft nicht und ziehen weiter. Erst in einem kleinen Dorf fühlen sie sich wohl. Das Mädchen bekommt dort eine warme Suppe, der Hase Salatblätter. Mit dem Mädchen und dem Hasen kehren Wohlstand und Reichtum in das Dorf ein.“
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Frederike Schäfer
Hugo
1
Ich stehe in einer überfüllten Küche und versuche, gelassen am Kühlschrank zu lehnen. Ich bin Studentin, ich bin auf einer Party. Ich finde das toll, ich muss das toll finden, mich wohlfühlen. Der Kartoffelsalat suppt vor sich hin, das warme Bier in der Wanne mit abgestandenem Wasser, vor einigen Stunden bestimmt frisch und kühl, jetzt den steigenden Temperaturen der Dachgeschosswohnung mit undefinierbarem Teppichboden ausgeliefert. Ich tippe auf Olive. Mit lilafarbenen Tupfen. Und piksen tut er auch. Ein bisschen wie Schmirgelpapier unter den nackten Füßen.
„Sockenparty“, hat Judith gerufen, als wir im fünften Stock ankamen.
„Jaa“, habe ich gesagt und nur gedacht, lustig, ich trage gar keine Socken.
Ja, denke ich, Party. Im Flur sitzen die anderen in einem großen Kreis, die Beine in die Mitte gestreckt. Sieht ein bisschen aus wie eine große, triste Blume, die morgen ihre Eltern besuchen wird und erzählt, wie wahnsinnig toll doch diese Party war. Und ihre Eltern werden sagen: „Jaja, diese Studenten. Als wir noch jung waren ...“ Ich will nicht Teil der Blume sein, aber in der Küche will ich eigentlich auch nicht sein. Um ehrlich zu sein, möchte ich überhaupt und gar nicht auf dieser Party sein. Es ist mittlerweile so eng, dass ich mich kaum rühren kann. Mein Kopf ragt unnatürlich weit in den Raum, weil sich hinter mir ein Gewürzregal befindet und ich meinen Kopf schlichtweg nicht anders halten kann.
Ich nehme mir ein zimmertemperaturwarmes Beck's Holunder und denke nur: Idiotenapostroph.
„Hat jemand einen Flaschenöffner“, fragt mein nach vorne gereckter Kopf.
„Klar“, sagt der Typ neben mir und öffnet meine Flasche mit seiner. Er braucht sechs Anläufe.
„Ich bin Hugo“, sagt er.
„Ich bin Frida“, sage ich.
„Hallo, Frida“, sagt er.
„Hi“, sage ich.
Wir trinken jeder einen Schluck, und irgendwie kommt es dazu, dass Hugo mir Fotos von Kleinkindern zeigt.
„Weißt du“, sagt er, „nur, weil ich ein Mann bin, kann ich Kinder ja trotzdem süß finden, so gar nicht sexuell, meine ich. Aber man muss sich immer irgendwelche perversen Witze anhören. Ist zum Kotzen.“
„Ja“, sage ich. „Ist echt beschissen.“
„Dabei“, sagt Hugo, „ist das doch voll okay. Ich meine wegen Frauenquote und so. Da darf ich doch wohl in einem Kindergarten arbeiten, oder nicht?“
„Ja“, sage ich. „Klar.“
Hugo packt sein Handy weg. Ich sage Handy und nicht Smartphone.
Hugo fragt: „Wollen wir vielleicht woanders hingehen? In Ruhe quatschen?“
„Ja“, sage ich. „Klar, gute Idee.“
Wir gehen in Judiths zehn-Quadratmeter-Zimmer und setzen uns auf die Matratze, die versucht, ein Bett zu sein, aber einfach nur eine harte Matratze auf einem kratzigen Teppichboden ist. Aber es ist ruhig, „zum quatschen“.
„Ich trinke ja keinen Alkohol“, sagt Hugo.
„Ach so“, sage ich, „wie kommt's?“, und trinke einen Schluck von meinem Beck's Holunder.
Hugo zuckt mit den Schultern. „Ach, war 'ne schwierige Zeit, also in der Schule. Alkohol und so. Hab dann entschieden, dass ich das nicht mehr brauche.“
„Ja“, sage ich. Mehr fällt mir nicht ein.
„Ja, auch mit Mobbing und so. Ich war auch richtig fett. War dann erst mal im Kindergarten und jetzt halt hier.“
„Wow“, sage ich. „Super, cool“, sage ich bestimmt auch noch. Hugo ist doch ganz in Ordnung.
2
Wir liegen auf einem neunzig-Zentimeter-Kinderzimmerbett im Haus seiner Eltern. Es müffelt. Irgendwie nach dreckigem Mann mit einer Spur Axe irgendwas.
Wir sind nackt. Ich liege unten. Meine Beine sind gespreizt, er auf mir drauf. Er schwitzt, und sein Rücken ist haarig. Wir küssen uns. Mit Zunge. Eigentlich mag ich das nicht, weil ich es nicht schaffe, meinen Speichelfluss zu kontrollieren, aber gut. Jetzt ist seine Hand zwischen meinen Beinen und versucht allem Anschein nach, seinen Penis in meine Vagina zu befördern. Irgendwie.
„Warte mal.“
Das war ich. Ich drücke Hugo von mir weg und wische mir schnell mit der Hand über den Mund.
Hugo sagt: „Äh.“
„Äh“, sage ich nicht, sondern: „Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir schlafen will. Also, nicht so, zum ersten Mal, meine ich. Ich will mit niemandem zum erstem Mal schlafen, der nicht mein Freund ist, das habe ich dir gesagt. Also, also richtig, meine ich, ein richtiger Freund, mein richtiger Freund.“
„Ja ...“, sagt Hugo. Mit drei Punkten am Ende, ohne zu erklären, wofür die drei Punkte stehen.
„Und ohne Kondom schon gar nicht“, sage ich.
„Ja, äh“, sagt Hugo, „also, es ist so, mit ist das für mich einfach nicht gut. Ich spür da nichts.“
Ich sage nichts.
Hugo sagt: „Ich hab ja auch keine Krankheit oder so. Ehrlich.“
Ich sage nichts.
Hugo küsst mich. Mit Zunge. Ich küsse ihn auch. Ich weiß nicht, wie lange wir uns küssen. Und ich liege immer noch so da, mit gespreizten Beinen. Alles andere würde auch keinen Sinn machen, wenn ich meine Beine lang ausstrecken würde, oder so. Oder wir nebeneinander lägen. Keinen Sinn. Und so ist das ja auch okay. Ich meine damit, Hugo ist schon okay. Lecken ist okay, und ich habe ihm auch einen runtergeholt. Das war in Ordnung. Und jetzt das Küssen, das ist auch in Ordnung. Er mit seiner Zunge, wie ein raues, kleines Tier in meiner Mundhöhle. Und jetzt bewegt er sich ein wenig. Sein Körper ist meinem so nahe, und ich merke erst gar nicht, was da passiert, da ist plötzlich nur so ein Schmerz, so ein Schmerz irgendwie in mir drinnen. Und ich realisiere: Okay, dann habe ich jetzt wohl Sex. So zum ersten Mal. Das ist scheinbar in Ordnung. Und es fühlt sich in mir ein bisschen so an wie beim Schulsport, wenn man durch die Halle rennt und stolpert und mit seiner nackten Haut über den Hallenboden rutscht. Und diese Haut, die gibt nach, und die reißt und die brennt, und gleichzeitig ist da dieses Gefühl von Kälte, das mit dem Schmerz kommt. Und ich, ich liege ganz ruhig da und bewege mich nicht und hoffe, hoffentlich sieht er den Schmerz nicht und die Kälte. Hoffentlich sieht er das nicht. Stattdessen sage ich: „Das tut weh.“ Und Hugo bewegt sich nicht mehr.
„Mann, tut mir leid“, sagt er. Und er küsst mich. Ich weiß nicht, ob ich das will.
Ich küsse ihn auch. Und Hugo bewegt sich jetzt, er wird richtig schnell und stößt und macht Geräusche. Und je länger er sich bewegt, desto weniger spüre ich den Schmerz. Und plötzlich bricht Hugo einfach zusammen, als wäre er bewusstlos. Er rollt sich neben mich, aber er ist nicht bewusstlos. Sein Augen sind zwar geschlossen, aber er lächelt. Ein seliges Lächeln ist das. Und aus mir, aus mir suppt eine warme, klebrige Flüssigkeit. Und mir wird übel, mir wird richtig übel. Und ich sage: „Ich muss mal auf die Toilette.“ Und irgendwie tut es jetzt wieder weh, so richtig weh. Ich pinkel, und es brennt, und da ist Blut. Aber das ist schon okay, das mit dem Blut, so beim ersten Mal.
Und ich komme zurück in sein Zimmer, und Hugo sitzt am Schreibtisch an seinem Computer, und er sagt: „Hey, kann ich eine Runde zocken?“
Und ich sage, „klar“, und lege mich auf das Bett.
„Du bist echt super“, sagt Hugo.
„Dann sind wir jetzt wohl in einer Beziehung“, sagt Hugo.
„Ja“, sage ich, „dann sind wir wohl in einer Beziehung.“
3
Ich nenne Hugo nicht mehr Hugo. Ich sage „Ügó“, französisch.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Peter Sipos
Schnee bei uns
Schon als ich dich kennenlernte, wusste ich, dass es niemals klappen wird zwischen uns. Wir leiden einfach beide zu viel. Wenn wir miteinander schlafen, dann sagst du oft, du fühlst dich wie eine Heldin, aber ich glaube du bist keine Heldin. Ich kann diese Sprüche nicht leiden und das solltest du wissen. Die Sonne scheint heute und es liegt Schnee auf unserem Grundstück, was eigentlich nicht sein kann, aber bei uns liegt immer Schnee. Wir sitzen im Garten und du willst nicht reden. Ich finde immer, dass du etwas mies drauf bist, wenn die Sonne scheint, aber du schließt nur die Augen und sagst, du wärst sonnenempfindlich, was nach meinem Empfinden nicht stimmt. Ziehen wir weg von hier, sage ich, ich kann diesen Schnee nicht mehr haben, ich sage das schon ewig. Ach, hör auf, sagst du, ich finde es schön hier, wir haben sogar Eiszapfen. Und ich bin genervt, weil du das immer machst: mich ablenken, wenn ich melancholisch werde. Das ist nicht wahr, sagst du dann und ich erkläre dir: Hör zu, Mell, du musst endlich aufhören, mir zu sagen, wer ich sein darf, du sprichst so selten gut zu mir. Und nach einer Weile frage ich: Hast du Hunger? Es ist anders, wenn ich esse, weil ich brauche Essen, damit ich nicht friere. Ich kaue den Salat und sage: wir müssen etwas ändern. Als ich dann aufgegessen habe, sitzen wir am Küchentisch und wir sind weiterhin nicht verheiratet. Es geht zu Ende mit uns, das weiß ich schon lange. Was soll man schon tun, frage ich. Du nickst, wie vorgestern auch schon. Ein verwachsenes Ehepaar wäre auch nicht schön, sage ich, weil ich vermute, dass du dasselbe denkst. Wir sind kein Ehepaar, sagst du. Ich finde, das war jetzt taktlos, sowas Eindeutiges zu sagen. Es ist kalt, sagst du, es war schon immer kalt in diesem Haus. Wieso bist du schon wieder so gereizt, frage ich indem ich dich über den Tisch hinweg streichle, mit der flachen Hand. Wir lachen heute schon gar nicht. Hallo, ich gehe jetzt, sage ich, weil du mich nur dann in Frieden lässt, wenn ich Quatsch rede. Das Lügen ist meine Spezialität, sage ich. Das Lügen ist nicht deine Spezialität, sagst du, wenn schon ist das Lügen deine Allergie. Und es ist endlich etwas dabei in deinen Worten, etwas das mitklingt, wie wenn eine Brise auch noch riecht, das heißt gut riecht, egal. Komm gehen wir jetzt endlich nach Hause, könnte ich dir befehlen aber wir sind ja noch Kinder, wir sind noch Kinder im Herzen, da brauchen wir keine Kinder kriegen. Es ist alles so chaotisch mit dir, hätte ich sagen können, als wir uns kennenlernten, damals, als wir hier einzogen. Aber stattdessen habe ich nur Unsinn geredet und meine Lippen gespitzt, wie auch heute. Spitze Lippen machen mich scharf, sagtest du einmal und ich weiß nicht warum, aber dieser Satz blieb immer in meinem Kopf. Eine Liebe ist das nicht. Wir blinzeln. Mell, rufe ich und du schaust kurz zur Decke hinauf, Mell, wir müssen gehen jetzt, unser Flugzeug startet. Ich verlasse dich, sagst du dann. Ich bin kein richtiger Mensch, ich mache alles schlimmer, ich habe keine Ambitionen und wenn ich hinfalle, dann bleibe ich liegen, weil von alleine aufstehen werde ich sicher nicht. Mell, lass uns gehen, Mensch, wenn wir den Flug verpassen, dann bleiben wir hier, was machen wir dann? Du schaust mit zusammengezogenen Augenbrauen auf meinen Brustkorb. Wenn du nur in meine Augen schauen würdest, dann könnte ich dich überzeugen, mit mir zu fliegen. Aber wir bleiben im Haus, das eigentlich schon immer nur ein Nebenhaus war. Das Nebenhaus von irgendeiner Fabrik oder so. Vielleicht kommt der Schnee von da. Wenn alles so bleibt, sage ich, dann ist es aus zwischen uns. Du machst die Tür zum Garten auf, also packe ich meinen Koffer. Dann schaust du mir dabei zu, weil du mich bestimmt vermissen wirst. Ich habe jetzt gepackt, sage ich und drehe mich zu dir um. Rauchen wir eine, fragst du und ich fühle mich, als hätte ich eine Scheidung hinter mir. Zumindest hasst du mich nicht. Draußen blickst du mir noch hinterher, dann nimmst du einen Kieselstein aus dem Schnee und wirfst ihn in die Ferne.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Karsten Sirach
Der Nachlass
Nach den von ihm persönlich gemachten Angaben hat Patient X - jung, kräftig, groß - über Jahre hin von ihm so genannte niedere Tätigkeiten ausgeübt, schreibt der Nachtarzt der Charité spät am Abend in seinen Bericht. Überleben!, sagte Patient immer wieder und: Hören Sie das! Welche Tätigkeiten, dazu gibt es keine weiteren Angaben. Er könne sich nicht mehr erinnern, was er wann wo und wie lange getan habe. Er wisse auch nicht mehr, wie er heiße oder wo er herkomme oder wo er wohne. Patient kam ohne Papiere. Angehörige konnten daher keine ermittelt werden. Patient hat sich selbst eingeliefert, nachdem er bemerkt habe, dass er die Verrichtung alltäglicher Handlungen kaum noch bewältigen kann und demnach auch die Fähigkeit zu jeder Art von Beschäftigung nicht mehr besitze. Dafür hat Patient keine Erklärung. Nur, dass jeder ergriffene Gegenstand sich schon nach kurzer Zeit seiner Aufmerksamkeit entziehe. Auch seinen Händen. Und auch jeder Mensch, mit dem er ins Gespräch kommen würde, wäre nach kurzer Zeit schon aus seiner Aufmerksamkeit verschwunden. Auch jedes Bild, jeder Ort, jeder Vorgang. Hören Sie das!, sagte Patient immer wieder und: Angst! Die üblichen Untersuchungen wurden durchgeführt. Auch verschiedene Experimente. Keine Spuren von Missbrauch. Weder geistig noch körperlich konnte eine Beeinträchtigung festgestellt werden. Beim Entlassungsgespräch hat Patient X sich um einen Posten als Nachtwächter beworben, schreibt der Nachtarzt der Charité früh am Morgen in seinen Bericht. Seine Bewerbung wurde aber auf Grund der oben genannten Tatsachen abgelehnt.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tara Meister
Was bleiben
im grünen bett der hügel, darauf ein Mahagonitisch zum abendmahl gedeckt zwei stühle und ringsumher wird gierig das abendlicht verschluckt vom blättermeer, der Dschungel wächst
einander gegenüber sitzen am mahagonitisch Vater und sohn, der Vater deckt und stellt und
richtet, bis alles ist wie er es will und es sein soll und der sohn folgt mit blicken den bewegungen
versucht sie sich einzuprägen, im kopf nachzuahmen, er weiß, der Vater sieht den Dschungel nicht
und er will Vater sein, der sohn,
und nicht sehen
im abendlicht glänzt das silberbesteck, der Dschungel nicht
aber er raunt, wispert und während die augen den Vater sehen hört der sohn wie sich die bäume räkeln feuchte pflanzenarme strecken
ein rascheln von auf laub tappenden tatzen
der blick auf das dickicht ist verborgen von den schultern des Vaters und er wagt nicht, der sohn
wagt nicht sich zur seite zu lehnen, um daran vorbei zu sehen, blickt auf den Vater
die teller, den krug und hört dabei wie der Dschungel wächst und näher kommt
ein vogel schreit, er zuckt zusammen der Vater mahnt mit strengem blick
der sohn errötet beschämt, erregt
tatzen kratzen irgendwo
der Vater nimmt den krug, ein kleiner wasserfall, der Vater fängt ihn mit den gläsern auf
kein einziger tropfen schafft es über den rand
dämmerung über dem hügel, noch ist es nicht beinahenacht, zwei vögel schreien
ein letzter prüfender blick des Vaters über den gedeckten tisch, gewissenhaft
und der sohn schaudert als wäre er selbst das messer über das gerichtet wird, ob es richtig liegt
die hände auf dem tisch versucht der sohn sich daran festzuhalten aber es sind nur hände
an sein ohr dringen leise lockrufe aus dem dickicht, singende vögel obszöne düfte
die aus dem Dschungel gekrochen kommen, auf den hügel zu
lassen den sohn die blumen des Dschungels sehen, die farben haben die zu viel sind
grell und voll und einfach nur farbe zu sein scheinen, gar nicht mehr blumen
und zwischen ihnen rennen allerlei tiere, die auch bunt sind, federn und fell
alles rennt im Dschungel der wächst, der sohn sitzt, rutscht auf dem großen stuhl hin und her
um seinen platz zu finden
und der Vater faltet die hände, drei vögel schreien in den wipfeln ein rascheln
der sohn versucht die blumen nicht zu sehen, sucht ein anderes rascheln
das der stoffserviette des vaters, aufgefaltet, weiß auf dem schoß
auf dem der sohn sich jetzt sitzen sieht, das kind und er denkt, dass man von dort keine bäume sieht
weil der kopf nicht über den mahagonitisch ragt
jetzt ist der sohn zu groß für den rand des tisches oder der tisch zu niedrig
er hört wie sich die baumriesen strecken, schamlos dem himmel entgegen
aber noch einmal wirkt auch der Vater groß im dämmerlicht, den Dschungel im rücken
und sein schatten fällt lang
sie essen langsam kalt werdendes wild, im dickicht tanzen die vögel federkleider knistern
der sohn denkt daran, dass einmal in einen apfel gebissen wurde
und danach wollte man nicht mehr nackt sein
und nun, wer war nun nackter? der Vater in seinen kleidern oder die vögel des Dschungels
die ihre bunten federn trugen um zu beeindrucken, sich zu behaupten
der sohn isst das fleisch, das in seinem mund bereits zu den früchten des Dschungels wird
die äste der bäume wachsen, strecken sich weit, bis die ersten blätter den sohn im nacken kitzeln
auf der stirn des Vaters eine einzelne schweißperle die hinabrinnt an der schläfe über die wange
aber keine träne ist, denn der Vater will den Dschungel nicht sehen, den Dschungel der wächst
so essen sie ein letztes mal zu abend
den feuchten händen des sohnes
immer wieder drohen ihnen messer und gabel zu entgleiten
der Dschungel wächst neue pflanzen drängen sich durch den boden jetzt ist es beinahenacht
neue tieren bevölkern das unterholz, die teller sind leer
und wie nun die dunkelheit kommt, gehen alle scheinwerfer an im Dschungel
das neonlicht stürzt sich durch die blätterdecke und ist dabei so hell
dass der Vater die augen schließt und da erhebt sich der sohn und weint, weil er wünschte
der Vater hätte den Dschungel wirklich nie gesehen
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Christoph Michels
in schnitten
die scheibe herunter, zum ineinander, kreuzend, sich verflechtend, im immer neuen, und von allen seiten, damit kein blick dahinter. in diesem rauschen, das sich monoton, seit stunden, legt es sich grau, als ob nie wieder etwas anderes - -
ein lkw, der langsam näher, zum dröhnen, im nebeneinanderher und wie angehalten:
der fahrer, angezogenes knie, aufgestützter ellbogen, hält er eine kippe, der rauch senkrecht. sein grauer bart, der tatoowierte oberarm, die augen geradeaus. plüschwürfel an der windschutzscheibe. und der rauch senkrecht und er unbeweglich, jeder in seinem.
scheibe still asphalt regen wimper angst, fließend, gespiegelt, zerschnitten.
und der wald sich dann doch, hinter der leitplanke, im flimmern, baum neben baum gestellt, im berechneten, ihre reihen, endlose reihen und alles in ihre struktur:
wald felder windräder, ein dorf, zur unvorstellbarkeit verflacht, die wiesen von hecken getrennt, ein tankstellen-hinweis auf einem anhänger in ein feld gestellt, reihen aus solarpanelen, schwarz zu silber, im vorbei, nebeneinander aufgereihte kühe.
zwei rehe, mit gesenkten köpfen im zerregneten gras, als ob auch sie dort hingestellt.
der versuch den blick zurück, der sich dann im flimmern der leitplanke und erst im horizont der felder wieder still.
als der bus bremsend, gekurve, betonklötze und der regen jetzt senkrecht die scheibe, das grau zerschneidend, der sich zusammenziehende blick, zum stechen ins hirn.
anhalten anfahren anhalten, „keine pause, gleich weiter, dankeschön“, aussteigende die in den gepäckfächern, dann durch die wartenden. einsteigende lassen andere auf dem parkplatz, in ihrem flach, das immer gleiche, sich kein name im beton.
die ruhe dann, als jeder auf seinem platz, dass sich die stadt noch immer im kopf, in jedem ihrer geräusche, verschachtelt, nicht mehr auseinander, zum hintergrund – dann vom anfahren geschluckt.
und der asphalt sich wieder, in seinem geradeaus, im ewigen hintereinander der autos, lastwagen, die sich zu viehtransportern, tanklastern, kühlwagen, reisebussen und die lichter des gegenverkehrs in der windschutzscheibe zerstreut, zum ungefähren – eine autobahnbrücke in weitem bogen und die vergangenen tage dann entfernt, jeder von ihnen zur anstrengung, als ob kein einziger mehr möglich. //
schon lange gefallene blätter, die unter den platanen, den zusammengeklappten sonnenschirmen, auch sie schon lange, und das laub, über das kopfsteinpflaster geweht, um diese skulptur, die dort, in der mitte des platzes: tanzende vor einem klavierspieler. grau in grau. laub. regen. nur wenige, die unbewegt, als ob es genauso vorgesehen, und ich mit ihnen, langsam zum teil dieses platzes, jeder in seinem, nicht anders zu denken, wo das licht, wo das grau, hin und zurück getauscht, die gleichzeitigkeit jeder sekunde und der platz im regen und der nachmittag ein ende.
nur das holz des tisches. und wie sie die weiße porzellantasse und sich dann wieder hinter den tresen stellte. blicke, die näher. und die kaffeetasse und im regen gingen welche über den platz und waren unvorstellbar. und dazwischen dieses, das sich nicht, nicht in ihr stehen. wie ich weggefahren, wie ich zurückgekommen war. wie köpfe über pappbechern, mateflaschen, kein gesicht, die augen ins grau, auch das so vorgesehen.
am gesundbrunnen war er eingestiegen, hatte sich neben mich gesetzt. das türkis seiner jacke im augenwinkel. dann mir gegenüber, sein kinn, das sich spitz aus seinem gesicht, abgezehrt in falten, adern, die sich über seine stirn, seine haare dünn und zerschwitzt. er trug eine zerrissene jeans und diesen türkisenen anorak, die zu langen ärmel, die ihm über die hände. als sein blick meinen und das grün seiner augen, wie direkt es, aus diesem gesicht heraus, überdeutlich, „you have a good soul“, in einem klar, wie es dort zwischen uns. andere schauten herüber, ein stehender drehte sich um, ohne dass er seinen blick von mir, „you know, i come from a planet where everything is green, everything” und irgendetwas an ihm, seine augen verändert, das grün, tiefer vielleicht, saß ich, ohne es zu verstehen, in den blicken der anderen, in seinem. er zog eine bürste aus seinem leinenbeutel, den grünen plastikgriff einer bürste ohne borsten, hielt er ihn mir, langsam kreisend, vors gesicht, mit konzentrierten augen, die kein einziges mal von mir, „ihre seele ist rein – gute menschen sind selten geworden“, er lächelte, steckte die bürste zurück und seine augen dann nachdenkend: „ich kam nicht alleine, ich kam mit einem jungen, der heulte wie ein wolf – er konnte ein stein sein, ein see, oder ein baum, er konnte jeder vogel sein. seine augen waren genauso grün wie meine, aber er ging nur rückwärts. er sagte, dass wir beide gemeinsam so alles sehen könnten. ich habe bloß noch seinen seinen seelenvermesser. he is the moon – – .“ als er mit zusammengekniffenen augen in seiner tasche, ein klapphandy, es dann zurück: „sie werden bald anrufen – jedes jahr rufen sie an, die philharmoniker, weihnachtssaison – meine stimme ist von einem anderen stern, sagen sie“ und sein lachen, die weißen zähne, die aufgerissenen augen, sich immer weiter, in dieses grün. und er zog eine lesebrille, einen zerknickten zettel aus seinem beutel, die brille umständlich aufsetzend, stand er dann, sich räuspernd, den blick über die brille ins leere, fing er an zu singen. fröhliche nacht. wie er dort in der mitte des wagens, in den blicken der anderen, geflüster, gelache, aber er weiter sang, die brust herausgestreckt, den kopf erhoben, sang er es zu ende. und stand, noch immer, im rattern der bahn und seine augen noch einmal auf mir: „take care, my son“. er gab mir die hand und stieg aus. und die leere, unter ihren blicken, versunken, in enge und ich stand dann an einem bahnsteig und wusste nicht, weshalb ausgerechnet dort. ich erkannte es wieder, aber das grau des bahnsteigs war wie in papier gewickelt, jeder stein, jeder mülleimer, alles entfernt. ich ging treppen herunter, oder hoch, stand vor einer straßenlaterne, um jeden einzelnen aufkleber, jede vermisstenanzeige, jeden abreisszettel, aber die buchstaben waren nur flimmern. die hauptstraße herunter, die von den bahnschienen zerteilt, lief ich vom bahnhof weg. das durcheinander der autos, im gehupe, aber auch das nur entfernt, wie in den worten eines anderen, die fassaden, die sich über dem gehweg, der immer breiter, jeder in seiner entfernung, war unerreichbar geworden. ein backshop, der früher ein gemüseladen, dann zehn meter weiter dieser gemüseladen. und konnte in keine der seitenstraßen, hätte es von oben, wie eine straße in die nächste, um einen anderen weg zurück zu finden. unvorstellbarkeit, diese straße, diese stadt, in welchen gedanken. die augen im starren festgehalten, als eine alte, die in einer mülltonne wühlend, sich dann zu mir: „hier, weitergehn, weitergehn alter – sonst kriegste nochn arsch voll heute, weitergehn“ und sich erst dann der blick lösend und sie sich wieder zur mülltonne.
und ich ging denselben weg zurück, nahm die bahn, köpfe ohne gesichter, jeder könnte jeder, wie sie sich im grau – und stand dann auf demselben platz, von dem aus ich losgefahren war, stand, als ob es das erste mal. aber der backshop und der alte, der neben dem eingang, mit seinem hund, in decken gewickelt. das kleingeld, seine hand gekrümmt, zerfurcht, er bedankte sich leise – es war so vorgesehen.
von raum zu raum zu gehen, ohne dabei irgendetwas hinter sich, ohne irgendein bild, immer wieder in neuem, gegen jeden schnitt.
und ich ging, quer über den platz, längst gefallene blätter, im regen und das gelb und ich ging hinein. ihr bild in der scheibe, das sich vor das grau des platzes, als ob kein bild mehr außerhalb, jedes nur noch aus mir heraus, in geschlossenen augen, sich eines ins nächste. kaffeereste, eingetrocknet. und sie stand noch einmal neben mir, nahm die tasse und sagte etwas vom grün, vom winter. mit einem blick, in dem etwas unentschiedenes und ich konnte sie verstehen. aber was, in welchen worten, in dieses stehen, ließe sich nichts ändern.
das holz des tisches und der wind den regen gegen das fenster, das langsam beschlagend, und weiter auf sich begrenzt, zu aussichtslosem, ging ich dann. noch einmal den blick, aber nur noch die umrisse sitzender, verschwommenes, sich fremd und unvorstellbar und auch sie, unwahrscheinlich geworden. //
der regen jetzt seitlich, gegen die scheibe klatschend. wie vergessenes, das losgelöst und zusammenhangslos, sich jetzt zurück. von stein zu stein. keine einzige mauer. und doch jeder stein, vorgesehen. in jedem bild, dieses reisens, ständig sich und nirgendwo, nur der erste gedanke: für immer verloren.
strommasten, die dunkel aus den feldern heraus, enten, die zu weißen flecken, die dämmerung sich in den bus, zu gespiegeltem, sich vor alles näherkommende, das zu bekannt noch, doch zerschnitten, jeder raum gesehen, jedes bild, jedes wort, ist wahllosigkeit.
jemand fängt an zu husten, ein telefon klingelt, der langsamer werdende bus.
und kein weiteres wort mehr hören zu können. //
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Daniel Resca
13A
Flaute. Stille Schwüle erdrückt die Stadt, der Hochsommer ist angekündigt eingetroffen, grelles Licht auf den Straßen, weiße Fassaden reflektieren die Strahlen. Der Körper sitzt da von der Welt gespalten, die Verwirrung ist im Kopf sichtbar, sie kreist frustriert um sich selbst ohne sich selbst zu fangen, sie verwandelt sich in Wut und droht hochzugehen, sie droht zu entweichen, sie will zerstören, die angestaute bittere Kraft, sie bahnt sich den Weg hoch, vom Bauch Richtung Hals, sie hat den Weg gefunden, sie ist kanalisiert, sie ist im Hals, sie bleibt stecken. Der Ausgang ist verschlossen, die Lippen sind verriegelt, sie können keinen Laut rauslassen, nicht jetzt, nicht hier im Bus. Der 13A fährt seine gewohnte Strecke, noch vier Haltestellen bis zur Endstation, die Lippen fangen an zu zittern, sie spüren den Druck, sie wollen nachgeben, nur noch drei Haltestellen, nur noch – Ah! Die Blicke heben sich von den Smartphones. Die Wut löst sich in Luft auf und verliert sich in der Welt. Die Augen starren noch, wandern bald aber wieder zu ihren Bildschirmen. Draußen scheint die Mittagssonne, stille Schwüle erdrückt die Stadt, der Hochsommer ist angekündigt eingetroffen.
Erschienen in: ecetera, Nr. 80, St. Pölten 2020. ISSN 1682-9115
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stefanie Marek
Sagt alles ab
Stell dir vor, dass die Apokalypse kommt, aber eine Welt, die untergeht, ist es bisher noch nicht. Stell dir vor, ab morgen sind alle Veranstaltungen abgesagt, verschoben, abgeblasen und storniert. In ein paar Tagen schon werden sie ganz verboten sein. Stell dir vor, es kommt ein Krieg mit einem Feind, den keiner sieht und die Veranstaltungen, die sind die ersten, die eine nach der anderen aus dem Kalender fallen, wie erschlagene Fliegen vom Fensterglas. Es gibt auch andre Tote, solche die geatmet und gelebt haben, aber die Eventleichen sind die, die dich als erstes treffen, weil du sie als erstes selber sterben siehst.
Sagt alles ab, ist die Devise, um Himmels Willen, sagt alles ab!
Ist das jetzt auch das Ende für so viele, die du kennst, werden es bald Künstler-Fliegen sein, die aus den Kalendern fallen, wenn sie versuchen noch zu retten, was bald nicht mehr zu retten ist? Sagt alles ab, denn unsre Zeit, die ist jetzt umgebucht.
Du sitzt in einem menschenleeren Zug und dort, wo du jetzt hinfährst, kommen ab morgen keine Leute mehr zusammen. Es ist alles abgesagt, nur das eine, das noch nicht. Es ist das heute Abend, das Konzert von einer Freundin, das ihr allererstes ist. Sie hat schon jahrelang davon geredet, sich dort oben hinzustellen, hat es so unbedingt gewollt und es dann nie getan. Stell dir vor, schlussendlich hat sie sich getraut, hat wochenlang vor dieser Bühne Angst gehabt und jetzt ist alles abgesagt. Nur dieser letzte Abend nicht, an dem sie allein mit der Gitarre im Gepäck die Solo-Vorband stellt. Dass du kommst, steht schon so lange fest und du kommst obwohl du ein schlechtes Gewissen hast, weil du sie unterstützen willst und weil das Gewissen schlechter wäre, wenn du zuhause bleibst.
Sagt alles ab, nein jetzt noch nicht. Nur dieser eine Abend noch.
Stell dir vor, die Welt wie wir sie kennen, die steht plötzlich ganz gespenstisch still. Sie hat sich so erschrocken in ihrer so gewohnten Eitelkeit, hat sich vorher nicht einmal von der Gewissheit stören lassen, dass sie in ein paar wenigen Jahrzehnten wirklich untergeht. Was sind schon wenige Jahrzehnte? Doch mindestens genug, um ein paar Kleinigkeiten zu verändern, die keinen wirklich stören und keinem wirklich helfen. Sagt alles ab, schreien die Kinder, um deren Zukunft es hier geht, sagt alles ab, wir bitten euch! Ihr seid doch naiv. Was stellt ihr euch denn bitte vor, ihr, die ihr nichts von der realen Welt versteht? Sagt alles ab, ist doch absurd. Und jetzt ist alles abgesagt, aber nur fast. Und du musst aufpassen, dass ihr euch nicht umarmt, dass du das Händeschütteln jedes Mal ganz brav verpasst.
Stell dir vor, es sind nur knapp zwanzig Leute hier in diesem Raum und sie spüren, dass ab morgen alles anders wird, dass sie irgendwie schon jetzt zuhause sein sollten. Zwanzig sind neunzehn zu viel und ab nächster Woche wird das auch so verordnet sein, auch wenn das jetzt noch keiner weiß. Stell dir vor, ihre Finger zittern und sie ist so nervös, das erste Lied gelingt ihr nicht so ganz, aber du siehst da etwas flackern in ihren Augen und etwas an ihrem Gesicht ist anders als sonst. Es ist ein Song von ihr und sie singt ihn zum ersten Mal vor Publikum.
„Sagt alles ab“, das schreit ein Schriftzug auf dem T-Shirt eines Sängers, der nachher noch auf dieser Bühne steht. Alle wippen mit und sie bewegen sich ein bisschen zur Musik, aber niemand tanzt, weil niemand richtig ausgelassen sein kann. Sagt alles ab, schreit mir das T-Shirt immer wieder ins Gesicht. Es ist ein Scherz. Sagt alles ab!
Aber vorher spielt sie noch ein Lied, ein Lied, ganz kräftig und ganz laut und nicht für dich, oder für ihre Mutter, die auch gekommen ist, und nicht für irgendjemand sonst. Es ist ihr Song und in ihrem Gesicht, da siehst du etwas, durch das du plötzlich ganz verwundert bist. Du siehst sie innen drinnen, dort wo ihre Stimme herkommt, siehst sie ganz so wie sie vielleicht wirklich ist.
Stell dir vor die Apokalypse kommt, zumindest fühlt es sich ein bisschen danach an und Ausgang gibt es noch, aber das auch nicht mehr so lang. Du hörst diese Gerüchte, wirst jeden Tag mit tausend richtigen und falschen Nachrichten bombardiert und weißt schon nicht mehr was du glauben sollst und ganz leise, langsam wirst auch du jetzt mit der Angst der andren infiziert, weil plötzlich nicht mehr sicher ist, was morgen noch passiert.
Von den andren Sängern bekommst du nicht viel mit, obwohl sie gute Stimmen und gute Texte haben, aber in deinen Ohren flirrt es und du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Sag alles ab und komm nach Hause – deine Eltern haben in der Pause angerufen. Du kannst doch nicht, dein Job und deine Wohnung, dein Leben in der Stadt. Du willst nicht weg. Sag alles ab. Denn andere Leben nur als deins, die stehen jetzt auf dem Spiel.
Und sie spielt ihr erstes Lied am Ende noch einmal und dieses neu gespielte, alte Lied, auf dieser Bühne, auf der sie jahrelang nicht stehen konnte und auf der sie jetzt schlussendlich steht, bevor morgen alles untergeht, ist besser noch bei dieser zweiten Chance, viel besser als beim ersten Mal.
Sagt alles ab, denn es ist besser so. Doch wir sind bald zurück. Die Bühne bleibt nicht ewig leer. Dass unsre zweite Chance so sein wird wie die erste, das hoffe ich ganz ehrlich nicht. Doch diese Freundin von dir und auch alle andren haben wir nicht abgeschrieben und nicht abgesetzt. Wir warten bis ihr wiederkommt.
Sagt alles ab – für jetzt.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at