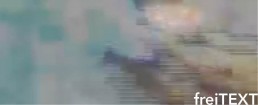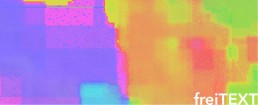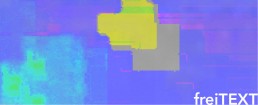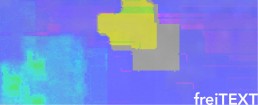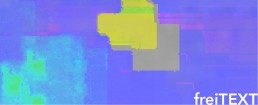freiTEXT | Cornelia Mayer
Neujahr
I.
Ich bin Nacht. Ich bin peitschender Regen, zehrende Kälte.
Ich bin ein windiges Wimmern, das klein und klumpig aus meiner Kehle fließt.
Ich bin ohne Gestern.
Mein Schatten, mein großer, kräftiger Beschützerschatten hält inne. Nur kurz. Seine grobe Hand ist weich und warm auf meiner Wange. Seine Lippen formen irgendetwas, aber der Klang der Worte wird vom Rauschen eines Autos verschluckt. Irgendwo schreit ein Baby. Laut, viel zu laut. Er gibt mir einen zitternden Kuss auf die Wange. Dann gehen wir weiter. Jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifährt, wird die Dunkelheit einen schmerzend blendenden Moment durchbrochen. Das stört mich kaum, das ist nicht schlimm.
Irgendwann schaut mich das schmale Gesicht meines Bruders nicht mehr von der schützenden Schulter herab an. Ihm sind die Augenlider zugefallen. Sein Kopf wippt auf und ab mit den Schritten unserer Mutter. Kurz wünsche ich mir, mein Vater würde mich auch tragen, mich vergraben in den sandigen Weiten seiner Jacke. Dann erinnere ich mich, dass seine Hand meine wärmt und das reicht mir.
Wir gehen weiter. Wie lang noch, wie lang noch, wie lang wie lang lang lang noch, denke ich nicht. Ich will es nicht denken.
Es ist so dunkel, dass ich meine Füße am Boden nicht mehr sehen kann. Das Gefühl darin habe ich auch verloren, sodass sie nur wie von selbst und ganz flattrig ihren Weg über die bleierne Straße finden. Vielleicht bin ich gar nicht da, wenn ich mich weder sehe noch fühle, denke ich. Aber ich höre mich, in meinem Kopf. Es ist laut.
Ab und zu drückt Vater meine Hand und es ist, als würde er mich, ein schwaches, kleines Blatt auf einem Fluss, damit anpusten. Meine Beine und Arme werden immer leerer, kälter und stumpfer, außer, wenn das kleine Drücken in der linken Hand ein bisschen Wärme verströmt. Ich habe kein Gefühl mehr für Zeit. Bevor ohrenbetäubend pulsierende Erinnerungen meinen Brustkorb enger schnüren können, suche ich fieberhaft nach etwas, an das ich denken kann. Ein paar Verse finden ihren Weg zu mir, Verse, die irgendwann vor all dem Jetzt im warmen Atem meines Vaters in mein Ohr geschlüpft sind.
Meine Manteltaschen sind mein Schrank, / mein Kopf ist eine Sternschnuppe.*
Ich weiß nicht, von wem das Gedicht ist, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass mein Kopf auch brennt wie eine Sternschnuppe. Aber vielleicht bedeutet das auch, dass ich mir etwas wünschen darf.
II.
Ich bin Licht. Ich bin viele Augen, starrende Gesichter.
Ich bin eine Explosion, eine paukend laute, die nicht enden will - aber irgendetwas hat, etwas Zartes, Zerbrechliches, etwas Schönes.
Ich habe ein Morgen.
Meine Finger sind umhüllt von Vaters samtigen Händen. Wie ein Bett, Matratze unten und oben eine Decke. Mein Bruder hält die andere Hand, wendet seinen Kopf unablässig nach links und rechts, nimmt all die Menschen in Augenschein. Es ist Nacht, wieder Nacht. Ich bin so dankbar, sagt meine Mutter immer und immer wieder. So dankbar. Morgens trinken wir jetzt Milch aus einer Packung, deren Aufschrift ich nicht lesen kann. Mein Bruder lacht, wenn ich versuche, die abgedruckten Wörter auszusprechen. Vater kann das inzwischen ganz gut - ansonsten macht er auch nicht viel. "Warten", sagt er, wenn ich frage. Wir warten weiter. Wie lang noch, wie lang noch, wie lang wie lang lang lang noch. Hör auf, das zu denken, murmle ich mir selbst zu. Vielleicht ist Warten unser Leben. Warten ist besser als all das, was unser Gestern zerfressen hat.
Viele sind hier, die nur so alt sind wie ich. Mein Blick wandert durch die Menge, verharrt auf einem rothaarigen Mädchen mit dunklem Schal, der zu groß, zu erwachsen an ihm aussieht. Ein Paar grüner Augen schaut mich einen kleinen, fremden Moment nur an, wendet sich sofort wieder ab.
Mutter und Vater flüstern. Ihre Stimmen klingen flatternd und freudig, obwohl ich sie nicht verstehe. Heute geschieht etwas, das fällt mir jetzt erst wieder ein. Halbherzig summe ich irgendeine Melodie vor mich hin, während sich eine stumme Unruhe in mir ausbreitet. Da streift mich jemand vorne an meiner Jacke und als ich aufblicke, schaut mich ein Lächeln an. Ich lächle auch ein bisschen. Dann verschwinden das warme Gesicht und die buschigen Haare hinter uns in der Masse. Es ist die Frau, die uns schon dreimal gesagt hat, dass wir keine Angst haben müssen. Wie wenn man nach einem Alptraum aufwacht und jemand sagt, alles nur ein böser Traum, nur ein Traum. Dabei meinte sie es irgendwie anders.
Da ist es. Auf einmal, wie aus dem Nichts, erheben alle ihre Stimmen im Einklang. In verschiedenen Sprachen, glaube ich zumindest. Denn die vertrauten, arabischen Worte kann ich auch ausmachen. Sie zählen. Und dann fällt mir ein, worauf wir warten. Mit den ersten Feuerwerksraketen durchschneidet mein Schrei das Dunkel. Ich breche in Tränen aus.
Plötzlich ist die Frau mit dem Lächeln wieder da.
Sie wiederholt ihre Worte auf Englisch wie einen Gesang.
Vater hält beide meiner Hände.
Mein Kopf ist eine Sternschnuppe.
Keine Angst. Das Feuerwerk ist nicht gefährlich.
Du bist in Sicherheit.
Frohes neues Jahr.
Cornelia Mayer
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
* Masri, Monzer: Träumerei (deutsche Übersetzung) aus: Âmâl schâqqa (Harte Hoffnungen) aus dem Zyklus: Gedichte aus der Tasche eines Khakimantels, 1978.
freiTEXT | Michael Wehrmann
Tabak am Bachwasser
Denkst, du bist so schlau, Papa. Stehe am Bach, habe mit feigen Fischen zu tun. Erzählst mir aber vom Tabakgeruch und deinen Tabakdosen. Halte meine Hand ins Bachwasser, sehe Fische drunter wegtreiben. Reicht ein Kieselstein, um Fischschwärme aufzuschrecken. Sind Unterwasserfeiglinge. Dein Geruch erreicht das Bachwasser, Holzgerüche, Minze, einige Harze, denkst, dass du so schlau bist, Papa, wie du alles weißt über Tabakanbau, Tabakgeschichte und Tabakdosen. Erzählst mir das alles, höre nicht hin, habe versucht, Schmetterlinge auf die Fische anzusetzen. Sehen fliegend aus wie deine Tabakdosen, wenn sie sich in der Luft auf- und zuklappen würden. Finde, die hören sich gefährlich an: Schmetterling. Hör‘ mal kurz zu, Papa, ist mir aufgefallen, dass die Bachwasseroberfläche sich bewegt. Können nicht drauf navigieren, diese Schmetterlinge, diese Schmetterdosen. Wurde mir klar, dass ich Libellen wegen der Fische anheuern muss. Sehen fliegend wie in der Luft stehende, eingefrorene Silberplättchen aus. Hören sich gefährlicher an: Li-bellen. Jetzt weht wieder dieser Geruch von hundert Hölzern, hundert Welten, am Bach, dort, wo ich stehe und ich assoziiere gerösteten Kakao. Bist ja so schlau, Papa, wie du alles weißt über Tabakwürze. Libellen heben jetzt ab. Fliegen in voller Flughöhe bewegungslos über dem Bach. Bleiben so, mitten in der Luft. Jetzt aggressiver Selbstmordsturzflug auf das Bachwasser hinunter, durchbrechen die Bachwasseroberflächen wie geworfene Speere. Dort, wo Libellen ins Bachwasser einbrechen, ragt ein Wasserspeer in die Luft, um sofort wieder in sich zusammenzufallen. Hast es nicht gesehen, Papa, hast erzählt und erzählt. Siehst auch nicht, wie ich jetzt Tabak ins Bachwasser treiben lasse. Werde die Libellen in den Tabakdosen bestatten.
Michael Wehrmann
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Thordis Wolf
track I – III
3d hast du gesagt. wir sind bei a, b, c vorbeigelaufen, an dem alten mann mit dem sabbernden hund und dachten: das nächste haus muss es sein. die kleinstädeplanerin hat sich wohl einen scherz mit uns erlaubt und das alphabet einfach umgestellt. das wissen wir noch nicht und läuten bei tür nummer 44. hinter den restlichen klingelquadraten in schwarz-feinripp: namen. gut leserlich, weil: indirekt beleuchtet, einheitliches schriftbild. korrekte beschriftung ist die halbe miete wert, hat sich da wohl jemand gedacht und trotzdem etwas übersehen: 44 namenlos, also: winzige lamellen unter meiner fingerspitze. sandra sagt: sicher wegen den bullen kein name dran. oder wegen der gis: sage ich und läute gleich nochmal. du hörst bestimmt nichts, die anderen sind laut. kaltschnäuzig will der alte mann mit dem hund jetzt wissen: was habt ihr hier zu suchen? jedes recht: sagt sandra unerschrocken. das reicht dem alten. er zieht davon und seinen vierbeiner hinter sich her, schnauze am boden. unheimlich: sagt sandra als ich bemerke: e statt d. die städteplanerin lacht sich ins fäustchen (verschluck dich nicht!) und wir schleichen um die ecke zum nächsten quader. das licht geht an, wir stehen richtig. d gleicht e, wie ein ei dem anderen. nur, dass neben den viereckigen klingelknöpfen andere namen stehen. nikolai grönwald. klingt ernst, aber: es bist du und ich: klingle. ich kann es selbst nicht glauben, ich gestehe: ich wusste nichts von deinem namen. du heißt uns trotzdem willkommen. der türöffner summt länger als nötig. draußen sieht der sabbernde hund, wie unsere schatten hinter milchglas ins innere von 3d verschwinden.
was hast du denn gedacht, wie er heißt? fragt mich sandra, als wir im lift unsere augen gegen das grelle fahrstuhllicht zusammenkneifen. vergiss es: sage ich und dann öffnest du die tür.
es riecht nach gras. (du würdest »ganja« sagen.) und vanillekipferln. kipferl ist ein hässliches wort. ich wünschte, es gäbe ein anderes dafür. vanillehörnchen vielleicht? beschissen, dennoch: already taken. bourbon-halbmonde: könnte funktionieren. später finde ich heraus: christmas scented candles, very seasonable. nicht winterliche musik als ausgleich: reggae, zeitlos. obwohl: du bist ein sommerkind. seit ich dich kenne, stehst du auf reggae. auf reggae und annika, die eigentlich mit nur einem n geschrieben wird und die jetzt mit dani zusammen ist. vor einigen jahren mal... da wart ihr beide ein paar, du und annika. ihr wart wie nimm2: leuchtend, nur nicht: gelb & orange. noch übrig aus dieser zeit sind: zwei falsch geschriebene namen in meinen kontakten und die couch, auf der wir jetzt sitzen. let’s get together and feel alright: trällert bob marley seine 1 liebe im hintergrund und sandra vor sich hin.
du kommst aus der küche auf uns zu: ins wohnzimmer. küche und wohnzimmer sind ein und derselbe raum. you move with purpose. (sonst wäre dein zugang nicht zu erkennen.) du bietest uns kuchen auf alufolie an. niemand hat geburtstag. sandra hört auf zu singen, nimmt sich ein stück und fragt mich: fährst du? aus der bisher unerwähnt gebliebenen runde sagt jemand: ich kann fahren, wirklich. du reichst mir eine gabel, ich lehne ab. lieber ess ich mit den händen. nusssplitter fallen aus dem schokoladenteig. ich denke an wolken und das schlaraffenland.
niemand rührt hier das besteck an. es bleibt: abandoned, am tisch liegen. während: ich, ungeübt in full lotus, auf die couch krümmle. mir wird schwindlig, i almost faint. but then: just light-headedness und: es geht gleich wieder. sorry: sage ich, ganz ehrlich. du lachst, kurz und laut. dann sagst du: macht nichts und nur annika weiß, warum, doch nichts von alledem: sie schläft schon lang. das bett ruft: sagst du und meinst damit eigentlich deine arbeit morgen. wir gehen, umarmungen zum abschied. du bläst die duftkerzen aus, während wir ins auto steigen. sandra und ich sitzen hinten. die rückbank ist kalt, auf den scheiben: frostkristalle. jemand schlägt vor: enteisen. mir gefallen die eisblumen. ich will, dass sie bleiben. das bringt unglück: behaupte ich und wir fahren los, lassen 3d hinter uns und den frost auf den scheiben liegen. was geht in dir vor: frage ich den schwarzen samthimmel und rechne nicht mit einer antwort. doch dann: ein scharfer schnitt, der beinah blutig endet. ich pralle mit der stirn gegen die kopfstütze des vordersitzes. ein erdbeben peitscht durch meinen körper. magnitude, magnitude, Magnitude, plötzlich hell: Magnitudo, ich sehe sterne. dann: stillstand, abrupt. ich hör die andern atmen. weiße wolken steigen auf. eine straßenlaterne wirft sich vor das erschütterte schwarz, licht fällt auf den intruder, mit dem wir beinah kollidiert wären. i see: he’s marked: LOVE 1. black velvet: denke ich und weiß: das war knapp. wer bekennt sich so offen zur liebe: frage ich sandra. du weißt aber auch gar nichts: antwortet sie und lässt ihre fingerknöchel knacken. vorne: shift to first gear, almost simultaneously. schon sind wir zurück: auf kurs.
Thordis Wolf
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Nils Langhans
Lichtschutzfaktor
Das Gästehaus lag einige Passstraßen oberhalb der Cinque Terre. Von meinem Zimmerfenster aus sah ich über die Hügelketten. In der Dämmerung verschwammen die Gipfel mit der steingrauen Wolkendecke zu einem bedrohlichen Klotz, der düster über der Welt thronte und mich grimmig anstarrte. Ich starrte zurück. Nichts regte sich. Das einzige Geräusch, das sich der vollkommenen Stille widersetzte, war der Gesang einiger männlicher Ammern. Ich war mir zumindest sehr sicher, dass es Ammern waren, und dachte darüber nach, wie praktisch es wäre, wenn es ein Shazam für Vogelstimmen gäbe. Über den Gedanken schlief ich kurze Zeit später ein.
Am nächsten Morgen klopfte Francesco an meiner Zimmertür und weckte mich sehr freundlich. Wir würden in einer halben Stunde losfahren, sagte er durch den Türspalt.
Zum Frühstück aß ich einen Apfel. Francesco hatte ihn sicher am Morgen von den pensionseigenen Apfelbäumen gepflückt, war auf eine klapprige, dreistufige Holzleiter gestiegen, hatte den Baum gerüttelt, die Äpfel waren zu Boden gefallen und es ward Frühstück. Ich hätte seinen Namen stundenlang aufsagen können. Francesco, Francesco, Francesco, so sonor wie ein Eichendorff-Gedicht, immer Francesco. Wäre er Deutscher und sie hätten ihn Franz genannt, ungläubig staunend hätte die Standesbeamtin seinen Vater angeschaut, ob er noch bei Trost sei, ein Kind Franz zu nennen, und das in den Achtzigern. Franz wie Strauß, wie Beckenbauer, wie antiquiert das klänge, ein Kind Franz nennen, nein, bitte, vielleicht im Zweitnamen, aber als Rufname wäre Franz eine Bürde - so würde sie reagieren als pflichtbewusste Beamtin, die sich dem paternalistischen Staat verpflichtet sah, der denen, die noch nicht ihrer Handlungen eigener Puppenspieler sein konnten, den Weg ins Gute wies. Franz, Franz, Franz. Man könnte es niemals vor sich hin summen oder gar singen. Man könnte es bloß salutieren. Franz Göring, jawohl, zu Befehl. Die Härte der deutschen Sprache war der wachste Erinnerungsruf, der einen jeden mit jedem Wort der Verbrechen mahnte, die von deutschem Boden ausgegangen waren. Die Härte des Deutschen machte zu allem fähig.
Wir fuhren in einem Fiat Skudo etwa zwanzig Minuten bergab, bogen uns um windschiefe Kurven, links, rechts, links, die Wipfel der Korkeichen schwangen erhaben im Rhythmus unseres 4-Zylinders, Francesco fuhr mit einer Hand am Steuer und ich studierte auf dem Beifahrersitz einen Bericht des Merian über den ökologischen Landbau in Ligurien. Die Sonne schien. Ich wühlte in meiner Strandtasche nach einer Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 25, denn die Septembersonne fräste sich nicht mehr so hemmungslos durch die Hautschichten wie die Augustsonne. Lichtschutzfaktor 25 würde ausreichen.
Francesco hielt an am Ortseingang von Riomaggiore und wünschte mir einen schönen Tag. Im Autoradio lief der Refrain von Grenade und ich dachte darüber nach, ob Bruno Mars wohl am Morgen seine Wimpern zupfte. Francesco fuhr weg und hupte zwei mal, während sich neben mir ein Mittvierziger in cargobrauner Dreiviertelhose beherzt mit der flachen Hand in die Arschritze griff, der Vertikalen entlang einige Sekunden hin und her rieb, schließlich anstandshalber flüchtig über die Schulter schaute und dann unbehelligt weiter ging.
Das eigentliche Riomaggiore erreichte man von der Stelle, an der Francesco mich abgesetzt hatte, durch eine Unterführung, die genauso gut zwei Bahngleise eines Provinzbahnhofs hätte verbinden können. Sie war eine denkbar schlechte Vorbereitung auf die Explosion, die sich – just da man aus dem Tunnel ins Licht ging – auf diesen paar winzigen Quadratmetern auftat. Mich überfiel ein Farbschauer, ein Zittern, die sorgfältig abgeblätterten Pastelltöne, das Preußenblaue Meer, einige Fischerboote, die Frauen beinahe versengt, Espresso auf Beistelltischen. Es war Zusatzversion der Realität, als würde man ein frühes Bild von Bernardo Bellotto auf LSD anschauen. Die Schönheit hier war kaum auszuhalten.
Ich stieg linkswärts der Bucht eine Treppe hoch, glaubte einen alten Schulkameraden im Gegenverkehr zu erkennen, traute mich aber nicht ihn anzusprechen, ging weiter, setzte mich auf die mit roten Ziegeln überzogene Mauer auf der Anhöhe und betrachtete einige Männer, die von den Felsblöcken ins Meer sprangen und wie junge Delfine im Wasser tollten. Ich zitterte noch immer. Die Sonne stand irgendwo im Westen. Am Nebentisch bat ein ergrauter Mann mit dunkelblauem Gaastra Polo die Kellnerin in perfektem Deutsch um die Rechnung.
Ich versuchte die Bucht von Riomaggiore auszuhalten, aber die Kulisse war zu perfekt, eine Superrealität, zu fein gearbeitet war, zu detailreich und zu gleißend. Ich ging die Stufen wieder hinab und bog in die Unterführung - erst jetzt fiel mir der bröckelnde Spritzputz auf, der sich an der Decke durch das Tropfwasser des Bergmassivs über Jahre in einen algigen Camouflagematsch gewandelt hatte.
Ein Zug fuhr in den Bahnhof von Riomaggiore ein. Die Klimaanlage sog die Menschen vom Bahnsteig in den Innenraum, sie würde sie wenige Minuten später in Monterosso wieder ausspucken, frierend und schlimm erkältet. Ach wer da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. Eichendorff konnte es ja nicht besser wissen. Damals gab es noch keine Klimaanlagen und keine Linoleumfußböden. Zum Glück musste er all das nicht mehr miterleben. Die Ästhetik der Moderne war ein einziger Irrtum.
Ich stieg in ein Taxi, ließ mich zu meiner Unterkunft fahren, packte eilig meinen Koffer, Francesco war nicht anzutreffen, ich stieg ins Auto und fuhr weiter Richtung Süden.
Nils Langhans
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Enno Ahrens
Auf, auf . . .
Bürgersteig verschlingende Bettelsuse; die Konsumgesellschaft breitet ihren Mantel aus. Ich - Bypassverschlingung - meine Schicksalshölzchen sind gefallen, Füßchen so spitz im Fundament; Flucht in die kühle Hintergasse. Wende mich um; das Gedärm trägt man schon ewig außen, ein Gewimmer über die Hochkultur nicht in der Galle, sondern am Revers, ein Emblem nahe der Rose, die man mir aus der linken Herzkammer stahl; der Abriss schmerzt noch nach. Die Starken, Erfolgreichen seien unbarmherzig, heißt es, und ein Dummbeutler, ein Opossum, huscht durchs Unterholz, ein Triumphator nicht nur für den Augenblick; Pedro, der Nachtportjeminee lacht und die Exilberliner schieben sich ihre Mollen mit Korn ein in die gefälteten Innenansichten.
Persilgeruch aus der Chemischen Reinigung löst meinen Bypassknoten nicht, gehe ins Internetcafe, will mich Freischreiben im Literaturforum; schwarze Materie erfüllt die Autorenlounge mit stummen Schrei: Ein vielversprechender Literat war im Strohfeuer seiner Texte der Hitze erlegen (Buschfeuer können ja so bereinigend sein.) Ansonsten geht es seinen üblichen Gang; die selbsternannten Kritiker sind wie eh und je am Umschichten in den Literaturforen, an diesen Scheiterhaufen der Gescheiterten; das Volk amüsiert sich; heuer wird Schreibentleins luftiger Vers ganz nach unten gelegt, ein leicht brennbarer Scheit. Rettbar vorm Entzünden vielleicht nur, indem man die Foren umtaufte in gemeine Volksguthaufen. Der Dichter zieht Hoffnung stolz hinter sich her, kompostierte Mistkügelchen, darin noch ungelegte Möchtegerneier, Abfallprodukte der Kritiker, welche man dem Poeten unter den Füßen wegziehen möchte, damit sie ihn nicht überrollen.
Der alzheimernde Schreiberkönig ist heuer nicht präsent; sein Schmierzettel liegt im geistigen Hinterland auf dem Werkstattsofa beim NeoTasmanischenTeufel, jenem nachhinkenden Freudianer im therapeutischen Separee. Grammatiktreue Pflegerinnen wischen ihm das Gesabber ab vom triefenden Frontallappen, ich entferne meinen Thread, klammere mich an meine Oversized-Barbie. Jetzt könnt der Lenz kommen.
Enno Ahrens
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Andreas Reichelsdorfer
Zwecks der öffentlichen Wirkung (1965)
Während der Anwalt versuchte, sich in der Zelle mit dem zum Tode Verurteilten zu verständigen, patrouillierte vor den Gittern die Selbstmordwache. Der Vollzug war für nächsten Donnerstag angesetzt.
Andreas Reichelsdorfer
Andreas ist Teil von Zweifel zwischen Zwieback, der 20. Ausgabe der Zeitschrift mosaik.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
ZZZ 10/12 | Katrin Theiner
Katrin Theiner, 1981 in Steinheim (Westfalen) geboren. Hat 2006 den Sprung aus der Provinz nach Berlin geschafft – mit einem Magister in Germanistik und Medienwissenschaft in der Tasche. Sie arbeitet als Texterin und Schreibcoach und veröffentlicht online und in Literaturzeitschriften. Aktuelle Texte sind in der„Trashpool“ und in „Das Prinzip der sparsamsten Erklärung“ zu finden. Sie war Finalistin beim Literaturpreis Prenzlauer Berg 2016 und veröffentlicht im Herbst 2016 Erzählungen beim Hamburger Literatur Quickie Verlag.
Katrin ist Teil von Zweifel zwischen Zwieback, der Kurzprosa-Anthologie zur 20. Ausgabe des mosaik. Ihr Text "Die Dunkelheit störte, die Locken auch" ist einer von 12, die anonym ausgewählt wurden, sich in diesem Band zusammenfinden und am 2. Dezember 2016 erschienen sind.
-
Buchstabierte Blumen
Vielleicht könnte ich ihre Welt besser verstehen, wenn ich in ihren Schuhen laufen würde.
Aber ich lasse sie schlafen. Durch die getönten Scheiben sah alles, was nichts mit uns zu tun hatte, nutzlos aus. Verlassene Fabrikhallen, übersonnte Weiden, breitschultrige Wassertürme und dahingekleckerte Häuser. Spargelfelder schmissen sich vor uns hin, Wolkenschwärme malten fliehende Schatten auf zu große Felder. Wir fuhren die Strecke zum vierten Mal. Tim und ich. Zweimal hin, zweimal zurück. Vorbei an dem Bahnübergang mit den gelben Schranken, daneben die verhüllten Tennisplätze, gleich das Rapsfeld mit den Gülletanks, die spitz zum Himmel zeigten. Der Zug glitt zu leise über die Schienen. Mir fehlte etwas. Das Rumpeln, die Geräusche, das Knacken von Lautsprechern. Irgendwas Echtes, am besten was zum Anfassen oder Riechen. Vielleicht etwas, das in der Hand schmolz, sich auflöste, einen klebrigen Film auf der Haut hinterließ. Etwas, das zu mir gehörte, wie Nowitzki zu den Mavericks. Etwas, das mir das Gefühl geben konnte, noch in meinem Körper zu stecken, diesem Ding, das ich immer für zu Peter Parker gehalten hatte – vor dem Spinnenbiss. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt roch alles nach ihr. Und über ihren Duft hatte ich mein Lakers-Trikot gezogen, die Nr. 24. Das hielt ich für das mindeste, auch wenn es das alte Trikot meines Vaters war, das er mir dagelassen hatte, an dem Tag, als er ausgezogen war. „Mach was draus“, hatte er gesagt und mich angeschaut, als warte er auf eine Entschuldigung für die letzten vierzehn Jahre.
weiterlesen im freiTEXT >>
-
Wind, Kind, Blind, Rind
Polly, so möchte sie genannt werden, habe ich in einem Forum für Allergiker kennengelernt. Erst schrieb ich mir mit Ellen, die unter kreisrundem Haarausfall und einer pelzigen Zunge litt und gerade dabei war, einer Unverträglichkeit gegen Zitrusfrüchte und vielleicht auch gegen ein neues Waschmittel auf die Schliche zu kommen, aber auf ihrem Profil-Bild hatte sie dieses typische Verena-Gesicht; schmales Kinn, pädagogisches Lächeln, durchsichtige Zahnkanten, massenweise Wirbel am Haaransatz, und so sehr ich mich auch bemühte, es fühlte sich einfach falsch an, sie nicht Verena zu nennen. Irgendwann schrieb sie, ich solle doch an einer Pekannuss ersticken, ich sei geisteskrank und seitdem hat sie nicht mehr geantwortet. Gestern schrieb mir Polly und erzählte von Nährstoffmangel, Brust-Migräne, einer abgebrochenen Darmsanierung und ihrer Liebe zu Nirvana. Ich beichtete ihr, dass mein Schnäuzer alleine dafür dient, die Blätterkrokanthaut in meinem Gesicht zumindest zwischen Nase und Mund zu unterbrechen und dass Schließfrüchte aller Art mein Tod seien. Come as you are, schrieb sie und heute treffen wir uns.
weiterlesen in mosaik16 >>
 Landschaft zum Verschwundensein
Landschaft zum Verschwundensein
Der Herr Onkel war tot. Den Mund voll brauner Fichtennadeln, den Bart auch, als hätte er einen zu großen Löffel Suppe in sich hineingeschaufelt, bei dem die Nudeln zwischen seinen Lippen wieder rauskamen. Oder als hätte er vor Hunger seine eigenen Bäume gefressen und war an Rinde, Harz und Zapfen erstickt. Die Tannenschonung hatte angefangen ihn zu beerdigen, warf Sand auf seinen muffigen Kompostsarg aus Ästen und Laub, aber bevor der Wald den Grabstein setzen konnte, den letzten Spruch aufgesagt hatte, und der Herr Onkel hätte es verabscheut, das Gefasel um Himmel, usw. usf., hätte geschrien, mit Gott und so hätten nur Arschkriecher was am Hut, und bevor die Bäume hinter der Lichtung an der Grabstätte für immer für Ruhe sorgen konnten, hatte ein Waldarbeiter seine Leiche in moosgrünen Gummistiefeln im Unterholz entdeckt.
weiterlesen im freiTEXT >>
freiTEXT | Maik Gerecke
Schriftstellernöte
Für mein Romanprojekt, in dem es um einen Swinger-Club geht, betrat ich die Höhle des Löwen, setzte mich mit einer Freundin in die U8 und fuhr zur Heinrich-Heine-Straße, um im berühmt-berüchtigten KitKatClub Berlin Input zu finden.
Und ich bekam, was ich wollte.
Schon als wir der Tür nur näher kamen, steigerte sich die Aufregung merklich. Wir zitterten etwas und ich hatte das Gefühl, meine Atmung unter Kontrolle halten zu müssen. Neben uns stiegen drei Kerle in Tutus und engen Strumpfhosen lachend aus einem Taxi und es war klar, wohin sie in diesem Aufzug wollten. Meine Begleitung packte mich sofort am Arm und beteuerte, wir müssten uns beeilen, um noch vor »denen da« die Türsteher zu passieren. Denn im Vergleich zu ihnen wirkten unsere Aufzüge äußerst langweilig. Vorallem meiner.
An der Tür wurden wir kurz aber eindringlich gemustert und ich sah die Skepsis in den Augen des Türstehers aufflammen. Er zuckte mit den Schultern, seufzte, schaute dann zu seiner Kollegin und sagte: »Mach du dit ma.«
Die erste Hürde war genommen, beim Bezahlen wurde es jedoch kritisch. Ich trug eine lange schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und ein offenes schwarzes Hemd darüber. Die Frau an der Kasse musterte mich ungläubig und sagte: »Haste vor, dich noch umzuziehen, oder wie?« Ihr Blick verharrte auf meinem Körper. »Also so … nää, so jeht dit nich.« Und ich sagte nur: »Ähm …« und dann erst Mal nichts mehr.
»Naja«, mischte sich meine Begleiterin schulterzuckend ein, »er ist halt Schriftsteller« und verzierte ihre Aussage mit einer Was-willste-machen-Geste. Sie wolle einfach mal mit mir tanzen gehen, erklärte sie weiter, und setzte dann ein bittendes, zuckersüßes Gesicht auf. Passend zu ihrer pinken Strumpfhose.
»Na, dassa Schriftsteller is, is ja schon ma jut, aber kanna nich wenigstens dit T-Shirt ausziehen?«
Die Verhandlungen begannen. Witzigerweise erledigten die beiden Frauen den Bärenanteil der Gespräche. Ich war wieder acht Jahre alt, fühlte mich klein und als beobachtete ich Mütter, wie sie in der dritten Person über mich redeten.
Man versicherte mir, es habe nichts mit mir zu tun, ich könne sein, wie ich wolle, aussehen, wie ich wolle, aber eben nicht hier. Und nicht so! Das sei zu sportlich. Aber wenn ich, nun ja, das T-Shirt ausziehen würde und mit – zumindest halb – aufgeknöpftem Hemd rumliefe, dann, ja, ihretwegen. Und auch wenn die Angestellten des Clubs die gewohnte Strenge des Berliners aufwiesen, erfuhr ich sie als ungewöhnlich freundlich. Regelrecht einladend. Für Berliner Verhältnisse.
Ich musste mich also umziehen.
Aber wo tut man das hier doch gleich? Wo sind die Umkleidekabinen? Ich suchte vergeblich. Das Umziehen erledigt man direkt an der Tür, gegenüber von der Kasse, da aber noch kaum jemand anwesend war, bekam ich davon nichts mit. Also ging ich wie ein verschüchtertes Pastorentöchterchen aufs Herren-Klo, an ein paar nackten, mit Lederriemen behangenen Kerlen vorbei, verkroch mich in einer Kabine und zog mich um. In dem merkwürdigen Bewusstsein, einen Fehler zu begehen. Danach wurde ich erneut der Frau an der Kasse präsentiert, die mich jetzt freundlich anlächelte, mir dann auf die etwas behaarte, bleiche Brust starrte und sagte: »Na siehste! Das ist doch schon echt sexy!«
Ich war in keiner besonders guten körperlichen Verfassung an diesem Tag, da ich den Abend zuvor bereits ziemlich über die Strenge geschlagen hatte. Ausgerechnet heute hatte ich einen dieser Tage, an denen man schwört: Heute kein Tropfen Alkohol.
Wir gingen als erstes ein wenig durch den Laden, schauten uns alles an. Den Pool-Bereich, die Chill-out-Area, die verschiedenen Floors, Ecken und Ebenen. Es war noch früh und der Laden relativ leer. Die ersten nackten Kerle streunten bereits durch den Club oder saßen herum. Ich sah einen älteren Herren mit Lederoberteil, dessen bestes Stück von einem Metallring gehalten wurde, erste weibliche Brüste flogen durch mein Blickfeld und auch ein paar männliche. Ein Kerl in teurem Anzug und Krawatte fernöstlicher Herkunft, der mich an das Wort »Businesstrip« denken lies, inspizierte interessiert aber verhalten die Räumlichkeiten, kletterte dann irgendwann hoch auf das Podest mit den Poles darauf und begann zu tanzen. Vornehmlich mit den Hüften.
Dann kamen die Lederanzüge, die Hundeleinen, Ketten, Strapse, die hier von beiden Geschlechtern getragen werden, genau so wie die Netzhemden, Netzstrumpfhosen oder Stringtangas.
Ich brauchte Alkohol.
Die Reize wurden zunehmend reichhaltiger und ich dachte mir, ein guter alter Aufenthalt an der Bar würde mir eine kleine Auszeit verschaffen. Dort angekommen stellte ich fest, dass die Bedienungen nackt waren. Sowohl oben, als auch unten. Und aus einem inneren Impuls, Anstand walten zu lassen, bemühte ich mich reflexartig, meine visuelle Neugier zu unterdrücken. Nicht direkt hinzusehen. So richtig hatte ich das Prinzip dieses Laden noch immer nicht begriffen.
Drei Bier später ist der Laden auf einmal rappelvoll. Die Leute tummeln sich auf den Tanzflächen. Penisse, Vaginas, Brüste soweit das Auge reicht. Ich sehe Menschen in Ganzkörper-Bärenkostümen, Männer, die sich permanent am Glied herumfummeln. Mir verlangt es nach Bier – immer mehr Bier – und meine Knie werden schwach. Es ist, als geschehe ganz langsam etwas mit meinem Körper, das man nur auf einen Drogenkonsum zurückführen kann. Jeder Raum ist von einer bis ins Unendliche gesteigerten Scheißegal-Einstellung erfüllt, dass man glauben möchte, man befände sich in einer Parallelwelt. Plötzlich erkennst du Grenzen – in dir und der restlichen Welt –, weil sie auf einmal nicht mehr da sind. Du bist frei auf eine Art und Weise, wie du diesen Begriff noch nie zuvor verstanden hast. Ein Gefühl, glaube ich, nachdem man leicht süchtig werden kann.
Der Laden füllt sich.
Dieser Ort, er lockt dich mit süßen, nie gekannten Möglichkeiten zwischenmenschlicher Interaktion immer tiefer in sein Innerstes. Nackte Arschbacken berühren dich, eine Brustwarze streift deinen Oberarm, auf einem Podest tanzt ein alter, dünner Kerl in Strapse und Nylons mit einer zappelnden Erektion, lächelt zufrieden dabei. So zufrieden, wie es nur irgend geht. Ich lache, freue mich für ihn.
Ach, was soll's. Drauf geschissen. Also los, noch'n Bier geholt, Begleiterin geschnappt und ab in die Menge. Mein Taktgefühl wird zunehmend physiologisch ausgelebt und auf einmal ist das alles hier gar nicht mehr so schlimm. Menschen ziehen sich aus, klatschen sich auf die Hintern, peitschen sich, betreiben BDSM und ich denke: Ja. Warum denn auch nicht?
Ich rauche, rauche, rauche. Trinke, trinke, trinke. Tanze synchron dazu. Die ersten lüsternen Blicke von attraktiven, leicht bekleideten Frauen grienen mich an. Ganz offen und unverhohlen. Das ist ungewöhnlich in dieser Stadt, auch wenn ihr Ruf etwas anderes verspricht. So direkt werde ich normalerweise nicht beäugt, muss in der Regel viel mehr arbeiten für einen einfachen Flirt. Ist dies hier – dieser Ort – vielleicht das wirkliche Berlin, von dem jenseits seiner Grenzen so viel gesprochen wird?
Meine Hemmschwelle sinkt und sinkt. Sinkt immer weiter. Der Drang, zu der langbeinigen Blondine da drüben rüberzugehen, aus einem Lächeln die Berührung namenloser Zungen und Körperteile werden zu lassen, steigt. Aber dann suchen mich Gedanken aus der Welt da draußen wieder heim. Zweifel, Bedenken, Ängste. Was, wenn dies? Was, wenn das? Krankheiten, trickbetrügende Prostituierte, unerkannte Transsexuelle.
Ich lasse sie links liegen, nur so zur Sicherheit, aber da kommt schon die nächste, lächelt mir zu. Von etwas weiter weg. Größere Brüste, süßes Gesicht, breitere Hüften, dunkle Haare. Nicht schlecht, nicht schlecht, denke ich mir.
Warum, weiß ich nicht, aber ich erinnere mich an früher. Wieder bin ich ein kleines Kind, denke an die Besuche beim Fleischer mit meiner Mutter und wie die Frau hinter der Theke mir immer eine »Gesichtsmortadella« schenkte. So nannte ich sie. Ich denke an den Anblick des Fleisches hinter dem Glas und wie nur sie, die Fleischfrau, die Macht hatte, mir eine dieser Genüsse zu gewähren.
Aber dann, kurz bevor ich mich zu vergessen beginne, werde ich von meiner Begleiterin beiseite genommen, die mich wieder an die beruflichen Gründe erinnert, aus denen ich überhaupt erst hier her gekommen bin. Sie zeigt auf etwas, hat ein Gesicht, das sagt: »Schau mal, dort!« Denn hinter uns geht der Abend gerade in die nächste Phase über.
Das Gang-Bang-Armageddon beginnt.
Das KitKat verschluckt dich, definiert Normalität für dich neu. Man kann nicht leugnen, dass du an kaum einem Ort so sehr akzeptiert wirst, wie hier. Ob du alt, dick, kahl oder vollbusig bist, ob du männlichen, weiblichen, dritten, vierten oder welchen Geschlechtes auch immer bist – all das spielt hier wirklich keine so große Rolle. Ein Gefühl, dass mir keine political correctness dieser Welt je verschafft hat. Denn die gewöhnliche Werteskala ist schlicht außer kraft gesetzt. Es herrscht ein so ungewöhnliches Höchstmaß an Akzeptanz, Offenheit und Neugier. Die Menschen haben sich in der Sexualisierung des sozialen Miteinanders vereinigt. Und die Welt da draußen, sie wird in so weite Ferne getragen, wie es kein Zug, Flugzeug oder Raumschiff je bewerkstelligen könnte. Sie ist ansteckend, diese Atmosphäre. Es ist, als kämst du in die Hölle und würdest feststellen, dass die Schauergeschichten über sie sittlich befangene Verunglimpfungen waren. Keine objektiven Schilderungen.
In einer Ecke sehe ich jetzt die hübsche junge Frau liegen, die am Beginn des Abends auf der Tanzfläche noch ihren BH auszog, ein wenig tanzte und ihn dann wieder anzog. Ich dachte, es sei ihr dann doch zu viel gewesen, aber jetzt liegt sie da. Die Beine mit den Highheels daran in die Höhe gestreckt und um sie herum tummelt sich eine Horde Männer. Auf ihr liegt etwas, das aus meinem Winkel nur ein sich auf und ab bewegender Hintern mit zwei Oberschenkeln unten dran ist. Der nächste in der Reihe ist ein Kerl im Arztkostüm. Sein Vorgänger ist fertig und er klettert in die Ausgangsposition. Versenkt sein Glied.
Ein Dutzend Männer hämmert vor meinen Augen diese zierliche Frau – dieses Mädchen – durch und ich bin überrascht, dass es mich nicht so sehr schockt, wie erwartet. Mich wundert nur, dass ich kein Kondom am Penis des Arztes gesehen habe bevor er sich an ihr verging.
Ich schaue mich weiter um. Über uns auf der Hochebene hängen zwei Frauen über dem Geländer, hinter ihnen Männerschlagen, rechts und links Hände an ihren Brüsten. Die Frauen schreien lustvoll und mit geschlossenen Augen, aber weil die Musik so laut ist, hörst du es nicht. Siehst es nur. Mir ist, als schaute ich einen Porno mit einem VR-Helm und statt mich zu verkriechen, mich zu genieren, bemerke ich auf einmal Aktivitäten in meiner Hose und die Neugier in meinem Bauch kitzeln. Ganz so, als sei ich allein Zuhaus'.
Überall um mich herum wird gevögelt. Neben mir, hinter mir, über mir. Ich bin Schriftsteller denke ich mir. Stülpe mir diese Berufsbezeichnung über wie ein schützendes Tuch und mache mir mentale Notizen. Dabei interessieren mich die vögelnden Gruppen mehr als die vögelnden Paare. Die Erfahrenen Clubgänger, mutmaße ich, spüren es wahrscheinlich schon nahezu präkognitiv sich ankündigen, wenn eine Frau ihr Okay zu einem solchen Intermezzo aussendet. Gieren sehnsüchtig nach Gang-Bang-Gelegenheiten. Trauben aus gierigen, ungeduldigen Männern entstehen und die Frauen liegen dort wie eine Bienenköniginnen, entscheiden über Ja und Nein. Erleben einen beinahe religiösen Trance-Zustand des vollkommenen Kontrollverlustes.
Und nachdem ich mich von all diesen Eindrücken habe verprügeln lassen, nachdem mein Geschlechtsteil sich gegen mich verschworen hat, nachdem die Welt dort draußen nur noch eine vage Erinnerung ist, sagt meine Begleiterin zu mir: »Ich glaub', ich hab genug für heute.«
Wir verlassen den Club. Die Welt, die ich jetzt betrete, ist nicht mehr dieselbe. Die Straßen sehen »merkwürdig« aus, obwohl es genau die gleichen sind, wie vor ein paar Stunden noch. Sie sind unwirklich geworden. Überhaupt sind Realität und Wirklichkeit nur noch zwei deformierte Gebilde.
Minuten später sitze ich in der U8 auf dem Weg nach Neukölln. Völlig fertig. Erschlagen. Körperlich, psychisch und geistig. Die Normalität, durch die ich alltäglich wandele, sie verstört mich auf einmal. Ist irgendwie nicht mehr »richtig«. Ich schaue nach links, schaue nach rechts, wundere mich, dass die Leute nicht einfach vögeln, wäre nicht überrascht, wenn sie es täten. Hier in der U8. Warum auch nicht? Ist doch egal. Was ist denn unser soziales Miteinander, außer eine komplexe Systematik aus Grenzen und Privilegien, die Handlungen und Möglichkeiten in eine Ordnung bringt? Grenzen, die wir selbst – als Menschen – gezogen haben, um uns in ihnen zu bewegen, und die wir auch selbst problemlos übertreten können wie den weißen Streifen auf einer Fahrbahn.
Etwas aus dem KitKatClub muss mir gefolgt sein, sich an mich geheftet haben. Wie ein finsterer Dämon. Mir ist, als könnte ich in dieser Welt hier draußen nur noch mit großer Anstrengung funktionieren. Ich habe gesehen, was sein kann, habe erlebt, dass diese Welt hier nicht so sein muss, wie sie ist.
Die Erfahrungen, die ich machen, die Bilder und Eindrücke, die ich sammeln wollte – ich habe sie alle bekommen. Habe sogar feststellen dürfen, dass meine Fantasie in Bezug auf den geplanten Roman einiges davon vorweggenommen hat. Aber in die Menge der Erfahrungen hat sich eine Reihe unerwarteter Selbsterfahrungen eingeschlichen, die ich ohne den KitKatClub niemals hätte machen können. Dafür muss ich ihm und den Menschen darin danken. Ganz ernsthaft.
Und die letzte Erfahrung, die ich an diesem Abend machte, war eine, die ich bis jetzt noch nicht ganz verstehe. Es ist merkwürdig, da ich normalerweise ganz anders bin. Denn das letzte, was ich heute Nacht wollte, war, allein zu sein.
Maik Gerecke
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
24 | Stefan Heyer
Ein Stück Seife
In die Socken hatte er den Zettel getan. Mühe sich gegeben. Viel Mühe. Die schönste Schrift. Mit Bleistift und Lineal Linien gezogen auf dem Blatt. Vorgeschrieben jeden Buchstaben. Jeden Schwung. Auch beim Pfarrer war gewesen. Zum Beichten. Wie jedes Jahr. Es war schwierig, ihn zu finden. Gerne wollte er einen Christbaum. Doch es war keiner aufzutreiben. Nicht für Geld, nicht im Tausch. Wie immer würde er an Weihnachten in die Kirche gehen, zum Gottesdienst. Auch ein altes Spielzeug wollte er dem Pfarrer geben, für andere Kinder. Doch fand kein geeignetes. Früher hatte sein Großvater immer besondere Süßigkeiten gebacken. Hatte eine eigene Bäckerei gehabt. Jetzt gab es diese Backstube nicht mehr. Aber Großvater buk hin und wieder, wenn er Mehl bekam, Brot im Keller. Dort hatte er jetzt einen kleinen Ofen, hatte ihn selbst gebaut. Aus Ziegel. Tat seinen Dienst. Aber es war schwierig an Mehl zu kommen. Weihnachten würde auch dies Jahr schön werden, ganz bestimmt. Wie jedes Jahr. Auf den Zettel hatte er nicht viel geschrieben. Ein Stück Seife hat er sich gewünscht, sein Vater machte sie immer noch, auch wenn Olivenöl knapp geworden war, Lorbeer war noch seltener. Ein Stück Seife. Er träumte von einem Bad. Das Haus stand schon lang nicht mehr. Sie wohnten jetzt bei den Großeltern, die hatten mehr Glück gehabt. Bombenangriffe. Auch die Kirche hat es getroffen. Eingestürzt. Nur noch Schutt und Asche. Der Pfarrer lebt noch. Irgendwo würde die Heilige Nacht gefeiert werden. Freiwillig würde seine Familie die Stadt nicht verlassen. Nachts hatte er oft Angst. Schüsse. Raketen. Bomben. Da verkroch er sich ganz tief in sein Bett. Seine Großmutter erzählte dann immer von früher. Aleppo war eine schöne Stadt gewesen. Früher. Eine sehr alte Stadt. 4000 Jahre alt. Viele Menschen haben hier gewohnt, früher, vor dem Krieg. Seine ganzen Freunde sind geflohen. Oder tot. Oft hat er Hunger. Er wusste nicht, ob er die Toten beneiden sollte. Er hat sich ein Stück Seife gewünscht. Weihnachten würde schön werden. Bestimmt. Ganz bestimmt. Und Schnee hatte er sich gewünscht. Schnee für Aleppo. Dann wäre die Stadt wieder schön. Aleppo als Schneelandschaft, kein Staub mehr, keine Steinwüste. Alles wäre ruhig.
Stefan Heyer
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
23 | Markus Grundtner
Das Streben nach Unglück
Wenn ich daran denke, wie ich damit umgehe, mir etwas zu wünschen und es tatsächlich zu bekommen, erinnere ich mich an die Nächte vor Weihnachten, als ich noch ein Kind war:
Das Kind schwingt sich auf sein Stockbett und schmiegt den Kopf in das weiche Kissen, um tief und fest einzuschlafen. Dann beginnt das Kind zu träumen. Es träumt von seiner Vorfreude auf Familie und Geschenke. Es träumt von einer Maschine, die das Vergehen der Zeit beschleunigt. Es träumt, wie es sich hellwach hin und her wälzt. Es träumt, dass es im Bett nur Unruhe findet. Es träumt von seiner feuchten Stirn und seinem trockenen Mund. Es träumt von seiner Decke, die einerseits zu dick und andererseits zu kurz ist.
Unerwartet nähert sich der erhoffte Moment dann doch. Das Kind träumt, wie seine Glieder nicht mehr zucken, sondern matt werden. Es träumt, wie sein Geist sich entspannt und zerfließt. Es träumt, wie seine Augen sich schließen und geschlossen bleiben. Das Kind träumt vom Einschlafen.
Der Glücksfall tritt ein. Doch dabei drängen sich Zweifel auf: „Einfach so, ganz plötzlich und unverdient? Das kann doch nur ein Trugbild sein.“ So vertraut das Kind seiner eigenen Gewissheit: „Tatsächlich schlafe ich gar nicht.“ Als der Schlaf im Traum kommt, nimmt das Kind den einzig logischen Ausweg aus seiner Angst, getäuscht zu werden, und erwacht so in eine Nacht, die noch lange andauert.
Inzwischen verlebe ich meine Tage nach diesem Muster. Ich fliehe vor Wünschen, von denen ich nicht glauben will, dass sie schon wahr geworden sind, damit sie sich endlich erfüllen.
Markus Grundtner
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: