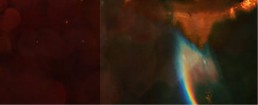13 | Markus Grundtner
Müll, aber schön
„Wir müssen über deine Tassen reden“, sagt Klaudia. Ich besitze kein einheitliches Set, alle auf einmal erworben. Meine Tassen habe ich im Laufe der Jahre angesammelt. „Die sind einfach unästhetisch“, sagt Klaudia.
Das mag sein, dafür kann ich mein Leben anhand meiner Tassen erzählen: Meine älteste Tasse ist schwarz – mit einem roten Stern darauf, das Rot fast weggewaschen. Die Tasse meiner Jugend: Sonntagmorgens habe ich verkatert Kaffee getrunken und mir vorgestellt, etwas zu sein, was ich nicht bin, und etwas werden zu können, was ich niemals werden kann.
Außerdem besitze ich eine Tasse mit einem Goldzeisig darauf. Neben dem Jus-Studium bin ich durch die Natur gezogen, um Vögel zu fotografieren. Ich habe nie gelernt, den Apparat unter Ausnützung all seiner Möglichkeiten zu verwenden. Wenn es das Schicksal will, mache ich ein gutes Bild. Fotografie ist mein Ersatz für Glücksspiel.
Ich habe eine Tasse aus dem Kafka-Museum in Prag. Ich habe mit „Vor dem Gesetz“ zu lesen begonnen und werde nicht aufhören, bis ich Kafka verstanden habe. So viel kann ich mittlerweile sagen: Wenn Kafka wüsste, dass sein Gesicht heute auf Tassen gedruckt wird, käme er zur Überzeugung, in seiner eigenen Prosa gelandet zu sein.
Dann sind da noch viele Tassen von Menschen, die meinen, das Büro wäre ein Ort für mich, um Spaß zu haben. Sie haben mir Spruchtassen geschenkt, dass es nichts Heimtückischeres gebe als Montag, nichts Ersehnenswerteres als Freitag und das einzig Wahre im Leben Kaffeetrinken sei.
All meine Tassen packe ich in eine Schachtel, denn im Dezember übersiedeln wir. Am Umzugstag fällt genau diese Schachtel als einzige von vielen im neuen Stiegenhaus die Treppe hinunter. Alle meine Tassen zerbrechen. Klaudia spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände, sie entschuldigt sich. Den zweiten Teil glaube ich ihr.
Am Weihnachtsmorgen stolpere ich im Schlafzimmer über eine braune Schachtel, die ich für den letzten Umzugskarton halte. Ich öffne sie: Tatsächlich sind Klaudias Weihnachtsgeschenke für mich darin.
Ein wenig später blicke ich aus dem Wohnzimmer auf die Straße und trinke Tee aus einer meiner neuen Tassen. Sie sind aus Emaille: Spezialanfertigungen, auf denen die Vögel Mitteleuropas abgebildet sind. Jeder Vogel trägt neben dem Schnabel eine Sprechblase mit einem eigenen Kafka-Zitat.
Vor dem Wohnzimmerfenster schwebt ein zerrissenes Stück Cellophan vorbei, dreht seine Kreise im Wind und funkelt in der Wintersonne. „Wahrscheinlich die Verpackung von einem Geschenk“, sage ich zu Klaudia, die mich von hinten umarmt.
„Stimmt“, sagt sie, „Müll, aber schön.“
Markus Grundtner
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
7 | Larissa Böttcher
Goldene Tage
Ich richte mich auf, hier entlang, stromaufwärts, hinauf, mit dem Handballen voran.
Draußen drängt die Sonne mit ihrem taubenblauen Licht. Es schwappt über die Dächer. Jagt durch die Straßen. Bombardiert die Fassaden. Sprengt das Eis von den Frontscheiben. Klettert durch das Fenster zu mir herein, während ich still dasitze und direkt hinein stiere, nicht mal blinzle. Es zerrt an meinen Zügen, wälzt sich durch die Poren und zieht darunter jede einzelne Faser straff. Ich richte jeden Finger meiner Hand einzeln auf, greife zu und ziehe, ziehe an diesem Hebel, immer wieder, in alle Richtungen, bis der Rahmen knackend nach außen schwingt.
Der Wind treibt meinen Atem hinaus in den Hof. Unten, an der Hauswand, kleben zwei Schatten. Sie flüstern und zittern und stecken die Köpfe zusammen. Ich beuge mich vor, etwas zu weit, etwas zu schnell. Kälte schlägt mir ins Gesicht, meine Gedanken, meine Entwürfe, meine Utopien geraten ins Taumeln. Sie schreien auf, rutschen ineinander, verknoten sich und kippen mit mir nach vorn, prallen von innen gegen meine Stirn und ich klopfe vorsichtig dagegen und es klopft zurück. Ich friere, doch ich dränge weiter hinaus, ich verrenke mir den Hals, denn ich richte den Blick aus.
Irgendwo da unten, da hinten, wo sich alles mit Menschen füllt und Worte abgestoßen werden wie Fremdkörper, gibt es einen Fleck. Ich bin mir sicher, es gibt ihn noch, diesen Fleck, zinnoberrot, den ich auf die Tapete gemalt habe, groß wie ein Kieselstein. An diese Wand, diese Wände, deine kahlen Wände, hinter denen es still war, hinter denen es still ist. Hinter denen dieser Fleck existiert.
Nur du, ein ganz und gar geräuschloses Wesen, konnte unbemerkt verschwinden.
Meine Gedanken raufen sich frei. Gebliebene, Wiederkehrer, Fremdgewordenes. Ich öffne den Mund. Meine Lippen sind trocken, sie reißen auseinander und ich rufe etwas in den Tag hinaus, etwas, dass ich nicht verstehe und ich blinzle, blinzle immer schneller, ich spüre, wie es mich schüttelt, wie es mich aus dem Bett reißt, mich herumwirbelt, wie die Fasern unter meiner Haut auseinanderplatzen und durch meinen Körper schnellen. Ich greife nach dem Fensterrahmen, kralle mich fest.
Draußen gurren die Tauben so laut, dass man glauben könnte, ein Gewitter rollt heran und vielleicht ist es so, dass du das auch in der Ferne noch hören kannst. Vielleicht sitzt du dort am Fenster und schweigst, während ich den Rahmen loslasse und in die Welt hinausstürze wie ein Kind, guck mal, ohne Hände, siehst du's? Wie ich in das blaue Licht eintauche, Funken schlage und versinke?
Die Schatten schrecken auseinander.
Ich nicke ihnen zu.
Es sind diese goldenen Tage.
Larissa Böttcher
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
6 | Gorch Maltzen
Mikrokosmos (Bagatelle)
Fühle wieder etwas. Laufe herum und habe diese Taste in mir. Drücke sie und kann weinen. Freue mich zu weinen. Bin kaum eierschalen-, übergangsjacken-, durchpausdick. Bin noch vorsichtig, aber bin da. Seufze. Mute mir Zumutbares mutig zu. Musik bedeutet wieder etwas, alles. Gehe alte Wege und finde neue Wege alte Wege wie neue Wege zu begehen. Kann wieder Dinge zulassen. Telefoniere jetzt weniger als drei Stunden am Tag mit Hanna, um mein Herz auszuschütten. Übe wieder mehr als drei Stunden am Tag Klavier, neuerdings Bartók, auch Schönberg. Nehme Johanniskraut, Baldrian, widerwillig. Es hilft. Glaube ich. Habe aufgehört zu verblassen. Verlerne erlernte Hilflosigkeit. Nehme mir Zeit für mich. Weiß um eigene Verletzlichkeit. Lasse mich überreden. Gehe ab und zu mit zu Dingen, die alle wichtig finden. Hanna sagt, man darf sein Leben nicht verpassen. Habe aufgehört zu verpassen, passe auf. Spüre Samt, Lametta, Wachs. Bin dankbar für kleine Dinge. Das Jahr geht zur Neige. Sehe Raureif an Neonreklamen nachts. Schmecke Frost. Erwarte Blüte.
Gorch Maltzen
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
2 | Peter Paul Wiplinger
Advent-Advent
„Advent-Advent, ein Lichtlein brennt; erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier; dann steht das Christkind vor der Tür!“ Diesen Spruch sagten wir Kinder, auch im Chor, wenn wieder einmal die Adventszeit angebrochen war. Dann waren die Tage kürzer und am Abend wurde es immer früher dunkel. Draußen konnte es schon sehr kalt sein. Und der erste Schnee blieb liegen und verzauberte die Natur und alle Gegenstände, auf die er fiel und die er wie in ein weißes Federbett einhüllte. Drinnen in den Häusern brannte schon früh das Licht. Man hatte den Ofen im Wohnzimmer oder in der Wohnküche eingeheizt; es knisterte und duftete das Holz. Und vom Kachelofen kam die wohlige Wärme und erfüllte den Raum. Man war nun am Abend in der Familie mehr beisammen als sonst, keiner ging so wie im Sommer irgendwo auswärts hin. Sogar die Männer gingen seltener ins Wirtshaus; und wenn, dann blieben sie nicht bis in die späte Nacht. Sie spielten auch nicht Karten und es war nicht so laut in den Gaststuben wie sonst. „Die Stille Zeit“ ist nun, sagte man. Und so war jetzt lautes Lärmen unangebracht. Vielmehr sollte man „Einkehr halten in sich selber“ und sich vorbereiten auf das große Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, auf Weihnachten.
Bis dahin aber war es noch weit, einige Wochen waren noch davor. Und da galt es, mehr als sonst zu beten und viel zu tun. Als erstes wurde am Samstag vor dem ersten Adventsonntag von der Mutter der Adventkranz gebunden, aus den duftenden Tannen- oder Fichtenzweigen, die man sich selber aus dem Wald geholt hatte. Der Vater half ihr dabei. Bei uns wurden die Zweige der Einfachheit halber gleich auf den wie ein Wagenrad über dem Tisch hängenden hölzernen Lampenschirm mit Blumendraht aufgebunden. Das ging ganz gut so und war sehr praktisch. Denn die Lampe innerhalb des Lampenschirmes, der nach oben offen war, befand sich dann innerhalb des Adventkranzes und wurde von diesem umschlossen. Die vier Kerzen, drei lilafarbene und eine weiße, wurden in ganz flache Kerzenhalter gesteckt und dann mit dem Draht, der an den Kerzenhaltern war, am Adventkranz angebunden. Am Schluss wurde noch ein breites dunkel-lilafarbenes Seidenband mit silberner Borte an beiden Rändern querlaufend über den Kranz gewunden. Wenn alles fertig war, sagte der Vater zufrieden „Schön ist er wieder, unser Adventkranz, nicht wahr, Mutter!“ Und diese antwortete darauf „Ja, schön ist er wieder, unser Adventkranz.“ Damit war alles getan. Und man wartete jetzt nur noch auf den Abend des ersten Adventsonntags.
Nach dem Abendessen versammelten sich die ganze Familie und auch die Hausangestellten im Wohnzimmer. Die Kinder saßen in einer Reihe um den Tisch herum, die noch kleinen auf dem Schoß einer älteren Schwester. Die Hausangestellten saßen auf dem Sofa an der Wand. Wenn der Vater zur Streichholzschachtel griff und ein Streichholz anzündete, dann mit dem brennenden Streichholz auf dem Tisch kniend den noch weißen Docht der ersten Kerze entzündete, dann verstummte sogleich jedes Gerede und Geflüster, und alle schauten gespannt und zugleich ergriffen auf die nun brennende erste Kerze am Adventkranz. Nachdem das elektrische Licht ausgemacht worden war, erleuchtete das Licht der Kerze die Finsternis, und der Raum war in eine schwache Dämmrigkeit getaucht. Die Flamme der Kerze flackerte, es knisterte und roch nach Wachs. Schatten zuckten oder lagen auf den Gesichtern. Und dann hörte man die Stimme des Vater nach einem kurzen Sichräuspern sagen „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“; wobei er und wir andächtig das Kreuzzeichen machten.
Dann beteten wir das „Vater unser“ und ein „Gegrüßet-seist-Du-Maria“; anschließend das „Glaubensbekenntnis“ und ein oder zwei Gesetzchen des „Freudenreichen Rosenkranzes“, darunter das mit dem Text „Den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast...“. Darauf nahm der Vater ein Buch, immer dasselbe, in jedem Advent, und schlug es auf. Um besser lesen zu können, entzündete er eine kleine Kerze, die in einem grünen, mit Blumen bemalten, hölzernen Kerzenleuchter steckte. Aus dem Buch las er dann den Abschnitt, der für den ersten Adventsonntag bestimmt war. Er las mit fester Stimme und fast so wie der Herr Pfarrer in der Kirche. Alle hörten aufmerksam zu. Niemand von den Kindern hätte sich getraut, irgendeinen Unfug zu machen oder wie in der Schule zu „schwätzen“. Nur manchmal hörte man ein Husten oder Räuspern. Es konnte sein, dass die schon alte und von der langen, schweren Tagesarbeit ermüdete Köchin beim Rosenkranzbeten kurz einschlief, und man ihr tiefes, etwas geräuschvolles Atmen hörte. Dann stieß sie sogleich eine andere Hausangestellte, oder wer eben neben ihr saß, kurz an, und sie wachte gleich wieder auf, schaute etwas verwundert um sich und betete weiter. Alle waren bei dieser Adventandacht ganz dem Gebet und der Erbauung hingegeben. Nur die hinten auf dem Sofa eingerollt liegende Katze schnurrte ganz leise; doch das wurde von den Stimmen der Betenden übertönt.
Als kleiner Knirps konnte ich natürlich noch nicht so lange und komplizierte Gebete wie das „Vater unser“, das „Gegrüßet-seist-Du-Maria“ und schon gar nicht das „Glaubensbekenntnis“, den „Rosenkranz“ oder den „Engel-des-Herrn“ mitbeten. Und so saß ich da, manchmal neben unserer lieben Köchin Fanni und plapperte jene einfachen Worte mit, die ich schon reden konnte, deren Bedeutung ich aber oft noch gar nicht verstand. Wenn ich schon müde war oder müde wurde von der einschläfernden Monotonie dieses Gebetsstimmenchores, dann schlief ich ein, wobei ich mich bei der Fanni anlehnte, und sie den Arm um mich legte. Man ließ mich schlafen, weckte mich aber kurz vor dem Ende unserer Adventandacht auf und sagte leise zu mir: „Jetzt bist du dran, Peterle!“ Und dann musste ich zum Vater gehen, mich zwischen ihm und der Mutter hinstellen - gerade dass der Kopf über die Tischfläche ragte - die Hände zusammenfalten, zu einem bereits vor mir aufgestellten, eingerahmten Jesusbildchen, das einen kleinen, blondgelockten Buben zeigte, aufblicken und „mein Gebet“ sprechen, das man mich gelehrt hatte und das ich - mit Hilfe von Vater und Mutter, die es mit mir ganz langsam und deutlich sprechend mitbeteten - nun aufsagen musste. Meist begann der Vater mit dem ersten Wort und ich betete dann - ein jedes Wort in kindlicher Manier betonend - mein Gebet: „Weil jetzt, o liebes Jesukind, die Engelein so fleißig sind, drum will auch ich für Dich mich plagen...“ Weiter weiß ich es nicht mehr, hier bin ich immer stecken geblieben und habe nicht weiter gewusst. Heute, nach fast sechs Jahrzehnten, habe ich den Rest meines Kindergebetes vergessen. Aber das „Mich-plagen“ ist mir noch als etwas mir Unangenehmes bis heute im Gedächtnis geblieben.
Kaum dass ich etwas älter und größer war als ein Knirps von drei oder vier Jahren, habe ich das Mich-plagen für das Jesuskind in der Adventszeit schon als besondere Religionsübung aufgefasst und dem entsprechend kistenweise das gehackte Holz aus der Holzlaube unten für die Köchin Fanni über die Stiege hinauf getragen und in die Holzkiste geschlichtet. Wiederum etwas später, als ich mich dann geweigert habe, dieses Kindergebet noch weiter aufzusagen, hatte ich mich gefragt, warum auch ich mich, bloß deshalb, „weil die Engelein so fleißig sind“, nun so für das Jesuskind abplagen soll. Ich konnte und wollte nicht einsehen, was das eine mit dem anderen zu tun habe. Und überhaupt, warum schon wieder so ein opferverdächtiges Wort wie „Mich-plagen“ anstatt „Mich-freuen“?! Immer musste man „Opfer bringen“; in der Fastenzeit, in der Adventszeit; bei einem Gelübde oder bei einer Novene. Sünde, Reue, Buße, Sühne, Strafe, Verdammnis, Fegefeuer und Hölle - das alles waren Begriffe und Bestandteile einer düsteren Welt, die mit der Religion und dem Katholizismus schon früh in mein kindliches Empfinden hineingelegt wurden, ob ich das nun wollte oder nicht. Von Freude und Fröhlichsein war kaum jemals die Rede.
So wie am ersten Adventsonntag wurde nun an jedem Tag bis hin zu Weihnachten die gleiche Adventfeier in unserer Familie abgehalten. Jede Adventandacht lief nach diesem beschriebenem Muster ab, manchmal war sie etwas kürzer, ein anderes Mal ein wenig länger; immer aber war es das gleiche Zeremoniell. Das hatte etwas Beruhigendes, manchmal etwas Einschläferndes an sich, aber man konnte sich auf etwas verlassen, daß es so sein würde, wie man es kannte. Und da dies mit wenigen und kleinen Abänderungen über viele Jahre der Kindheit und dann der Jugend so verlief, bildete dies einen Bestandteil dessen, was man „Familientradition“ nannte und als solche bezeichnen kann. Meine Geschwister und ich wurden von Jahr zu Jahr größer. An meine Stelle und die meiner Kindergebete mit dem „O du liebes Jesukind, weil jetzt die Engelein so fleißig sind...“ und dem „Jesukindlein komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir! Mein Herz ist klein, darf niemand hinein, als Du, mein liebes Jesulein“ traten die Kinder und ihre Gebete meiner nun verheirateten älteren Geschwister, die fallweise zu unserer Adventandacht kamen. Sie saßen dann genauso andächtig wie wir damals, vielleicht ein wenig verschreckt, weil eben doch nur Besucher, um den Tisch im Wohnzimmer herum. Die Fanni gab es nicht mehr; die liebe alte Frau, meine wichtigste Bezugsperson in meiner Kindheit, war schon gestorben. Ebenso einige meiner Geschwister, die ein unerwarteter, viel zu früher, tragischer Tod aus der Familie herausgerissen und in den Herzen meiner Eltern tiefe, unheilbare Wunden hinterlassen hatte. Hausangestellte gab es längst nicht mehr. Das Geschäft war abgegeben, verpachtet. Ich war weggezogen und kam zwar regelmäßig, aber doch nur selten nach Hause. Vater und Mutter waren alt geworden, müde, krank, schweigsam. Nur an den Enkelkindern schienen sie sich noch zu erfreuen. Das laute Beten über längere Zeit fiel ihnen schwer. Die Stimme des Vaters war schwach und brüchig geworden. Die Mutter lebte in sich zurückgezogen, in ihrem eigenen unausgesprochenen Innern. Die Adventandachten hatten aber Generationen und Jahrzehnte überdauert und überbrückt; als etwas Gemeinsames, Verbindendes, Zuverlässiges.
Auch jetzt wurde noch an jedem Adventsonntag eine neue Kerze am Adventkranz angezündet und am vierten Adventsonntag die einzige weiße Kerze, als sichtbares Zeichen, dass das Fest der Geburt Jesu Christi nahe sei. Aber nicht mehr der alte Vater zündete sie an. Er konnte nicht mehr auf den Tisch klettern und sich beim Kerzenanzünden hinaufknien. Jetzt bat er eines seiner Enkelkinder. Und eine herzergreifende Traurigkeit lag in seiner Stimme und erfüllte auch mich, wenn er mit einem matten, etwas verlegenen Lächeln einem seiner schon größeren Enkelkinder das brennende Streichholz, das seine zitternde Hand an der Reibfläche nach mehrmaligen Versuchen endlich doch entzündet hatte, hinhielt und bat: „Geh’, sei so lieb und zünd’ mir die Kerze oben an!“ Dann stieg dieses Enkelkind auf den Sessel, kniete sich auf den Tisch, so wie einst der Vater das getan hatte, und zündete die Kerze oben am Adventkranz an. Dann flackerte die Kerze auf und erleuchtete die Finsternis. Und mit jedem Adventsonntag wurde es heller im Raum. Und wieder freuten sich Kinder auf Weihnachten; und mit ihnen die alten Eltern, die noch immer das Gleiche für die Enkelkinder taten, was sie Jahrzehnte hindurch für ihre eigenen vielen Kinder getan hatten.
Natürlich ging man auch jetzt noch während der Adventszeit in die „Rorate“, eine Frühmesse an Werktagen mit besonderen Gebeten und Liedern für diese Zeit der Vorbereitung in Erwartung des Herrn. Noch immer sang man die alten, bekannten Lieder, das „Tauet Himmel, den Gerechten...“ und „O Heiland, reiß die Himmel auf...!“ Noch immer saßen im Dunkel der Kirche, bevor die Kerzen am Altar angezündet wurden, die Frauen und die wenigen Männer hingeduckt in den Kirchenstühlen, eingemummt in schwere Mäntel und dicke, wollene Tücher. Denn der Winter ist bitter kalt in diesem Land an der Grenze, und die Kälte kriecht einem durch alle Kleider hindurch unter die Haut bis auf die Knochen. Noch immer wurde in der letzten Adventwoche ein Christbaum aus einem der Wälder der Bürgergemeinschaft geholt. Später brachte uns dann jemand den großen Baum. Noch immer wurde bei uns jedes Mal ein paar Tage vor Weihnachten die große Kiste mit der Krippe, mit den in Papier eingewickelten und in Holzwolle eingehüllten Figuren sowie dem hölzernen Stall, den der Vater schon vor Jahrzehnten gebastelt hatte, vom Dachboden ins Wohnzimmer herabgetragen. Und dann wurden dieser Stall und diese Gipsfiguren, die Hirten und Schafe, der Ochs und der Esel, Maria und Josef sowie die kleine Holzkrippe mit Stroh für das Jesuskind auf einem über die hohen Sofalehnen gelegten dicken Brett, das mit Moos ausgelegt und mit Tannenreisig und einem Zaun aus dünnen Haselnusszweigen umgrenzt wurde, aufgestellt; die Krippe noch leer und ohne das Jesuskind, das erst am Heiligen Abend hineingelegt wurde. Dann wurde noch ein kleiner Kiesweg, der gerade hin zum Stall führte, angelegt. Und auf dem standen dann kleine rote Kerzen in sternförmigen niedrigen Kerzenleuchtern, die zum Gebet oder zur Betrachtung für die Kinder angezündet wurden. Auch eine Beleuchtung gab es im Stall, so dass es die Heilige Familie hell hatte. Und dann saßen der alte Vater und die alte Mutter mit den vielen kleinen Enkelkindern vor der Krippe mit den angezündeten Kerzen und der kleinen Beleuchtung im Stallinneren und beteten die gleichen Gebete, die wir als Kinder gebetet hatten. Und der Vater sagte manchmal „Kinder, jetzt ist die Krippe noch leer, aber bald kommt das Jesuskind hinein; dann zu Weihnachten.“
Das alles wurde aus unserer Kindheit über Jahrzehnte hinweg hinübergerettet in die nächste und übernächste Generation. Ob es dort weiterlebt, weiß ich nicht. Mit dem Tod meiner Eltern und dem darauffolgenden Auseinanderbrechen der Großfamilie endete sowohl diese Gestaltung der Adventszeit, als auch die anderer Tage, Zeiten und Feste im Kirchenjahr. Es endete ein gelebtes Lebensbeispiel, eine Familientradition. Heute, nach all den Jahrzehnten, erinnere ich mich an meine frühe Kindheit. Ich sehe in meiner Erinnerung Lichter brennen, die es längst nicht mehr gibt. Und ich glaube die Stimmen von Vater und Mutter und von meinen längst verstorbenen Geschwistern zu hören, wie sie singen: „Tauet Himmel, den Gerechten, Wolken regnet ihn herab! Also rief in langen Nächten einst die Welt, ein weites Grab ...“ Und ich vermeine, dann auch den hellen Klang jenes Glöckchens zu vernehmen, das jedes Mal bei der letzten Adventandacht, nämlich der am Heiligen Abend, nachdem wir mit dem Beten und Singen geendet hatten und still dasaßen, zuerst kaum hörbar, wie aus weiter Ferne, dann aber näher kommend, geläutet hat, worauf der Vater zu uns Kindern sagte: „Horcht’s Kinder, es läutet; das Christkind ist da!“ Dann sind wir langsam aber innerlich ganz aufgeregt durch die dunklen Räume hinaufgegangen zu jenem Zimmer, durch dessen offenen Türspalt ein helles Licht geleuchtet hat, von dem man uns gesagt hatte, dass es von jenem Licht herrühre, das „das Licht der Welt“ sei. Und da stand dann ein wunderschöner, großer, geschmückter und nach Wald duftender Weihnachtsbaum. Davor und darunter lagen viele Päckchen. Und dann sangen wir alle gemeinsam und tief ergriffen das schöne alte Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht ...“
Peter Paul Wiplinger
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Katja Johanna Eichler
Schlamm und Schimmel
Sie trank inzwischen täglich Schlamm. Sie rührte sich jeden Morgen einen Teelöffel der Vulkanmineralien in ein Glas mit etwas Wasser, bis dies zu einer grauen Masse wurde und trank es. Jeden Morgen schaute er zu, wie die Masse in einem schmalen Rinnsal schwerfällig vom Glasboden in Richtung Rand rutschte und dann zwischen ihren beiden kirschroten Lippen verschwand. Jeden Morgen fand er, dass sie über Nacht wieder an Farbe verloren hatte, dass ihre Haut unterschiedliche Grautöne ausprobierte. Nach zwei Wochen fand er, dass ihre Haut auch die Grautöne verloren hatte und weiß, fast durchsichtig wurde. Im Folgenden fand er sogar, dass die Haut feine Risse bekam, so wie alter, weißer Marmor. Er dachte an antike Statuen in griechischen Tempeln, er dachte dann an Rom und an Pompej, an den Vesuv, der noch immer halb wach vor sich hin dämmerte und er dachte vor allem an Asche, die alle Häuser bedeckte und heiß in menschliche Lungen gesogen wurde. Inzwischen regnete es in jedem seiner Nachtträume Asche. Meist fiel sie in leisem Sinkflug auf eine zarte, fast durchsichtige Statue mit feinen Bruchstellen an Knien und Ellbogen. Bei näherem Hinsehen erkannte er Lola, obwohl ihr Statuen-Gesicht verzerrt aussah, die Stirn faltig, die Augen zusammen gepresst, der Mund eine schmale Linie. Es waren keine göttlichen Gesichtszüge, es waren schmerzverzerrte Linien. Eine Kore mit weltlich belastetem Antlitz.
Wenn er morgens aufwachte, lag sie nie mehr neben ihm. Vergeblich ließ er seine Hand Morgen für Morgen auf die andere Seite des großen Bettes wandern, das sie sich kurz vor Weihnachten zusammen gekauft hatten, nachdem sie diese Dachgeschosswohnung in der Innenstadt gemeinsam bezogen hatten. „Liebesnest”, hatte er sie damals liebevoll genannt. Jetzt war es „die Wohnung”. Eine Wohnung, in der zwei Menschen ein und ausgingen, um ihr Tagesgeschäft zu verrichten. Für Lola bedeutete das, früh aufzustehen, zur Uni zu gehen, danach die Unterlagen zu lesen, die wichtigen Stellen mit einem neongelben Marker anzustreichen und sie dann an der einzig richtigen Stelle in ihrem Universum von gereihten Ringordnern unterzubringen. „Die Wohnung” war zu einem Ort der Reihen geworden: Der Schuhreihen im Flur, der Bücherreihen im Wohnzimmer, der Reihen von Gewürz- und Müsligläsern in der Küche, von aufgereihten Kissen auf dem Sofa und Reihen von Duschgel- und Shampootuben im Bad.
In „Liebesnestern”, wie er sie meinte, gab es keine Reihen. Dort waren die Betten unordentlich, die Bettbezüge rochen nach Liebe und wiesen mehrdeutige Flecken auf. In „Liebesnestern” standen unbeachtet benutzte Weingläser herum, auf dem Küchentisch und neben dem Sofa, auf dem in wohliger Vertrautheit Kissen herum lümmelten. Espressokannen standen bereit, in denen jederzeit schwarzes italienisches Espressopulver aufgekocht werden konnte. Es gab Trauben im Kühlschrank und aufgebrochene Knoblauchzwiebeln, die achtlos neben großen Flaschen von frisch abgefülltem Olivenöl lagen. Es kam vor, dass Reste von Avocado, Schinken und roter Beete auf bunt befleckten Holzbrettern zu Zeugen eines gemeinsamen Kochens in leichter Bekleidung wurden, die einzig mögliche Schlussfolgerung nach einem Tag im Bett, der die Hautporen erfüllt hatte, aber nicht die Mägen. In „der Wohnung” fand sich von all dem nichts.
Als er Lola das erste Mal begegnet war, war sie weit davon entfernt gewesen, dem Abbild einer Göttin zu ähneln. Damals war sie eine Göttin. Sie unterschied sich von den anderen Erstsemesterinnen, die die Tischreihen des Hörsaals mit ihrer raschelnden und raunenden Profanität füllten, indem sie mit ihren Popos in viel zu engen Hosen die Klappstühle herunter drückten und nervös an ihren Haaren, dem billigen Modeschmuck und ihren Telefonen herum fingerten. Sie war ihm so anders als die anderen erschienen, dass ihr Anblick ihn geschmerzt hatte. An jenem Tag hatte er die Vorlesung dazu genutzt, sie genau zu studieren, ihr kantiges Profil mit dem starken Mund und der langen geraden Nase und ihre simplen glatten rötlichen Haare, die vorgaukelten, niemals irgendeiner Behandlung ausgesetzt gewesen zu sein. Als sie den Saal betreten hatte, schmucklos und schlicht gekleidet, hatten ihre Augen blitzschnell die Sitzreihen überflogen und zielbewusst seine selektiert. Er wusste, er hatte diese Wirkung, er war es gewohnt, dass ihm viele Blicke zukamen, doch damals war es anders gewesen. Nach der Vorlesung hatte sie hinter der weit geöffneten Flügeltür des Hörsaals auf ihn gewartet und er war auf sie zugegangen, als wäre dieser Augenblick alleine dafür bestimmt gewesen. Sie hatte ihm die Hand gereicht, sich ihm vorgestellt und er hatte ihre Hand mehrer Augenblicke in seiner gehalten. Nur drei Monate später waren sie zusammen gezogen. Er hatte sich glücklich gefühlt, bis das mit dem Schlamm begann.
Das mit dem Schlamm veränderte nicht nur seine Träume, sondern auch sein Geschmacksempfinden. Es fing damit an, dass er eines Morgens dachte, die Marmelade sei schimmelig. Oder das Toastbrot. Er nahm die Toastscheiben aus der Tüte, klappte sie auseinander und studierte sie sorgfältig. Aber er konnte keine Schimmelspuren entdecken. Er roch am verschmierten Deckel der Marmelade, stob mit der Messerspitze durch die rote Masse und quirlte die dunkelroten Punkte auf. Er konnte auch hier keine Schimmelschlieren entdecken. Irgendwann stellt er fest, dass sich der Schimmelgeschmack nicht nur auf das Frühstück beschränkte. Er zog sich durch alle seine Mahlzeiten. Er stellte auch fest, dass der Geschmack nicht pilzig, sondern steinig war. Er fragte sich, wie lange das mit dem Schlamm und dem Schimmel noch so weiter gehen konnte.
Es regnete, als er die Wohnung betrat, genau acht Wochen nachdem sie angefangen hatte, Schlamm zu trinken. Genau zwölf Wochen nachdem sie gemeinsam in ihr Liebesnest gezogen waren, das niemals eines werden sollte. Er zog seine Stiefel aus und stellte sie zu den anderen Schuhen, die sich im Flur an der Wand zwischen Eingangstür und WC-Tür aufreihten. Er zog seine durchnässte Jacke aus und hing sie an einen Haken aus der Reihe von Haken, die über die Schuhe wachte. Er ging in die Küche und sank erschöpft auf einen Stuhl. Es ließ das Licht aus, obwohl es draußen dämmerte und schaute abwechselnd zum Fenster hinaus und zu den Konturen der Trinkglas-Reihe auf dem Wandboard und der Müsligläser auf der Anrichte. Neben den großen Vorratsgläsern konnte er den weißen Kunststoffbehälter erkennen, der das puderige Pulver enthielt, das jeden Morgen als schmale Schlammlawine durch den Kirschmund rann. Er wusste, was auf dem Etikett stand, er wusste es auswendig, so oft hatte er es gelesen: Zeolith, Detox-Pulver, der Schadstoffbinder. Es würde alles absorbieren und hinaus transportieren, neue Energie geben, ja es half sogar gegen explodierte Atomreaktoren. Er hatte es selbst einmal probiert und er wusste, es machte Bauchschmerzen und einen grünlichen Stuhlgang, aber hey, alles nur leichte und völlig erträgliche Nebenwirkungen für einen maximal sauberen Darmtrakt. Plötzlich stand sie im Türrahmen, er erschrak und fragte sich, ob er die letzten Worte still gedacht oder laut gesagt hatte. Er hatte sie nicht kommen hören oder war sie die ganze Zeit da gewesen? Lief sie überhaupt noch oder schwebte sie bereits? Was hatte das Zeug schon alles absorbiert? Die letzten weltlichen Mikrospuren von Alkohol, Koffein und Schokolade? Oder bereits Nähr- und Mineralstoffe, gar erste Zellen? Höhlte es ihren Körper von innen aus? War sie nur noch die Hülle von Lola? Eine schwebende Kore in einem geordneten Imperium aus Reihen? Er sah ihr ins Gesicht. Es war nicht das verzerrte Antlitz aus seinen Träumen. Ihr Gesicht war klar und eben. Sie kam auf ihn zu, setzte sich auf seinen Schoß und legte ihre Arme um seinen Hals. Er konnte sie kaum spüren, aber er roch sie. Sie roch nicht nach Ascheregen. Sie roch nach Regenregen. Sie roch so anders als all die anderen. Sie roch so göttlich, dass es ihn schmerzte.
Katja Johanna Eichler
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Daniel Klaus
Kaugummis
An die Langsamkeit muss ich mich erst gewöhnen. Das ist nicht einfach. Die Minuten verrinnen mir nicht mehr zwischen den Fingern, sondern sie knoten sich aneinander, ineinander, und manchmal bleibt die Zeit für einige Momente einfach stehen, ohne sich von der Stelle zu rühren.
Aber die Krücken sind ein Fortschritt. Die ersten Tage durfte ich nur im Bett oder auf der Couch liegen, mit drei Kissen unter dem Fuß und einer Packung Eis darauf. Ich bin beim Basketballspielen umgeknickt. „Schwere Bänderdehnung“, sagte der Arzt, als er sich das Röntgenbild ansah. „Das braucht seine Zeit.“ Und mit dieser Diagnose hat er leider Recht gehabt. Ich bin froh, dass ich jetzt diese Krücken habe und mit ihnen die Wohnung verlassen kann. Endlich. Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet.
Es ist gar nicht so einfach, und es dauert eine ganze Weile, bis ich vom fünften Stock unten bin. Ich achte auf jeden Schritt, den ich mit meinem rechten Fuß und den beiden Krücken mache, und nach einer Weile merke ich, dass das Laufen für die Arme anstrengender ist als für das eine Bein. Eine seltsame Erfahrung. Schließlich öffne ich die Haustür und trete nach draußen.
Es ist halb ein Uhr mittags. In Berlin leben ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen. Vielleicht 800.000 davon halten gerade Mittagsschlaf. Es ist sehr ruhig auf der Straße. Vielleicht hängt die Stille aber auch mit der Hitze zusammen.
Ich gehe ein paar Schritte durch diese mittagsmüde Großstadtstille. Vor dem Esmarcheck bleibe ich stehen. Ich lege den Kopf in den Nacken und betrachte die gegenüberliegende Hausfassade wie ein Tourist. Ich lasse meinen Blick wie einen Aufzug vom obersten Stockwerk bis zum Erdgeschoss hinuntergleiten und steige dort mit meinen Augen aus. In der Zeitgalerie ist es dunkel. In der Zeitgalerie ist immer Winter, denke ich, selbst im Sommer. Merkwürdigerweise scheint gerade an diesem Ort die Zeit spurlos vorbeizugehen, während sich der Rest der Straße in ständiger Veränderung befindet.
Mitten in diesen Überlegungen läuft der schüchterne Nachbar aus dem Hinterhaus an mir vorbei. Mit gesenktem Kopf. Er ist der erste Mensch, den ich heute sehe. Er trägt Segeltuchschuhe und bewegt sich lautlos über den Bürgersteig. Ich blicke ihm hinterher. Kurz vor der Apotheke bleibt er stehen. Er betrachtet irgendetwas an der Wand. Ich gehe ein paar Schritte weiter, weil ich neugierig bin, und jetzt kann ich es erkennen: Es ist ein Kaugummiautomat. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Wie lange er wohl schon an dieser Wand hängt? Mein Nachbar kramt in seinen Taschen, holt eine Münze heraus und steckt sie in den Kaugummiautomaten. Mit einer andächtigen, fast feierlichen Bewegung, dreht er den Griff herum und hört auf das Klacken im Ausgabefach. Er wartet einen Moment, bevor er das Ausgabefach öffnet und die Kaugummis in seine Hand und von dort in ein Leinensäckchen rollen lässt, das er aus der Tasche gezogen hat. Ein Teil von ihm, sein Gesichtsausdruck und seine Körperhaltung, erinnern an den kleinen Jungen, der er einmal war, und den ich nie kennen gelernt habe. Dann wiederholt er das Ganze.
Und wieder.
Und wieder.
Seine Bewegungen werden schneller und sicherer.
Es ist noch immer sehr ruhig in der Esmarchstraße. Wir sind die einzigen Menschen. Nur ein Radfahrer mit losem Schutzblech fährt in der Liselotte-Herrmann-Straße über das Kopfsteinpflaster. Mein Nachbar scheint tatsächlich den kompletten Kaugummiautomaten leeren zu wollen. Er steht nun vor ihm wie ein erfahrener Panzerknacker oder Juwelendieb und wirft ein Geldstück nach dem anderen hinein. Ruhig und systematisch räumt er den Kaugummiautomaten wie einen Geldsafe aus.
Mein Herz pocht. Es ist Blödsinn, aber ich komme mir vor wie sein Komplize, der Schmiere steht. Es ist niemand zu sehen. Er hat freie Bahn.
Und dann scheint er fertig zu sein.
Ich humpele mit meinen beiden Krücken zu ihm und werfe einen Blick auf den Kaugummiautomaten. Er ist leer. Ein perfekter, völlig legaler Raubzug.
„Hallo“, sage ich.
„Hallo“, sagt er und sieht mich an. Es ist das erste Mal, dass ich ihn reden höre. Er lächelt und hält mir seinen gefüllten Leinenbeutel hin: „Bitte“, sagt er. „Greifen Sie zu.“
Ich suche mir einen grünen, einen blauen und einen gelben aus. Auf einem Balkon im Haus gegenüber steht ein Windrad, das sich schläfrig im Wind bewegt. Ich stecke sie mir alle drei auf einmal in den Mund und beginne, die Farben abzulutschen.
„Die sind wirklich gut“, sage ich, die Ellbogen lässig auf die Krücken gelehnt.
„Davon träume ich seit ich elf bin“, sagt er. „Und heute, zwei Tage nach meinem 38. Geburtstag, habe ich es endlich gemacht.“
Wir stehen beide vor dem leergeräumten Automaten in der stillen Esmarchstraße. Ich gratuliere ihm nachträglich. Wir lächeln. Und zerkauen mit unseren Kaugummis die Zeit.
Daniel Klaus
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Manon Hopf
wir haben noch den Schwindel einer Reise in den Beinen als wir schon im Feld stehen, aus dem tiefen Wein Erinnerungen ziehen die noch nachts in unsren Hosen halten, wüste Klettenköpfe sind am Schienbein, in den Kniekehlen ein Ziehen, Beugenwollen, wir sind groß geworden auf den Wegen senken wir die Blicke, suchen unsre Erde, unsre Gräser zwischen Kieselsteinen, Schotter, die Augen, die den Händen näher waren, jetzt ein Kopfumblicken sind, ein Sehen ohne Hand und Fuß, die Landschaft einsortierend, Nutzen, Schönheit die ein Nutzen ist der malträtierten Seelen, sie lassen sich scheuchen vom einsilbigen Kirchturmläuten durch die dünnen Gassen wächst ein Holzgeruch, im Ofen liegt die Ruhe einer schwarzen Nacht, die mit uns in dicken Jacken auf der Dachterasse sitzt, sich nach dem weißen Rücken streckt des greisen Mont Ventoux
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Florian Neuner
Visions of Samuel, Teil 1
Beklemmung
Herr Samuel Lichtenbring litt seit einiger Zeit unter entsetzlichen Beklemmungszuständen und war daher nicht mehr Herr seiner selbst. Er konnte es sich nicht versagen, dauernd mit dem Fuß zu wippen, wenn er über einem trockenen Kolleg saß. Was der Mensch sei, war ihm undeutlich, und er hatte verlernt, es wissen zu wollen. In der Regel wollte er um diese Uhrzeit nur noch nach Hause.
Herr Samuel Lichtenbring versuchte es mit Laufen, er war aber bereits außer Atem, wenn er den Feldweg hinter seinem Haus erreichte. Dann setzte er sich ins Gras und seufzte, seufzte noch einmal, seufzte unzählige Male, als sei es eine Beschäftigung. Er saß da, als warte er auf jemanden oder auf Erlösung, er hörte ein paar Krähen, er zog seine Schuhe aus, gähnte, rieb sich die Augen, gähnte wieder, als ob ihn jemand erhören sollte ‒ der liebe Gott oder der Nachbar. Er ging dann nach Hause und duschte, bis die Haut rot war.
Herr Samuel Lichtenbring war kein Träumer. Er sah die Dinge in ihrer Einfachheit, die Dinge waren so, wie sie waren, mein Gott, warum sollten sie anders sein, warum sich Gedanken machen. Bis die nervösen Zustände begannen. Er hielt sich seitdem nachts wach, um algebraische Aufgaben zu lösen, er fütterte seinen Goldfisch, er las lateinische Abhandlungen über die Natur, er versuchte den Gesang der Vögel und die Stimmen der Menschen in Noten zu fassen. Herr Samuel Lichtenbring hatte an die Vollkommenheit seines Lebens geglaubt. Sein Leben war ein Kreis. In dem Kreis war alles. Keiner durfte in den Kreis. Herr Samuel Lichtenbring hätte eher seinem Goldfisch das Sprechen beigebracht ˗ wenn er nicht von der Idiotie dieses Unterfangens überzeugt gewesen wäre ˗ als sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Überzeugt nämlich war er von seinen Fähigkeiten. Bis eines morgens die nervösen Zustände einsetzten. Eigentlich fingen sie nachts an. Er sah nachts einen Film, und die Bilder gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Lesen wäre an sich eine gute Idee gewesen, aber plötzlich konnte er sich für kein Buch mehr entscheiden. So fing es an: dass er sich nicht mehr für ein Buch entscheiden konnte. In einer Kettenreaktion fielen ihm Entscheidungen fortan grundsätzlicher schwerer. Am nächsten Morgen überlegte er sich, ob er den Kaffee nicht ohne Zucker trinken sollte. Er bekam regelrecht Angst vor einer Zuckerkrankheit. Am Nachmittag wippte er bereits das erste Mal mit den Füßen. Das Kolleg sagte ihm gar nichts mehr. Er freute sich nicht mehr auf die Algebra, die lateinischen Abhandlungen, die Vogelstimmen. Das Essen schmeckte nicht mehr. Der Goldfisch schien plötzlich beim Durchziehen des Wasserglases deutliche Geräusche zu machen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen, er hatte einmal in der Bibliothek eine Erektion, nur weil ihn eine Frau angelächelt hatte. Das erste Mal, seitdem er hier arbeitete, erlaubte er sich vor Feierabend an die frische Luft zu gehen, er atmete durch, doch es war zu viel Luft und zu wenig Möglichkeiten. Er hatte auch auf einmal den Wunsch, fliegen zu können, und er kehrte an diesem Tag nicht in die Bibliothek zurück.
-
Lukrez
Mechanisch kaufte er seinerzeit den Band Lukrez. Er war einerseits beeindruckt von dessen Versuch, zu erklären, was die Welt im Innersten zusammenhielt (er erinnerte sich an den Anspruch eines Biolehrers, der sie zu Beginn jedes Schuljahrs mit diesem Faust-Zitat gequält hatte) und das noch dazu fast ausschließlich mit Hilfe der damaligen Naturwissenschaft, die seinerzeit noch enger mit der Philosophie verzahnt war. Andererseits vergötterte er bereits als Oberstufenschüler die lebenspraktische, unironische Lakonie: Erst als Professor allerdings sollte er den Tipp, das Bordell zu besuchen, um sich vor Liebeskummer zu schützen, erst tatsächlich zu schätzen lernen. An irgendeiner Buchhandlung kam er vorbei, ging, von einem unerklärlichen Gefühl geleitet, hinein, erinnerte sich an die Blume und an den Lateinunterricht an der Schule und an einen Nachmittag im Juli, als er mit Gretchen Weiler im Gras saß und sie über die Natur sprachen, ein bisschen auch über Philosophie, das erste und letzte Mal, dass Herr Samuel Lichtenbring mit einer Frau über Philosophie sprach. Im Gras neben ihnJen lag Lukrez. Sie kamen direkt aus der Lateinstunde an diesen Musenort, den er einmal beim Umherschlendern entdeckt hatte. Die kleine Dorfschule, die sie besuchten, lag an einem Bach, worin sie badeten. Den Lukrez, der hier im Gras lag, verlor er irgendwann; gleichsam leistete er also auf eine Art Abbitte, oder vielmehr hatte er das Gefühl, Abbitte zu leisten, als er an diesem Nachmittag, von einer unbestimmten Ahnung geleitet, den Lukrez wieder kaufte. Entflammt steckte er ihn in die Tasche.
Rosenflügel
In seiner Kindheit hatten die Rosen keine Flügel. Dabei war er davon überzeugt, dass sie keinesfalls nur trostlos nach unten fielen. Die Blätter konnten sich auch in die winzigen, kaum wahrnehmbaren Ösen der Luft einhaken. Wie in einer Windhose für Liliputaner schraubten sie sich dann noch oben und fügten sich ins Himmelmosaik ein. Lange sah er ihnen nach, bis seine Augen sonnenfleckig und wolkenmustrig waren. Ikarus fiel ihm dann ein und dass er weiterschreiben musste, wenn es ihm schon nicht gelang, die Vorlesungsmanuskripte fertigzustellen.
Ein Bettler mit einem Strich wie einem Mund, goss diese besonderen Rosen. Waren sie verwunschen? Er wünschte sich dann immer ein Prinz im Märchen zu sein und der andere sein mittelloses Gegenstück. Das erinnerte er noch. Der Bettler hatte kleine Augen, die sich fast in die Höhlen zurück verkrochen. Sonst sprach er nicht viel. Als Gärtner war er von meiner Eltern ganz unvermittelt eingestellt worden. In einer Fußgängerzone sah ihn mein Vater und offerierte ihm einen Job, weil er ihn wohl an einen Schulkameraden erinnerte, der im letzten oder vorletzten Krieg gefallen war. Vielleicht handelte es sich auch nur um einen Bischof, der sich zur Erde neigen wollte, um substanzielle Arbeit zu leisten. Das hatte Samuel vielleicht aber möglicherweise bloß in einem Film gesehen.
Die Zahnbürste
Er steht nach dem Aufschlag der Geschlechter vor dem Waschbecken. Er hat die Zahnbürste vergeblich gesucht. Hierfür hat er den ganzen Rucksack ausgeräumt und ihn wieder eingeräumt, um ihn nur zur Vergewisserung noch einmal auszuräumen. Die Bürste ist nirgends zu finden. In ihrem Hintern entdeckt er die kindliche Kaiserin. Tut diese irgendetwas? Zwinkert sie vielleicht? Es beschäftigt ihn sehr, so sehr, dass er darüber fast die Güte des Ineinandergreifens der Geschlechter vergisst. Ihr macht das tatsächlich ein bisschen Wut. Ihn verwundert das. Sie aber will eben die Güte des Ineinandergreifens nicht relativiert wissen und seine Gedanken an die Zahnbürste lassen sie glauben, dasselbe habe ihm vielleicht nicht gefallen. Warum muss er auch an diese dämliche Zahnbürste denken? Warum kann er die Dinge nicht einfach sein lassen, auf sich beruhen lassen, in sich beruhen lassen, so wie sie eben sind. Woher kommt die Sucht, alles erklären zu wollen? Ja, warum muss er, kaum dass die bei dem Aufschlag verlorene Kontrolle zurückgekehrt ist, diese sofort wieder im Zwischenmenschlichen, in der Kommunikation, in seinem Gehabe installieren? Warum nicht die angenehme Taubheit auf seinem Penis genießen und die Reste des Warmstrahls ihrer Vagina auf der Haut belassen, auf seiner Zunge die Salzigkeit ihrer Klitoris?
Während es ihr kommt, denkt er an das arschkalte Wasser der Ach oder war es die Urspring, so genau weiß er es trotz ihrer mehrfachen Erklärung, welcher Fluss nun welcher ist, nicht, in einen von diesen beiden jedenfalls ist sie nach einem ausgedehnt schnellen Lauf gesprungen. Das erstemal, dass das Gesez der Freiheit sich an uns äußert, erscheint es strafend. Es kam ihr vier Mal. Müssen in der Erinnerung schon wieder vergangen sprechen, der Fluch des Nachträglichen. Nicht hintereinander, sondern immer wieder, während er sie leckte, dann von hinten in sie eindrang, in einer unbeschreiblichen Verrenkung, einem eigentlich unmöglichen Winkel, gerade noch ihren Kitzler zu fassen bekam, was sie in dieser einmaligen Mischung und der unvermittelten Heftigkeit der doppelten Penetration, dem h‘schen Gesetz der Wechselwirkung zwischen Stoff und Geist, nochmal kommen ließ; während sie sich selbst an ihrer Hand rieb, ließ sie der Schreck, dass es ihr wieder kam, nochmal in die Ach springen. Übertritt der Grenzlinie: viermal. Zweimal hin, zweimal zurück. Er erinnerte seine Kindheit, wo er nach dem Seilspringen, im Gebüsch kauernd und lesend, die Kacke zurückhielt, sie fließen ließ, sie wieder zurückhielt. Ich möchte nicht mit dir über deine Zahnbürste reden. Nicht jetzt, sagte sie. Das verletzte ihn. Es war eine, wenn auch von ihm gewollte Auslegung der Sache: Die Auflehnung, die sich in ihrer Weigerung, über den Verlust seiner Zahnbürste zu sprechen, erwies. Er konnte es nicht fassen, dass die Welt sie so wenig anging. Seine Welt, die er doch nur aus Zufall mit ihr und all den anderen Menschen teilte. Manchmal wünschte er sich einen Privatzugang zur Welt, einen eigens für ihn angefertigten Schlüssel, der einzig und allein in die Hintertür passte. Die Hintertür, die vielleicht auch einzig für ihn angefertigt war, sodass der Doppelzugang wie die Penetration, der Ausgang zur Welt für sie, verdoppelt war. Er bedauerte, dass es ihm aufgrund seiner Anatomie nie so heftig kommen würde. Die seidige Taubheit auf seinem Geschlecht, wurde langsam aber sicher auch zum Schmerz. Und die Zahnbürste hatte er immer noch nicht gefunden. So sehr er sich auch anstrengte, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, mischten diese sich immer wieder ein. Er musste wohl heute Nacht ohne seine eigene Zahnbürste leben, notgedrungen eine von ihr nehmen. Warum war ihm das unangenehm?
Florian Neuner
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anna Sophia Merwald
Sie an der Leine
Sie bauen ein Haus, leben sich ein und kleben auseinander, sie vegetieren in vorbildlichen Gärten mit gestriegelten Kindern und verriegelten Türen.
Sie zwingen die Mundwinkel und sie wippen mit dem Kopf, im Takt ihre vollautomatischen Rasenmäher, die nichts machen und auch Lärm.
Sie lugen über ihre tapezierte Hibiskushecke, ihre Perücken Ton in Ton, die Kinder tragen Maulkorb, der Terrier Schnuller, sie selbst eine Leine.
Eigenmächtig mähen sie den Rasen, weil der Roboter tuts doch nicht.
Die Kinder, eins, zwei, sie haben den Überblick verloren, machen ihnen Nudeln in der Mikrowelle kalt.
Eigenmächtig mähen sie den Rasen, weil sie wollen, dass er nicht mehr ist.
Und als er dann nicht mehr ist als geschredderte Erde, schlucken sie in 30 Gramm dosierte kalte Nudeln.
Die Kinder wissen einfach, was ihnen schmeckt, sagt Kind zwei. Oder drei.
Sie haben den Überlick verloren.
Geht in die Arbeit, spielen, sagen sie zu den Kindern, drei, zwei, sie haben die Rollen verloren.
Die Kinder schleudern zur verriegelten Tür und schnellen zurück.
Sie ersticken fast, ziehen sich die Nudeln wieder aus dem Hals, wer soll denn das alles schlucken. Mit bloßer Hand wühlen sie in ihren Hälsen.
Sie suchen nach sinnhaftiger Ordnung, doch ihre Körper sind Hülsen. Sie sind offene Rohre und gestaute Vakua. Sie sind an Überwässerung getrocknete Pfützen.
Die Kinder, eins, vier, sie haben die Fassung gewonnen, reißen die Hibiskushecke von der Wand, trampeln sie zu Boden.
Sie werden gestürzt und laufen aus.
Und später bleiben die Gärten leer und dann ist der Terrier - Leinen los! - an der Leere ertrunken.
Anna Sophia Merwald
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Knaß
In Tagen wie Wahnsinn
in tagen wie wahnsinn liegen die toten am gang, ob ich die toten am gang sehen würde, wer die toten am gang denn seien, wer da schießen würde, wer da denn schießen würde, aber da sind längst keine toten mehr am gang, am gang hängen nur kinderfotos von mir und meinen schwestern und das hochzeitsfoto meiner eltern, am gang frisst die katze, am gang stehen die schuhe und der wlan-router und das telefon, aber da sind keine toten am gang, sage ich zu ihm, ich sage, er habe nur geträumt, das sei nur ein traum, das mit den toten, aber er beharrt darauf, er beharrt auf den toten, nach 100.000 bier und einem hausbau, einer karriere bei der gendarmerie, „herr inspektor!“, nach drei kindern und detaillierten fotografien in geordneten alben und noch akribischerem briefmarkensammeln, nach der produktion von honig, immer mehr honig, nach der beerdigung von seinem einzigen sohn, nach der leitung des ÖKB, nach dem zusammenbauen von puzzlespielen mit mehreren 10.000 teilen, ist da wirklich alles, was bleibt, die toten am gang, die toten am gang, die toten am gang, aber dann schläft er wieder ein und ich falle über alle leichen
in tagen wie wahnsinn zitieren wir gemeinsam mephistos faust „ich bin der geist der stets verneint“, über einem glas bier verneinen wir uns voreinander, sonst dürften wir uns nicht annähern, aber gemeinsam mephisto zitieren ist unser klopstock und später holt er mich mit dem motorrad ab und wir kurven durch die gegend, meine heimat, die ich nicht kennen will, und das plastik an meinen docmartins verschmort und meine füße werden heiß, während er mich hundert mal fragt, was ich von ihm wolle, wie ich mir das vorstelle, dass er mit jemanden wie mir nicht reden könne, dass er mit jemanden wie mir normalerweise gar nicht reden würde, dass ich mit jemanden wie ihm nicht reden dürfte, weiß ich auch, aber er isst schweinsbraten wie mein opa und er ist beim ÖKB wie mein opa und er vertritt ansichten wie mein opa, aber mit ihm kann ich streiten, ihm kann ich alles an den kopf werfen, ich sage ihm, dass es falsch ist, was er denkt, ich sage ihm, dass alles gefährlich ist, was er denkt, ich erkläre und rede und erkläre und rede, damit er endlich aufhören kann, weil „cui bono“ nützt niemanden, ich erkläre und rede und erkläre und rede, damit er endlich aufhört zu denken, ziehe ich mich aus
in tagen wie wahnsinn erzählt mir meine oma vom schafe hüten, von der theatergruppe, die sie in ihrer jugend geleitet hat, von den gelungenen aufführungen und wie schwierig es war, dafür alles zu organisieren, sie erzählt mir, dass sie aber keine jugend gehabt hat, weil die schönsten ihrer jahre waren krieg, und dass sie in die kirche gegangen sei, statt zu den treffen der nazis, dass die dort schon überlegt hätten, was sie mit ihr machen sollen und dass die bdm-führerin aber gemeint hätte „was wollt’s denn mit der? die tut doch keinem was“, dass sie in die kirche gegangen wäre anstelle und gott sei dank anstelle, dass sie schindlers liste gelesen habe, viel später, und dann zitiert sie mir die gedichte, die sie schreibt, weil sie andauernd schreibt, zuerst im kopf und dann schreibt sie die texte auf, das erste gedicht hat sie während des schafe hütens geschrieben, das kann sie auch noch, und früher habe sie mit meinem opa gemeinsam geschrieben, als er noch lustig war, meint sie, damals als er noch lustig war, später erzählt mir mein papa im auto, mehr über das schreiben meiner oma, später im auto will mir mein papa mehr erzählen von seinem früher, aber sein ganzes sprechen schweigen
in tagen wie wahnsinn lüge ich wie gedruckt auf papier, im internet, in umgangssprache, im dialekt, in standarddeutsch oder hochdeutsch, wie man umgangssprachlich sagt, ich umgehe alles, denke, dass ich doch verstehen können muss, entschuldige zu vieles oder sehe darüber hinweg, denke zu oft „ja, aber“, und sage weder das eine noch das andere, weil ich selbst eine einzige leerstelle bin, denn wer bin ich, wenn ich über feuerwehren, über botanikvereine, philatelie, über verkehrsunfälle, bienen, über faschingssitzungen, über die eröffnung von unterführungen und die hegeringschau schreibe und mir ein video anschaue von einem mann, der die geflüchteten gefilmt hat, wie sie durch die stadt gehen, weil „da muss man ja was tun dagegen“, wer bin ich, wenn überall gesagt wird, aber „auslända woll ma keine haben“, und ich nicht mehr dagegen halte, weil ich nicht stark genug bin, weil es mir nur ums eigene überleben geht, wer bin ich, wenn ich in meiner freizeit hannah arendt zitiere und verena stefans häutungen zehnmal lese und für das frauen*volksbegehren aufrufe, und wen macht man aus mir, wenn der einzige kommentar dazu ist „ist eh liab, was du denkst, ist eh liab“, vielleicht bin ich wirklich nur mehr eine liabe hülle, das fräulein, das fräulein redakteurin „a liabes diarndle, was wollt’s denn mit der? die tut eh keinem was“
Julia Knaß
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at