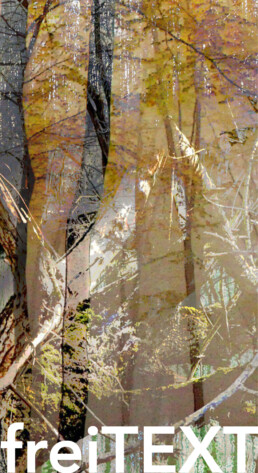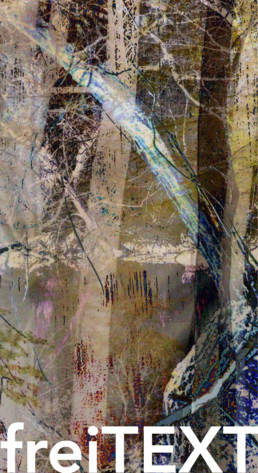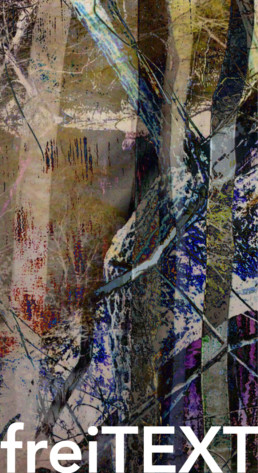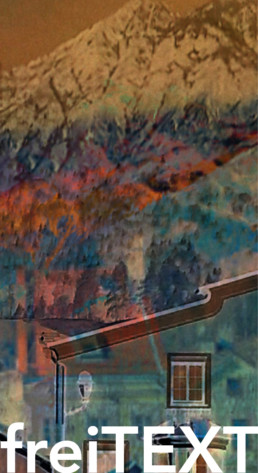freiTEXT | Simon Loidl
Es war nichts
Wir saßen in Blickweite der Bar und warteten auf unser Essen. Wir sprachen kaum, denn wir hatten uns schon den ganzen Tag über unterhalten. Ich beobachtete die anderen Personen in dem Lokal, doch da gab es nicht viel zu sehen. Ein Mann ging an uns vorbei in Richtung des vorderen Teils, wo sich die Bar befand. Er blickte sich um, als wäre er ebenfalls zum ersten Mal hier. Weder vor noch hinter der Bar war jemand zu sehen. Plötzlich blieb der Mann stehen. Er schien etwas auf dem Boden zu betrachten, aber ich konnte nicht sehen, was. Nach ein paar Sekunden bückte er sich und hob etwas auf, das er in die Höhe hielt: eine oder zwei Spaghettinudeln, die offenbar beim Abräumen eines Tellers hier gelandet waren. Ich verstand nicht, weshalb der Mann die Nudeln aufgehoben hatte. Während er seine Hand, in der er immer noch die Speisereste hielt, wieder senkte, näherte sich in seinem Rücken, vom Eingang des Lokals her, eine Frau. Sie ging direkt auf ihn zu. Sie sprach ihn an. Ich hielt den Atem an, gespannt, wie sich der Mann aus der Situation herausmanövrieren würde, mit vom Boden aufgehobenen Nudeln ertappt zu werden. Ich weiß nicht, warum, aber ich war mir sicher, dass er die Nudeln in die Hosentasche stecken würde. Eine andere Möglichkeit sah ich nicht, wenn er nicht erklären wollte, weshalb er mitten in einem Lokal stand und Nudeln in der Hand hatte, die offensichtlich nicht seine waren. Doch der Mann machte weder das eine noch das andere. Er drehte sich um und grüßte die Frau. Dann wandte er sich zur Bar, legte die Nudeln in einen Aschenbecher, nahm diesen und trug ihn durch eine Tür, die hinter der Bar in eine Küche oder einen Abstellraum führte. Mir wurde klar, dass der Mann hier arbeitete. Ich begann wieder normal zu atmen, wandte meinen Blick von der zu Ende gegangenen Szene ab, blickte mein Gegenüber an und hob die Schultern.
„Was ist?“, fragte sie mich.
Ich schüttelte den Kopf.
Es war nichts.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tara Meister
Das Freie
Wir lernen uns kennen an einem Abend, in einer Gasse. Sie steht zwischen zwei Mülltonnen und ich stelle mich dazu, es ist die Rückseite eines kleinen Bio-Ladens mit Café, es hat längst zu, wir sind hier, um Abgelaufenes abzuholen, uns verbindet die dafür entworfene App. Weil ich so etwas noch nie gemacht habe, weil Leute vorbeigehen und uns mustern, schwitzen meine Hände. Ich mustere Marlene, deren Blick in die Ferne gerichtet ist, war der Name tatsächlich Marlene? Sie trägt einen bunten, samtigen Body mit wilden Pflanzen darauf, er ist tief ausgeschnitten, zwischen ihren Brüsten ist der Kopf eines Schlangentattoos zu sehen. Um ihren Hals eine Kette, deren Anhänger in ihrem Ausschnitt verschwindet, als hätte die Schlange ihn gefressen. Marlene ist groß gewachsen, kurvig und war bestimmt schon einmal hier. Alles oder etwas an ihr zieht mich magisch an. Es kommen noch zwei andere und Stefan- der damals mein Freund war- der gar keine Lust darauf hat, das sieht man ihm an. Ich habe es vorgeschlagen, er sagt dann nicht ja und nicht nein, er kommt vorwurfsvoll mit. Während der Ladenbesitzer kommt, während er ein paar Sätze mit uns wechselt, uns mit ins Lager nimmt und dort Papiertüten mit Essen verteilt, sehe ich Stefan an und merke, dass er Marlene, nicht ansieht. Es ärgert mich, ich wünsche mir, dass sie seinen Blick anzieht wie meinen, dass er sieht, was schön ist. Wütend drücke ich ihm weiche braune Bananen in die Hand. Ich bemerke Schweißflecken auf seinem blauen Hemd, das auf einer Seite aus seiner Hose gerutscht ist. In diesem Moment finde ich ihn erbärmlich, ich starre auf Marlenes Haar auf dem Weg nach draußen. Die Tür schließt sich, wir gehen ein paar Schritte weiter zu einer Grünfläche und beginnen dort das Essen zu verteilen. Stefan sieht mit etwas Abstand zu, ich bin innerlich seltsam erschüttert von diesem Abend, Marlene wühlt in den Papiersäcken. Sie wühlt und wühlt als würde sie nach einem Schatz graben. Wie eine Piratin, denke ich, und dass ich gerne wenigstens Steuermann wäre und ich sage Stefan, dass er doch mit dem Moped schon vorausfahren soll, ich würde nachkommen, ich habe keine Lust mehr nachzukommen. Mit vollem Rucksack, einer Flasche Wein in der einen und einer goldenen Dose Sardinen in der anderen Hand geht Marlene los, ich frage in welche Richtung sie muss, ich sage, ich auch, sie wirkt nicht begeistert. Gemeinsam gehen wir ein paar Straßen weiter und dann den Kanal entlang und ich weiß nicht mehr, was ich mir erhofft habe. Marlene bleibt für einen Moment stehen, um die Dose zu öffnen und das Öl abzugießen, dann essen wir im Gehen die Sardinen und spucken die abgebissenen Köpfe in den Fluss, der sie vielleicht raus aus der Stadt trägt. Während wir ein bisschen reden, merke ich schließlich, dass da etwas Dunkles, Unerfülltes ist. Ob mich das angezogen hat, frage ich mich.
„Wie heißt du nochmal?“, frage ich sie.
„Marlene.“
Es ist ein weiter Weg in Marlenes Leben.
Ich war keine Ausnahme, wie alle anderen auch habe ich sie im Laufe der Zeit immer wieder verloren.
Vor drei Jahren, erfahre ich irgendwann, ist sie in Wien angekommen, hat begonnen Psychologie zu studieren, nach einem Semester gemerkt, dass es nicht das Richtige war und einfach weiter gemacht. Immer noch ist das Studium unsichtbar, die Bücher in ihrem Regal sind allesamt Thriller, die Prüfungen schreibt sie von anderen unbemerkt.
Auf allen Fotos und jetzt gerade lacht sie, hält sie mich mit den Augen fest. Sie hat die lauteste Stimme in der WG, aber sie schweigt viel. Ich schlafe mit ihrem Mitbewohner und höre sie spät nachts zur Toilette schlurfen.
Manchmal sehe ich sie tagelang nicht und wenn dann die Türe aufgeht, sind ihre Schritte langsam. Über den Winter ist sie schwerer geworden.
„Wir wollten doch segeln gehen.“
„Heute nicht. Vielleicht morgen, wenn der Wind geht.“
Oft steht sie unruhig im Raum. Wolken, die sie nervös machen, fettige Pfannen wütend, aber kein Schwamm und keine Kerze machen die Wohnung zu einem Ort, an dem sie sein möchte. Wochenlang ist sie hungrig und still.
Aber jetzt ist Frühling und morgen, wenn der Wind geht, nimmt sie mich mit an die Donau, auf das Segelboot.
Ich gehe schlafen, sie sitzt noch länger dort am Tisch. Morgen, denke ich und in meinen Ohren rauscht es.
Am nächsten Tag erzählt sie, dass sie spät nachts ein Geräusch gehört hat, zwischen zwei und drei Uhr, sie war lang wach und ist spät aufgestanden. Es hätte jemand etwas Großes aus dem Fenster geworfen. Und dass sie sich heute doch nicht nach Segeln fühlt.
Mit einer Einkaufstasche verlasse ich das Haus, da liegt vor mir auf dem Gehsteig in einer glitzernden Lache ein toter Fisch.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jasmina Cavkunovic
orpheus
Unter lauten Regentropfen hatte ich geschworen, dich zu vergessen – der Fairness halber, wie man sagt. Doch auf dem Weg zum Kino sah ich deine Straße wie ein flüchtiges Panorama aus dem U-Bahn-Fenster, und vergaß, was ich vergessen sollte.
Ich denke zurück an kalte Jännertage, wo ich mein Handy nach der Arbeit an mein Herz hielt, als ich deine Nachricht auf dem Bildschirm sah. Auf dem Weg zur Straßenbahn fühlte ich mich wie ein kleines Kind an seinem ersten Schultag – aufgeregt, das Gerät wie eine Schultüte fest umklammernd, als liefe es davon, wenn ich es nicht täte. Erbittert waren noch Monate später die Kämpfe mit der Schwerkraft, wenn ich meinen Daumen über dem Anrufsymbol neben deinem Namen schweben ließ, und obgleich ich sämtliche Schlachten gewann, glänzte ich auf einer jeden Siegesfeier durch Abwesenheit. Heute spüre ich die rechteckige Form meines Handys durch die Manteltasche an meinem Oberschenkel, während meine rechte Hand die linke hält. Die Beschriftung des Massagestudios in deiner Straße verläuft sich unterdessen in der wachsenden Distanz.
Weichgezeichnet waren wir, und weichgezeichnet haben wir die Linien, die unseren Zufluchtsort markierten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es unseren Ort noch gibt, doch manchmal stolpere ich heute noch über Drahtseile, die ebendort am Boden liegen, wo du mich zum letzten Mal gehalten hast. Und du, versuchst du je das Gefühl von meiner Hand in deiner zu übertünchen, als wäre es Parfüm auf verschwitzter Haut? Sitzt du je auf deinem Dach und denkst über den Anfang unseres neu begonnenen Endes nach? Ist der Himmel je wieder so rosarot gewesen wie an jenem Montagabend im September? Langsam kehrt der Winter ein, es ist vermutlich besser so.
Schändlich mein Gedanke, unsere Karte sei interessanter gewesen als unser Gebiet. Absurd die Idee, unter der babyblauen Decke, die du mochtest, unser Wunderland nachzubilden, mit Serotonin-Modellen aus Kunststoff. Wenn ich in Träumen nach dir greife, bleibt mir nichts als Ruß auf meinen Händen; und wenn ich wach bin, spüre ich deinen Schatten an meinen Füßen – du hast ihn drangenäht, ehe du verschwandest. Ein bisschen Dunkelheit habe ich aus dem Hades mitgenommen, sie ist mein heiligster Besitz, habe ich festgestellt, und zugleich meine größte Last.
Du bist ein Blutfleck, eine Zäsur in meiner Geschichte. Deine Straße ruft noch immer meinen Namen, hörst du’s auch? Ich habe mich umgedreht, ich hab’ mich umdrehen müssen, einmal mehr. Ich werfe meine hundert Ehrenworte über Bord, unfähig zu vernehmen, wohin sie treiben.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Norbert Schäfer
Siebrecht
Gemessenen Schrittes begab er sich zum Komposthaufen und ließ einen Armvoll Efeuzweige und Blätter fallen, die sich gleichmäßig über die Schichten von feuchten Gras- und Moosresten, trockenen Blütenblättern und Zweigen verteilten. Das meiste blieb oben liegen, nur wenige Zweige rutschten seitlich hinab. Die Blütenstände waren ausgebildet, aber über die Beeren hatten sich schon die Drosseln und Amseln hergemacht. Efeu war so eine vitale Pflanze! Man kam mit dem Nachschneiden kaum hinterher. Und giftig obendrein. Nie bearbeitete er die Efeuhecke ohne seinen Mundschutz. Margarete kannte sich gut in diesen Dingen aus und hatte ihn von Anfang an auf die gesundheitlichen Gefahren hingewiesen.
Die Sonne meinte es gut heute – sie wärmte ungewöhnlich stark für einen April-Nachmittag. Siebrecht schwitzte ein wenig in seiner Gartenkluft. An seinem linken Hosenbein der kastanienbraunen Cordhose waren Spuren von Gartenerde zu erkennen. Er durfte nicht vergessen, sie abzubürsten, bevor er das Haus betrat. In dem kleinen Garten des Endreihenhauses in Köln-Müngersdorf fühlte er sich wohl. Und geschützt. Er trug derbe Arbeitshandschuhe über den langen Ärmeln seines schon ausgeblichenen karierten Holzfällerhemds. Die Stoffkappe mit dem Aufdruck des Blumenladens „FloraFit“ schützte seine Augen vor der Sonne. Nun, zumindest die Schutzmaske würde er jetzt ablegen können. Ruhig streifte er die Handschuhe ab, bevor er die Haltebänder der Maske hinter den Ohren löste. Er faltete den Stoff sauber und legte ihn auf die Bank.
Er vermisste sie.
Gegen die Sonne blinzelnd richtete Siebrecht einen letzten, kritischen Blick auf die Hecke. Einen etwa eine Handbreit heraus ragenden Zweig hatte er übersehen. Das hätte Margarete sicher nicht gefallen. Nein, das konnte er so nicht lassen. Bedächtig legte er den Mundschutz an, zog die Handschuhe über und machte dem widerspenstigen Spross den Garaus.
Unter dem Rhododendron hatte sich verrottendes Laub angesammelt. Den würde er nachher entfernen. Natürlich könnte er es auch sofort angehen. Das wäre kein Problem. Aber seine innere Uhr war im Laufe der Jahrzehnte präzise geworden. Er hatte ein untrügliches Gespür dafür, dass es Kaffeezeit war. Jetzt sollte der Duft von frischem Kaffee aus der offenen Terrassentür strömen. Wie freute er sich dann immer auf den Kuchen. Natürlich behielt er die liebgewordenen Rituale bei. Den Bienenstich hatte er schon am Vormittag beim Bäcker gekauft, und den Kaffee würde er jetzt selbst aufsetzen. Eine komplette Kanne – Siebrecht brachte es nicht übers Herz, nur eine halbe zu kochen. Lieber schüttete er den Rest weg. Er schlüpfte in die grauen Filzpantoffeln. Sie waren ein Geburtstagsgeschenk von Margarete und schonten den Fußboden. Sie war so praktisch veranlagt.
Langsam an einem Stück Bienenstich kauend dachte er über das kommende Osterwochenende nach. Die sonntägliche Ostermesse im Kölner Dom war für Margarete immer das Erlebnis des Jahres gewesen. Das prachtvolle Bauwerk, die vielen Menschen, die klare und schon wärmende Frühlingsluft und vor allem die andächtige, festliche Stimmung...
Siebrecht hatte sich dazu immer in seinen besten Anzug geworfen. Er machte sich eigentlich nicht sehr viel aus Religion, aber Margarete hatte ihm stets verdeutlicht, wie wichtig christliche Traditionen waren.
Ein junges Paar blickte ihn von dem Hochzeitsfoto auf dem Sekretär an. Wie weich Margaretes Züge darauf noch waren. Der Silberrahmen wies im Licht der durch die Terrassentür fallenden Sonnenstrahlen einen leichten Staubbelag auf. Staubwischen war immer seine Domäne gewesen – er würde sich heute Abend darum kümmern. Jetzt war erst einmal der Rhododendron dran. Siebrecht erhob sich ächzend und zog sich die Handschuhe über.
Der Boden unter dem Rhododendron war wieder schier. Mit beiden Armen griff Siebrecht sich einen Stoß Laub, den er auf dem Rasen zusammengeharkt hatte. Er mochte das Rascheln, wenn sich die trockenen Blätter über den Komposthaufen verteilten. Die Asseln und kleinen Spinnen, die hektisch das Weite suchten, störten ihn nicht. Er hatte ein Herz für Tiere, wenngleich sie sich aufgrund Margaretes Katzenhaarallergie nie eins angeschafft hatten. Hunde – tollpatschige, schmutzige Biester! – kamen für sie ohnehin nicht in Frage.
Mit dem rotkarierten Stoff-Taschentuch wischte er sich den brennenden Schweiß aus den Augen. Sein Blick fiel auf die Lücke zwischen dem Rhododendron und dem Flieder. Über den Zaun konnte er am Nachbarhaus vorbei einen Zipfel des Müngersdorfer Stadions erhaschen. Oder es mochte mittlerweile auch einen anderen Namen tragen. So ganz verstanden hatte er den Grund für diese Namensänderungen nie. Musste wohl Geld im Spiel sein.
Dort spielte am Wochenende häufig der EffZeh. Erste oder zweite Bundesliga – so genau wusste Siebrecht das nicht mehr. Die stiegen dauernd auf und ab. Früher, als Kind, hatte er oft und gerne gekickt. Er war nicht der schnellste, aber ein ganz passabler Verteidiger, wie er fand. Und Spaß hatte es gemacht, wenn ihn die anderen mitspielen ließen, was manchmal vorkam. Insbesondere wenn sie nur wenige waren.
Hin und wieder hatte er mit der Idee geliebäugelt, sich ein Spiel des Clubs im Stadion anzuschauen. Aber Margarete hatte ihn glücklicherweise rechtzeitig davon abgehalten. Letztlich wäre es eine reine Geldverschwendung gewesen. Solche Veranstaltungen waren laut, kulturlos und es wurde viel getrunken und gegrölt. Und es gab Prügeleien. So ein Stadionbesuch hätte letztendlich nur Scherereien gebracht – da hatte sie völlig Recht.
»Tag, Häär Siebräächt. Schön Wedder hugg.«
Zwischen dem Goldregen und dem Hibiskus zeigte sich die Gestalt der Nachbarin. Gisela Niewöhr – eine verwitwete Mittfünfzigerin. Mit gesenktem Blick inspizierte Siebrecht seine Fußspitzen. »Tag.«
»Wie gonn et Ehr Frau? Isse verreist?«
Er hob ein wenig die Lider und blickte verstohlen zu ihr herüber. Ihr Lächeln – ein wenig künstlich, wie er fand – wurde umrahmt von einem goldblonden, halblangen Pagenschnitt.
Die Haare waren natürlich gefärbt. Darauf hatte ihn Margarete schon vor Jahren hingewiesen. Nur Flittchen würden ihre Haare färben. Und dann auch noch als Witwe. Mit derlei Volk sollten und wollten sie keinerlei Umgang pflegen.
»Is auf Kur.« Eigentlich sah sie ja ganz freundlich aus, stellte er nach einem weiteren, vorsichtigen Blick fest. Aber das traf vermutlich für einige Frauen ihres Schlages zu.
»Ach, Se ärme Höösch. Da sin Se jaanz allein! Kann ich Ehr e bessche zor Hand gonn beim Huushald? Maache ich gään.«
Sie trug weder eine Arbeitskleidung noch eine Schürze, stattdessen ein gepunktetes blaues Kleid. Er fand, es stand ihr gut.
»Ich kütt zooräch.«
Margarete hatte ihr Haar nie gefärbt. Früher schimmerte es in seidigem Brünett. Später wurde es von ersten grauen Strähnen durchzogen, die dann langsam die Oberhand gewannen. In den letzten Jahren krönte ein akribisch gepflegter Dutt die mittlerweile grau gewordene Mähne.
»Wie Se wolle. Se künn gään hingerdren op e Liköörsche vörbeikünn. Schön Tag noch!«
Gisela Niewöhr zog sich wieder in ihre Wohnung zurück. Siebrecht atmete tief aus. Es fiel ihm ohne Margarete schwer, den nötigen Abstand zu aufdringlichen Nachbarn zu wahren. Ganz besonders zu Gisela, wie er die Witwe in Gedanken nannte. Obwohl... es könnte vielleicht ganz nett sein, sich bei einem Gläschen zu unterhalten. Wenn sie Limonade angeboten hätte... Siebrecht trank keinen Alkohol.
Nachdenklich stützte er sich auf seine Harke. In zehn Minuten würde ein Konzert des Wiener Symphonie-Orchesters im Fernsehen übertragen werden. Margarete liebte diese Sendungen. Und manche waren auch wirklich schön – das musste Siebrecht zugeben. Aber ohne sie wäre es nicht das Gleiche. Er beschloss, sich das Konzert nicht anzuhören.
Natürlich konnte er auch mal wieder die Eckkneipe „Zum Geißbock“ aufsuchen. Samstags wurden die Spiele live übertragen – man musste nicht ins Stadion gehen. Er war nur einmal da gewesen, als Margarete zu ihrer kranken Schwester gefahren war. Der Laden war gut besucht, aber nicht übervoll gewesen. Die Leute hatten schon etwas komisch geguckt, als er sich nur ein Wasser bestellt hatte. Aber außer ein paar gemurmelten, spöttischen Bemerkungen ließ man ihn unbehelligt. Margarete konnte ihm so einiges von Menschen erzählen, die sich buchstäblich um den Verstand, wenn nicht sogar um ihr Leben „gesoffen“ hatten, wie sie es nannte. Auch ihr verstorbener Onkel Herbert, den er persönlich nur dreimal gesehen hatte – bei der Hochzeit und zwei Geburtstagen, wenn er sich recht entsann – zählte dazu. Einzig und allein eine Flasche Kirschlikör, als Medizin zur Linderung ihrer überreizten Nerven, war erlaubt. Die Ärmste litt an manchen Tagen so sehr, dass ein Glas oft nicht ausreichte. Siebrecht wischte sich eine Träne aus dem Winkel seines rechten Auges. Glücklicherweise hatte er sich immer einer robusten Gesundheit erfreut.
Als er einen weiteren Schwung trockenen Laubs über den Komposthaufen leerte, bemerkte er es. Aus der untersten Schicht mit dem gemähten Gras ragte etwas hervor. Wie ein toter Ast. Mit fünf kurzen, dicklichen Zweigen.
Der Arm wirkte eingetrocknet, die Haut mittlerweile grau. Er versuchte, den goldenen Ring zu ignorieren, der noch an einem Finger steckte. Nie hätte er es gewagt, ihn abzuziehen. Nun... er hatte es versucht – aber der Finger war zu fleischig, er wirkte wie im Laufe der Ehe um den Ring weitergewachsen. Unauffällig blickte er um sich, aber von den Nachbarn war niemand zu sehen, und Gisela dürfte sich mit ihrem “Liköörsche“ trösten. Mit dem Außenrist seines rechten Schuhs versuchte er, die Extremität wieder unter die Grasklumpen zu drücken. Der Arm war schon sehr steif und rutschte immer wieder zurück. Siebrecht drückte und trat immer heftiger. Mittlerweile bearbeitete er ihn mit der Schuhspitze wie einen Fußball.
Es nützte nichts – wie zum Gruß schnellte der Arm immer wieder zurück.
Siebrecht seufzte. Das würde bestimmt Scherereien geben.
Schweren Schrittes begab er sich zur Kellertreppe, um die Säge zu holen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Luca Bognanni
Der Bobbel
42 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten. So lange saßen sie jetzt hier. Sie wussten das, weil die Stoppuhr immer noch lief. Sie hatten sie zu Beginn gestartet und seitdem ratterten die Ziffern ununterbrochen um die Wette, die Zahlen jagten einander ohne sich einzuholen, ohne Rast, konstant und zuverlässig zogen sie vorüber. Immer wenn nach 24 Stunden das Rennen von vorn begann, ritzte einer der Beiden mit dem Armbanddorn einen Strich ins Holz und so wussten sie eben, dass es 42 Tage, 12 Stunden und bald 22 Minuten waren, die sie mit den Augen die Digitalanzeige der Stoppuhr fixierten und hin und wieder einen Strich in die Wand kratzten. Sie hatten sich mit der Situation arrangiert. Eingerichtet, hatten sie sich, so sehr wie man es sich in einem Kleiderschrank eben einrichten konnte. Immerhin zwei klapprige Campingstühle hatten Platz gefunden und auf denen hockten sie jetzt und schwiegen sich an, denn sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Der Eine von ihnen verzog hin und wieder das Gesicht, er runzelte dann die Stirn, blinzelte mit den Augen, und schob die Brauen so gewaltsam zusammen, dass die Furchen auf der Stirn kleine Rettungsgassen bildeten. Die Andere stützte dagegen die Ellenbogen auf den Knien ab, krümmte den Rücken und vergrub das Gesicht in die aufgefächerten Hände. Sie taten das immer, wenn er durchs Treppenhaus polterte. Schwer und unbeholfen. Jeder Schritt war eine Detonation. Der Schrank begann dann zu zittern, das Holz pulsierte, Staub wirbelte durch die Luft. Mit jedem Tag wurden die Schritte derber, die Schwingungen gewaltiger, die Beben häufiger. Das ganze Haus wippte mittlerweile, wenn der Bobbel auf die Stufen stampfte.
Der Bobbel hatte sich eingeschlichen. Heimlich und harmlos. Am Anfang hatten sie es gar nicht so recht mitbekommen. Irgendwann war er eben da gewesen. Der Eine war sich sicher, dass die Andere ihn angeschleppt hatte, aber wann genau, dass konnte er beim besten Willen auch nicht mehr sagen. Irgendwann war er halt da, der Bobbel. Da hatte sie ihm gesagt, er solle den Bobbel doch bitte mal aufheben und dabei hatte sie auf den kleinen kugelförmigen Teigklumpen, der von der Arbeitsfläche auf die Fliesen gefallen war, gezeigt. Und er hatte den Bobbel aufgehoben und jetzt verfluchte er diesen Tag. Der Bobbel hatte sich schnell nicht mehr nur auf Teig beschränkt. Er war übergesprungen auf andere Dinge. Einmal da, konnte er vieles sein. Ein Wollknäuel, eine Bodenwelle, ein Tennisball. Alles Rundliche wurde fortan Bobbel genannt. Erst von der Anderen, etwas später von dem Einen. Frikadellen, Bäuche, Keksdosen – alles Bobbel. Irgendwann, als bereits Gebäckstücke, Küchengeräte und Gymnastikbälle zum Bobbel geworden waren, hatten sie es gemerkt. Da hatte die Andere zu dem Einen an einem Montagabend als sie in der Küche standen gesagt, sie habe es vergessen den Bobbel an die Straße zu stellen und mit Bobbel meinte sie den Müllsack und da hatten sie sich kurz in die Augen geschaut und mussten beide herzlich lachen, denn den Müllsack hatte bisher nun wirklich niemand Bobbel genannt. Und jetzt konnte plötzlich alles ein Bobbel sein. Schuhe, Kerzen, Steuererklärungen, Bademeister, Frischhaltefolie. Alles Bobbel. Wenn Gäste bei ihnen zu Besuch waren, kam es nicht selten vor, dass sie kein Wort verstanden. Zu weit erstreckte sich der Bedeutungshorizont des Wortes mittlerweile. Zwischen Sonnenschirm und Chicken Nuggets, konnte alles ein Bobbel sein. Der Eine und die Andere hatten dagegen längst gefallen am Bobbel gefunden. Sie schauten sich dann verschwörerisch an, wenn um sie herum alles rätselte, ob mit Bobbel jetzt gerade der Salzstreuer oder der Buchsbaum im Nachbarsgarten gemeint war. Der Eine und die Andere dagegen wussten immer was gemeint war. Sie achteten darauf ob die Augen beim Sprechen zusammengekniffen waren, ob sich die Lippen zu einem langgezogenen Oval formten, ob ein Akzent auf den ersten Vokal gesetzt wurde, ob die zweite Silbe verschluckt oder das „l“ sich, beinahe französisch, wie ein Kaugummi in die Länge zog. Der Bobbel konnte sich für sie ganz unterschiedlich anhören. Mal war er eher ein „Bòbbel“, mal fast schon ein „Bobbèl“, manchmal ein „Bobelle“ und nicht selten auch ein „Bobbl“. Der Eine und die Andere verstanden immer was verlangt war, wenn vom Bäcker ein Bobbel mitgebracht werden sollte. Auch jetzt, wo sie seit 42 Tagen, 12 Stunden und fast 25 Minuten im Schrank festsaßen, wussten sie: Es war die beste Zeit ihres Lebens.
Problematisch war es geworden als sich der Bobbel nicht mehr nur auf Nomen beschränkte, sondern sich auch nach und nach Verben und Adjektive zu eigen machte. Sätze wie „was bobbelst du hier rum?“, „ich dachte heute Abend bobbeln wir mal wieder“ oder „du wolltest doch den gebobbelten Bobbel anziehen?“ vermehrten sich exponentiell. Längst nannten die Andere und der Eine sich gegenseitig nicht mehr beim Namen, sondern sprachen auch in Anwesenheit anderer von ihrem Bobbel. Die ersten Missverständnisse entstanden schnell. Da hatte der Eine der Anderen statt eines Pfunds Mehl einen Staubsaugroboter aus der Stadt mitgebracht und da hatten sie beide noch gelacht, aber es war nicht dieses Lachen wie damals beim Müllsack, es war ein angespanntes Aufgrunzen, weil die Andere mit dem Staubsaugroboter ja jetzt keinen Bobbel backen konnte. Und es wurde immer schwieriger über die Missverständnisse hinwegzusehen, denn die Massagestühle, Mikrowellen und Thermodecken, die statt der gemeinten Marmeladen, Sparschäler und Deo-Roller angeschafft wurden, stapelten sich bereits. Einmal war die Andere für eine Woche verschwunden, nachdem der Eine sie gefragt hatte, ob sie sich am Bobbel träfen, weil sie schon so lang nicht mehr da gebobbelt hätten und dann war sie aber nicht in der Schlange ihrer Lieblingseisdiele aufgetaucht, sondern zu dem Ferienhaus an der Nordsee gefahren und hatte sich gewundert, warum er denn nicht da einträfe. Das war der Punkt, an dem sie gemerkt hatten, dass hier irgendwas schieflief. Dass der Bobbel sich viel zu breit gemacht hatte in ihrem Haus, ihrer Garage, ihrem Leben. Dass man ihn jetzt mal rausschmeißen müsse wie damals den Müllsack. Und so hatten sie sich zusammengesetzt, um eben diesen Rauswurf zu besprechen und als sie da saßen merkten sie plötzlich das ganze Ausmaß des Unheils. Dass sie den Bobbel gar nicht mehr rauswerfen konnten, weil er schon viel zu groß und breit geworden war. Und das war ja auch kein Wunder, denn sie hatten ihn gefüttert mit allem möglichen. Erst jetzt bemerkten sie, dass der Bobbel mit ihnen am Tisch saß und er lachte über sie, weil es ihnen so lange gar nicht aufgefallen war. Und jetzt wurde ihnen bewusst, dass sie gar nicht mehr miteinander sprechen konnten, weil ihr Wortschatz nur noch das Wort Bobbel kannte. Und so übernahm fortan der Bobbel das Sagen im Haus und sie das Schweigen. Und eines Tages, nachdem der Eine gerade vom Joggen nach Hause gekommen war, teilte ihnen der Bobbel mit, dass sie jetzt leider beide in den Kleiderschrank ziehen müssten, weil der Bobbel gewachsen sei und noch mehr Raum benötige. Und das war vor 42 Tagen, 12 Stunden und gleich 29 Minuten gewesen. Und alles was sie hatten war eben jetzt noch diese Stoppuhr, die der Eine noch vom Joggen umhatte, und obwohl das Leben jetzt doch sehr eingeschränkt für den Einen und die Andere in diesem sehr engen Kleiderschrank war, tat es irgendwie gut auf die Digitalanzeige zu schauen, auf die Zahlen, die sich gegenseitig verfolgten, denn sie waren eben Zahlen und keine Wörter und kein Bobbel und das waren die schönsten Momente bis die Schrankwand wieder anfing zu zittern.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Saskia Raupp
Halstuchspiele in Kakanien
„Tut’s noch weh?“, fragte Dolores mit sanfter Stimme.
In Bademänteln rauchten sie auf der Sonnenterrasse der Ski-Hütte die ersten Zigaretten des Tages. Robert wusste nicht, ob sie sich über ihn lustig machte. Bislang hatten sie keine zehn Worte gewechselt. Deine Anwesenheit lässt mich alle Schmerzen vergessen, wäre wahr und gelogen zugleich gewesen, fand er als Antwort aber indiskutabel ‑ viel zu kitschig. So stellte er sich Dialoge in Bestsellern vor, die er nicht las. Als Controller im Headquarter der Versicherung blieb ihm nur in den Ferien Zeit zum Lesen und dann verlangten seine Ansprüche nach etwas Gehaltvollem.
Gestern war ihre Reisegruppe im Kleinwalsertal eingetroffen. Und keine halbe Stunde nach ihrer Ankunft hatte Robert sich den Knöchel verstaucht. Die anderen hingen jetzt gewiss mit roten Gesichtern im Schlepplift oder kippten den ersten Jagertee. Er hätte daheimbleiben sollen.
Sein Schweigen wurde langsam peinlich.
„Glück im Unglück“, hörte Robert sich sagen. „Auf der steilen Treppe hätte ich mir auch den Hals brechen können.“
Er bereute diesen Nachsatz sofort und zog - ohne groß darüber nachzudenken - den Knoten am Gurt seines Bademantels fester. Bei ihrem Beruf musste sie ihn zwangsläufig für ein Weichei halten. Also, falls es stimmte, was man über sie munkelte.
Umringt von den Bergmassiven der Allgäuer Alpen und unter schlumpfeis-blauem Himmel fühlte Robert sich noch bedeutungsloser als sonst. Sofern das überhaupt möglich war.
„Der Berg da drüben“, er zielte mit seiner Kippe auf einen der Gipfel, „der mit dem Buckel, heißt Großer Widderstein.“
Dolores kräuselte die Lippen.
Er versuchte, nicht daran zu denken, was sie tat, jeden Tag tat – und dass sie ihn deshalb so ansah. Er faselte weiter, stotterte: „M-Mein St-Sternzeichen.“
„Witzig, meins auch!“
„Mein Geburtstag ist am 22. März.“
„Nein! Meiner auch!“
„1996!“
„1969!“
Ihr Lachen steckte an. Es rollte aus dem Bauch, schüttelte den ganzen Körper und löste die Klümpchen, die er innerlich angesetzt hatte. Aus Angst, Scham, oder mangelnder Rührung. Emotionale Emulsion, dachte er und, dass sie seine Mutter sein könnte.
„Zweiundzwanzig“, sagte Dolores. „Eine Zahl, die aussieht wie verliebte Schwäne.“
„Ich mag Schwäne“, sagte Robert augenblicklich.
Das war die Wahrheit. Er hätte aber auch Schweine gemocht, wenn es half, den Zauber des Augenblicks zu verlängern.
„Jeder mag Schwäne. Diese komischen Vögel sind rein, elegant, monogam …“
„Und gemein, wenn es darauf ankommt. Schon mal gesehen, wie ein Schwan sein Nest verteidigt?“
Sie löschte ihre Zigarette im Schnee und grinste.
Endlich. Ihre Kopfbewegung in Richtung Esszimmer interpretierte Robert nicht nur als Aufforderung zum Frühstück. Ob er mit ihr etwa …
Eine Stunde später saß Robert in einem Ledersessel vor dem Kamin und las weiter im Mann ohne Eigenschaften, das er im letzten Sommer begonnen hatte. Ihm gefielen Skepsis und Ironie der Untergangsstimmung, auch wenn er nur schleppend vorankam. Als Dolores aus der Sonnenbank zurückkehrte und sich ihm gegenüber mit einem Buch niederließ, glühte ihr Gesicht. Sie lagerte ihre Füße neben seinen auf einem Hocker, der an einen Melkschemel erinnerte. Roberts rechter Knöchel, dick mit Schmerzsalbe beschmiert, war in einen Drei-Meter-Verband aus dem Erste-Hilfe-Kasten gewickelt, ihre Füße steckten in Plüschpantoffeln mit Krokodilgesichtern. Sonst stießen ihn derlei Spielereien ab, aber hier oben vor dem Feuer gefiel ihm der Glaube ans Fressen-und-gefressen-werden.
À la recherche du temps perdu wickelte Dolores ihre Ringellocken um den kleinen Finger, zog sie lang bis zu den Schultern und ließ sie wieder nach oben schnellen, wo sie dank natürlicher Sprungkraft oder Dauerwelle an den Ohrläppchen endeten. Robert schielte immer wieder zu ihr hinüber. Sein Blick folgte der zarten Linie, die ihr langer schlanker Hals vom Unterkiefer über den Kehlkopf bis zum Schlüsselbein zeichnete. Wenn eine Passage gefiel, wippten die Krokodile.
„Du magst Hälse.“
„Wie bitte?“ Robert blickte aus seinem Buch auf.
Sie taxierte ihn mit unverhohlener Neugier.
„Du magst Hälse“, wiederholte sie. „Jetzt habe ich das geschnallt. Schon mal Atemkontrolle ausprobiert?“
„Nein! Wie kommst du darauf?“
„Dein Halstuch. Hätte ja sein können, dass du gern damit spielst.“
„Das ist von meiner Schwester.“
„Ach so“, sagte sie, als wäre damit alles geklärt. „Und ich war früher Physiotherapeutin.“
Robert verstand überhaupt nichts mehr. Wie kam diese Person dazu, sich über ihn lustig zu machen? Gerade jetzt, wo er dabei war, sie … Ja, was eigentlich? Ihn fröstelte.
Atemkontrolle. Woher wusste sie das? Er wollte weiterlesen, nach tagheller Mystik suchen, aber die Buchstaben tanzten vor seinen Augen aus der Reihe. Ihm schien, als wartete Dolores auf irgendetwas. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, worauf. Schließlich fragte er: „Warum bist du mitgekommen, wenn du dir aus Wintersport gar nichts machst?“
„Frieren ist meine Kernkompetenz. Mein Job ist wie ein ewigwährender Wintersport.“
Prompt sah er sie vor seinem geistigen Auge in Latexkleidern. Reflexartig kniff er die Augen zusammen und schüttelte den Kopf. Das Ganze dauerte keine Zehntelsekunde, Dolores merkte es trotzdem. Halb belustigt, halb entschuldigend fügte sie hinzu: „Wo, wenn nicht in Eis und Schnee, kann ich mich wärmen und gehen lassen?“
„Ist das denn anstrengend?“
„Das Bisschen Auspeitschen und Stiefel-Lecken-Lassen?“ Plötzlich war sie die Eingeschnappte. „Natürlich, ist das anstrengend! Viel Verantwortung. Deine Schwester sollte es sich gut überlegen, bevor sie diesen Weg einschlägt.“
„Meine Schwester ist tot.“
„…“
„Konntest du ja nicht wissen.“
Sie schwiegen lange.
„Komm, gehen wir in die Sauna“, sagte Dolores endlich.
„Mit dem Verband?“
„Stimmt. Der sitzt zu stramm.“ Sie begann ihn zu lösen. Als er zuckte, sagte sie: „Physiotherapeutin, schon vergessen?“, und tastete seinen Knöchel ab. Aus der Nähe offenbarte ihr Gesicht die Spuren der Zeit. Lachfältchen überwogen, laut Roberts Theorie, ein Indiz für Leute, die ein selbstbestimmtes Leben führten. Je länger Dolores an seinem Bein herumfummelte, desto tiefer furchten Sorgenfalten ihre Stirn. „Das sollte sich besser ein Arzt ansehen.“
„Morgen“, sagte er entschieden. „Heute komme ich sowieso nicht mehr dran. Mich interessiert, was du vorhin mit Atemkontrolle meintest. Wie funktioniert das?“
Auf dem Weg zur Sauna beschrieb sie die rauschhaften Gefühle beim Erwachen aus der Ohnmacht. Robert erfuhr, dass Würgespiele zur Steigerung der Lust schon vor über hundert Jahren in Südfrankreich verbreitet gewesen waren und dass der Autor Jean Gino sie in einem seiner Romane beschrieben hatte.
In der Umkleide streiften sie das Thema Sicherheitsmaßnahmen.
„Leidest du oder jemand aus deiner Familie unter Asthma?“
Sie öffnete ihren Bademantel.
„Nein, nicht das ich wüsste.“
„Panikattacken?“ Ihre Brüste zeigten noch nach oben.
„Auch nicht.“ Robert schwitzte. „In wie viel Prozent aller Fälle geht das denn schief? Mit Notarzt und so?“
Die Antwort klang wie ein Witz. Jedenfalls im Vergleich zu seiner Schadenkostenquote. Was hemmte ihn eigentlich den Bademantel und Halstuch auszuziehen?
„Wirklich gefährlich ist nur die Selbststrangulation. In meinem Studio arbeite ich mit unterschiedlichen Materialien. Gasmasken, Korsetts und so. Man kann aber auch einfach Alltagsgegenstände benutzen wie diesen Bademantelgurt hier.“
Höchste Zeit in die Sauna zu gehen! Neben der Schwalldusche stand ein Korb mit Handtüchern. Sollte er sich bedecken? Lachte sie ihn dann wieder aus? Er stellte sich ihre Ringellöckchen bei hoher Luftfeuchtigkeit vor.
Schon drückte Dolores ihn sanft gegen die Sauna-Tür.
„Du kannst es so wickeln, oder so …“ Sie demonstrierte verschiedene Spielarten. „Das sind natürlich nur Trockenübungen“, endete sie. „Aber, wenn du willst …“
Robert überlegte. „Lass mich mal.“
Der Bademantelgurt hing ihm wie ein Schlange um den Hals. Er griff mit beiden Händen nach den Enden, schüttelte den Kopf, löste stattdessen sein Halstuch und bevor sie Nein sagen konnte, hatte er es um ihren Schwanenhals geschlungen. Schön stramm, wie damals.
„Robert“, flüsterte Dolores mit weitaufgerissenen Augen. Dann sagte sie nichts mehr.
Als die Domina zu Boden sank, fing Robert sie auf. Er trug sie in die Sauna, bettete sie auf eine der oberen Bänke, holte zwei Handtücher, rollte sie auf und schob sie ihr in den Nacken und unter die Knie. Dann setzt er sich auf die untere Ebene und betrachtete sie von den Zehen bis zur Stirn. Sie gefiel ihm immer besser. Gerne hätte Robert das Spiel länger ausgekostet, doch er hörte, dass die anderen zurück waren und durch die Hütte lärmten. Der Aufregung, die gleich einsetzen musste, zog er die Ohnmacht vor. Und zog. Und zog.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jan-Christian Petersen
Wir wissen nichts von Mauretanien
Nachts höre ich den Lärm der Biogasanlage aus zwei Kilometern Entfernung. Dieses stetige und beinah unmerkliche Geräusch erfüllt die Luft wie ein Auto, das bei laufendem Motor neben mir steht. Im Morgengrauen erhebt sich mit der Sonne auch der Wind, wird laut und überwältigend. Ich lebe in Schleswig-Holstein auf tropfnassem Marschland zwischen zwei Meeren. Wo immer man sich hier aufhält, es sind nie mehr als 60 Kilometer bis zur Küste und es regnet fast das ganze Jahr.
Als ich zum ersten Mal von Mauretanien hörte, wusste ich nichts über das Land, seine Menschen – geschweige denn, wo es auf das Karte liegt. Das habe ich mit dem größten Teil der Deutschen gemein. Als Europäer interessieren wir uns meist erst für ein fremdes Land, sobald wir Wirtschaftsinteressen zu pflegen beginnen oder wenn dessen Bevölkerung eine Bedrohung für uns darstellt.
Der Boden, auf dem ich lebe, ist grün und reich an Gras. – Mauretanien besteht aus blassen Sand- und Steintönen, als wäre das ganze Land in Aquarellfarben gemalt. Ich sehe Bilder von ziegelsteinförmigen Häusern. Wüstenwind verwischt den Horizont.
Vor meinem eigenen Fenster saugt der Nebel an der schwammnassen Marsch. Die Menschen im nahe gelegenen Dorf kämpfen dieser Tage um ihr Recht, ihre Dächer mit glasierten Pfannenziegeln bedecken zu dürfen. Sie rebellieren gegen einen Artikel ihrer Dorfsatzung, der ihnen lediglich den Gebrauch matter Dachziegel gestattet. – In Mauretanien verteidigen sich die Menschen gegen Artikel 306. Es ist das Blasphemie- und Apostasiegesetz. Praktisch jeder kann zum Tode verurteilt werden oder im Gefängnis landen. Der Geruch von Insektiziden steht in übervollen Zellen.
Ich bin überwältigt vom Sturm, der draußen tobt. Die Bäume sind vom Wind in Form gepresst. Selbst bei Flaute sehen ihre Zweige wie wehende Fahnen aus. Alles Wachstum wird hier in Richtung Ostküste gedrängt, wo die großen Städte liegen.
Bäume in Mauretanien, falls überhaupt vorhanden, stehen allein, dünn und klein mit verschrumpelten Rinden, aber mit Baumkronen, die wie Fontänen gefächert sind. Einige Sklaven ruhen noch in ihren Schatten. Über Generationen wurden Hunderttausende von ihnen ohne eigene Geschichte aufgezogen. Die Wüste bietet in ihrer selbst das perfekte Monument einer Erinnerungskultur, welches die Auslöschung jeglicher Identität zu versinnbildlichen taugt. – Oder vielleicht sollte man hier ein leeres Plateau als Denkmal errichten? Es würde jeden Tag von einwehendem Sand gereinigt werden – als Geste, die den Willen zeigt, das Gedenken an die Opfer der Sklaverei am Leben zu erhalten.
Ich höre den Zug. Er fährt in ungefähr drei Kilometern Entfernung an meiner Wohnung vorüber. Es dauert eine Weile, bis die Geräuschlandschaft wieder von der Biogasanlage eingenommen ist. Sie klingt noch immer wie ein Auto mit laufendem Motor, dessen Fahrer nicht weiß, ob er fortfahren oder bleiben soll. – In den letzten Wochen habe ich fast zwei Dutzend Berichte von Mauretaniern gelesen, die aufgrund von Gesetzen verfolgt wurden, deren Auslegung jeglichen Ausdruck von Leben und handelnder Fürsorge strafbar zu machen verstehen.
Manchmal, wenn die Biogasanlage abgeschaltet ist, kann ich hören, wie der Zug langsam in die Nacht verschwindet. Jeden Tag liefert er Touristen wie Frachtgut auf einer von den Nordseeinseln ab. Den ganzen Weg entlang mästen sich Schafe, Kühe und Wildgänse am üppigen Gras. – So groß, wie die mauretanische Wüste ist, so lang und schwer ist auch der Zug, der sie durchquert. Eisenerz ist das Gold des Landes. Es wird von den Minen im Nordosten über 700 Kilometer bis zu den Häfen im Westen transportiert. Grundsätzlich teilen wir denselben Ozean. Er liegt nur wenige Schritte von meiner Haustür entfernt.
Ich bin fasziniert von dem neu entdeckten Land und entsetzt über die Geschichten des Despotismus, die Mauretaniens Ruhe überschatten, nachdem auch dort der Zug vorbeigefahren ist. Sand weht hinter ihm her. – Der deutsche Schriftsteller Arno Schmidt hat einmal geschrieben, das Leben bedeute den Sieg von Proteinen über Silikate. Die Sahara lässt es umgekehrt aussehen. Nur wenige Prozent Mauretaniens sind überhaupt für die Landwirtschaft geeignet. Der Wind formt Dünen wie Meereswellen und wandert mit den Gebeten nach Osten. Heilige Ruhe liegt über der Wüste. Wie jeden Freitag wird in den Moscheen für ein friedliches Wohlergehen gebetet, während gleichzeitig zahlreiche Mauretanier kriminalisiert werden, weil sie Liebe und Trauer auf andere als die islamische Weise teilen.
Ich stehe am Ufer. Meereswellen spülen das Land hinfort. Was ich sehe, steht kaum in Widerspruch zu dem, was in einigen mauretanischen Siedlungen geschieht. Langsam fortfließende Lawinen fluten Wege und Straßen. Sand hatte einst das alte Chinguetti überdeckt – diese heilige Siedlung, in der alte islamische Schriften aufbewahrt und bewacht werden. Vor langer Zeit wurde der ganze Ort auf höhere Gebiete verlegt. Die Sahara hat auch diese Siedlung eingenommen. Die Häuser, die man heute dort sieht, stehen auf denen, die begrabenen sind. Die Wüste erhebt sich und ich sehe das Ansteigen der See.
Kleine Inseln ragen aus dem Wattenmeer empor. Es gibt in keiner anderen Sprache ein Wort für diese einzigartige Landschaft, die direkt vor der Westküste Schleswig-Holsteins liegt – ein Weltnaturerbe, das geformt wird von sich ständig bewegendem Wasser, angezogen vom Mond. Im Mittelalter war das Meer hier festes Land. Die Wellen haben es weggerissen. In Jedem Herbst werden die Inseln von solchen Sturmfluten überschwemmt. Allein die Häuser, die auf kleinen Hügeln erbaut sind, ragen dann aus dem schäumenden Meer. Wellen bersten an den Mauern.
Ich sehe Schwärme von Graureihern nach Mauretanien fliegen. Der Herbst ist genauso die Zeit des Nebels. Er bedeckt das Marschland mit Silber wie die Wüste, wenn sie vom Vollmond beleuchtet wird. Ich habe Mauretanien selbst nie gesehen. Ich bin nicht vielen Mauretaniern begegnet, die mir aus erster Hand erzählt haben, was sie im Alltag bewegt oder in Bezug auf die Vergangenheit des Landes. Wir Europäer kolonisierten einst den afrikanischen Kontinent, beuteten die Ressourcen aus und versklavten Millionen. Wer bin ich, dass ich die Sklaverei in Mauretanien so selbstbewusst anzuprangern wage? Europa hat sie reich gemacht.
Von der Küste zurück nehme ich eine alte Enzyklopädie von Johann Christoph Adelung aus meinem Regal. Veröffentlicht wurde das Buch 1793. Ich blättere nach "Europa" und finde die Definition: "Der Name des kleinsten, aber aufgeklärtesten und gesittetsten Weltteiles." Ich lösche das Licht und blicke aus dem Fenster. Ich sehe den Nebel. Es ist der Schleier meiner Unwissenheit, der anmaßende Projektionen widerspiegelt, die in meinem Zustand der Untätigkeit entstehen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Dakota Bronson
Roberta Lima
„Roberta, Roberta!“, dachte ich und klopfte eifrig an das U-Bahnfenster als ich sie Richtung Heiligenstadt sitzend im gegenüberliegenden Wagon erblickte. Es war dies in der U-Bahnstation Meidling. Die Distanz zwischen den beiden entgegengesetzten Zügen war in dieser Station die größte. Vielleicht sogar größer als im restlichen Streckenverlauf. Dazwischen eine große asphaltierte Innenfläche mit insgesamt vier Reihen an Sitzbänken mit geräumigem Abstand dazwischen. Unmöglich konnte sie da mein Klopfen hören oder meine Gedanken empfangen. War sie es überhaupt? Dieser dunkelhaarige kleine Pagenkopf auf dem aufrechten schlanken Hals zwischen den zarten geraden Schultern einer vierzigjährigen Frau, die ohne jegliche Übertreibung und erst Recht aus der Ferne, auch wenn dieses Addendum das Kompliment schwächt, wie vierzehn aussah, konnte doch nur ihr gehören!
Unsere Züge setzten sich in Bewegung und zwar gleichzeitig und in die gleiche Richtung. Entgegengesetzt war bloß ihre Sitzposition.
An den weißen Zwischenmauern im Stationsbereich, die jeweils nur kurz die Sicht versperrten, vorbei, ging es draußen weiter Richtung Heiligenstadt. Die Züge näherten sich an, das heißt der Abstand verringerte sich, nach wie vor saß sie auf gleicher Höhe und sah nach wie vor gerade aus. Endlich erblickte sie mich und winkte, während ich noch immer behämmert klopfte. Schließlich gab mir ihr gewinnendes Lächeln die nötige Selbstsicherheit und ich lächelte zurück. Nun da unsere Gesichter einander zugewandt waren, sahen wir auch in die entgegensetzte Richtung, bloß die Züge fuhren noch immer in dieselbe. Das war herrlich, denn sie hörte nicht auf zu lächeln und gelegentlich zu winken und nur sie konnte dies auf eine Art meistern, die es auch über einen größeren Zeitraum hinweg nicht lächerlich wirken ließ. Den Zeitraum einer gefühlten glückseligen Ewigkeit, in der ich wiederum verzückt dasaß wie ein Mondkalb und nicht anders konnte als dämlich zu grinsen und mir auch nichts anderes wünschte. Dann kam jedoch plötzlich der entsetzliche Gedanke, dass ihr Zug ja schließlich in einen anderen krachen müsste, der diesem entgegenkam! Ich musste sie unbedingt warnen, kam aber aus der grinsenden Lähmung nicht heraus. Sie schien nun meine Gedanken zu erraten und winkte ab statt zu. Mit einer Handbewegung die deutete, es würde schon nichts passieren. Genieße doch das Leben!
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Felix Wünsche
Mein Gesicht
Ich meide Spiegel. Den Blick in den Spiegel. Mir ist das zu schmerzlich. Dieses Bild dort im silbern hinterlegten Glas. Normalerweise versuche ich immer schon von außen festzustellen, ob in einem Café Spiegel hängen, an der Wand, hinter dem Tresen. Spätestens beim Hineinkommen entdecke ich sie, wenn ich prüfend kurz verharre, bevor ich ganz in den Raum trete. Doch jetzt, heute ist mir einer entgangen. Er hängt an einem schmalen Wandstück, hellblau gemalt, in schwerem, hölzernem Rahmen. Groß. Belauert mich. Wühlt in mir. Sein Blick. Dieser Blick, der mich so unangenehm bedrängt, dem ich nichts mehr entgegenzusetzen habe. All diesen Blicken. Etwas stimmt nicht mit mir, mit meinem Aussehen. Nicht die Kleidung. An meiner Kleidung liegt es nicht. Das habe ich in den letzten Wochen erprobt. Mehrfach, oft, für eine Weile mit dringender Besessenheit habe ich Kleidungsstücke gewechselt, den ganzen Stil meiner Erscheinung geändert, mir ganz ungewohnte Zusammenstellungen ausprobiert, die ich Modemagazinen entnommen habe. Eine kostspielige Anstrengung. Aber nichts. Keine Veränderung. Weiter treffen mich die Blicke. Unerbittlich. Habe ich sie zuvor nicht wahrgenommen?
Etwas habe ich verloren. Etwas sehen die Menschen in mir, das Unbehagen in ihnen erweckt. Ablehnung, Widerwillen, Ekel bis hin zu Abscheu, eine stille Wut entzündet sich, manchmal beschirmt durch ihre Lider, Verachtung auch, Hass. Sogar Hass. Überall diese Gesichter. Verstohlen die meisten, kurze Blicke, fast hastig wenden sie sich ab. Manchen steht ein erstauntes Erschrecken in der Miene. Prüfend andere, lange nach Wahrheit forschend, bereit, Gutes zu entdecken, plötzlich enttäuscht, wütend, anklagend, Mühe an mich verschwendet zu haben. Unverhohlen starren mich Einzelne an, voller blödsinniger Neugier, sich ihrer Begleitung lachend zuwendend, einige zeigen mit dem Finger auf mich, hämisch verschiedentlich, voller Lust an dem, was sie als meinen Makel, unauslöschlich, unverzeihlich betrachten. Eisige Härte versteinert immer wieder Gesichtszüge, eine angestrengte Angewidertheit, nur am fast unmerklichen Zucken der Mundwinkel erkennbar, der Begegnung mit mir ausgesetzt zu werden. Am erträglichsten sind die Kinderblicke. Ernst und neugierig erlauben sie mir, mich wie ein seltenes Zootier zu fühlen. Die Kellnerin hier hat mir ausdruckslos ins Gesicht geschaut, flüchtig, mit halb niedergeschlagenen Augen, ein Ausdruck, der ein vages Echo wachgerufen hat. Ihre Haare fallen ihr weit in die Stirn. Keiner dieser Blicke. Sind sie real? Nehme nur ich sie so wahr? Kann ich mir sicher sein, dass mich alle so ansehen, wo selbst jener Spiegel im Wandblau mich beklommen werden lässt?
Etwas schaut mich aus den Gesichtern an. Richtet Gesetze auf. Schafft Recht. In dem Moment, in dem mich die Blicke treffen, verurteilt es mich. Ich gehe nur noch mit gesenktem Kopf dahin. Was hat mich hierher gestellt, in fortgesetzte Begutachtung? Ein Wall ist niedergebröckelt. Allmählich, schleichend? Habe ich es nicht gemerkt, hätte ich es verhindern können? Oder ist er niedergebrochen, plötzlich? Zwischen mir und ihnen. Diese stille Fassade, unauffällig getüncht, schmucklos, die sich einreihte in die Häuserfronten entlang einer der vielen Straßen. Mich verbarg in der Menge der anderen Gesichter. Weg jetzt. Alles liegt offen da. Jeder kann beanspruchen, alles über mich zu wissen. Puppenhauswände, das Innere dem prüfenden Blick dargeboten. Wer schauen will, schaue. Meine Seele. Liegt offen. Scheint jenen Blicken offen zu liegen. In meinem Gesicht, auf meiner Haut. Mit einem Mal möchte ich mich verbergen. Bin ein Flüchtling geworden. Fremd. Gehe gemessen. In mir der Impuls zu rennen, wegzulaufen, ein ständiger Begleiter. Ich schlage den Blick nieder. Unwillkürlich. Bald hatte ich gelernt, Blicken subtil auszuweichen. Immer mehr hat sich in mir die Überzeugung festgesetzt, die Ursache sei in mir zu finden, strahle nach außen, müsse aufgehalten werden. Ich trage einen Hut, eine Sonnenbrille mit großen Gläsern. Ziehe ihn tief in die Stirn. Dann wieder fühle ich mich getrieben, von meinem Recht getrieben - welchem? -, hinauszugehen, mich dem Gericht zu stellen, entgegenzustellen, unverhüllt, mit hoch erhobenem Kopf. Vergebung erhoffend. Gerechtigkeit fordernd. Ein blöder Trotz vielleicht. Denn gleichzeitig will ich nichts mehr als mich verkriechen. In meiner Wohnung. Fest abschließen. In dieser Wohnung ohne Fassade. Mit dem Spiegel, dem einen Spiegel, den ich nicht meiden kann. Ständig am Anfang und auch jetzt in manchen Momenten, viel seltener und unter stetig zunehmendem Unwohlsein, das sich zu einer quälenden seelischen Pein steigern kann, habe ich mich selbst dort im Silberglas examiniert. Dem einzigen Spiegel in meinen Räumen. Teil des pompösen Aufbaus einer alten Kommode, die ich, ganz dem momentanen Geschmack an alten Möbeln entsprechend, im Internet erworben habe. Mit sorgfältiger Akribie fahre ich jede Linie, Kerbe, Erhebung meines Gesichts nach. Lippen, Augenfalten, Nasenflügel, die feinen Hügel der Wangen. Wieder und wieder, weiche meinem eigenen Blick aus, während sich ein erstickendes Ekelgefühl an mich heranschleicht, von mir Besitz ergreift, mich in der Magengrube packt, schüttelt, würgt, sauer und schal. Obwohl ich nichts, wirklich nichts auffinden konnte, was mir auf irgendeine denkbare Weise nicht menschlich erschien. Eigenheiten der Gestalt, der Haut, Porung oder Färbung, Deformierungen. Keine Merkmale, die mich eindeutig von anderen abheben würden. Etwas später, wenn ich mich erholt habe, durch gleichmäßiges Atmen beruhigt, einen Tee trinke, jagen meine Gedanken wild dahin, drängt sich mir der Verdacht auf, ich könnte in einer Illusion von mir selbst befangen sein, mein Gehirn könnte mir eine Gestalt zeigen, die nicht der Wirklichkeit, der schrecklichen Wirklichkeit entspräche. Ein Wunschbild, das ich mir von mir selber mache. Leider habe ich keine vertrauten Menschen, die ich dahingehend befragen könnte. Freunde sicher, aber niemanden, den ich in die mögliche, allergrößte Verlegenheit bringen wollte, eventuell eingestehen zu müssen, dass auch sie oder er etwas an mir anstößig finde, bisher in Stillschweigen verhüllt. Etwas, das auch sie möglicherweise nicht voll in ihr Bewusstsein dringen lassen, um den Kontakt mit mir überhaupt möglich und erträglich zu machen.
Hier muss ich etwas gestehen. Vor ein paar Tagen, bei einer dieser schwierigen Selbstbeschauungen habe ich zu meinem zitternden Erschrecken eine rötlich-braune Läsion auf der linken Wange entdeckt. Sie ist klein. Unscheinbar. Und so muss sie meiner Aufmerksamkeit entschlüpft sein. Oder ist es ein Riss in meiner Illusion über mich selbst, der mich diese Stelle hat auffinden lassen? Nun treibt mich die ständige Besorgnis um, dass sie wächst, sich ausbreitet. Wie konnte ich sie übersehen? Wie lange ist sie schon da? Vielleicht ist dieses Mal die Ursache für die Aufmerksamkeit, die ich errege. Gleichzeitig bin ich sicher, dass es diesen Fleck anfangs nicht gab, er eher hervorgekommen, gewachsen ist mit der erzwungenen Entfremdung. Eine Markierung. Mir aufgedrückt. Natürlich habe ich überlegt, einen Arzt aufzusuchen. Doch hält mich zurück, dass mir so recht kein Weg einfällt, wie er Abhilfe schaffen könnte, wollte er mir nicht ein gänzlich neues Gesicht verpassen, da es mit der Entfernung der Stelle nicht getan sein würde. Dies aber etwas ist, das mir medizinisch nicht möglich erscheint und trotz all meiner Pein auch nicht wünschenswert.
Am meisten drängt es mich dazu, in Gesichter zu schauen. In so viele, wie nur möglich. Ich setze mich auf eine Bank in der Fußgängerzone, in Shopping-Malls, in Cafés, wie jetzt, mit Hut und Sonnenbrille, schaue die Gesichter an, die vorüberziehen, registriere jedes Mienenspiel, jeden Ausdruck, jedes kleine Muskelzucken. Sie gleiten vorbei. Stetig. Ein Strom. Frisch, ausgelaugt von der Zeit, jedes ein bisschen anders, alle ein wenig gleich. Vorderfronten. Schützen ihre Träger. Markieren ihre Ansprüche. Zeigen ein Bild, von dem ich nicht weiß, was es über die Räume dahinter erzählt. Alle haben es. Was ich verloren habe. So scheint es mir. Ein Gesicht. Das meine Seele trägt, verhüllt zum Ausdruck bringt. In den anderen suche ich meins. Hoffe, dass es mir jene Blicke, die es mir gleichgültig entrissen haben, genauso gleichgültig zurückgeben. Eines Tages. Wenn ich nur lange genug ausharre.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Peter Sipos
wenn ich verschlafe
wenn ich meine socken angezogen habe, dann laufe ich immer zum arzt, in den socken die straße hinab und stehe dann vor der praxis und klingel mindestens dreimal, schnell nacheinander, mit dem finger fest gegen die klingel gedrückt und der arzt (er arbeitet ganz alleine in der praxis) ruft aus dem fenster herab: „wieso kommen sie erst jetzt zu mir? ich habe sie schon lange erwartet?“ und ich rufe dann zum fenster hinauf (das der arzt aber gerade schon schließt): „ich habe verschlafen, tut mir leid.“
beim eintreten zögere ich für eine sekunde, damit ich meine entscheidungen nicht übereile und laufe dann die treppen hinauf, zwei, drei stufen auf einmal, obwohl eigentlich auch ein aufzug vorhanden wäre, und oben hämmere ich gegen die tür des arztes, auf der tür steht: „dr. kewesch“ und außerdem die öffnungszeiten (rund um die uhr) und wenn der arzt dann nicht innerhalb der nächsten zwölf sekunden öffnet, dann stampfe ich mit den füßen auf den kleinen willkommensteppich vor der tür, bis der arzt endlich öffnet und ich ihn anschreien kann: „sie idiot haben mir ihre telefonnummer immer noch nicht gegeben, wie soll ich dann bescheid sagen, dass ich später komme?“ aber der arzt gibt mir seine telefonnummer trotzdem nicht, ich glaube weil er angst davor hat, dass ich ihn einmal im urlaub anrufen werde, um zu erfahren, wo ich ihn auffinden kann, für den fall, für den notfall.
„ziehen sie bitte ihre dreckigen socken aus“, sagt der arzt, ich nenne ihn in diesem fall: „notarzt“. das macht aber nichts zur sache, weil herr dr. kewesch im selben fall zwei messer aus der schublade zückt (das eine messer für meine niere und das andere um die öffnung in meinem bauch wenigstens ein stück weit offen zu halten). „bitte“, sage ich meistens wenn es so weit kommt, „ich möchte meine socken heute ausnahmsweise einmal anbehalten dürfen.“ aber der notarzt, herr dr. kewesch, brüllt in mein ohr: „sie sind zu spät heute, ich darf jetzt alles entscheiden!“ wir lachen und schütteln unsere hände, als wären wir zwei freunde, es geht jedoch beim händeschütteln immer nur darum, dass der notarzt meinen puls messen kann (das kann er eigentlich nie so richtig, weil ich meine hand nach ein paar sekunden aus seinem griff reiße).
ich halte für einen moment die luft an, weil es dann schon so weit gekommen ist, dass dr. kewesch mich operieren will und weil er kein einziges mal bisher schmerzmittel zur verfügung hatte, muss ich mich selbst in narkose bringen, das funktioniert nur gut, falls ich die luft lange genug anhalte, bis ich atemnot bekomme, ich frage oft nach einer plastiktüte, die ich mir über den kopf ziehen kann, aber selbst das hat herr dr. kewesch selten für mich parat. die luft geht mir schnell aus, ich blicke in den letzten sekunden vor meiner ohnmacht in eine der verschmutzten ecken, dort liegt ein sandwich von mir, das ich letzte woche nach der operation in die ecke geworfen habe, ich möchte fragen: „darf ich von diesem sandwich ein letztes mal beißen?“
doch dann ist es zu spät, weil alles wird schwarz vor meinen augen und mir wird sehr schwindelig und ich bräuchte etwas luft, nur ein bisschen luft, ein letztes mal atmen bitte, herr dr. kewesch, herr notarzt, lassen sie mich atmen, ich hasse es wenn ich nicht atmen kann und ich wache auf, als die operation schon lange vorbei ist, mindestens zwei stunden später und ich liege eine weile da und summe leise vor mich hin, wie ich es zu tun pflege, wenn ich sehr große schmerzen habe, mit halb offenem mund und der arzt setzt sich an sein cello und versucht mein summen zu begleiten, um mich zusätzlich zu versorgen, dafür muss ich normalerweise einen aufpreis bezahlen aber vielleicht gewährt er mir diesmal alles umsonst, er hat jetzt schließlich meine niere.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at