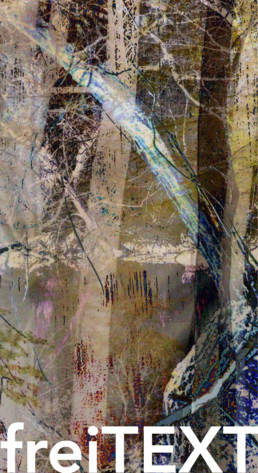freiTEXT | Maline Kotetzki
Kirschrot
Langsam ließ sie die Bürste durch ihr ohnehin schon spiegelglattes Haar gleiten. Sie griff es im Nacken zusammen und drehte es solange, bis an ihrem Hinterkopf ein fester Knoten entstand, den sie mit einer goldene Spange feststeckte. Keine dieser Bewegungen nahm sie bewusst wahr, alles an ihr war auf Automatisierung eingestellt. Wenn sie jemand fragen würde, welche Ohrringe sie anlegte - es waren die blauen mit den kleinen Perlen -, sie könnte die Frage nicht beantworten. Seit drei Wochen war das nun schon der Fall. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, was seit dem Anruf geschehen war. Sie hatte einfach nur funktioniert, obwohl dieses „Einfach“ gar nicht so leicht gewesen war. Mit nichts von alledem hatte sie gerechnet, aber wer tat das schon? Es gab Dinge, über die kaum jemand sprach, vielleicht, weil man damit keine Geister rufen wollte, die unter den Türspalten durchkletterten und sich einnisteten.
Der Regen fiel in langen, grauen Fäden vor dem Fenster herunter, während sie mit einer Tasse Tee in der Hand hinausblicket. Eigentlich würde sie lieber einen Kaffee trinken, aber ihr Herz pochte ohnehin schon zu schnell und hinter ihren Schläfen sammelte sich bereits ein stechender Schmerz, den auch das beste Lavendel-Öl aus dem Reformhaus nicht wegdünsten konnte.
Durch die letzten Wochen war sie wie durch einen dichten Nebel geschlafwandelt, nur begleitet von ebenjenem Schmerz, der auch jetzt ihren Kopf durchdrang. Sie wusste nicht, was sie alles unterschrieben, welchen Plänen sie zugestimmt hatte. Wahrscheinlich hatte sie sich Sachen aufschwatzen lassen und alles würde exorbitant teuer sein, aber das kümmerte sie nicht, obwohl es das wahrscheinlich sollte. In ihr war kein Platz für Gedanken über Geld, alles war verdrängt worden. Sie war froh gewesen, jegliche Entscheidungen in die Hände anderer zu geben, nur hier und da ein Kreuz machen oder ihren Namen unter ein Schriftstück setzen zu müssen. Dennoch war sie beim Unterschreiben immer wieder ins Stocken geraten, denn das auf dem Papier, das war nicht nur ihr Name. Sie hatten ihn zusammen getragen und jetzt war sie die alleinige Trägerin. „Namen sind Schall und Rauch.“ Aber dieser Name hatte ein Gewicht, das sie niederdrückte. Jedes Mal, wenn sie ihn aussprach, blieb ihr für ein paar Sekunden die Luft weg. Vielleicht sollte sie ihn wieder ändern, vielleicht, dachte sie und wusste im selben Moment, dass sie es doch nicht tun würde.
Eine Sache hatte sie in dieser Zeit verstanden. Das Wort „immer“ hatte keine Macht. Sie hatten sich geschworen, immer beieinander zu bleiben, immer zusammen zu sein. Und jetzt? Jetzt gab es nur noch ein Nie, das sich bis ins Endlose ausdehnte. Nein, „immer“ gab es nicht, damit hatten sie sich belogen, weil sie es nicht besser wussten. Es gab nur „niemals mehr“. Niemals mehr diese Stimme hören – warum gab es auf der Mailbox keine persönliche Ansage? – niemals mehr eine Berührung, niemals mehr dieser Geruch nach Zitronen und Kaffee und Holz. Sie vermisste den Körper, der sie so viele Jahre begleitet hatte, der jeden Morgen und jeden Abend neben ihr im Bett gelegen hatte, das jetzt seltsam unausgeglichen aussah und dessen eine Seite sich nicht mehr veränderte, nicht mehr unordentlich, nicht mehr schlafeswarm wurde. Sie konnte nicht verstehen, wie sich alles ändern konnte und doch so aussah, als ob es stillstand. Und wie die Welt noch immer so wie vorher war, auch wenn sie nicht anders hätte sein können.
Die Tasse Tee in ihrer Hand wurde langsam kälter, es stieg kein Dampf mehr auf. Sie blickte an sich hinunter. Da waren die schwarzen Schuhe, das schwarze Kleid, die schwarzen Strümpfe. Über einem Stuhl hing der schwarze Mantel. Wie blind hatte sie die Teile aus dem Schrank genommen; nur auf die Farbe geachtet. Keines dieser Kleidungsstücke würde sie je wieder tragen können, das war eine der wenigen Sachen, derer sie sicher war. Sie würde sie wegwerfen oder in die hinterste Ecke ihres Schrankes stopfen und hoffen, dass sie sie so schnell nicht wieder benötigen würde.
Wieder blickte sie hinaus in den Regen und in ihren Gedanken regte sich etwas, was sie nicht zu fassen bekam. Alles wurde übertüncht. Vom Klingeln des Telefons. Von einer besorgten und gleichzeitig unbeteiligten Stimme. Von Bildern, die während des Gesprächs durch ihren Kopf brausten und von denen sie hoffte, so sehr hoffte, dass sie nie stattgefunden hatten. Von einer Umarmung. Von einem weiteren Telefonat, bei dem der Hörer aufgeknallt wurde. Von einem Lachen. Von den Tagen dazwischen. Von blauen Farbspritzern auf dem Küchenboden. All das war so viel wichtiger als alles, was seitdem geschehen war und je wieder geschehen würde. Morgen um diese Zeit würde sie schon den Weg zwischen den Birken entlang gegangen sein, den Blick fest auf den Boden gerichtet. Nur die Füße des Pfarrers würden sich in ihr Sichtfeld schieben und sie würde ihnen im Takt zu den Kirchenglocken folgen. Bis sie zu einem Loch kamen, an das sie nicht denken wollte, das ebenso bodenlos war wie die Zukunft, die sich vor ihr ausbereitete.
Wieder dieses Pochen im Kopf. Sie hatte etwas vergessen, etwas Wichtiges. Sie versuchte, ihre Gedanken darauf zu lenken, weg von den Tanzschritten und den Schmerzen in den Füßen, weg von den Klängen einer Trompete und dem Geschmack von Zitronenravioli. Es hatte etwas mit dem Regen zu tun, da war sie sicher. Sie konnte den Gedanken fast schon erhaschen, wie die Schnur eines Drachens, der knapp über ihrem Kopf schwebte und den der Wind stets nur einige Zentimeter zu hoch fliegen ließ. Sie streckte sich ihm entgegen, stand auf den Zehenspitzen, griff in die Luft. Und plötzlich hielt sie ihn in der Hand.
Es waren Regenschirme! Mit so etwas Banalem hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. In Filmen hatten immer alle schwarze Regenschirme bei so einem Wetter. Oft trugen sie dann auch noch schwarze Sonnenbrillen, was ihr immer paradox vorgekommen war, aber wenn sie sich ihre Augen so ansah, konnte sie es jetzt sehr gut nachvollziehen. Meistens stiegen die Menschen aus Taxis oder Limousinen, zumindest aus schwarzen Audis aus und von der Seite wurde von irgendeinem Mann in einem zu engen Anzug ein Regenschirm über sie gehalten, der ebenso schwarz war wie ihre Kleidung. Wie konnte sie das vergessen? Und wie konnte sie an so etwas denken?
Vollkommen unangebracht, wirbelte eine Stimme durch ihren Kopf, die verdächtig nach ihrer Tante klang. Die hatte jedes Mal geseufzt, wenn sie auch nur einen lauteren Schritt gemacht hatte, und ebendiese Worte gemeinsam mit einer Schwade Zigarettenrauch zwischen ihren Zähnen ausgestoßen. Wie konnte sie jetzt an einen Regenschirm denken? Es war tatsächlich so gar nicht angebracht, aber was hieß das schon?
Draußen hielt ein Taxi. Sie blickte auf die Uhr an ihrem rechten Handgelenk. In zwanzig Minuten musste sie dort sein. Sie stellte die Teetasse in die Spüle, zog den Mantel an und blieb an der Tür stehen, neben der ein kirschroter Regenschirm lehnte, der ihr mit seiner knallenden Farbe immer wie der perfekte Schutz gegen das nasse Grau vorgekommen war. „Damit du ihn nicht liegen lässt. Etwas Knalligeres hatten sie nicht“, weil sie in den Tagen davor immer ohne aus der Wohnung gegangen war und damit jedes Mal das Wetter herausgefordert hatte. Ihren alten Schirm, einen schwarzen, der heute so perfekt gepasst hätte, hatte sie irgendwo liegen lassen. Sie zuckte mit den Achseln, wedelte die Stimme ihrer Tante weg wie deren Rauch, der ihr immer im Hals kratzte, und nahm den roten Schirm in die Hand. Er würde das einzige Stück seien, das sie auch nach dem heutigen Tag verwenden würde. Sie hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet ein Regenschirm sie an diesem Tag zum Lächeln bringen würde.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ferenc Liebig
Brücken
Der Mann, er weiß nicht, wo er im Leben steht, ob er überhaupt steht oder schon längst sitzt, und was es bedeuten würde, wenn er denn nun sitzt und nicht mehr steht, dieser Mann, der unruhig ist, ein wenig aufgescheucht sein Leben begeht, nie ankommen mag, sich selbst nicht sicher, ob er überhaupt ankommen will, weil ankommen letztendlich auch Endgültigkeit ausstrahlt, die ihm dann sagen würde, von nun an geht es nicht mehr weiter, hier wirst du verweilen oder schlimmer noch, ausharren müssen, der sich dem Pejorativ dieses Wortes bewusst ist, ausharren, als würde es keinen Ausweg mehr geben, als wäre man eingeschlossen von etwas, das man nicht bezwingen kann, dieser Mann, der ungerne wartet, da warten doch bekanntermaßen bedeutet, sich in Abhängigkeiten zu begeben und Abhängigkeit für ihn wie eine Fessel ist, die sich immer fester schnürt, sich in seine Haut schneidet, kaputte Zellen zurücklässt, Wunden, aus denen Narben werden, Narben, die im Sommer weiß bleiben, die sich abheben, für jeden sichtbar sagen, dir hat man etwas fürchterliches angetan, dass du für den Rest deiner Tage mit dir herum tragen wirst, von denen du auch nach etlichen Versuchen der Gewöhnung den Blick niemals abkehren kannst, weil abkehren mit verdrängen gleichzusetzen ist und verdrängen nur vorübergehend funktionieren kann und nie eine langfristige Lösung ist, dieser Mann, der sich nach Dingen sehnt, die er nicht in Worte fassen kann, denn Worte kratzen nur an Oberflächen, zerkratzen sie, bis das, was man darunter vermuten könnte, noch besser versteckt ist, bis einem Angst und Bange wird, nie dahinter steigen zu können, hinter die Geheimnisse, die verschachtelt, ungeordnet, nicht zähmbar, ineinanderfließend ihre Grausamkeit verdeutlichen, die Freiheit mit Grenzenlosigkeit verwechseln, dieser Mann, fast vierzig, ein wenig müde von seinen unbeherrschbaren Gedanken, läuft an einem Büro vorbei, in dem eine Frau einen Aktenordner auf den Schoß hat, ihn wieder und wieder durchblättert und nach einem Rechenfehler sucht, der ihr sagt, es gäbe noch Hoffnung.
Diese Frau, Mutter zweier Kinder, alleinerziehend, vom Mann im Stich gelassen, der sich irgendwann dazu entschieden hat, es sein zu lassen und von einer Brücke gesprungen ist, aufgeschlagen auf einer dicken Eisschicht, den Schädel in Einzelteile hat zerspringen lassen, wie ein Glas, das einem unachtsam aus der Hand gleitet, sich in Splittern auf einem Boden verteilt, diese Frau mahnt sich zur Ruhe, aber da ist keine Ruhe mehr, nur Bedrohung, Ängste, Rechnungen, die zwar geöffnet, aber ungelesen sind, weil ungelesen sagt, vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, vielleicht kriegen wir noch die Kurve, vielleicht müssen wir nicht aus der Wohnung ausziehen, das Auto verkaufen, uns von den alten Möbelstücken trennen, die im Antiquariat möglicherweise etwas abwerfen, vielleicht passiert etwas Überraschendes, ein Gewinn, obwohl man nirgends mitspielt um gewinnen zu können, vielleicht ein Erbe, weil jemand stirbt, der zur Familie gehört, von dem man noch nie gehört hat, der kurz nach der Geburt verschwunden ist, weil die Mutter noch minderjährig, der Freund überfordert, die Eltern besorgt um das Ansehen in der Gemeinschaft waren, vielleicht trifft man auf einen Mann, der sich nicht daran stört, zwei Kinder mit großzuziehen, der sich nicht von den Schulden abschrecken lässt, diese Frau, Seite um Seite umblätternd, ohne wirklich erkennen zu können, was auf den Seiten steht, weil Tränen verschwimmen lassen, die leersaugende Ohnmacht dem Kopf keinen klaren Gedanken fassen lässt, Hoffnung wie ein Fremdwort ohne Übersetzung bleibt, diese Frau, kurz aufblickend, sieht das Bild ihrer Kinder auf dem Schreibtisch stehen, die Kinder, auf einem Platz in Madrid, knallbunt angezogen, die Arme umeinander gelegt, wie Geschwister, denen Streit fremd ist, die aussehen, als könnten sie niemanden was zu Leide tun, erinnert sich, wie sie danach Eis essen gegangen sind, kurz nachdem sie das Foto geschossen hatte und sie vom warmen Wind gestreichelt, eine Leichtigkeit verspürt hat, die ihr nur dieses eine Mal begegnet ist.
Erdbeereis, sagt der Junge und nahm die Eiswaffel entgegen. Für sein Alter war er schon sehr weit. Weit sein oder besser gesagt, weiter sein als der Rest ist meistens mit Problemen behaftet, weil es nicht normal ist, weiter zu sein und dann sitzen erst die Erzieher mit den Eltern in der Runde und sprechen über Auffälligkeiten, dann kommen Therapeuten, wollen das man Häuser und Bäume malt und Fragen beantwortet und mit Figuren spielt, am besten Situationen nachstellt, Situationen, die Zuhause passieren, die zum Alltag gehören, die Einblicke über das Verhalten der Eltern gewähren, die nach Ursachen suchen, weil man mit den anderen Kindern nicht zurecht kommt, sie ausschließt, von ihnen ausgeschlossen wird, weil man Dinge sagt, die andere Kinder in dem Alter nicht sagen, die überfordern mögen, aus ratlosen Blicken gekräuselte Stirne machen, die das Kind bewerten, kategorisieren, in eine Ecke stellen, die niemand sonst betreten sollte, weil es komisch ist und man auch Angst hat, vom Kind bewertet, kategorisiert zu werden, dass es einen durchschaut, die Regeln und Rituale hinterfragt, sich auflehnt, gefährlich wird, mit seinem Wissen die Überforderung durchdringt und der Junge, an seinem Erdbeereis leckend, lächelt seiner Schwester zu, die zwei Jahre jünger ist, zu ihm aufschaut, wie jüngere Geschwister zu älteren Geschwistern aufschauen, stolz und wissbegierig, sich in ihrer Nähe vor den Gefahren des Lebens beschützt fühlen. Der Junge flüstert seiner Schwester etwas ins Ohr, die daraufhin kichert und für diesen Moment scheinen die Sitzungen in hellen Räumen, mit Therapeutinnen, die ihre Beine übereinandergeschlagen haben, die ihre Haare zum Zopf tragen, ihre Stimmen fürchterlich ins Kindliche verziehen, vergessen und er streckt seine Brust raus, wackelt mit der Hüfte, hüpft von einem Bein aufs andere, was seine Schwester dazu animiert, es ihm nachzumachen, woraufhin ihr Eis auf den Boden fällt, einen vanillefarbenen Fleck auf dem hellen Pflastersteinen hinterlässt und ihr Tränen in die Augen treibt. Kurz nur, weil der Junge ihr sein Eis gibt und sagt, es gibt Schlimmeres als den Verlust einer Eiskugel und dann schaut er zu seiner Mutter, die von der Geste angetan, ihm einen Luftkuss zuwirft.
Der Fleck wird am nächsten Morgen von der Straßenreinigung wegspült. Vermischt mit chlorversetztem Wasser wird er langsam den Bordstein herunterrinnen, in einem Gullischacht verschwinden und von dem anbrechenden Tag, der aufsteigenden Sonne, den Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, die Bussen nachrennen, schwere Einkäufe tragen, überlegen, ob sie die Fenster wirklich geschlossen haben, sich fragen, ob sie glücklich sind, mit ihrem Beruf, die sich einen Ausweg aus der Eintönigkeit erträumen, die ihre Bedürfnisse dem Funktionieren unterordnen, die das Wochenende mit Freunden planen, in Schlangen im Supermarkt den Einkaufszettel noch mal studieren, weil sie das Gefühl nicht loswerden, etwas vergessen zu haben, die sich mal wieder bei ihren Eltern oder ihren Kindern melden müssten, aber abends zu erschöpft sind, um zum Telefonhörer zu greifen und dann doch lieber fern sehen oder Bücher lesen oder auf dem Sofa sitzend Wein trinken und ihrem Partner vom Tag erzählen, vom Chef, der sich wieder aufplustern musste, der alten Frau mit den Plastiktüten, die Pfandflaschen gesammelt hat, der neuen Richtlinie oder dem Formular, auf dessen dritter Seite ein Rechtschreibfehler ist, dem überschwemmten Keller eines Kollegen, der seit Wochen schon gesagt hatte, dass seine Waschmaschine merkwürdige Geräusche macht, den Kindern, die sich in der Schule langweilen und auf die nächste Hofpause warten, den Jugendlichen, die in Parks Gras rauchen und der Meinung sind, ihre Klausuren verrissen zu haben, die sich über Jungs oder Mädchen unterhalten, traurig oder euphorisch werden, die irgendwann zur Uhr schauen und sich verabschieden, den Touristen, die sich vor Sehenswürdigkeiten fotografieren, in Museen einkehren, die die im Reiseführer empfohlenen Restaurants ausprobieren, den Nachrichten, die von Krisen berichten, Toten, Prominenten, die mit Fehltritten auf sich aufmerksam machen, nichts mehr mitbekommen. Der Fleck wird dann schon lange nicht mehr da sein.
So wie der Mann. Er biegt nun um die Ecke, geht seiner Wege, öffnet die Tür zu seiner einsamen Wohnung, macht Dosenraviolis im Topf warm, denkt darüber nach, sich einen Hund anzuschaffen, um sich gebraucht zu fühlen, um an Halt zu gewinnen, obwohl er unschlüssig ist, ob er dadurch wirklich an Halt gewinnen würde und ob er der Verantwortung überhaupt gerecht werden könnte und so isst er die Raviolis im Stehen und der Schatten, den er wirft, wird langsam länger und bald wird der Schatten verschwinden und dann ist nur noch Dunkelheit da und er wird noch immer im Raum stehen, die Raviolis zwar gegessen trotzdem Hunger haben und vielleicht wird er sich an das Mädchen erinnern, in das er mal verliebt war, die in ihm nicht mehr als einen guten Freund sehen wollte und sich dann auf einer Party in einer Ecke mit einem Jungen aus der Parallelklasse verknotet hat und wie sein Herz in tausend Splitter brach und er dann los ist, die Treppe heruntergestürmt, sich aufs Fahrrad geschwungen hat, nach Hause ist und sich im Bett liegend geschworen hat, er würde das nie machen, dieser Demütigung der Liebe noch einmal eine Chance geben.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Liona Binaev
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mir ist heute eingefallen, dass ich gestern tot sein wollte, besser als andersrum. Du hast reichlich eingekauft: Tomaten, Gurken, Quark, Kaffee, Äpfel, Chips, drei Packungen, ich öffne sie alle, Kaugummis, zwei Packungen, ich schmeiße sie weg. Der Zeiger tickt so laut, als wolle er meine Wut erreichen, aber mir geht es großartig, seit nicht mehr gestern ist. Du hast auch drei Konservendosen mit Fisch gekauft, haltbar bis: siehe Seitenprägung, 01/2025.
»Ieh«, sage ich. »Fisch kommt mir nicht ins Haus.«
»Seit wann?«
»Seit gestern.«
Du lachst nicht, ich lache nicht, der Fisch lacht nicht. Ich bestehe darauf, dass wir den Fisch heute essen oder wegschmeißen, du sagst, hast du deine Tage, ich sage, unoriginellerweise ja, wir essen den Fisch zum Mittag, sagst du, mit Kartoffeln.
Heute ist Sonntag, also war gestern Samstag. Am Samstag hat eine junge Frau in unserer Nachbarschaft gegoogled.
Ich gehe spazieren. Du sagst, das Essen ist fertig, wenn du wiederkommst.
Ich biege rechts ab, links ab, geradeaus. Die Welt gefällt mir. Wenn ich lächle, lächelt etwas zurück. In der Bäckerei meines Vertrauens beschenkt man mich mit Spritzgebäck, wenn ich nur einmal im Monat komme. Ich war gestern schon da. Ich will rechts abbiegen, links, nicht geradeaus, da winkt mir jemand zu und ich gehe geradeaus. »Heiß aus der Fritteuse«, sagt jemand und packt mit der Zange zu. »Wie geht es dir?«
»Heute geht es mir großartig«, sage ich.
»Lass es dir schmecken.«
Am Samstag hat eine junge Frau in unserer Nachbarschaft gegoogled, wie man sehr wahrscheinlich am besten stirbt und komplexer Suizid war die Antwort. Sie hat sich diesen Begriff auf der Zunge zergehen lassen wollen, aber er ist nicht geschmolzen, nur wie ein Anker in ihren Bauch gesunken.
Gestern ereilten mich gute Nachrichten, es gibt Antworten auf meine Fragen.
Ich habe mal einem Menschen aus der Uni gesagt, er könne mich immer anrufen und gestern musste ich daran denken, dass ich eine Lügnerin bin, denn gestern hätte dieser Mensch mich nicht anrufen können, ich war unerreichbar. Er hätte im Sterben liegen können und ich war unerreichbar.
Das Essen ist fertig, ich bin heilfroh, dass der Fisch verwertet ist. »Lass es dir schmecken«, sagst du. »Weißt du, was mir aufgefallen ist«, sagst du. »Du hast alle Chipstüten geöffnet und die Kaugummis liegen im Müll.« »Lass es dir auch schmecken, mein Lieber!« »Ich frage mich natürlich, warum du das gemacht hast.« »Google kann dir sicher aushelfen!« Du lachst nicht, ich lache nicht, aber der tote Fisch in meinem Bauch freut sich, Frau Anker wiederzusehen.
»Ich will ein bisschen mehr im Jetzt leben«, sage ich. »Mich irritiert ein Kaugummi, der fünf Jahre haltbar ist. Und Chips, wenn sie immer knusprig bleiben. Das ist sehr unachtsam, so weit im Voraus zu denken.« Du räumst den Tisch ab. »Schauen wir unsere Serie weiter?«, frage ich. »Die geht mir zu lang«, sagst du.
Ich schreibe eine Karte an meine liebe Freundin aus der Uni, weil ich achtsam sein will. Es ist eine Beileidskarte; sie hat guten Humor. Der Tag hat noch neun Stunden und ich schreibe ein paar Karten mehr. Alles Gute an meine Mutter, Herzlichen Glückunsch zur Hochzeit an meinen Bruder, Mit 80 geht die Party erst los an meinen Vater, ich schreibe sogar dir kleinem, fiesen Arschloch ein paar liebe Worte. Deine Karte ist die einzige ohne Text auf ihrer Motivseite. Ein Schmetterling, der sich an einer roten Blüte nährt. Ich finde die Karte pervers, also passt sie gut zu dir.
Diese eine olle Frau aus der Nachbarschaft, die gestern die Macht des Internets entdeckte, hat eine Rasierklinge von ihrem Freund ausgeliehen, Aspirin und Quetiapin in einer Schublade gefunden und ist dann über ein Seil gestolpert.
Du gehst aus. Du sagst, ich gehe aus, weiß nicht, wann ich wiederkomme. Ich sage, du mich auch, du sagst, das finde ich unfair, ich sage, du mich immer noch auch. Du gehst aus. Früher hätte mich so eine Konversation tief getroffen. Gestern zum Beispiel. Gestern hätte ich vielleicht impulsiv gehandelt und versucht, dich meine Rache spüren zu lassen wie die kleinen Borderline-Mädchen mit Verlustangst. Aber heute ist nicht gestern und ich reagiere sehr erwachsen. Ich lasse mir ein Bad ein. Lege George Michael auf und singe fick dich im Takt der Blubberblasenplatzer. Mir fällt ein, dass du dich gestern auch sehr fragwürdig verhalten hast. Mir fällt außerdem ein, dass du dich für dein Verhalten gestern nicht entschuldigt hast. Und du hast der Frau aus der Nachbarschaft außerdem nicht gesagt: Bei deiner Vorgeschichte sollte ich wissen, dass dich solche Konversationen tief treffen. Die Frau hätte darauf wahrscheinlich geantwortet, dass sie sich bemüht, ihr Wohlsein nicht von anderen Menschen abhängig zu machen, da dies den endgültigen Verlust ihrer Autonomie bedeuten könnte. Du hättest vielleicht erwidert: Hä? Oder aber vielleicht: Wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht hättest du gar nichts gesagt und wärst ausgegangen. Ich würde dieser bescheuerten Frau aus der Nachbarschaft gerne mal sagen, dass es unverantwortlich ist, einem Menschen, der mit viel Geduld und Liebe mit ihr umzugehen versucht, eine so große Last aufzubürden und ihn hintergründig für ihre negativen Gefühle verantwortlich zu machen, da sie eben dies in ihren langjährigen Therapiesitzungen zu unterbinden versucht hätte und es eigentlich besser wissen müsste. Aber diese scheiß Frau von nebenan lernt es einfach nicht.
Das Badeöl färbt das Wasser so schön rot wie die Blüte auf der Karte mit dem Schmetterling.
Ich bin froh, dass heute Sonntag ist. Samstage sind schwere Tage für mich. Erstaunlicherweise freue ich mich am Freitagabend immer auf sie, ich steige in die U-Bahn und denke mir, eine Woche geschafft, dir geht’s gut, morgen gönnst du dir mal eine kleine Auszeit, Netflix und Paul Celan, aufstehen gegen 9, Kaffee kochen und während die Maschine schwarzes Gold tropft, meditieren, das goldene Licht überzieht meinen Körper, ein- und ausatmen und es bemerken, ich kann machen, was ich will, der Tag gehört mir, ich könnte jetzt, ich werde jetzt, aber dann kann ich plötzlich nicht und werde auch nicht. Es ist dieses Gefühl im Bauch. Dieser Schrei, nicht von Edvard Munch, es quietscht wie ein Schwein vor dem Bolzenschuss.
Aber daran will ich jetzt nicht denken, es ist Sonntag. Ich schau jetzt gleich Netflix und dann werde ich vielleicht ein paar von Celans Gedichten lesen. Aber erstmal mach ich mir Kaffee. Eine Packung ist leer, aber du hast ja heute neuen gekauft. Ich lächle kurz leicht irritiert, denn heute ist ja Sonntag und ich frage mich, wo du eigentlich eingekauft hast, wenn heute Sonntag ist. Aber dann meditiere ich meine Fragen einfach weg und rege mich nicht über das rote Badeöl auf, das mir aus dem Badezimmer gefolgt ist.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Hatice Acikgoez
Die modifizierte Frau
7 Uhr. Wie jeden Morgen klingelt mein Wecker, den ich seufzend ausstelle. Neuer Tag im alten Leben, das mir nur zuwider wird. Ich stehe auf, sammle die Kleidungsstücke, die wie explodierte Fetzen auf dem Boden verteilt herumliegen auf und ziehe sie mühsam an. Alles wird anstrengender mit der Zeit, wenn man das Leben nur lange genug hasst. Ich laufe ins Bad, pinkle halb neben die Schüssel und springe unter die Dusche. Der fehlende Duschvorhang macht sich jedes Mal durch die Wasserspritzer auf dem Boden bemerkbar. Nach der Dusche steht mein Bad vollkommen unter Wasser. Mir egal.
Schüssel, Müsli, Milch. Löffel, löffeln, Mund. Kauen, Schlucken. Tagein, tagaus.
Wem macht das alles eigentlich noch Spaß?
Bei der Arbeit setze ich mich an meinen Computer und tippe. Nichts was ich hier tue ist von irgendeiner Bedeutung. Langeweile. Stinkende, gähnende Langeweile. Man checkt die Mails, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter und Snapchat. Und scrollt. Und scrollt. Und dann? Bedeutungslose Leere, die einem nur vermittelt, wie wenig man wert ist. Und ein für die ganze Welt sichtbarer Beweis wie viel mehr Wert alle anderen sind.
Wieder zu Hause. Internet, Pizza, Klingel. Essen, Netflix, Duschen. Netflix. Netflix. Netflix. Netflix. Schlafen. Was für ein toller Tag.
19 Uhr. Mein Handy vibriert und ich nehme mit schnell schlagendem Herzen ab. Er ist es. Fragt, was ich heute mache. Was er denn machen will, frage ich. Ich wüsste schon, was er will.
Ich stehe auf, sammle die Kleidungsstücke aus dem Karton, die mir einst so heilig waren und ziehe sie aufgeregt an. Lässt man etwas lange genug zurück werden die Erinnerungen in unserem Gehirn durch einen Filter gezogen und sehen auf einmal fantastisch aus. Die Vergangenheit wird unschlagbar. Die Gegenwart nur eine bittere Enttäuschung.
Ich laufe ins Bad, suche die Tusche, Wimpern und Perücken zusammen.
Makeup, Gesicht, Pinsel. Malen, Verteilen. Wimpern, Zange, Tusche. Endlich wieder. Man, macht das Spaß.
Ich stehe auf der Bühne. Alles, was ich tue hat eine Bedeutung für mich. Mein Herz pocht, angetrieben durch meine schnellen Bewegungen zur Musik, meine Wangen glühen rot durch die Hitze, die Musik ist laut, aber das Dröhnen tut mir gut. An Langeweile kann ich gar nicht denken. Wie viel man auf einmal wert sein kann, wenn man sich selbst schätzt.
Endlich wieder bei ihm. Internet, Pizza, Klingel. Essen, Netflix, Duschen. Netflix. Netflix. Netflix. Netflix. Sex. Schlafen. Was für ein toller Tag.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Rolf Schönlau
Korsaren
Guck mal, da will einer mitfahren, sagte Leon. Halt an, Papa!
Blödsinn!
Wieso, wir haben hier hinten Platz genug. Leon rückte zur Mitte, nah an Anna heran, die sich ganz dünn machte: Bitte, Papa!
Seid ihr jetzt völlig durchgedreht?
Ich dachte, wir nehmen das ernst hier, empörte sich Leon.
Nicole zwinkerte ihrem Mann vom Beifahrersitz aus zu: Tu den Kindern doch den Gefallen.
Wenn ihr unbedingt wollt. Bitte! Stefan bremste abrupt.
Leon beugte sich grinsend zur Seite und öffnete die Tür.
Furchtbar nett, dass Sie mich mitnehmen.
Die Stimme gehörte zu einem jungen Mann, ganz in Schwarz, Cyber-Brille über die Stirn geschoben. Anna und Leon trauten ihren Augen nicht und rückten noch weiter zur Seite. Auch Stefan und Nicole starrten den Tramper an.
Leon hatte als erster begriffen und zeigte auf die Brille: Ist da derselbe Film drauf?
Jep.
Willst du nicht weiterfahren? sagte Anna zu ihrem Vater, der seine Frau fragend ansah, bevor er vorsichtig Gas gab.
Ich glaube, das ist sowas wie ein Schwarzfahrer, flüsterte sie.
Wir sind Korsaren!
Fresh. Immer noch Annas Lieblingswort.
Daraufhin Leon: Ihr doubelt Charaktere?
Nur die Randfiguren.
Und die Brille?
Eye-Trek, ein PMD von 2009. Schon mit See-through Modus. 1,30 Meter virtuelle Diagonale.
Darf ich mal? fragte Anna. Der Korsar reichte ihr Brille und Controller.
Wie lange mussten Sie warten? fragte Stefan mit einem Blick in den Rückspiegel.
Nicht lange. Er lachte. Ich kannte Ihre Buchung und die Strecke. Der Rest ist Berechnung.
Dieselbe Optik, sagte Anna, nachdem sie die Brille mehrmals ab- und wieder aufgesetzt hatte. Vom Motorrad, oder?
Honda CBR 600 RR.
Dürfen Sie das überhaupt? fragte Stefan.
Wir sind Korsaren!
Leon schaute ungeduldig zu Anna hinüber: Lass mich auch mal! Und dann zum Korsar: Darf ich? Noch bevor der nickte, schnappte er sich das Gear.
Nicole fragte den jungen Mann, ob er zu einer Gruppe gehörte.
Nein, antwortete der, aber alle würden sich so nennen, die sich einen Charakter als Avatar kapern und ihn rezzen.
Die was?
Auferstehen lassen, übersetzten Leon und Anna im Chor.
Nicole wollte wissen, ob noch mehr Korsaren unterwegs wären. Er schüttelte den Kopf: Hier nicht. Woanders schon. Auch harte.
Wie?
Einer, den er kennen würde, habe sich einen Jogger gekapert, der im Dunklen plötzlich am Straßenrand auftaucht. Wenn ein SimCar auf seiner Höhe ist, schlägt er auf die Karosserie ein. Da Nicole nicht ganz zu begreifen schien, erklärte er, die Insassen müssten denken, sie hätten den Jogger angefahren, würden aussteigen und ihn auf der Kühlerhaube liegen sehen. Mit Blut und allem.
Ein Albtraum!
Und die Bildspur, fragte Stefan, wo haben Sie die her?
Eine Runde legal fahren und grabben.
Nichts dahinter? hakte er nach. Keine Philosophie?
Na ja, es gebe schon welche, die sich als Sim-Guerilla sähen. Die wollten das Simulacrum per Affirmation aufheben.
Und Sie?
Ich platze gern in fremde Träume.
Schlechte Erfahrungen? wiederholte er Stefans nächste Frage. Nein, nie gemacht. Sein schönstes Erlebnis? Ein Reisebus. Essen, Trinken, alles frei. Super Party.
Leon, gib mir mal die Brille, sagte Nicole. Der reichte sie seiner Mutter und erklärte den Controller: Rechts. Links. Gas.
Los, wir fahren ein Stechen! forderte sie ihren Mann heraus.
Wie?
Motorrad gegen Auto. Sag mir, wo du bist.
Stefan gab markante Punkte an: Rechtskurve – Parkplatz – Steigung – Wildwechsel. Nicole lag anfangs weit zurück, holte aber auf. Bei VW-Cabrio war sie dicht hinter ihm, um bei 12% Gefälle vorbeizuziehen. Auch Stefan gab Gas. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Von ihren Kindern angefeuert, jagten sie über die Landstraße.
Nicole hatte gerade einen kleinen Vorsprung herausgefahren, da erlosch das Straßenbild in der Frontscheibe. Flimmern und Rauschen. Dann der Claim des Betreibers: Mal wieder selber fahren? Wir haben die alten Marken – SimCar.
Gewonnen! triumphierte Nicole.
Nur, weil die Zeit um war, entgegnete Stefan.
Nicole nahm die Brille ab und gab sie zurück: War super! Der Korsar lachte und öffnete die Tür: Danke.
War mir ein Vergnügen, sagte Stefan.
Cheerio, riefen Anna und Leon ihm nach.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Nils Dorenbeck
Gertruds Kleider
Die Bombe fiel in der Nacht zu meinem zehnten Geburtstag. Sie fiel durch das Dach und alle Stockwerke, und dann explodierte sie nicht. Auf dem Wohnzimmerteppich lag sie wie schlafend.
Da wir jetzt kein Zuhause mehr hatten, wurden wir verschickt. Das heißt: Ich wurde verschickt. Meine Brüder mussten wieder nach Frankreich. Ich kam zu Fröschkes. Die Fröschkes hatten Schokolade. Die Fröschkes hatten große Töchter, die kleinen Jungen Schokolade gaben. Dabei war ich ja gar nicht mehr klein, ich war ja jetzt schon zehn. Aber Schokolade hatten die und waren schon große Mädchen und hatten keinen Bruder. Lisbeth hieß die eine, Elisabeth eigentlich, die war sechzehn und hatte Zöpfe, links einen und rechts einen, die machte sie auf am Abend und kämmte sich lange und lachte mich aus, weil mein Mund offen stand, wenn ich zusah am Abend.
"Willste noch Schokolade?"
"Nee."
"Hab auch keine mehr. Darf dir auch nicht so viel geben."
"Will ja auch keine mehr."
"Was willste denn?"
"Nichts."
Und die andere hieß Anna. Die hatte nur einen Zopf, hinten, der war dafür länger; die war auch schon größer. Die hatte schon einen Soldaten. Sagten sie, aber der war nie da. Nur Anna war da. Und Lisbeth. Und die Eltern von Anna und Lisbeth waren da, die waren schon alt. Und Lisbeth kämmte ihr Haar glatt am Abend, und Anna stand schweigend am Tor schon am Morgen und wartete auf Post vom Soldaten. Wenn welche kam, rannte sie auf ihr Zimmer und schloss die Tür ab hinter sich und kam nicht mehr raus da für Stunden, denn der Soldat hat sehr lange Briefe geschrieben. Aber Anna hat nie was erzählt von dem, was er schrieb von der Front. Ich hab auch nie gefragt. Nur Herr Fröschke hat gefragt.
"Was hat er denn geschrieben?"
"Nichts."
"Irgendetwas wird er wohl geschrieben haben."
"Er hat aber nichts geschrieben!"
"Warum schickt er dann Briefe, wenn doch nichts drin steht?"
"Ach Papa!"
"Wo stehen sie denn?"
"Ist doch gleich."
"Nein, das ist nicht gleich, im Krieg ist es nie gleich, wo man steht mit seiner Einheit. Ich habe damals deiner Mutter immer geschrieben, wo wir standen, obwohl wir monatelang in unseren Stellungen hockten."
"Da wird die Mama sich aber gefreut haben."
"Jetzt werd noch frech!"
Und dann floh Anna wieder auf ihr Zimmer und schloss die Tür ab hinter sich, und Herr Fröschke hat erzählt, wie das war in seinem Krieg, wenn sie wochenlang in ihren Stellungen hockten und immer die gleichen Briefe nach Hause schickten. Denn es stand immer das Gleiche drin in den Briefen. Weil sie ihre Stellungen nie verlassen haben, weil die Front sich nicht bewegte, weil jeden Tag das Gleiche passierte, und weil man das, was passierte, nicht nach Hause schreiben konnte und schon gar nicht an sein Mädchen. Aber sein Mädchen hat er geheiratet nach dem Krieg, und sein Mädchen war froh, als es sich nicht mehr ängstigen musste über Briefen, in denen immer nur stand, wie schön der Himmel war über Frankreich. Herr Fröschke hat dann immer sehr lange erzählt, und ich glaube, er hat manches erzählt, was er seinem Mädchen nicht geschrieben hat. Ich war ja ein Junge. Und sein Mädchen ist dann der Anna nachgegangen und hat sie nach dem Brief gefragt, glaube ich, aber anders als Herr Fröschke, glaube ich, und ist dann sehr lange bei der Anna geblieben und hat auch erzählt von dem Krieg von Herrn Fröschke, aber auch anders. Und ich hab Herrn Fröschke zugehört und an Lisbeth gedacht, der ich auch gerne aus Frankreich geschrieben hätte.
Lisbeth aber interessierte sich nicht für den Krieg ihres Vaters und war immer froh, wenn er fertig erzählt hatte. Und manchmal war sie auch froh, wenn ich dann nicht wusste, was ich machen sollte, und dann hat sie mich manchmal gefragt, ob ich ihr nicht ein Bild malen wolle. Malen konnte ich ja, sogar besser als meine Brüder, und das haben sogar die gesagt, wenn ich Männekes malte auf dem Zeitungsrand, denn Papier war knapp. Und einmal hat sie mich gefragt, ob ich ihr nicht ein Bild von ihr malen wolle. Und ich hab ja gesagt.
Als das Bild fertig war, wollte ich es ihr nicht zeigen. Aber ich hatte es ja für sie gemalt, und also musste ich. Sie hat es sich lange angeschaut und nichts gesagt. Und dann hat sie gesagt, dass das Bild schön sei, und ich bin rot geworden und hab gesagt Du-bist-auch-schön. Und Lisbeth hat mich so angeschaut mit ihren Zöpfen.
Und einmal hat auch Frau Fröschke etwas erzählt, weil wieder so lange kein Brief da gewesen war von dem Soldaten, und das hatte auch mit Mädchen und mit Soldaten zu tun. Da war sie noch jung gewesen, noch jünger als Anna, noch jünger als Lisbeth, noch kleiner als ich, ein richtiges Kind noch, und das war noch vor dem Krieg von Herrn Fröschke gewesen, aber Soldaten gab's da auch schon und Mädchen. Frau Fröschke war da ein ganz kleines Mädchen und hatte eine Freundin, die hat sie immer besucht nach der Schule. Und die Freundin hatte eine Schwester oder eine Cousine, die war schon groß und hatte schöne Kleider in ihrem Schrank und viele davon – so viele und so schöne, dass die Freundin von Frau Fröschke immerzu davon erzählt und damit angegeben hat, was ihre große Schwester für Kleider hat. Und Frau Fröschke hat gesagt Das-stimmt-ja-gar-nicht, und die Freundin hat gesagt Es-stimmt-doch, und das ging ein paar Mal so hin und her. Und dann hat die Freundin von Frau Fröschke nichts mehr gesagt und bloß noch geguckt, weil sie so tief Luft geholt und dabei ganz große Augen gekriegt hat, und dann hat sie gesagt: "Und wenn ich sie dir zeige!" Und da hat Frau Fröschke vor Schreck gar nichts drauf gesagt.
"Aber du darfst es nicht meiner Schwester verraten."
"Ich sag nichts, versprochen."
"Los. Komm."
"Ja."
Und dann sind sie in das Haus geschlichen von den Eltern von der Freundin von Frau Fröschke und waren beide ganz aufgeregt, und die Freundin hat den Kleiderschrank von der Schwester aufgemacht ganz leise, und Frau Fröschke hat den Mund nicht mehr zugekriegt vor Staunen, so schöne Kleider hatte die Schwester von ihrer Freundin! Und Frau Fröschke war ganz neidisch auf die Schwester von ihrer Freundin, und ihre Freundin war auch neidisch auf ihre Schwester, aber außerdem stolz, weil Frau Fröschke noch neidischer war als sie selbst, weil das ja nicht ihre Schwester war, die so schöne Kleider hatte. Aber weil Frau Fröschke ihre beste Freundin war, hat sie sie getröstet und mit noch mehr Stolz und noch mehr Neid gesagt: "Die Gertrud hat ja auch schon ‘nen Soldaten!"
Jedenfalls ist Frau Fröschke ganz schnell nach Hause gelaufen und hat geweint und hat zu ihrer Mutter gesagt: "Mama, Mama, ich will auch ‘nen Soldaten!“ Und ihre Mutter war schrecklich entsetzt und hat mit ihr geschimpft. Aber ihr Vater hat sie in den Arm genommen und hat sie gestreichelt und gesagt: "Sei still, du kriegst gleich zwei."
So war das. Das hat Frau Fröschke beim Abendessen erzählt, und Herr Fröschke hat nichts mehr gesagt. Und Lisbeth hat so komisch auf ihre Schwester geschaut, und die hat gelächelt, und Frau Fröschke auch. Und abends im Bett hab ich an Lisbeth gedacht, die auch Kleider trug und schön war und gut roch, und der ich aus Frankreich geschrieben und die ich dann geheiratet hätte, denn die Lisbeth war knorke, und ich weiß nicht warum.
Am nächsten Tag war dann endlich wieder ein Brief da. Aber nicht von dem Soldaten, sondern von seinen Eltern, und Anna hat viel geweint.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Simone Alber
Sinnlosigkeitsprobleme wirksam bekämpfen
Wenn man von einem Sinnlosigkeitsproblem befallen ist, sollte man nicht am Samstagvormittag zum Edeka gehen.
Ein Sinnlosigkeitsproblem krallt sich grau und schwer im Gehirn fest und wabert einem neblig trüb ums Gesicht herum. Es ernährt sich von der Lebensfreude seines Wirts und saugt ihm den Elan aus den Gliedern. „Wozu das alles.“, flüstert es. „Macht doch eh keinen Sinn.“ Ein Sinnlosigkeitsproblem ist in keiner Lebenslage förderlich, aber es gibt doch Tätigkeiten, die kann man trotz akutem Befall einigermaßen ausüben.
Putzen zum Beispiel ist auch mit Sinnlosigkeitsproblem möglich. Das Sinnlosigkeitsproblem motzt dann zwar: „Wird doch eh wieder dreckig!“, aber wenn es die frisch geschaffene Sauberkeit sieht, wird es ein wenig kleinlaut, und das Gemotze wird leiser.
Keller aufräumen, Steuererklärung machen, einen Pulli kaufen: alles Dinge, die sich trotz Sinnlosigkeitsproblem einigermaßen bewerkstelligen lassen.
Man kann mit einem Sinnlosigkeitsproblem auch relativ entspannt vor dem Fernseher sitzen. Das Sinnlosigkeitsproblem hockt daneben und mault vielleicht leise vor sich hin, aber durch die Fernsehberieselung wird es eingelullt und drängt sich nicht in den Vordergrund.
Richtig empfehlenswert ist Kino. Wenn man einen guten Film erwischt, kann es sein, dass das Sinnlosigkeitsproblem gar nicht erst mit rein kommt. Es wartet draußen, oder es geht schon mal nach Hause, und wenn man Glück hat, findet es den Heimweg nicht, und man ist es für eine Weile los.
Auch Joggen ist eine Möglichkeit, um es loszuwerden. Das Sinnlosigkeitsproblem ist eher unsportlich. Wenn man einigermaßen trainiert ist, kann man ihm davonlaufen.
Wäsche aufhängen dagegen ist nicht empfehlenswert bei akutem Sinnlosigkeitsproblem-Befall. Bei dieser Tätigkeit hockt es einem schwer im Nacken, so, und es flüstert einem ins Ohr: „Schon wieder diese Socken, schon wieder diese Unterhosen. Die hast du letzte Woche auch schon aufgehängt. Und morgen wirst du sie wieder abhängen. Und nächste Woche wieder aufhängen. Und dann wieder abhängen.“
Ja, beim Wäsche aufhängen fühlt sich das Sinnlosigkeitsproblem bestätigt.
Aber samstags beim Edeka, da entfaltet es sich zu seiner ganzen Größe. Da trumpft es richtig auf.
Schon die Tiefgarage ist seine Welt. Es schmiegt sich an die grauen Betonpfeiler, und man atmet es ein mit der kalt-feuchten Luft. Es suhlt sich im schmutzigen Wasser der Pfützen. Im Scheppern der Einkaufswagenräder hört man seine Stimme: „Wozu, wozu, wozu.“ Es quetscht sich mit hinein in den Aufzug. Neben die Aufzugknöpfe hat es einen alten Kaugummi geklebt, der seine Botschaft verbreitet: Hoffnungslos. Trostlos. Sinnlos.
Am Pfandflaschenautomat glotzt es einem aus dem Rohr entgegen, in dem die Plastikflaschen verschwinden und sofort geschreddert werden. Aus den überquellenden Süßigkeitenregalen höhnt es: „Auspacken, fressen, wegwerfen. Plastikschwemme. Karies.“
So richtig wohl fühlt es sich in den Gesichtern der Menschen, die einem auf dem Rollband auf dem Weg nach unten entgegenkommen. Müde, graue Sinnlosigkeitsgesichter mit bitteren Kerben um den Mund. „Und ich, und ich?“, fragen die Gesichter. „Wann bin ich dran? Und wer liebt mich?“ Das Sinnlosigkeitsproblem lässt ihre Leben jämmerlich und klein erscheinen.
Das Sinnlosigkeitsproblem klebt in den ungewaschenen Haaren der jogginghosigen Schlurfeinkäufer und ruft zur Resignation auf: „Wozu die mühevolle Prozedur mit dem Shampoo auf sich nehmen! Übermorgen sind sie eh wieder fettig.“
Kartoffeln, Bananen, Haferflocken, Nutella, Mehl, Spaghetti, Salami, Milch, Eier, Joghurt, Emmentaler. Ja, ja, und dann zum Schluss das Klopapier. Das Sinnlosigkeitsproblem nickt sinnig vor sich hin.
Der Wagen voll, das Überleben wieder für eine Woche gesichert. „So viel Mühe!“, sagt das Sinnlosigkeitsproblem. „Und wozu? Arbeiten, Geld verdienen, Einkaufen, Ausräumen, Einräumen, Kochen, Essen, Spülen. Ein ewiger Kreislauf. Und wozu? Alt werden. Sterben.“
Das Sinnlosigkeitsproblem ist kein angenehmer Zeitgenosse. Und Menschen, die von ihm befallen sind, sind ebenfalls unangenehm. Sie sind meist griesgrämig und schlecht gelaunt. Wenn man etwas von ihnen will, werden sie pampig. Und wenn man nett zu ihnen ist, fangen sie an zu heulen.
Wer ein Sinnlosigkeitsproblem hat, sollte möglichst nicht samstags zum Edeka gehen. Besser ist es, darüber zu schreiben. Schreiben findet das Sinnlosigkeitsproblem langweilig. Das gleichmäßige Flüstergeräusch des Stifts auf dem Papier macht es müde. Und in einem aktiven Gehirn kann es sich so schlecht festkrallen. Irgendwann schläft es ein und fällt ab. Da liegt es dann in seiner ganzen aufdringlichen grauen Hässlichkeit und schnarcht vor sich hin. Dann sollte man ganz leise den Stift aus der Hand legen und sich vorsichtig aus dem Zimmer schleichen. Pssssst! Tür zu!
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Thomas Büch
Erinnerung an eine Insel
1.
Ringemeier saß im Nachtbus und bestand beinah vollständig aus Heimkehr. Dabei entzog sich ihr gerichtetes Existieren durch den Ortswechsel jeder Sehnsucht. In Ringemeiers Vorstellung war die Dunkelheit (von Sternen einmal abgesehen) ein vollkommen durchsichtiges Objekt in den weiß behandschuhten Händen ältlicher Pärchen, welche niemand mehr als Eltern beschrieb. Mag sein, dass Mütter, lange in der offenen Tür stehend und von einer gewaltigen Schafherde umgeben, mit nachtblinden Augen auf die ausbleibende Tochter warten. Mag sein, dass die Probleme beginnen, wenn die gute Erde in all ihrer Kugelförmigkeit sämtliche Grenzen an die Endlosigkeit verliert. Mag sein, dass spät nur eine Kategorie von Zeit darstellt. Ringemeier fuhr nach Hause. Sie war größtenteils keine zwanzig Jahre alt.
2.
Schneidinger liebte für sein Leben an R.'s Haut einzig und allein ihre Muttermaligkeit und obwohl man annehmen darf, dass es sonst niemanden auf dieser Welt gab, dem er ein Gefühl entgegenbrachte, das Zuneigung zumindest annähernd ähnelte, sprach er nie von Haut, sondern immer bloß von Integument, so sehr war er Gefangener einer Sprache, die das Verletzlichsein als Konzept des Miteinanders leugnete. Es kann daher kaum wundernehmen, dass er letztlich sogar in weitaus höherem Maße seiner Sterblichkeit zum Opfer fiel, als dies üblicherweise Angehörigen des männlichen Geschlechts möglich ist.
3.
In dem kleinen, ein bisschen verwilderten Gärtchen unserer Protagonistin lebte aber noch viele Jahre ein Maulwurf mit einem siebenzackigen hellen Fleck auf der Stirn. Sie hätte ihn gerne einmal einem ihrer Besucher gezeigt, nur kamen die immer erst in tiefer Nacht, und musste daher dieses pelzige Ding auch einer sehr überschaubaren Miniaturwelt zugehörig erscheinen, so hätte doch kein Mensch je die zum Gestreicheltwerden geschaffene Geschmeidigkeit seines Fells vergessen mögen oder die glücksverlorenen Quieklaute des Winzlings, wenn er sich am Köpfchen kraulen ließ.
4.
Wir alle sind Teil einer vollkommen linear erzählten Geschichte und falls es uns zuweilen auch so vorkommen mag, als bedürfe unsere Flüchtigkeit eines vielstimmigen Chores von Chronisten, wollen wir gleichwohl nie der Kränkung anheimfallen, sofern uns das Gegenteil bewiesen wird.
5.
Es dämmerte schon sehr zum folgenden Tag hin, als der inzwischen arg ramponierte Bus in die Hofeinfahrt einbog. Zu solch exzentrischer Besuchsstunde hielt sich das Empfangskomitee in engen Grenzen, aber ein paar Schafe standen herum. Manch einer wäre ob der Begrüßung durch spärliche Blöklaute und vereinzelte neugierige Blicke enttäuscht gewesen, Ringemeier indes sprang lachend aus dem Führerhaus, und am Himmel leuchtete der Morgenstern aus dem ungeheuren Licht seiner Möglichkeit.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Achim Stegmüller
Verfolgungen
1
„Ich war nicht immer so allein. Ich hatte mal eine Freundin. Wie ich nach ihr Sehnsucht habe. Wäre ich mit ihr zusammen geblieben, hätte mein Leben einen anderen Verlauf genommen. Ich wäre um die Sonne gekreist und nicht um den Mond. Ich säße nicht andauernd hier im Treppenhaus. Sie hat sich immer einen Hasen gewünscht. Einen kleinen weißen Hasen mit roten Augen. Ich habe diesen Wunsch nie erst genommen. Und dann hat sie mich an dem Tag, als ich ein Referat über Strukturwandel im Ruhrgebiet hielt, verlassen. Ich habe es nicht verstanden. Ich war noch beschwingt vom Lob meines Professors. Sie sagte: Du hast mir keinen Hasen gekauft. Und ich: Was? Sie: Du hast mir keinen Hasen gekauft, und deshalb verlasse ich dich. Ich kann ja nicht ewig darauf warten, dass man mir einen Hasen schenkt.“
2
„Ein weißes Monster verbreitet Angst und Schrecken. Es ist so groß wie zehn Eisbären. Wenn es nur einmal sein Maul so richtig aufreißt, ist schon ein halbes Reisbauerndorf weg. Wer kann, der flieht. Und wohin dieses weiße Monster auch kommt, überall sind die Dörfer und Städte schon verlassen. Das weiße Monster wird immer hungriger! Das Monster stößt auf ein neues Dorf. Alle Bewohner sind über Nacht geflohen, nur ein kleines Mädchen ist vergessen worden. Ein Waisenmädchen, eines aus dem Ausland, mit einer anderen Hautfarbe, eines, das die einfache Arbeit im Stall verrichtet. Und wie das Mädchen am frühen Morgen aufwacht, schaut es in die Augen des Monsters. Sie findet diese Augen nett. Das Monster nimmt sie in seine Pranken und hebt sie hoch in die Luft. Das Mädchen fühlt sich wie eine Königin. Sie zeigt dem Monster die Wasser- und Speichervorräte des Dorfes, damit es sich stärken kann. Und dann geht das Mädchen voraus und das Monster hinterher und wie sie so gehen wird das Monster immer kleiner, wird zu einem Hasen. Und noch bevor sie in der nächsten Stadt ankommen, weiß schon jeder: Das kleine Mädchen hat das weiße Monster gezähmt. Man feiert Feste für das Mädchen und das Monster, baut Tempel für sie, aber sie mögen die Stadtluft nicht und ziehen weiter. Erst in einem kleinen Dorf fühlen sie sich wohl. Das Mädchen bekommt dort eine warme Suppe, der Hase Salatblätter. Mit dem Mädchen und dem Hasen kehren Wohlstand und Reichtum in das Dorf ein.“
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Frederike Schäfer
Hugo
1
Ich stehe in einer überfüllten Küche und versuche, gelassen am Kühlschrank zu lehnen. Ich bin Studentin, ich bin auf einer Party. Ich finde das toll, ich muss das toll finden, mich wohlfühlen. Der Kartoffelsalat suppt vor sich hin, das warme Bier in der Wanne mit abgestandenem Wasser, vor einigen Stunden bestimmt frisch und kühl, jetzt den steigenden Temperaturen der Dachgeschosswohnung mit undefinierbarem Teppichboden ausgeliefert. Ich tippe auf Olive. Mit lilafarbenen Tupfen. Und piksen tut er auch. Ein bisschen wie Schmirgelpapier unter den nackten Füßen.
„Sockenparty“, hat Judith gerufen, als wir im fünften Stock ankamen.
„Jaa“, habe ich gesagt und nur gedacht, lustig, ich trage gar keine Socken.
Ja, denke ich, Party. Im Flur sitzen die anderen in einem großen Kreis, die Beine in die Mitte gestreckt. Sieht ein bisschen aus wie eine große, triste Blume, die morgen ihre Eltern besuchen wird und erzählt, wie wahnsinnig toll doch diese Party war. Und ihre Eltern werden sagen: „Jaja, diese Studenten. Als wir noch jung waren ...“ Ich will nicht Teil der Blume sein, aber in der Küche will ich eigentlich auch nicht sein. Um ehrlich zu sein, möchte ich überhaupt und gar nicht auf dieser Party sein. Es ist mittlerweile so eng, dass ich mich kaum rühren kann. Mein Kopf ragt unnatürlich weit in den Raum, weil sich hinter mir ein Gewürzregal befindet und ich meinen Kopf schlichtweg nicht anders halten kann.
Ich nehme mir ein zimmertemperaturwarmes Beck's Holunder und denke nur: Idiotenapostroph.
„Hat jemand einen Flaschenöffner“, fragt mein nach vorne gereckter Kopf.
„Klar“, sagt der Typ neben mir und öffnet meine Flasche mit seiner. Er braucht sechs Anläufe.
„Ich bin Hugo“, sagt er.
„Ich bin Frida“, sage ich.
„Hallo, Frida“, sagt er.
„Hi“, sage ich.
Wir trinken jeder einen Schluck, und irgendwie kommt es dazu, dass Hugo mir Fotos von Kleinkindern zeigt.
„Weißt du“, sagt er, „nur, weil ich ein Mann bin, kann ich Kinder ja trotzdem süß finden, so gar nicht sexuell, meine ich. Aber man muss sich immer irgendwelche perversen Witze anhören. Ist zum Kotzen.“
„Ja“, sage ich. „Ist echt beschissen.“
„Dabei“, sagt Hugo, „ist das doch voll okay. Ich meine wegen Frauenquote und so. Da darf ich doch wohl in einem Kindergarten arbeiten, oder nicht?“
„Ja“, sage ich. „Klar.“
Hugo packt sein Handy weg. Ich sage Handy und nicht Smartphone.
Hugo fragt: „Wollen wir vielleicht woanders hingehen? In Ruhe quatschen?“
„Ja“, sage ich. „Klar, gute Idee.“
Wir gehen in Judiths zehn-Quadratmeter-Zimmer und setzen uns auf die Matratze, die versucht, ein Bett zu sein, aber einfach nur eine harte Matratze auf einem kratzigen Teppichboden ist. Aber es ist ruhig, „zum quatschen“.
„Ich trinke ja keinen Alkohol“, sagt Hugo.
„Ach so“, sage ich, „wie kommt's?“, und trinke einen Schluck von meinem Beck's Holunder.
Hugo zuckt mit den Schultern. „Ach, war 'ne schwierige Zeit, also in der Schule. Alkohol und so. Hab dann entschieden, dass ich das nicht mehr brauche.“
„Ja“, sage ich. Mehr fällt mir nicht ein.
„Ja, auch mit Mobbing und so. Ich war auch richtig fett. War dann erst mal im Kindergarten und jetzt halt hier.“
„Wow“, sage ich. „Super, cool“, sage ich bestimmt auch noch. Hugo ist doch ganz in Ordnung.
2
Wir liegen auf einem neunzig-Zentimeter-Kinderzimmerbett im Haus seiner Eltern. Es müffelt. Irgendwie nach dreckigem Mann mit einer Spur Axe irgendwas.
Wir sind nackt. Ich liege unten. Meine Beine sind gespreizt, er auf mir drauf. Er schwitzt, und sein Rücken ist haarig. Wir küssen uns. Mit Zunge. Eigentlich mag ich das nicht, weil ich es nicht schaffe, meinen Speichelfluss zu kontrollieren, aber gut. Jetzt ist seine Hand zwischen meinen Beinen und versucht allem Anschein nach, seinen Penis in meine Vagina zu befördern. Irgendwie.
„Warte mal.“
Das war ich. Ich drücke Hugo von mir weg und wische mir schnell mit der Hand über den Mund.
Hugo sagt: „Äh.“
„Äh“, sage ich nicht, sondern: „Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir schlafen will. Also, nicht so, zum ersten Mal, meine ich. Ich will mit niemandem zum erstem Mal schlafen, der nicht mein Freund ist, das habe ich dir gesagt. Also, also richtig, meine ich, ein richtiger Freund, mein richtiger Freund.“
„Ja ...“, sagt Hugo. Mit drei Punkten am Ende, ohne zu erklären, wofür die drei Punkte stehen.
„Und ohne Kondom schon gar nicht“, sage ich.
„Ja, äh“, sagt Hugo, „also, es ist so, mit ist das für mich einfach nicht gut. Ich spür da nichts.“
Ich sage nichts.
Hugo sagt: „Ich hab ja auch keine Krankheit oder so. Ehrlich.“
Ich sage nichts.
Hugo küsst mich. Mit Zunge. Ich küsse ihn auch. Ich weiß nicht, wie lange wir uns küssen. Und ich liege immer noch so da, mit gespreizten Beinen. Alles andere würde auch keinen Sinn machen, wenn ich meine Beine lang ausstrecken würde, oder so. Oder wir nebeneinander lägen. Keinen Sinn. Und so ist das ja auch okay. Ich meine damit, Hugo ist schon okay. Lecken ist okay, und ich habe ihm auch einen runtergeholt. Das war in Ordnung. Und jetzt das Küssen, das ist auch in Ordnung. Er mit seiner Zunge, wie ein raues, kleines Tier in meiner Mundhöhle. Und jetzt bewegt er sich ein wenig. Sein Körper ist meinem so nahe, und ich merke erst gar nicht, was da passiert, da ist plötzlich nur so ein Schmerz, so ein Schmerz irgendwie in mir drinnen. Und ich realisiere: Okay, dann habe ich jetzt wohl Sex. So zum ersten Mal. Das ist scheinbar in Ordnung. Und es fühlt sich in mir ein bisschen so an wie beim Schulsport, wenn man durch die Halle rennt und stolpert und mit seiner nackten Haut über den Hallenboden rutscht. Und diese Haut, die gibt nach, und die reißt und die brennt, und gleichzeitig ist da dieses Gefühl von Kälte, das mit dem Schmerz kommt. Und ich, ich liege ganz ruhig da und bewege mich nicht und hoffe, hoffentlich sieht er den Schmerz nicht und die Kälte. Hoffentlich sieht er das nicht. Stattdessen sage ich: „Das tut weh.“ Und Hugo bewegt sich nicht mehr.
„Mann, tut mir leid“, sagt er. Und er küsst mich. Ich weiß nicht, ob ich das will.
Ich küsse ihn auch. Und Hugo bewegt sich jetzt, er wird richtig schnell und stößt und macht Geräusche. Und je länger er sich bewegt, desto weniger spüre ich den Schmerz. Und plötzlich bricht Hugo einfach zusammen, als wäre er bewusstlos. Er rollt sich neben mich, aber er ist nicht bewusstlos. Sein Augen sind zwar geschlossen, aber er lächelt. Ein seliges Lächeln ist das. Und aus mir, aus mir suppt eine warme, klebrige Flüssigkeit. Und mir wird übel, mir wird richtig übel. Und ich sage: „Ich muss mal auf die Toilette.“ Und irgendwie tut es jetzt wieder weh, so richtig weh. Ich pinkel, und es brennt, und da ist Blut. Aber das ist schon okay, das mit dem Blut, so beim ersten Mal.
Und ich komme zurück in sein Zimmer, und Hugo sitzt am Schreibtisch an seinem Computer, und er sagt: „Hey, kann ich eine Runde zocken?“
Und ich sage, „klar“, und lege mich auf das Bett.
„Du bist echt super“, sagt Hugo.
„Dann sind wir jetzt wohl in einer Beziehung“, sagt Hugo.
„Ja“, sage ich, „dann sind wir wohl in einer Beziehung.“
3
Ich nenne Hugo nicht mehr Hugo. Ich sage „Ügó“, französisch.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at