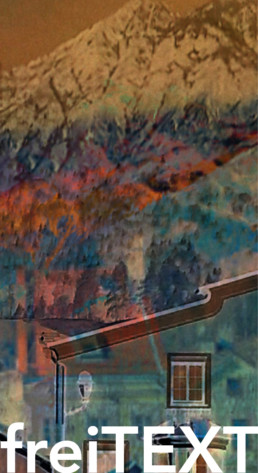3 | Sarah von Lüttichau
Ein Tag im Dezember
„Kennst du die Serie mit dem Drachen, wo …“
„Ich mag diese Drachengeschichten nicht, Drachen sind doch immer nur Stellvertreterprobleme, da macht man sich was vor, ganz klar.“
Das Wetter ist schon wieder auserzählt und ein anderes Thema will mir nicht einfallen, ich schweige, mache mich klein, ziehe die Schultern hoch, die Arme dicht an meinen Körper und beiße in den Apfel, den ich schon seit einer Weile in der Hand halte. Es dämmert bereits. Wir sitzen immer noch auf der Schaufensterbank, unsere Rücken jetzt kalt im Neonlicht. Und er tut mir leid. Ich werde gleich aufstehen und nicht wieder kommen. Manchmal ist es zu schwer, eine Idee in die Wirklichkeit zu holen.
Auf der gegenüberliegenden Straße hat sich eine Plane vom Baugerüst gelöst und flattert im Wind, schlägt gegen das Eisengerüst. Er umschließt seinen Pappbecher mit beiden Händen, atmet schwer und ich frage mich, ob er das auch merkt, dass es da nichts gibt zwischen uns. Ich kann seine Gesichtszüge nicht lesen, nicht mehr. Die Falten, die grauen Haare, es ist immer noch merkwürdig, ihn so zu sehen.
Die Linden haben längt keine Blätter mehr, mit ihrer dunklen Rinde zeichnen sich ihre Umrisse klar von den umstehenden Altbauten ab. Eine Elster schreckt auf, ruft schnalzend laut und wir drehen synchron die Köpfe.
Dann wird es Zeit. Ich beuge mich nach vorne und werfe den Rest vom Apfel in den Mülleimer neben uns und wische meine klebrigen Finger an meiner Jeans ab.
„Ok“, sage ich und er nickt.
„Du hast ja meine Mail Adresse“ und ich frage mich, warum ich das sage, nur um irgendwas zu sagen. Er nickt und schaut noch mal kurz hoch, nickt zum Abschied, wie ein Fremder.
Ich gehe die Straße runter. Die Autos sind so dicht geparkt, dass ich kaum hindurch passe, um die Straßenseite zu wechseln. Ich verstehe, warum das so ist, dass es in der Stadt immer zu wenig Platz gibt und ärgere mich trotzdem. Um mir eine Packung Lakritz zu kaufen, gehe ich in den nächsten Kiosk. Die Verkäuferin ist freundlich, sie wünscht mir einen schönen Abend, lächelt und ich lächle auch. Die Sonne verschwindet zwischen den Häuserschluchten, die Luft wird kalt und klar. Ich setze mich auf die Bank an der Bushaltestelle und reiße die Verpackung auf. Das Lakritz klebt sofort zwischen meinen Zähnen und ich versuche mit der Zunge die Stückchen zu lösen. Mein Telefon vibriert in der Tasche.
EVA: Und wie war es?
DU: Ach, wie immer :(
EVA: :(
DU: Dann halt nicht, ist auch nicht schlimm
EVA: Bist du sicher
DU: ja, schon
EVA: Väter halt …
DU: Lass uns später telefonieren
DU: ?
EVA: !
DU: jetzt Bahnhof, melde mich später
Ein Plastikgeräusch lenkt mich ab. Neben mir eine junge Frau, die umständlich ihre vollen Einkaufstaschen von der einen in die andere Hand manövriert, um ihr Portemonnaie aus der Tasche zu holen. Der Bus kommt.
Wir steigen ein und die Busfahrerin hat tatsächlich so eine rote Mütze auf. Ich frage mich, ob sie dass muss, ob das vorgeschrieben ist. Ich zeige ihr meine Fahrkarte und setze mich auf einen Platz am Fenster. Es ist dunkel und die Weihnachtsdekorationen leuchten in den Schaufenstern des gegenüberliegenden Einkaufszentrums. Menschen in viel Kleidung und mit vielen Taschen schieben sich aneinander vorbei, wollen rein, wollen raus. Mein Atem kondensiert an der Glasscheibe, verzerrt die Lichter und ich wische mit dem Ärmel meiner Jacke darüber. Ich suche die Packung Lakritz und esse weiter. Als der Bus anfährt, lehne ich meinen Kopf an, schließe die Augen. Dann fällt mir auf, dass es das erste Mal seit Jahren ist, das mich das alles nicht traurig macht, dass da nichts ist und ich muss lächeln.
.
Sarah von Lüttichau
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
2 | Georg Großmann
Mühlviertler Nacht
ich befinde mich in den
gestapelten, fest
verzahnten
polyedern, bin
im haus, draußen;
der dreikant-hof, huf-
schläge, leere, die weite,
der wald, der den hof nachts
belauert
drinnen; das wasser, der
saugmund der
abwasch, das
spülkasten-rauschen
draußen; das gluckern der jauche
im hochbehälter, die sprache des blasenschlagenden
dunkels
draußen läuft mein drinnen
mein kochwasser
mein zahnpastaschaum
meine ausscheidung in
den gärenden teich
während sich jemand daneben
versteckt hält und atmet und
hört und weiß, dass ich
da bin, im haus und mich sieht
in den fenstern
und lächelt
und hechelt
und herschleicht
und blicke von draußen
nach drinnen wirft
aus dem weiten
dunkel heraus in die aus-
geleuchteten polyeder
auf mein bildschirm-
beflimmertes
gesicht
.
Georg Großmann
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
1 | Avy Gdańsk
Wortgewand
Alle Wangen sind mit Aufregung bemalt. Ich stecke im Atemgefieder der Menschen fest, es ist zu warm, ich kann mich nicht bewegen. Der Bus ist ein Schiff, die Straße schwappt darunter hinweg. Wir schwanken, der Seegang wirft uns alle aus der Bahn. Quer durch die Sitzreihen segeln Gespräche, eine Gruppe verstreut auf getrennten Plätzen. Zersprengt in Einzelheiten. Ich weiche den zungrigen Mündern aus, ihrem groben Gelärm auf dem Gang, schlage den Kragen ums Kinn. Unsere Köpfe und Schultern im Spiegel, wir sind ein Renoir auf den Scheiben. Die anderen Busse kurze Raupen mit stämmigen Fühlern, die Straßenbahn eine singende Nacktschnecke. Immer wieder fahren sie an uns vorbei und wir passieren lichtgefüllte Fenster, Lebensraum. Das Murmeln der Menschen ein Bienenstock. Mein schwerer Kopf versinkt im Summen wie in einer Kissenhülle. So sprechen die Dämmermenschen: vorbei an den Herzkapillaren. Eine nadellose Sprache, untauglich zum Blutgewinn. Ich wetze meine Worte, will zur feinsten Ader.
Immer weiter geht die Fahrt, immer mehr Ummantelte stürzen heraus, nur ein Falter steigt zu. Unter den wartenden Laternen schwebt eine milde Abendkälte, bei jedem Öffnen der Türen huscht davon etwas herein, ein kühlender Streif über Augen und Wangen, ein Spätherbstschweif. Er fächelt mir Erinnerung um die Nasenflügel, bald ist es Zeit, Endhaltestelle. Ich stehe allein im Bus, Stiefel fest auf dem Boden, die Teerwellen reitend. Wir gleiten durch die Kurven, im Bauch der Schlange bin ich ein schlingernder Schatten in lichttriefenden Innereien, ein Dunkelförmiges unter zuckendem Glas.
Mit Wucht spuckt sie mich aus, ein Ruck brusteinwärts, mein Fuß setzt sich auf unbekanntes Land. In meinen Schritten weiß ich zu gebieten, laufe mal wie Herrin, mal wie Herrscher, die Straßen voll von nichts als meinem Trittlaut. Frei ist nur, wer kein Wohin erfragt.
Das Blattgold der Alleen schimmert auf der Straße, ich schleiche nun, werde zu Lautlosem, bin ein Wanderer zwischen den Fenstern, der sich in der Nacht versteckt, sich anpasst an die Vorwelt – die Gegend vor verschlossener Tür. Auch ein anderer streift durch die Vorwelt, ein Jäger, der Fallen aufgespannt hat in den Lücken zwischen den Mülltonnen, unter den Außentreppenstufen, in den Gittermustern der Gartentore: Netze aus Schwärze, in denen sich jeden Abend ein paar Blicke verfangen, ein paar Unglückliche in den Abgrund fallen mögen. Füllen sich die Netze mit dem Sehnen der Menschen, nährt er sich davon, liefert er das Eingesammelte irgendwo ab? Oder breitet sich die Schwärze in ihnen aus, füllt sie an wie melancholische Plätzchenformen? Was auch immer sein Zeil ist, nie mangelt es ihm an Beute, denn die Augen treibt es nach draußen. Keiner kann es lassen, den Blick auf Wanderschaft zu schicken, weit fort aus dem Gefängnis des Schädels. Die Sehnsucht hört nie auf, immer suchen die Menschen die Welt mit den Augen, und was sie sehen, gibt ihnen Bedeutung, zeigt eine Lesart der Welt. Wie außen, so innen. Aber wenn alles nur ein Spiegel ist – ich passiere eine Tür mit einem Schild in Fraktur, „Familie ist die Heimat des Herzens“ – dann Gnade den Dämmermenschen. Jemand, der sich so an vermeintlich bedeutungsschwere Worte klammert, weil er selbst der Tiefe entbehrt, dem ist auch das Meer nur ein blauer Streifen, ein Urlaubsmotiv, und selbst das muss er nachbearbeiten, damit es den Anschein von etwas erweckt – etwas, das ihm fehlt, das er sucht und das er niemals finden wird.
„Ja, ein unerträglicher Gedanke – die armen Menschen.“
Ich fahre herum und neben mir steht der Jäger, deutet auf das deprimierende Schild, entfaltet ein weiteres Netz. Das spannt er zwischen den Grashalmen des Vorgartens, ein verschachteltes, viellagiges Leporello, das unbemerkt den Garten ziert, der ausartend mit Schildern dekoriert ist.
„Menschen, die Sprüche wie Schutzschilde aufstellen, empfinden einen großen, wenngleich dumpfen Seinsmangel.“
Er pocht gegen ein Blechschild mit der Aufschrift „Mein Haus, meine Regeln“.
„Jeder klammert sich an Worten fest, an irgendwelchen Zitaten, die einen an etwas erinnern sollen oder in etwas bestätigen. Sinnstiftung eben.“
Wieder holt er ein Netz aus der Tasche und beginnt es zu ziehen und zu formen, dehnt das unendliche Nichts.
„Aber wer die Worte noch nie verstanden hat, für den bleiben sie tot, und das ist wirklich allein. Siehst du?“
Erneut zeigt er auf ein Schild neben einem Vogelhäuschen, unter dessen Vordach er sein Netz anbringt. Geknicktes Origami, vernetzte Vorwelt. Seine geschickten Finger spannen das Netz von dort unter dem Schild weiter, zwischen dem bedruckten Holz und dem Baumstamm dahinter, schnippen prüfend mit dem Mittelfinger dagegen, es federt sacht. Das Holz des Schilds ist noch nass von vergangenem Regen, unter der industriell aufgedruckten Schnörkelschrift „A house is made of walls & beams - A home is made of love & dreams“ klaffen die Risse immer weiter auseinander.
„So viel Fremdsprachen, besonders bei Leuten, die keine beherrschen“, sagt er, in seinen Taschen nach neuen Netzen wühlend. „Weiter weg kann man von der Welt nicht sein. Wer nicht mal die Worte richtig kennt, die sie beschreiben – selbst, wenn es nur Plattitüden sind – an dem treiben die Füllhörner vorbei, ohne ihren Reichtum auszuschütten.“
Mit niedergeschlagenen Lidern fingert er ein weiteres Netz aus der Tasche, macht sich unter einem letzten Schild zu schaffen, hier ist die Leere richtig angebracht. Schlicht „Happiness“ auf einer spiegelglatten Oberfläche.
„Ein Wunsch, eine Bitte, eine Beschwörungsformel? Glauben die Leute, wenn sie sich so ein Wort in den Vorgarten stellen, werden sie glücklich? Und was für eine Art Glück soll das sein?“ Er beäugt das Schild neugierig, bringt seine formbare Falltür an. „Wer zaubern mag, muss Opfer bringen. Wer die Welt aufschließen will, muss die Wünschelrute ins eigene Herz stechen.“
Wir treten zurück, bestaunen das Werk von der Straße aus. Ich staune, der Jäger begutachtet vielmehr. Die taschenbesetzten Lagen seiner Überhänge flattern, als der Nachtwindhund vorbei prescht. Er wirft uns aus dem Gleichgewicht, so wenig Halt ist in den blättrigen Schlaufen der Herbstluft – beide landen wir auf den Hosenböden. Mantel und Überwürfe breiten sich um uns aus, wir überdisteln das Grau des Asphalts.
Durch meine fransigen Knie hindurch setzt sich gleichmütig der Bürgersteig fort, zwischen den Gittern des Gullis verschwinden weitere Netze in der Tiefe. Das ganze Gebiet ein fallengespicktes Revier, zappendustere Lauerbeutel überall. Meine Finger spitzen sich ihnen zu, wollen in den Strudel tauchen, nach dem Nichts greifen. Ich drücke sie gegen den rauen Boden und frage den Jäger, wie viele der Schildbürger ihm ins Netz gehen.
„Nicht viele“, meint er mit halbgesenkten Lidern, unter denen die Pupillen klaffen wie zwei Schlüssellöcher. „Sie sehen nichts. Wer Hände hat, der koste, wer Lippen hat, der taste, habe ich jedes Mal in den Abend geflüstert. Man kann das auf viele Weisen verstehen, und jede davon ist nützlich. Aber sie verstehen gar nichts.“
Mit scheuchenden Bewegungen streift er sich den Staub von den Beinkleidern, macht aber keine Anstalten aufzustehen. Ob es ihm gefällt, am Boden zu sein? Auch ich bleibe sitzen. Welche Leute ihm denn dann in die Blickfalle tappen, will ich wissen. Er erwidert: „Was denkst du?“
Weil ich nicht weiß, wohin die Fallen führen, was dort gefangen und eingesammelt wird, kann ich keine Antwort sagen.
„Übergehende Augen aller Art“, beginnt der Jäger, „fallen dort hinein. In meinem Netz entspinnt sich die Welt, die diesseits davon nicht möglich ist, aber mit allen Fäden fest an der hiesigen hängt. Ein Quallenstoff, ein Schwebeteil mit hundert lockenden, hundert begierigen Armen.“
Seine Beschreibung gibt mir Rätsel auf, und er fragt mich verstohlen: „Willst du einen Blick hineinwerfen?“
Ich biete ihm an, ihn stattdessen beim Wort zu nehmen, beim zottigen Wortpelz, sein flackerndes Fell zu halten und ihm nachzusteigen in den goldenen Mund der Morgenstunde, hinter die Mauer aus sonnigen Zähnen.
Doch er verneint – noch brauche er mich hier – und hängt mir den Mond an, eine fliegende Fußfessel, damit mein Schritt schleppend wird und er mich langsam leuchtend erblickt, sobald ich näherkomme. Ich aber, Gestirnshäftling, entsinne mich meiner Zungenspitze und steche eine Silbenader an. Die Blätter steigen vom Boden wie Nebel, heben sich hundertfach empor, ein fuchsschnäuziger Schwarm nach Norden. Die Luft eine bauchige Laubstaude, Dächer stoßen sich an der Errötung. Wie singende Schnabelschuhe tragen mich die Blätter, von meinen Lippen tropft das Zauberwort. Horchte jemand hin, so könnte er es hören.
.
Avy Gdańsk
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiVERS | Chris Lauer
Paternoster
Glück im Unglück,
Wenn nur der Vater
Und nicht die Mutter,
Sagt sie
Und zieht
Das Ginstergelb fest,
Das vorhin im Briefkasten lag.
Doppelt kann man sie binden
Um den Mädchenarm,
Fast dreifach
Am Ende von allem,
Die Horizontebene,
Die sie teilt
In Himmel und Erde
In Himmel und Erde.
Dein Reich komme.
Sie kocht und wäscht
Für ihre Geschwister;
Das Kleinste schieben sie und ihr Bruder
Wie Jungelterngewordene
In einem Holzwägelchen
Vor sich her.
Es schreit nie.
Manchmal denkt sie Unerhörtes,
An Opulenz, im Einschlagpapier eingewickelt:
Eine Vollkornstulle mit Butter,
Und ihr Mund wundet
Von den ausgespuckten Aprikosenenkernen,
Die sie aufsammelt, wenn niemand hinsieht:
Wie Taler blinken sie zu ihr herauf,
Wie braune Paukanten,
Die mit ihrem eingeritztem Spalt
Zeigen wollen,
Dass sie, ganz anders als Frauen,
Keine Schönheit brauchen; dass man sie
Ja nicht mit Frauen verwechseln sollte,
Dass sie sich vielleicht auch wünschen,
Frauen zu sein, weil sie denken,
Als Frau müsse man, ja ja, gespalten sein.
Sie überkaut die Ahnung von Sommer,
Während sie unweit
Das Blechern von Medaillen hört:
Ein Windspielstapeln,
Das schon an der nächsten Straßenecke
Einknickt.
Für Nelly Kerngut
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Senka
Die klirrenden Münzen eines monísto
Sandyr wühlt in Kumkas Deutsche Mark Sammlung und grinst. Ja, das ist genau das, was sie gesucht hat.
Brauchst du sie wirklich nicht mehr?
Kumka zuckt mit den Schultern. Er hat die Münzen aufgelesen, als er klein war, weil er kein Taschengeld bekommen hat, aber eigenes Geld für Gummischlümpfe im Lotto-Laden haben wollte.
Sandyr will die Münzen noch bearbeiten, die Gesichter der Frauen aus ihrem Stammbaum draufkleben und sie in ein monisto flechten. Das wird sie dann anai-anae nennen, als ein Stück für ihre Ausstellung. Da wird es noch geflochtene Panneaus geben, wird ganz hübsch sein. Sie stapelt die Münzen nach Größe. Anai-anae bedeute die Mütter der Mütter, hat sie vor Kurzem gelernt, das sei nämlich ihre Sprache, das Udmurtische, nur ihre Familie hätte das nicht sprechen dürfen. Aber wem erzähle sie das, der Kumka, der kenne das doch sicherlich auch! Sie lacht und wirft das rot gefärbte Haar über die Schulter. Kumka macht: Hm-m. Aber eigentlich kennt er das nicht. Seine Eltern sprechen Russisch, sein Opa auch, er wüsste nicht, ob sie jemals eine andere Sprache hätten sprechen wollen.
Kumkas Mama freut sich besonders, wenn Sandyr zu Besuch kommt. Sie zwinkert ihnen zu, sie sorgt dafür, dass Kumkas Eltern während Sandyrs Besuch nicht in der Wohnung sind. Sandyr hat eine Lebensgefährtin, aber das wissen weder ihre, noch Kumkas Eltern. Kumka weiß das, weil er ihr auf Instagram folgt.
Vor Kurzem hat sie dort ihren Namen von der russifizierten Fassung Aleksandra zu Sandyr geändert, außerdem in der Beschreibung alles gelöscht und „udmurtisch-feministische Liturgie im deutschen Exil“ hingeschrieben.
Kumka fragt, ob sich dadurch was verändert habe. Sandyr rümpft die Nase. Es gab danach einen Shitstorm in so einer Bubble von Leuten, von so scheiß Physiognomikern, die meinen, man müsse am Aussehen einer Person die Herkunft ablesen können, sonst sei diese nicht valide, aber mit solchen Idiotinnen will sie auch nichts zu tun haben. Und sie bekommt mehr Follower-Anfragen von russischsprachigen feministischen Profilen und russisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland, aber sie sei sich da nicht sicher und nimmt nur die Anfrage von Leuten an, die Kunst machen. Hat Kumka gewusst, dass so viele russisch-orthodoxe Kirchen in Deutschland Instagram haben?
***
Sanja hänge andauernd am Handy, ein Wunder, dass sie überhaupt ihre Klausuren bestehe.
Die Mutter skypt mit ihren Freundinnen und sie eröffnen die Runde rituell mit Geschichten von ihren Kindern. Wer zum wie vielten Mal gebärt, wer sich geschieden, wer sich eine Anstellung bei der Gazprom geschnappt hat.
Sandyr macht sich nicht die Mühe, ihrer Mutter zu erklären, dass auf diesem Handy auch die Lektüretexte abgespeichert sind. Sie überfliegt Butler, Kristeva und Žižek, macht sich nebenher Notizen, wie sie alle später im Seminar verreißen wird, und behält die Benachrichtigungen im Auge, ob bei Kommentarverläufen der Eventposts von out-ural Trolle auftauchen, wen sie blockieren, wen sie mit einem präzise gewählten Mat zurechtweisen, wen sie konvertieren könnte.
Konvertieren, Lajma seufzt, Sandyr soll es endlich mal lassen, das so zu bezeichnen. Außerdem spiele sie doch damit voll in dieses Narrativ rein, auf das sich das Propaganda-Gesetz stützt, mit der sozialen Übertragbarkeit… Und sie seien doch keine Sekte.
Manchmal spricht Lajma so, als sei sie Teil von Sandyrs Aktionsgruppen. Manchmal tut sie auf gebürtige Deutsche und will Sachen erzählt bekommen, wie es da so ist, woran sich Sandyr erinnere. Und Sandyr erinnert sich nur an die Sprache, die sie erst nach dem Umzug nach Deutschland gelernt hatte. Alle Erinnerungen, die sie hat, sind Erinnerungen an Urlaube in Russland, im Sommer, wenn die Stadt leer ist, weil alle sich vor dem Stadtsmog in ihre Datschas zurückgezogen haben. Um im Winter hinzufahren, dafür hatten sie keine passende Kleidung.
Ja-ja, winkt Sandyr ab. Gegen den Mat hätte Lajma aber nichts einzuwenden, oder wie?
Gegen den Mat hat Lajma auch was, aber Sandyr verwendet ihn mit Fingerspitzengefühl, da vertraut ihr Lajma schon. Sandyr weiß, dass das keine Worte sind, die man schreit oder inflationär verwendet. Eine knappe präzise Setzung bewirkt mehr. Wie bemitleidenswert verhält es sich im Gegenzug bei den Deutschen oder auch bei den Engländern – wo sie zwanzig Mal „Fuck!“ brüllen müssen, braucht Sandyr nur einen einzigen besonnen ausgesprochenen Begriff und damit ist alles gesagt. Lajma beschreibt Sandyrs Art oft als besonnen. Das lässt Sandyr manchmal daran zweifeln, ob Lajma wirklich hört, was aus Sandyrs Mund kommt.
Du musst halt echt allen in diesem Land andauernd beweisen, dass du kein Kamel bist! schreit Sandyrs Mutter ins Laptop-Mikrophon, damit es bis Russland hörbar ist.
Lajma prustet los. Sie bekommt durch die Kopfhörer nur Fetzen mit, die sie allesamt sehr amüsieren, sie zieht sich den Stöpsel aus einem Ohr: Was soll das denn bedeuten?
Das mit dem Kamel? - Ja.
Kennst du das nicht? Sagt man halt so. - Wo sagt man das?
Na, bei uns. - In Russland? Oder in eurer Familie? Oder auf Udmurtisch?
Sandyr zuckt die Schultern, das weiß sie nicht, aber man sagt es halt so.
Seitdem sagt Lajma, wenn es Sandyr von innen schüttelt und sie niemanden um sich haben will und alle hasst: Du bist kein Kamel. Und Sandyr stimmt zu: Ich bin kein Kamel.
Wenn die russischsprachigen Bekannten in der Uni ihr inadäquates Verhalten vorwerfen, weil sie den Dozenten darauf hingewiesen hat, dass Belarus und Russland zwei unterschiedliche Länder sind, und sein Nachfragen nach ihrer persönlichen Meinung zu Lukaschenko nichts in einem Literaturseminar verloren hätte, sie außerdem nicht qualifiziert sei, irgendwelche Auskunft zu Belarus zu geben, weil sie keinerlei Berührungspunkte mit dem Land hätte. Ich bin kein Kamel.
Wenn ihre Mutter ihr sagt, sie solle die eigenen Nerven schonen und ein gesundes Maß an Ignoranz an den Tag legen und die Nachrichten Propaganda sein lassen.
Today’s affirmation: Ich bin kein Kamel.
***
Wenn Sandyr den Ellbogen versehentlich auf den Tellerrand abstellt, noch während sie merkt, dass es das spitze Gewusel von Perlen an ihrer Haut ist und nicht das glatte Tischholz, und den Ellbogen schnell hochreißt, klappt der Teller bereits um und die Glasperlen platzen unsichtbar über die Küchenfliesen, in die Schatten, die die Tischlampe nicht ausleuchtet. Sie lauscht, ob der Lärm ihre Mutter aufgeweckt hat, aber diese schnaubt leise weiter vor sich hin. Als sich Sandyr auf allen vieren auf den Boden niederlässt, bohren sich die Perlen in ihre Knie, Zehen und Handflächen. Sie verzieht das Gesicht und schüttelt sie sich von den Händen.
Sie stellt sich vor, wie die Perlen zwischen den Fliesen Wurzeln schlagen, sprießen, Blumen tragen und zu Perlensträuchern emporwachsen. Die Perlen reifen in Hülsen heran, wie die dünnen Akazienhülsen, aus denen Sandyr mit ihrem Vater Pfeifen gebastelt hatte. Er pustete rein und es kam ein Ton heraus, Sanja pustete und die Hülse blieb stumm. Sie pustete und pustete, spuckte wütend in die Hülse. Da zeigte ihr Vater auf das Wiesen-Rispengras: Schau mal, Hahn oder Henne? Sanja ließ die Hülse fallen, maß die Rispen mit dem Auge ab: Henne. Ihr Vater zog die Rispen mit Daumen und Zeigefinger am Stiel entlang hoch. Eine lange Rispe schaute aus den restlichen hervor. Na, doch ein Hahn, hm? Sanja schüttelte den Kopf: Nochmal!
***
Sandyr lehnt am Fensterbrett und hält die Tasche und den Mantel ihrer Mutter. Diese schimpft und es hallt bis zur Toilettendecke hoch. Der Termin für den Antrag für die Große Witwenrente, nach dem Absetzen der Kleinen Witwenrente, zieht sich bereits seit zwei Stunden. Sandyr versteht nicht, warum ihre Mutter darauf bestand, dass sie zum Übersetzen mitkam, denn diese versteht alles einwandfrei und schafft es, gleichzeitig auf ihre Tochter und die Sachbearbeiterin einzureden. So schnell kann nicht mal Sandyr zwischen den Sprachen switchen.
Es rieselt in die Kloschüssel. Weißt du, bei uns, da stellt man sich mental auf Schikane ein, ja? Und hier tuen sie auf zivilisiert, machen Sicherheitskontrollen, geben dir so ein Nummernzettelchen und was dann?
Hm-m, macht Sandyr mechanisch.
Und dann sitzt da diese Tussi und wühlt sich durch die Papierstapel und kann nicht mal Kopfrechen! Sandyrs Mutter wäscht sich die Hände ab. Weißt du, bei uns, da weiß ich halt, ich bringe einen Cognac mit und ich erniedrige mich ein wenig, aber dann wird da auch was gemacht!
Sandyr reicht ihrer Mutter die Sachen zurück. Das ist klassistisch, Mama, und du romantisierst Korruption.
Die Mutter gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Wer hat dich bloß erzogen, dass du so aufgeklärt bist, hm?
Sandyr zieht ihr Smartphone hervor, trottet der Mutter hinterher und klickt sich durch die Nachrichten. Neuigkeiten vom Justizministerium Russlands, weitere Eintragungen von queeren und feministischen Initiativen als Ausländische Agenten, Auszüge aus Gesetzesentwürfen gegen Agitation…
Sie öffnet die Kalenderübersicht und starrt auf den roten Eintrag, geht die Check-Liste durch, die sie sich dafür notiert hat. Ja, sie hat definitiv alle Papiere vorbereitet. Sie hat darin einzigartige Expertise, mit acht Jahren ist sie bereits Behörden-Briefe mit den Eltern durchgegangen und war stolz darauf gewesen, wenn sie den Eltern ein „Nein, das muss so!“ sagen konnte. Der Antrag auf das Auslandssemester in Perm sei ohnehin rein formal. Es will ja sonst keiner hin.
***
Lies mir aus den Krym’schen Legenden vor.
Oh, nein, Kind, nicht schon wieder! Hast du danach keine Alpträume?
Nein. Ich will das Märchen über Oksana!
Und das Märchen über das Rübchen? Wollen wir nicht gemeinsam alle Tiere herbeirufen, damit sie zusammen die Rübe herausziehen?
Nein! Ich will das Märchen über Oksana!
Na, wenn schon, dann vielleicht das Märchen von den Schwestern? Wo der einen Schwester der schöne lange Zopf von einer Hexe abgeschnitten wird und sie stirbt, und dann muss die andere Schwester sich den Zopf von der Hexe holen?
Nein! Das Märchen von Oksana!
Und das Zauberwort?
Nein!
Das ist nicht das Zauberwort.
Bitte. Danke. Nein! Sanja plustert sich auf.
Die Mutter seufzt.
Oksana, Oksanochka, so eine schöne Frau, so stark, niemand konnte sagen, er hätte jemals eine Träne in ihrem Auge gesehen. Die schwarzbärtigen Kazaken scheuten sich, sie anzusprechen. Nicht, dass sie sich fürchteten, aber vorsichtig waren sie.
Am heißen Tag ist Stille in der Siedlung. Jeder versteckt sich von der Hitze, und die Oksana trägt das Tragjoch mit den Leinwänden zum Fluss zum Bleichen. Gej-gej, Oksana, Oksanochka…
Gej-gej, Oksana! ruft Sanja.
… Wenn du gewusst, wenn du geahnt hättest, wärst du nicht mit den Leinwänden zum Fluss hinunter gegangen. Du wärst nicht weggegangen, wenn du gewusst hättest, dass von der weiten Steppe Unheil naht.
***
Ein Panneau flechten bedeutet, die Muster der Welt wahrzunehmen, abseits der Muster, die uns von dem ӟуч beigebracht werden. Es bedeutet, zu heilen. Die Hände arbeiten, der Geist arbeitet, langsam mit dem Atem, die Fäden in den Fingerknöcheln eingekeilt. Befeuchte den Wollgarn mit der Spucke, drehe ihn schmal, ordne ihn in das Gewebe ein, kämme die Knoten aus. Du wirst starke Finger haben, starke Handmuskeln. Sanja prustet los und schaltet sich stumm. Starke Finger, ja-ja…
Und behalte unbedingt das Werkzeug deines Vaters, wnuchka, die Birkenrinde und das Brenneisen und das Messerchen. Wer weiß, vielleicht holst du es hervor und merkst, die Rinde, die schmeichelt deiner Haut und du willst sie formen. Dann schnitzt du ein tujesok nach dem anderen und sagst den Deutschen, das sei traditionell, vegan und nachhaltig, aus aufgeforsteten sibirischen Wäldern. Die Oma, die hat ein gutes Auge fürs Marketing, das kommt gut, wenn du die Preise hoch setzt.
Das ist kultureller Exhibitionismus, Oma.
Was sagst du? Du verwendest so schlaue Worte, mein Kind, ich bin so stolz auf dich. Zeigen sie in den Nachrichten bei euch die Brände? Das sind nicht die Gewitter - wann hat es zuletzt Gewitter gegeben? Das sind nicht die Torfbrände wegen der trockenen Erde, nein. Das sind Menschen, die das Gras anzünden, weil sie es immer so gemacht haben, um es schnell auszuroden. Weißt du, das Gras, das könnte man ja auch abmähen. Da sollte es Strafen geben, heutzutage, auf oberster Ebene sollen sie da was erlassen, dass das auch ankommt, bei den Menschen. Dieser Dunst über Moskau vor ein paar Jahren, das hat der Kreml davon, wenn sie Sibirien brennen, wenn sie die eigenen russländischen Menschen das eigene Land anzünden lassen. Wir sind ja schon weit weg hier, was die da oben mit Europa und den USA machen, falls das mal gefährlicher wird, wir sind hier sicher. Wir fürchten Gayropa nicht, wir räuchern uns schon selbstständig aus.
Oma, was sagst du da, das macht keinen Sinn, nimmst du deine Medikamente ein?
Du fragst mich immer nach den Medikamenten, wenn ich dir etwas Wichtiges sagen will.
Ja, aber nimmst du die?
Sanechka, mir gefällt dieser bevormundende Ton nicht. Ich werde jetzt auflegen.
Warte, warte, ich werde bald ganz in der Nähe sein, in Perm.
Was willst du hier?
Naja, arbeiten. Nützlich sein.
Also, ich weiß nicht, meine Liebe, du machst doch was mit Literatur, oder? Das braucht doch hier niemand.
Ich wollte mehr sowas in Richtung Menschenrechte und Feminismus machen.
Ja, aber das braucht doch in Perm erst recht keiner. Sind doch nur Kriminelle dort, gab’s neulich wieder mal eine Statistik, da haben sie das auch dokumentiert, ja.
Sandyr lacht verunsichert auf. Brauchst du mich denn?
Versteh mich nicht falsch, mein Kind, aber ich musste mich daran gewöhnen, euch nicht zu brauchen.
***
Sandyr wartet, bis Lajma eingeschlafen ist, schiebt sie vorsichtig von sich, dreht sich auf den Bauch und legt die Nase an den Bettrand. Sie hat sich in der Kindheit angewöhnt so einzuschlafen. Damals trug sie einen langen Zopf und damit die Hexe ihr das Haar nicht abschneiden konnte, hatte sie es sich unter den Bauch geklemmt. Sie hatte ja keine Schwester, wer hätte ihren Zopf zurückbringen können? Und hätte die Hexe versucht, ihr den Zopf unter dem Bauch hervorzuziehen, da wäre Sandyr schon aufgewacht und hätte sich gewährt.
Am Anfang hat Lajma gefragt: Tut dir der Hals nicht weh, wenn du so schläfst? Sandyr hat versucht zu erklären, mit der Hexe und dem Zopf und der Schwester, und Lajma hat den Kopf zur Seite geneigt: Aw, du warst so ein phantasievolles Kind.
Lajma mag es, Sandyr Eigenschaften zuzuschreiben, bei jeder Zuschreibung runzelt Sandyr die Stirn. Sie fühlt sich nicht besonnen, sie war nie phantasievoll, sie ist nicht mutig. Sie wendet den Kopf zu Lajma und stupst mit dem Zeigefinger in Lajmas Bauchnabel. Sie hat eigentlich keine Ahnung, aber Lajma hat das noch nicht durchschaut. Sie nimmt sich jede Nacht vor, Lajma am Morgen zu fragen: Willst du mich in Perm besuchen?
***
Sandyr schaltet sich stumm, winkt in die Kamera und ergänzt ihre Pronomen im Namen für den Zoom-Calls. Die meisten haben ihre Kameras ausgeschaltet. Sie hat vorab ein Handout an die Organisierenden geschickt, mit Beratungsstellen in Deutschland für russischsprachige, queere Menschen, Migrationsmöglichkeiten und die ersten Schritte, um sie einzuleiten. Es wurden fünf Personen eingeladen, die auf Social Media in Support-Gruppen aktiv sind. Jede soll einen Impulsvortrag halten, was an Deutschland besonders toll sei. Sandyr hatte vorab nachgefragt, ob es denn nicht sinnvoller wäre, aufzulisten, was ihr nicht gefalle, um auf Herausforderungen vorzubereiten, aber das hätte nicht ins Konzept gepasst. Der Umzug ins Ausland sei schon anstrengend genug, die Desillusionierung käme auch so, an diesem Punkt gehe es vor allem darum, Mut zu machen und Kraft zu geben. Sandyr soll als letzte sprechen.
Die Deutschen seien höflich und grüßten immer, das Justizsystem sei gerecht und die Medizinausstattung auf höchstem Niveau, die Polizei behandle einen wie einen Menschen, die Krankenversicherung erstatte alles, der Sozialstaat sorge für jeden, die Politik sei feministisch, klar, weil ja Bundeskanzlerin, die Medien berichteten unparteiisch, Lesben und Schwule dürften heiraten, Kinder kriegen, trans und nicht-binäre Menschen eine Personenstandsänderung machen…
Sandyr hält die Luft an. Sie möchte fragen: Kennt ihr Deutsche, so privat? Allesamt ewig freundliche Übermenschen, die immer hilfsbereit sind, ja? Wart ihr denn nie ernsthaft krank, habt ihr nie nächtelang in der Notaufnahme warten müssen, mit Verdacht auf Schlaganfall bei der Mutter, und dann eine völlig übermüdete Ärztin angeschrien, die auch nichts dafür konnte? Habt ihr schon mal versucht, eine Anzeige gegen fremdenfeindliche Gewalt zu erstatten, und euch angehört, wie der Polizeibeamte immer neue Rechtfertigungen für den Angreifer fand, Verständnis wecken wollte, das sei ja ganz anders gemeint gewesen? Habt ihr nie einer gerichtlichen Auseinandersetzung beigewohnt, Sachbearbeitung von mehreren Jahren, Richter, die irritiert sind, von kulturellen Unterschieden? Habt ihr schon mal jemanden hier verloren und beerdigt?
Sie atmet aus, da ist es wieder: Sie unterstellt, sie wirft anderen vor, etwas nicht erlebt zu haben, als mache sie das zu etwas Besserem, als hätte sie dadurch eine klareren Blick. Sie ist die falsche Person, um bei solchen Runden Erfahrungen zu teilen, oder vielleicht auch: Sie hat die falschen Erfahrungen in einem richtigen System gemacht. Sie muss ein Einzelfall sein, denn wenn sie der Lajma Sachen erzählt, dann erwidert sie: Also, das glaube ich jetzt nicht! Und wenn sie Lajma sagt, das klinge für sie so, als meinte Lajma, dass Sandyr lügt, sagt Lajma: Das verstehst du nicht, das sagt man so in Deutschland, das heißt doch nicht, das ich dir wirklich nicht glaube. Und die Oma, die sagt: Jetzt bist du aber undankbar! Was glaubst, wie es den Kindern auf dem Nordpol geht. Und allen, allen geht es gut in Deutschland und nur Sandyr rutscht durch die Paragraphen, durch die Regelungen, durch die Konzepte.
Sie schaltet ihr Mikro an, zieht die Mundwinkel auseinander und streckt die Nase hoch, damit die Tränen nicht aus den Unterlidern schwappen: Es wurde ja alles schon gesagt, ich würde einfach nur Sachen wiederholen. Wollen wir direkt mit der Fragerunde starten?
***
Sandyr schaut vom Lektüretext hoch. Der Zug ist auf einer Brücke über dem Rhein angehalten. An den Stangen türmen sich bunte Schlössertrauben mit aufgedruckten Initialen. Sandyr fragt sich, ob bei der Konstruktion von Brücken das Gewicht von solchen Liebesbekundungen mitberechnet wird und ob sie einstürzen könnten, wenn zu viele Schlösser angebracht sein würden. Sie stellt sich vor, wie unter ihr die Brücke knarzt, wie der Zug langsam anfängt, in sich zusammenzufallen, und sie für einen kurzen Moment schwerelos wird, ehe der Waggon auf dem Wasser aufschlägt. Sandyr drückt die Wange an das kalte Glas und überlegt, welche Schlagzeilen es gäbe, zu viel Liebe bräche Brücken ein, ein älterer Herr, der sich über den Vandalismus beschwert, den die jungen Leute mit den Schlössern betreiben, vage Stellungnahme der Eisenbahngesellschaft… Sie entsperrt mechanisch das Smartphone und scrollt durch die News Broadcasts, ohne mit dem Blick an den Überschriften hängen zu bleiben. Sie öffnet eine Datei für eine neue Liste. Was zu tun wäre, sobald der Antrag für Perm genehmigt ist. Der Cursor blinkt. Sandyr schaut wieder auf die Schlösser draußen. Die Genehmigung würde erstmal nur eine Reihe weitere Aufgaben zum Abarbeiten bedeuten, das war’s. Sie checkt die Mails, den Telefonverlauf, falls sie zufällig die Benachrichtigung über einen verpassten Sprachanruf weggedrückt hat, wechselt zur leeren Datei zurück.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Samuel Kramer
Ein Vakuum ist unveränderlich ein Vakuum,
es sei denn, es würden Zugänge geschaffen.
Das Gedicht (d. i. das Vakuum) kann nicht vor Publikum wiedergegeben werden.
Wäre es möglich, es vor Publikum wiederzugeben,
würde daraus die Zerstörung des Publikums resultieren.
Das Gedicht kann nicht vor Publikum wiedergegeben werden.
Wäre es möglich, wäre das Gedicht nicht entstanden.
Wenn es möglich wird, wird das Gedicht unmöglich.
Ich wünsche mir die Zerstörung des Publikums.
Zerteilt, ionisiert, verstreut, auf der Suche nach Notausgängen
bildeten sich heilsame Verweise und Klumpen kohäsiver Expertise.
Das Gedicht kann, nachher, nicht vom Publikum wiedergegeben werden.
Wäre das Publikum möglich, würde daraus ein Gedicht resultieren.
Bitte greifen Sie bei Druckabfall nach der Luft. Halten Sie mich nicht
auf. Und bleiben Sie unter keinen Umständen ruhig.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Knaß
Uns Gespenster (Ein Spiegelspiel)
(1)
Vielleicht hatte es etwas mit dem Wasser zu tun und dass ich nach Sternen tauchen wollte, im Fischteich. Sie war am Ufer gesessen, und hatte andere Wörter geformt. Ich dachte, wenn ich das wirklich will, dann hat der Laich Zacken. Meine Beine voller Schlamm, im Hintergrund der Wald und der Berghof. Und zwischen den Grashalmen hat etwas geraschelt. Hörst du es, hat sie geflüstert und mich erwartungsvoll angesehen.
Das Rascheln war kein Geräusch der Wiese, es kam aus einem anderen Leben, wurde immer lauter, bis es uns die Welt abschnitt, wir rannten vor ihm davon, dann, ich verlor Wassertropfen, sie einige Wörter, es hat beides verschlungen, ich weiß das, ohne dass ich hingesehen hätte.
In mein Tagebuch schrieb ich am Abend, das hätte nicht passieren dürfen. Was sie schrieb, weiß ich nicht, aber ich stelle mir vor, das hätte nicht passieren dürfen. Ich stelle mir vor, sie schrieb es mit meinen Tropfen so wie ich ihre Wörter verwendete. Danach haben wir nicht mehr darüber geredet. Ich habe einige Sterne gemalt und daruntergeschrieben: Froschlaich mit Zacken.
(2)
Vielleicht hatte es etwas mit Herkunft zu tun und dass sie nach Meeresrauschen im Wald Ausschau hielt. Sie hatte einen Stift und meinte, sie könne die Bäume damit umschreiben. Sie dachte, wenn sie das wirklich will, dann würde Sand aus den Ästen rieseln. Wir gingen durch eine Wüste zurück zum Hof und verwischten unsere Spuren selbst
An dem Abend hat niemand von uns etwas geschrieben, aber das Geräusch war zurückgekommen. Ich flüsterte, hörst du es, und sie nickte und verlor ihren Kopf dabei. Da wusste ich, dass ich nicht mehr davonlaufen konnte, vor ihm. Also stand ich auf und hielt meinen Kopf fest, während ich auf das Fenster zuging.
Aber als ich den Vorhang beiseiteschob, war da nur eine Wand. Ich habe geflüstert, es ist nichts, es ist wirklich nichts, und ihren Kopf vom Boden aufgehoben. Ich flüstere das noch immer, wenn ich abends allein im Bett liege, es ist nichts, es ist wirklich nichts mehr, es ist niemand. Und jedes zweite Mal glaube ich mir, dass es stimmt.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
POEDU - Text des Monats November
Ich denke, mein Innen sieht aus,
dass ich denke wie mein Innen aussieht.
Mein Innen ist immer genau das, was ich sehe.
Mein Innen ist voller Geheimnisse, wie die Bücher,
die ich nicht gelesen habe. Mein Innen ist ein Schlagzeug,
das mich in Bewegung bringt. Ich bin eine Achtelnote,
weil ich schnell bin. Mein Innen ist mein Herz.
.
Ari
(8 Jahre alt)
.
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe diesmal kam von Kerstin Preiwuß:
Innenleben. Wie siehst du innen aus. Wie sieht das innen aus? Wie sieht das Innen aus? Lebt es? Ist es rot? Kann es pulsieren? Kannst du es fühlen? Fehlt ihm was? Und wie bewegt es sich fort, fährt es Achterbahn oder Geisterbahn? Kann es sich gar verwandeln? Oder bleibt es unsichtbar?
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
POEDU - Text des Monats Oktober
Lautlos
Lautlos tanzt der Staub
Durch die letzten Sonnenstrahlen
Sonst ist es so still
Man hört ihn schon fast fallen
Lautlos pocht mein Herz
Blut fließt durch meine Adern
Sonst ist es so still
Man hört es schon fast knallen
Lautlos schwebt die Luft
Über meinen Körper
Sonst ist es so still
Man hört sie schon fast wallen
Lautlos bleibt die Zeit
Und ist es auch gewesen
Jetzt ist es nicht mehr still
Ich höre sie laut schallen Du Laternenpfahl ganz unten
Du Bürgersteig am Stiel
Du Globuskopf ohne Länder
Du Meer ohne Land
Du Kloinhalt als Burgersauce
Du gemixt braunes Klopapier mit Gartenschlauch
Und Rosenbuschsmoothie
.
Regina
(11 Jahre alt)
.
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe diesmal kam von Hung-Min Krämer:
Oft versuchen wir Erwachsenen, möglichst viele Sachen zu erledigen und haben sehr viel zu tun. Kennst Du das? Aber manchmal nehme ich mir auch Zeit für etwas und dann ist es fast so, als könnte ich die Zeit für ein paar Momente langsamer laufen lassen. Kinder können das meist besonders gut, zum Beispiel wenn Du draußen bist und Dir einen schönen Stein anschaust oder einfach nur für einen Moment den Wind in deinem Gesicht fühlst. Und unser jüngerer Sohn nimmt sich immer Zeit für eine Umarmung. Ich habe mir letztens Zeit genommen, nichts anderes zu tun, als den Wasserkocher Wasser kochen zu lassen.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sophie Vizthum
Seit zwei Minuten offline
Liebe Fanny,
wie geht es dir da drüben in Tokio? Hast du schon einen riesigen Pikachu gekauft? Wie schmeckt Sushi ohne Glutamat? Ich muss dir gleich gestehen, allzu Spannendes kann ich nicht berichten – aber ich habe mich heute nicht übergeben und das ist schon was.
Du fehlst mir hier. Und immer, wenn ich dich vermisse, versuche ich mich abzulenken. Ich habe also mal wieder Tilly geschrieben. Du erinnerst dich vielleicht noch an sie: ich habe sie in so einem Online Forum Anfang der Zweitausender kennengelernt. Die, die auch Probleme hat. Die, die alle paar Sekunden von online zu offline wechselt.
Tilly schrieb mir, dass sie gerade eine Demonstration gegen die Unterdrückung Schwarzer in den USA organisiert. Dagegen kamen mir meine Sorgen irgendwie winzig vor.
Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, was sie sich dadurch erhofft, hier in Österreich? Aber Tilly würde sagen, natürlich verstehst du das nicht, du hast kein Gefühl für die Welt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, warum wir überhaupt noch reden.
Ich habe gesehen, dass du jetzt auch viel postest und so was. Ich hoffe, dass du nicht auch in diese digitale Generation abgerutscht bist, die für alles eine Rechtfertigung parat hat? Du bist nicht schuld am Elefantensterben, dein Einkauf wird CO2-neutral versandt, diese Jogginghose ist aus der schönen Provinz Chinas – das können sie uns ja verkaufen und so, aber glauben muss ich es nicht, oder?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir alles zu viel wird. Ständig gibt es nur Probleme, aber kauf mich, dann geht es dir besser. Wenn ich mir die Zähne putze höre ich fremden Menschen beim Quatschen über Schwangerschaftsprobleme, beim Planen von Weltreisen oder beim Testen von Produkten zu – dabei bin ich weder schwanger, noch habe ich Geld für eine Reise, noch brauche ich so ein Scheißproteinpulver. Aber ich könnte dir stundenlang von Episiotomien und Proteinpancakes erzählen.
Ja, natürlich könnte ich endlich die selbstgemachten Ohrringe von Anna kaufen und sie dadurch unterstützen. Klar, wären zwei Sportleggins zum Preis von einer super. Und die Babybären in Käfigen in Bulgarien tun mir eh leid. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber wo bleibe da eigentlich ich?
Ich habe übrigens jemanden kennengelernt, das wird dich sicher interessieren. Elias heißt er – er kocht gerne und schaut mir beim Spielen auf der Wii zu.
Er merkt sich so Dinge, die anderen gar nicht auffallen. Zum Beispiel, dass ich die eingedrehten Nudeln lieber habe, weil ich denke, sie schmecken nussiger.
Wenn wir gemeinsam kochen, darf ich auf der Fläche gleich neben dem Herd sitzen, wie damals, und rühren. Ich rühre alles um, Wasser, Currys, Chillis, ich rühre mal nach links, mal nach rechts und rede und alles ist gut. Erinnerst du dich noch, damals in der Therapie, da haben wir es nicht anders gemacht.
Wenn ich Elias dann sehe wird sicher alles besser. Er gibt mir das Gefühl, dass es okay ist, mal abzuschalten – wir hören nichts, wir sehen nichts, wir igeln uns ein und der Lärm, den lassen wir vorbeiziehen. Ich glaube, ich werde meinen Fokus auf ihn richten. Zumindest bis du wieder da bist. Schauen wir mal, wie lange es gut geht.
Ich sollte jetzt gehen. Ich bin schon viel zu lange online. Aber eigentlich bin ich gar nicht daheim. Vor mir dreht sich ein Ringelspiel, es dreht und dreht sich und malt eine bunte, runde Spur in die Luft, dort wo sonst eigentlich die Kinder sitzen, weißt du. Die Kinder? Die sind schon lange nicht mehr da. Vielleicht schlafen sie auch nur. Musik höre ich keine.
Jemand in schwarzen Adidas-Hosen boxt gegen einen ledernen Ball. Das dumpfe, mechanische Geräusch des nachgebenden Boxsacks bringt mein Blickfeld zum Wackeln.
Gestern Abend war ich schon hier, mit Elias, wir haben uns Zuckerwatte geteilt und Schaumbecher verschlungen. In der Geisterbahn war mir schlecht. Heute Morgen bin ich wieder gekommen, bin durch die Maschinenreihen spaziert, habe mich auf winzige Fahrgeschäfte gesetzt, die nicht gut genug abgesperrt sind und habe geraucht. Ich habe auch versucht Cola zu kaufen, aber die Automaten blinkten alle rot. Sonst ist noch niemand da. Vielleicht war auch nie jemand da. Und es ist alles nur in meinem Kopf.
Jagen, das tun sie uns alle, mit ihren Scheißideen von Vollkommenheit. Hier sitze ich, kurz nach Sonnenaufgang an einem Junimorgen und überlege, heutzutage nehmen wir die Maschinen überall hin mit. Besonders ist das schon lange nicht mehr. Und freiwillig irgendwie auch nicht.
Ich warte auf Elias.
Schreib mir mal wieder.
Sayonara!
.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at