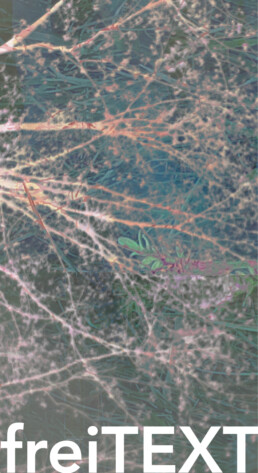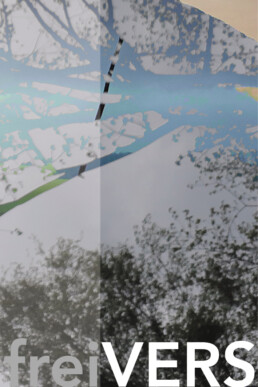freiTEXT | Florian Mittl
Babyblues
Überglücklich war deine Mutter, als sie mir erzählt hat, dass sie schwanger ist. Am Balkon sind wir gesessen, im Herbst, schön war es draußen. Deine Mutter war auch schön, und ich habe sie in den Arm genommen und geküsst und habe ihr zärtlich über den Bauch gestreichelt. Und ich habe überspielt, dass sich mein Bauch zusammengezogen hat. Nichts gegen dich, aber Vatersein war nie ein großer Wunsch von mir. Und wir haben ja nie wirklich gesprochen über das Kinderkriegen. Und dann ist es eben passiert.
Komisch, dass sich das dann so extrem verändert hat. Nämlich bei deiner Mutter. Die Schwangerschaft war okay, keine große Übelkeit, keine Komplikationen. Und da der Bauch im Winter gewachsen ist, war es auch von den Temperaturen her angenehm. Der Geburtsvorbereitungskurs war auch gut. Sogar lustig. Und es hat uns gefreut, dass wir dort Hans und Petra kennengelernt haben.
Dann bist du auf die Welt gekommen, fast zehn Wochen zu früh. Nicht einmal halten konnte ich dich am Anfang. In voller Schutzmontur bin ich neben dir gestanden und habe dich angeschaut, wie du in diesem Glaskasten lagst. Inkubator heißt das Ding. Kommt vom Lateinischen incubare, und das heißt brüten. Auch nicht der beste Name. Da bin ich also gestanden und habe dir beim Brüten zugeschaut.
Währenddessen war deine Mutter mit sich selbst beschäftigt. Postpartale Depression. Auch bekannt als Wochenbettdepression oder Babyblues. Fünfzehn Prozent der Mütter sind davon betroffen. Da rinnen Tränen, Muttermilch und Wochenfluss. Und zwar ständig. „Hat mit der Hormonumstellung zu tun“, haben sie uns gesagt. Und rundherum gratulieren dir alle. Haben ja keine Ahnung. Auch Hans und Petra nicht. Zu denen war ich dann einmal ziemlich ungehalten. Seither Funkstille.
Nach zwei Wochen Sonderurlaub bin ich heute zum ersten Mal wieder im Heim gewesen. Noch müder als sonst, noch desillusionierter. Meine Kollegen haben mir auf die Schulter geklopft, dann haben wir das Wesentliche der Dienstübergabe besprochen.
Danach habe ich meine Runde gemacht, das übliche Warm-Satt-Sauber. Den Herrn Schober habe ich geduscht, der hat sich gefreut. Genüsslich gebrummt hat er, als ich ihn abgetrocknet habe. Aber dann ist schon Katharina hereingestürmt und hat mich aufgefordert, mich zu beeilen. Die Essensausgabe stehe an. Nach dem Essen die Leute zurück in die Zimmer bringen, danach ein bisschen Papierkram. Dann hat Katharina gesagt, dass ich Frau Koracek reinigen soll. Komplett voll war die, von oben bis unten. Durchfall der allerersten Sahne, genau während dem Wechsel der Windel. Als ob ihr Darm genau diesen Moment abgepasst hätte. Eh klar, dass die Oberschwester da mich ruft. Immerhin hat sie mir assistiert und dabei geholfen, Frau Koracek in die Dusche zu bringen. Was für eine Sauerei. Die Laken habe ich volley weggeschmissen.
Frau Koracek ist in einem ähnlichen Zustand wie du, habe ich mir gedacht, als ich sie nach dem Duschen frisch gewickelt habe. Im Alter wird man eben wieder jung. Nur, dass dein Stuhl besser riecht. Also noch nach gar nichts. Katharina hat inzwischen das Bett neu überzogen und gemeinsam haben wir sie hingelegt. Frau Koracek hat immer wieder etwas Unverständliches gemurmelt und mich dabei direkt angeschaut. Ich habe sie ignoriert, aber Katharina hat gemeint, dass sie „Foto“ sagt. Ich dachte zuerst, dass sie ein Foto von ihrer Familie sucht, aber die standen alle gerahmt am Nachtkastl oder lachten von den Wänden. Dann ist mir gekommen, dass sie vielleicht ein Foto von dir sehen wollte. Frau Koracek habe ich in den letzten Wochen alles erzählt, jeden Tag ein bisschen. Von dir, deiner Mutter, dem Krankenhaus, dem Brüten, Hans und Petra, alles. Irgendwem musste ich es erzählen und bei Frau Koracek weiß man, dass das Gesagte unter uns bleibt.
Ich habe also auf meinem Handy geschaut und gesehen, dass ich nur zwei Fotos von dir habe. Eines ist unscharf. Das zweite zeigt mich mehr als dich. Ich stehe neben dem Inkubator und strecke beide Hände durch die Öffnungen zu dir. In voller Schutzmontur, weil du so empfindlich warst. Von dir sieht man nur einen undefinierten rosa Fleck, einen Teil deines Gesichts zwischen Decke und Kopfpolster. Mich sieht man aufgrund der Atemmaske auch nur zum Teil, aber der gequälte und hilflose Blick fällt trotzdem auf. Ich habe das Foto zuerst Katharina gezeigt, die ratlos die Schultern gehoben hat, dann Frau Koracek. Die hat die Zunge rausgestreckt und schnell hin- und herbewegt. Ganz aufgeregt war sie, als sie dich gesehen hat.
***
Nach drei Tagen durchgehend Dienst heute wieder bei dir im Krankenhaus. Deine Mutter lässt dich grüßen, sie schafft es heute nicht.
Ich darf noch nicht rein zu dir und im Wartebereich läuft ein Fernseher. Fußball. Stimmt, Sturm Graz spielt heute um den Titel. Na dann. 0:0 steht es, in der 66. Minute. Und anscheinend gewinnt Salzburg gerade haushoch im Parallelspiel. Also eher nix mit Titel. Nicht, dass mich das sonderlich interessieren würde.
Und dann passiert es doch: 69. Minute, 1:0 Sturm. Alle freuen sich. Toben. Die Fahnen schwingen. Unerwarteterweise freue ich mich auch. Und fühle mich als Teil von etwas Größerem. Kitschig, oder?
Aber der Kitsch gehört auch dazu, denke ich mir, nehme mein Handy heraus und gehe auf die Webseite des Fanshops von Sturm Graz. Schnell finde ich die Babysachen und bestelle einen Body in Schwarz-Weiß. Süß sieht der aus. In ein paar Wochen wirst du hineingewachsen sein. Willkommen im Leben.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Ferenc Liebig
Meldebescheinigung
Der Junge ist damit beschäftigt,
seine Ausweisnummer an ein Gedicht zu hängen,
Zahl für Zahl den Begriff Herkunft abzutragen,
als wäre er ein Fluss und seine Heimat ein Felsen,
denn von Liebe und Tod redet es sich leichter,
von den Gewissensbissen, die nur aufwühlen
und keinen Trost verteilen,
von grasbewachsenen Berührungen,
die am Handtuch enden,
sei getrocknet, schreibt er,
du missverständliche, verschwitzte Achsel,
sei endlich, schreibt er,
du überforderte, schiefe Schulter.
Er beendet das Gedicht mit der Zeile
und doch findet sich überall Glück darin
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jörn Birkholz
Batalski
Neun, sieben, acht, drei, sechs, fünf, acht, drei, sechs, vier, fünf, eins. Enter. DIESEN ARTIKEL KAUFEN WIR NICHT. Hätte Batalski sich ja denken können. Das Buch, irgendein preisgekrönter Schwedenkrimi, bringt nichts ein – zu alt. Im Grunde braucht man nur nach dem Erscheinungsjahr zu schauen. Alles, was älter als ein oder zwei Jahre ist, kann man vergessen. Oh, was haben wir denn da? Batalski stellt das versiffte Roßhalde von Hesse zurück in den Schrank, ohne die ISBN überhaupt einzugeben und greift sich das guterhaltene, also noch nicht gelesene Werk Ein tödliches Geheimnis – in Blut geschrieben von Nele Neuhaus. Grad mal ein Jahr alt. Er schöpft Hoffnung, hämmert die ISBN ins Handy und tatsächlich: Momox bietet ihm 2 Euro und 13 Cent. Ab in die digitale Verkaufsbox. Ein sinnloses Glücksgefühl durchströmt Batalskis Körper, wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, das einen Spielsüchtigen kurzzeitig überkommt, wenn der Spielautomat mit fröhlichem Piepen ein paar Eurostücke ausspuckt.
„Na, was dabei?“, kommt es plötzlich von der Seite. Verdammt, Batalski hat nicht aufgepasst; da ist er wieder, der zigarrerauchende Fahrradmann mit dem langen Mantel und dem Indiana-Jones-Hut – allerdings in schwarz. Batalski glaubte um diese Zeit, so kurz vor Mittag, hätte er seine Ruhe. Augenblicklich riecht es nach Raucherkneipe, obwohl sie draußen ein paar Meter vom Rhein entfernt vor diesem überfüllten Bücherschrank stehen. Der Hutmann schielt skeptisch auf das dicke Neuhaus Taschenbuch in Batalskis Hand. Hutmann weiß, dass Batalski nicht zum Stöbern oder Schmökern herkommt – schon gar nicht in dem mit Blut geschriebenen Geheimnis von Frau Neuhaus – sondern lediglich um „abzusahnen“. Trotzdem scheint Hutmann Batalski zu mögen, denn er versucht ständig ihn in ein Gespräch zu verwickeln, wobei Gespräch nicht ganz richtig ist, vielmehr beginnt Hutmann jedesmal einen Monolog, wenn er Batalski antrifft. Und er trifft ihn oft an, was Batalski ein bisschen peinlich, aber auch nicht zu ändern ist. Oft sieht Batalski den Hutmann, wenn er, ebenfalls mit Fahrrad, den Bücherschrank am Rhein ansteuert. Der schwarze Hut, der Rauch und der Mantel sind nicht zu übersehen. Rasch biegt Batalski in eine Seitenstrasse und wartet dort einen kurzen Moment. Schnell hat er gelernt, dass der Hutmann sich immer für höchstens drei bis fünf Minuten beim Bücherschrank aufhält. Einmal konnte er ihn aus sicherer Entfernung sogar beobachten. Weder stellt der Hutmann etwas hinein, noch nimmt er etwas heraus. Er sortiert! Hutmann stellt die Bücher ordentlich, soweit das möglich ist, zusammen, schwingt sich dann wieder auf sein Rad und macht sich auf den Weg zum nächsten nicht weit entfernten Bücherschrank an der Mainzer Volkshochschule. Von dort gehts dann zum dritten und letzten Bücherschrank, dem in der Mainzer Neustadt. Woher Batalski das weiß: weil er selbst diese drei Schränke aufsucht um seiner kleinen Nebenbeschäftigung nachzugehen. Diese drei Schränke liegen alle verhältnismäßig nah beieinander. Mit dem Rad braucht er höchstens zwei bis drei Minuten von Schrank zu Schrank. Nach kürzester Zeit hat er sogar Hutmanns bevorzugte Zeiten mitbekommen. Hutmann dreht seine erste Runde recht früh morgens, dann eine zweite am frühen Nachmittag und er beendet den Tag mit einer letzten Runde am frühen Abend. Batalski weiß das alles so genau, weil er genau zwischen diesen Schränken wohnt – und er bemerkte den rauchenden Hutmann bereits, bevor Batalski selbst überhaupt auf diese Schränke aufmerksam wurde.
„Neuhaus?“, kommt es jetzt leicht angewidert aus dem Hutmann heraus. Sowas geschieht selten, oder fast nie, dass er Batalski direkt anspricht.
„Ich brauche ein Geschenk für meine Mutter“, lügt Batalski, „und es ist gut erhalten“, beendet er den Satz mit der Wahrheit.
„Ja, viele ältere Leute mögen sowas wohl“, entgegnet der Hutmann und beginnt sogleich damit den Schrank aufzuräumen. Ob Hutmann ahnt, dass das meiste Chaos von Batalski angerichtet wurde? Tatsächlich ist Batalski immer recht hektisch und ungeduldig, wenn er sich dem Inhalt dieser Schränke widmet und er schmeißt die „wertlosen“ Bücher einfach oben auf die anderen Bücher drauf. Zeit ist schließlich Geld. Während der Hutmann sortiert, stellt Batalski Das tödliche Geheimnis zurück ins Regal, nach dem Motto, vielleicht ist es ja doch nicht das richtige Geschenk für seine liebe Mama. Was ohnehin egal ist, da Batalskis Mutter in ihrem Leben nie Bücher gelesen hat, seit fünf Jahren tot ist, und er das Ding, sobald Hutmann weg ist, sofort wieder aus dem Schrank fischen wird. Zudem schielt er auf einen relativ neuen, gebundenen und guterhaltenen aber tatsächlich grottenschlechten Suter-Roman und kann es kaum erwarten, dass der Ordnungsfreak mit seiner Aufräumaktion fertig wird und zum Schrank an der Volkshochschule oder in der Neustadt verschwindet. Batalski befürchtet, dass der Hutmann sich extra Zeit lässt, weil er den „Plausch“ mit ihm – warum auch immer – anregend findet. Plötzlich gesellt sich eine ältere Frau zu ihnen, beziehungsweise zwängt sich zwischen den beiden durch und stellt irgendein abgegrabbeltes Kochbuch und Frank Schirrmachers Das Methusalem-Komplott umständlich in den Schrank. Wenn sie gleich weg ist, wird Batalski sich auf die Schirrmacher-ISBN stürzen. Sofort rückt der rauchende Hutmann die beiden Neuankömmlinge gerade ins Regal, die Omi schluderig reingestellt hatte. Die alte Dame verschwindet wieder, nachdem sie kurzzeitig die Neuhaus so halb aus dem Regal zog – Batalski blieb fast das Herz stehen – aber sie gleich darauf wieder zurück schob. Sie fühlte sich sichtlich unwohl zwischen den beiden Herren und der penetrante Zigarrenrauch tat sein Übriges. Batalski starrt weiterhin auf Suter.
„Kennen Sie eigentlich den Kollegen mit dem tiefergelegten Fahrrad?“
„Bitte?“, fragt Batalski.
„Na, der mit dem tiefergelegten Fahrrad. Der hat so n Pferdeschwanz und fährt immer zwischen den Schränken hin und her.“
„Ach der“, sagt Batalski, obwohl er keine Ahnung hat, um wen es geht.
„Ja der, der macht das seit 2010, solange beobachte ich den schon. Also im Grunde solange diese öffentlichen Bücherschränke hier überhaupt stehen.“
„Aha“, erwidert Batalski und starrt weiter auf Suter und den schon verstorbenen Schirrmacher.
„Ja, der lebt davon! Der hat sein ganzes Leben nie gearbeitet, bezieht Bürgergeld und fährt den ganzen Tag hin und her und sucht die Schnäppchen. Ich beobachte den schon lange, wissen Sie?“
„Aha.“
„Der nimmt hier so n paar Schrottbücher raus, dazu die, die ein bisschen was wert sind und fährt dann zum nächsten Schrank und stellt die Schrottbücher da wieder rein. Verstehen Sie, was ich meine?“
„Ja, ja.“
„Hab ich alles beobachtet. Damit die Leute nicht denken, dass er nur nimmt. So stellt er den Dreck wieder rein und die Guten behält er natürlich. Und dann fährt er zum nächsten Schrank. Verstehen Sie, was ich meine?“
„Ja, ja.“
„Der Kreislauf im Schränkedreieck“, lacht er jetzt rauchausstoßend.
Batalski grinst ihn dümmlich an.
„Der ist auch ziemlich aggressiv und duldet keine Konkurrenz.“
Der Hutmann blickt ihn jetzt ganz spitzbübisch an und pafft an seiner Zigarre. Batalski wird ein bisschen schlecht. Aber er kann nicht gehen, nicht ohne seine Ausbeute.
„Der wohnte bis vor kurzem noch bei seiner Mutter. Die ist jetzt wohl auch schon seit zwei Jahren tot. Und so dreht der seine Runden, Wie gesagt, seit 2010! Ich kenne seine Zeiten ganz gut. Die erste Tour macht er gleich ganz früh morgens, um alles was spätabends noch reingestellt wurde abzugreifen? Viele machen grad hier am Rhein noch Abendspaziergänge und stellen dann gerne noch die Bücher rein. Da hinten wohnen doch die ganzen Bessersituierten.“ Er weist zu irgendwelchen stylischen Neubauten hin. „Die Leute stellen dann die neuen, teuren Bücher da rein, die sie kurz vorher zum Geburtstag oder zu sonstwas bekommen haben – irgendwelche Optimierungsratgeber oder Bücher über Beschneidungsschicksale im Sudan”, lacht er, „und die sie sowieso nicht lesen werden. Abgesehen davon, reiche Leute lesen ja nicht.”
Arme Leute auch nicht, denkt Batalski.
„Aber diese Bücher bringen noch was ein, und dann kommt morgens ganz früh der Kollege und holt alles raus. Seine zweite Tour macht er dann nachmittags und die letzte am frühen Abend.“
„Aha.“
„Ja, ein ganz unangenehmer Typ ist das“, beendet der Hutmann seinen Monolog, während er weiterhin damit beschäftigt ist, die Bücher ordentlich in Reih und Glied zu stellen. Batalski verkneift sich zu husten, der Rauch ist langsam unerträglich.
„Also dann, noch viel Erfolg beim Suchen“, verkündet der Hutmann plötzlich, schwingt sich auf sein Rad und verschwindet. Der Zigarrengeruch bleibt zurück und das sogar unverhältnismässig lange. Nachdem er weg ist, greift sich Batakski sofort den Suter-Roman, mit dem kindischen Titel Der rosa Elefant, 1,51 Euro. Stabil. Dann wird noch der Schirrmacher gecheckt, der nichts einbringt. Vielleicht hat Omi es vorher geprüft, aber wahrscheinlich eher nicht. Omis sind da nicht so. Das Teil ist von 2004, daher für momox komplett wertlos. Dennoch, zusammen mit einem alten Sartre-Taschenbuch Mai 68 und die Folgen (0,15 Cent) hat Batalski immerhin eine Ausbeute von insgesamt 3,79 Euro. Mal sehen, was der Schrank an der Volkshochschule gleich zu bieten hat. Allerdings sollte er noch ein bisschen warten, bis sein rauchender Freund dort aufgeräumt hat. Aber vielleicht auch lieber nicht zu lange, bald ist es drei und Batalskis schärfster Konkurrent könnte schon mit dem tiefergelegten Fahrrad auf dem Weg hierher sein. Das ist Batalski langsam alles zu aufregend, er sollte sich einen neuen Job suchen. Er steigt auf sein Fahrrad und macht, dass er verschwindet. Die Luft riecht immer noch nach Zigarre.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Chrischa Oswald
Was bleibt
nach den Sommern
in den Auslagen
ist immer das Blau
Augen liegen am Boden
und ich sammle sie
mit meinen Sohlen
wie süße Beeren
Was bleibt
nach den Sommern
ist immer das Blau
Und der Blick
der sich umstülpt
nach innen
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Zara Leander
Krokodilszähne
Du machst gerade deinen Mittagsschlaf, während ich das schreibe. Mams liegt auf dem Sofa mit dem Laptop auf dem Bauch und tippt mit halboffenen Augen. Seit ein paar Tagen schreist du in der Nacht. Die Ärztin sagt, das kommt, weil dir Zähne wachsen. Es ist gut und wichtig, Zähne zu haben. Aber das kannst du noch nicht verstehen.
Gestern hat Mams beim Kochen geweint. Sie hat den ganzen Nachmittag in der Küche gesessen und ich durfte nur rein, um mir ein Glas Wasser zu holen. Du warst bei Grossmams, damit sie lernen kann. Als ihr zurückkamt, hat sie Mams gescholten, weil ich noch nichts gegessen hatte.
Es kommt vor, dass sie plötzlich zu weinen anfängt. Meistens gibt sie mir einen Kuss auf die Stirn und sagt, dass es nichts mit mir zu tun hat. Dann gibt sie mir dich in die Arme, geht in ihr Zimmer und wenn sie wieder herauskommt, ist alles gut. Aber gestern hat sie einfach weiter Käse über die Nudeln gerieben. Ich bin zu ihr hin und habe ihre Beine umarmt, wie ich es gemacht habe, als ich noch klein war. Sie ist ganz still gestanden, mit der Käsereibe in der Hand. Und als ich ihre Beine losgelassen habe, ist sie auf den Balkon und hat eine Zigarette geraucht. Ich hasse es, wenn sie Zigaretten raucht.
Du hast deinen Schoppen getrunken. In der Nacht davor hattest du wieder Schmerzen. Mams hat für dich gesungen und dich geschaukelt, bis du eingeschlafen bist. Danach ist sie ins Bad, hat ihre Haare gebürstet und die Lippen angemalt. Erst mit einem Töpfchen rosaroter Farbe, dann mit einem dünnen, dunklen Stift. Sie hat eines der schwarzen Tops angezogen, die hinten im Schrank hängen. Dann hat sie etwas aus der Kommode in ihre Handtasche gepackt und ihren Schlüssel gesucht.
Eigentlich wollte ich mich vor die Haustür setzen und weinen, weil ich es hasse, wenn sie uns alleine lässt. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Erst als sie den Schlüssel zweimal umgedreht hatte und ihre Schritte im Treppenhaus leiser wurde, bin ich aus unserem Zimmer gekommen und auf den Balkon gegangen. Sie fuhr aus der Garage und bog in die Strasse ab. Ich habe gewinkt und nach ihr gerufen. Aber sie hat mich nicht gesehen.
Du hast von all dem nichts mitbekommen und deinen Daumen gelutscht. Wenn du so still bist, denke ich, dass du etwas träumst, das mit uns nichts zu tun hat. Du bist an einem Ort, von dem nur Babys träumen können, einem breiten, braunen Fluss.
Manchmal stelle ich mir vor, dass dir gar keine Menschenzähne wachsen, sondern Krokodilszähne. Erst fällt es niemandem auf, aber nachdem du ein Kind auf dem Spielplatz gebissen hast, bemerken die anderen, dass etwas an dir anders ist. Später bekommen wir das Klassenfoto nach Hause und alle Eltern starren nur auf dein Lächeln, fasziniert und verängstigt zugleich.
Mams sagt immer, ich solle dich in Ruhe lassen, wenn du schläfst. Aber ich habe dich aus deinem Gitterbett gehoben und durch die Wohnung getragen, weil mir alles so still und leer vorkam. Du hast ein bisschen gequengelt und geweint, bist dann aber an meiner Schulter wieder eingeschlafen. Als ich dich zurück in dein Gitterbett legte, hatte ich einen Sabberfleck auf dem T-Shirt.
Ich holte mir Cinniminnies aus der Küche und schaltete den Fernseher ein. Mams hasst es, wenn ich aus der Packung esse. Ich glaube, deshalb habe ich es gemacht. Auf den meisten Sendern waren die Bilder dunkel, es gab viel Wald und Polizei. In einem Film ging es um einen Mann im Gefängnis. Er hatte einen orangen Anzug an und viele Tattoos, darunter eins im Gesicht, wie Sam. Ich weiss nicht, ob du dich an ihn erinnerst. Er hat rote Haare, Sommersprossen und ein Spinnennetz unter dem linken Auge.
Bevor du gekommen bist, sind Sam, Mams und ich oft in den Park gegangen. Sam hat einen Drachen mitgebracht, wenn es windig war, und ich durfte ihn steuern. Auf dem Drachen war ein Feuerwehrauto, das in der Sonne rot glitzerte. Als Mams und du im Krankenhaus wart, hat er einen Luftballon gekauft, den er an euer Bett gebunden hat. Er hat sich auch deinen Namen auf den Unterarm tätowiert, mit Sternen drumherum. Das fand sie erst nicht gut. Aber dann hat sie es Grossmams erzählt und dabei gelacht. Also muss es ihr doch gefallen haben.
Abends haben wir immer zusammen Fernsehen geschaut. Sam hat in Mams Zimmer geschlafen und seine Zahnbürste im Bad gelassen. Manchmal haben sie sich gestritten, aber am nächsten Tag war alles wieder gut. So ging das eine Weile. Dann wurde sie wieder traurig und hat die ganze Zeit geweint. Grossmams hat ihr gesagt, dass sie nicht mehr auf dich aufpasst, wenn sie nicht zur Schule geht. Danach hat sie sich jeden Nachmittag mit dem Laptop in der Küche eingesperrt und Sam ist mit uns in den Park gegangen.
An einem Abend hat Sam Lasagne gekocht. Mams hat nichts gesagt, nur still auf ihren Teller geschaut. Da hat Sam mit der Faust auf den Tisch gehauen. Er hat ihr gesagt, dass er das Leben geniessen will und dass er das mit einem Gesicht wie ihrem nicht kann. Mams ist in ihr Zimmer gegangen und hat noch mehr geweint. Manchmal möchte ich sie schlagen, wenn sie so weint. Aber dann sehe ich sie alleine auf ihrem Bett sitzen und nehme mir vor, mehr für sie zu machen. Sie sagt ja immer, dass ich mehr im Haushalt helfen könnte. Also habe ich die Wäsche aufgehängt und Staub gesaugt. Aber das hat sie gar nicht gemerkt.
Am nächsten Tag ist Sam mit einem Strauss Blumen zurückgekommen. Er hat wieder in Mams Zimmer geschlafen und am Morgen gesagt, dass wir zusammen in die Ferien fahren. Wir haben Orte aufgezählt, die uns gefallen: Portugal, Spanien, Sardinien, Ibiza, Türkei…
Seither habe ich ihn nicht wieder gesehen und Mams nennt ihn nur noch „das Thema“. Ich sage z.B.: „Kannst du die Lasagne so machen wie Sam?“ Und sie sagt: „Fang nicht wieder mit dem Thema an.“
Vielleicht ist es besser so. Grossmams sagt, dass Leute, die viel versprechen, viel lügen.
Trotzdem würde ich gerne wissen, was passiert ist. Letzte Woche hat mich Frau Mörgler auf dem Schulweg angesprochen und mich etwas zu Mams und Sam gefragt. Ich habe mit den Schultern gezuckt. Sie sagte: „Das darfst du mir wahrscheinlich nicht sagen, gell?“ Dann hat sie mir gesagt, dass sie und Herr Mörgler oft über uns sprechen. Und dass ich bei ihr läuten darf, wenn wir alleine sind.
Ich bin davongerannt. Ich finde es komisch, dass die Mörglers über uns sprechen und es mir auch noch sagen. Ich habe das Gefühl, dass sie ein Geheimnis von uns kennen, von dem ich selbst nichts weiss.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Mina Herz
bau mir ein haus
bau mir ein haus
in meinem körper aus glas
deine finger sollen die nägel
in meinem atem sein
bau mir ein haus
unter meinen nackten sohlen
dein lächeln soll der hammer
auf meinen knien sein
bau mir ein haus
für meine brüchigen arme
dein schweigen soll der zement
auf meinen handflächen sein
werde mein haus
bette mich in dir
wo mir bis zuletzt
alles fremd bleiben soll
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tillmann Lösch
Dann sind wir schlimm zueinander
Auf dem Fensterbrett stirbt eine Fliege. Die liegt auf dem Rücken und summt und dreht sich im Kreis. Aber hoch kommt die nicht mehr. Giovanni schaut zu. Zwischen den Händen hält er sein künstliches Gebiss. Langsam dreht er das Gestell zwischen verhornten Fingern hin und her. Leute, die ihn sehen, denken, er wäre Anfang sechzig. Weil er sich bewegt, als hätte er einen Hüftschaden. Die Beine dick vom Wasser. Und die Füße sehen aus, die schaut er sich schon gar nicht mehr an. In seinem Pass steht, dass er '79 geboren ist. In Neapel. „Mafia, Mafia“, sagen die anderen manchmal zu ihm, wenn sie zusammen im Stadtpark sitzen und saufen. Aber was wissen die? Neapel kennt er eigentlich nicht mehr. Und der Mann auf dem Foto, das muss wer anderes sein.
Skupek ist vor einem dreiviertel Jahr das erste Mal im Park aufgetaucht. Die Frau weggelaufen, sagte er und auf Arbeit, da versteht ihn auch keiner. Seitdem saß er nachmittags bei den niedrigen Mauern, die die Beete eingrenzten, und trank ein kleines Boonekampfläschchen nach dem anderen. Er hatte einen stoppeligen Bart und war so dürr, dass ihm die dunklen Jeanshosen um die Beine schlackerten, wenn er sich bewegte. Und wenn er gegen Abend irgendwann aufstand, um nach Hause zu wanken, sah es aus, als könnte der nächste Windstoß ihn einfach umknicken wie einen Strohhalm. Aber Skupek hielt sich. Und am nächsten Tag saß er wieder auf der Mauer.
„Kannst bei mir auf der Couch schlafen, wenn du was brauchst“, sagte er irgendwann zu Giovanni.
„Nur für n paar Tage vielleicht“, antwortete Giovanni. Skupek nickte, trank eines seiner Fläschchen leer und grinste.
Die Fliege auf der Fensterbank summt. Giovanni schaut zu Skupeks Tür hinüber. Die ist angelehnt, aber durch den kleinen Spalt kann er nichts erkennen. Die Rollläden im Wohnzimmer sind halb heruntergelassen, das Licht ist schummrig. Skupek will das so. Dass die Rollläden fast ganz unten sind. Dass kaum Licht reinkommt. Giovanni versteht das. Dann ists nur halb so schlimm. Als er trotzdem einmal versucht hat, etwas mehr Licht reinzulassen, hat Skupek mit seiner Krücke nach ihm geschlagen und auf Slowenisch herumgeschrien.
„Wenn du das noch einmal machst, brech ich dirs Kreuz!“, hat Giovanni damals gesagt, als wieder Ruhe war. Aber der Skupek? Der hat wieder nur gegrinst, so wie er es immer macht und den Ton am Fernseher lauter gedreht.
Giovanni betrachtet die Tür. Vielleicht ist der abgehauen?, denkt er. Vielleicht ist der einfach weg? Seit zwei Tagen hat er den Skupek nicht mehr gesehen. Seit Dienstag, als Fußball lief. Italienspiel. Natürlich Streit. Ganz am Ende war Skupek taumelnd in seinem Zimmer verschwunden. Ob ers noch bis ins Bett geschafft hat, weiß Giovanni nicht.
Er legt das Gestell auf den Wohnzimmertisch und greift nach seinem Handy. Die Lederhülle ist abgewetzt und schmierig, auf der Rückseite stecken lose Papierfetzen. Eine der leeren Flaschen fällt klirrend um, weil er mit dem Fuß dagegen stößt. Er flucht. Er wischt über das gesprungene Display. Er überlegt und weiß nicht, was er machen soll. Sein Blick geht zur Tür. Am Ende lässt er es bleiben, legt das Telefon zurück auf den Tisch und sieht der Fliege dabei zu, wie sie stirbt. Der ist weg, denkt er. Ist abgehauen.
Nach einer Weile steht er doch auf. Mit seinem massigen Körper lehnt er sich gegen die Wand und sieht durch den Spalt. Aber im Dunkeln kann er nichts erkennen. Er wartet, schluckt, merkt, wie sein Herz hämmert. Seine schwere Hand mit den offenen Stellen und dem Schorf liegt auf der Klinke der Tür.
Beim Rausgehen stolpert er über Skupeks Schuhe. Es regnet zwar und es ist saukalt, aber das ist Giovanni egal. Er geht zum Bahnhof und schaut dort in die Mülleimer. Er wartet im Vorraum der Toiletten und sammelt die Gutscheinzettel ein, obwohl er weiß, dass ihm die kein Laden abnehmen wird. Er sitzt auf einer Bank und die Augen fallen ihm immer wieder zu. Als die Sicherheitsleute kommen, steht er auf und verzieht sich. Vor dem Bahnhofsladen im Untergeschoss bleibt er stehen und zählt in seiner Hand ein paar Münzen ab. Er will gerade reingehen, da kommt der Ladenbesitzer und packt ihn an der Schulter. „Verzieh dich, aber schnell!“, sagt er. Er gibt Giovanni einen Stoß und Giovanni spuckt ihn an. Dafür fängt er sich eine. Er fällt und die Bierflasche, die er dabei hat, die er vorhin beim Türken geholt hat, nicht in diesem scheiß Laden hier, die geht kaputt. Er will aufstehen, greift in die Scherben, schneidet sich und rutscht aus. Ein paar Leute schauen, eine junge Frau will ihm helfen. Sie fasst nach seinem Arm, aber Giovanni reißt sich los. „Ich hab erst einen erschlagen!“, schreit er den Ladenbesitzer an und die Frau weicht zurück.
„Mach ich auch noch mal, wenn ich muss!“ Blut läuft Giovanni zwischen den Fingern hindurch. Der Ladenbesitzer verschwindet in seinem Geschäft, die Frau ist schon weiter. Giovanni steht auf und wankt die Unterführung entlang nach draußen.
Er nimmt die letzte Treppenstufe und wartet keuchend vor der Wohnung im fünften Stock. Er drückt die Klingel. Er ist klitschnass vom Regen und die Beine tun ihm weh. Er klopft gegen die Tür und klingelt noch mal. „Skupek!“, ruft er. Als sich nichts tut, nimmt er den Schlüssel und öffnet. Drinnen ist es dunkel. Er zögert, drückt den Lichtschalter im Flur, aber die Birne ist ja schon seit zwei Wochen durch, erinnert er sich. Er schließt die Tür und tastet sich humpelnd den engen, dunklen Flur entlang. Unter seinen Schuhen knirscht es, als ob er über viele kleine Scherben laufen würde. Dann stößt er mit dem Knie gegen etwas. Der Schmerz lässt ihn stöhnen. Endlich erreicht er den Wohnzimmertisch und sucht zwischen leeren Flaschen und Verpackungsmüll nach der Fernbedienung. Er schaltet den Fernseher an. Das Licht des Bildschirms erhellt das Zimmer. Laute Stimmen einer Quizshow quatschen durcheinander. Eine Frau lacht laut, während die Männer noch lauter dazwischenrufen. Giovanni lässt sich auf das Sofa fallen und dreht den Ton ab. Das blaue Licht flutet den Raum. Wenn er sich Mühe gibt, sieht es beinahe so aus, als wäre er unter Wasser. Wenn er die Augen schließt, könnte er sich vorstellen, in einer großen gläsernen Glocke tief unten in irgendeinem Ozean zu sein. Neapel liegt am Meer, denkt er. Aber hier gibt es kein Wasser, und er öffnet die Augen wieder. Hier riecht es nur nach kaltem Rauch, nach ungewaschenen Bezügen und altem Teppichboden. Und dann ist da noch etwas anderes, denkt er.
In der Nacht wacht Giovanni auf. Er hat geträumt. Von Schweinen hat er geträumt. Von Schweinen in einem Schlachthof. Da hat er mal gearbeitet. In Kempten, im Allgäu, direkt neben einer Kaserne. Zwanzig Jahre ist das her. Die Tiere wussten ganz genau, was los ist, wenn die Lastwagen sie nachts brachten. Wenn sie durch die schmalen Gänge getrieben wurden, schrien sie wie kleine Kinder. Vor Angst rissen sie sich gegenseitig die Ohren ab und bissen sich die Körper blutig.
„Wenn wir merken, dass das Ende naht, dann sind wir schlimm zueinander“, hat Skupek mal gesagt, als sie zusammen auf dem Sofa saßen. Giovanni verstand nicht, was er damit meinte und Skupek erklärt nie etwas. Jetzt versteht er es. Er blickt zur Tür hinüber. Die steht offen. Einen kleinen Spalt nur. Aber hat er die nicht vorhin zugemacht?, denkt er. Er weiß es nicht mehr. Wagt nicht, sich zu bewegen. Der Fernseher läuft immer noch. Nackte Frauen stöhnen in die Kamera und Giovannis Mund ist ganz trocken.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Jan-Eike Hornauer
Ausblenden
Selenskyjs Schreie werden langsam stumm.
Denn wer will sie bloß immer weiter hören?
Ein neuer Schrei, der findet schon sein Publikum.
Doch Dauerschreien, ach, das kann nur stören.
Selenskyj rührt uns so nicht länger an.
Sein Schrei verharrt ja bloß im Ewiggleichen.
Wie man die Grenzen nur nicht sehen kann!
Und halfen wir nicht schon? Das muss auch reichen.
Selenskyj, ach, ist keiner, der versteht:
Er schreit ja weiter wirklich voll und ganz!
Aus Notwehr greifen wir zur Ignoranz.
Selenskyj wird von uns auf still gedreht.
Wir sehen bald nurmehr den lauten Schrei.
Und denken uns – vielleicht – noch ›Munch!‹ dabei …
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sean Keibel
Der junge Anwalt
In der Stadt hatte schon lange kein Prozess mehr stattgefunden; während die Stadt weiter und weiter angewachsen war, hatte man das Gericht darüber ganz vergessen und nie weiter ausgebaut. Es war noch ganz vom dörflichen Charakter geprägt, von der Gestaltung des Saales, der mehr einem Wirtshaus glich, bis zu der Kreidetafel hinter dem Richterstuhl, die die Punkte der beiden Seiten aufnahm, als wäre es ein Spiel. Für gewöhnlich wurden Streitfälle ausgelagert in die zweitgrößte Stadt im Kreis, wo man bei der Städteplanung weniger nachlässig gewesen war und zudem im Winter gut beheizte Bänke erwarten durfte; in dem nun vorliegenden Fall aber traten zwei einflussreiche Familien gegeneinander an, an denen sich die Nachbarstadt nicht die Finger verbrennen wollte. Es blieb also nur der alte Saal.
Angehörige beider Familien saßen zu beiden Seiten, prominent hervorgehoben ihre Oberhäupter, die als Ankläger und Angeklagte fungierten und neben ihren Anwälten leicht erhöht saßen. Auf den mittleren Bänken saßen unbeteiligte Zuschauer, hinter ihnen auf einer kleinen Tribüne die Geschworenen. Alles erhob sich, als der Richter mit seinen Dienern eintrat und vor der Tafel Platz nahm, die noch halb verblasste Reste von Prozessergebnissen aus alten Zeiten anzeigte. Man machte sich nicht die Mühe, eine gründliche Reinigung vorzunehmen – es hätte als ein Akt der Respektlosigkeit aufgefasst werden können –, und so nahmen zwei Gerichtsdiener, einer für jede Seite, statt eines Schwammes gleich ein Kreidestück in die Hand und gingen in Position. Der erste Prozesstag war noch ganz der Ausbreitung des Falles gewidmet gewesen, den Grundsätzlichkeiten, den unumstößlichen Tatsachen, der Vorstellung aller Beteiligten. Jetzt ging es an die Erörterung der Schuldfrage. Aus größtem Respekt wollte der Richter – er machte das gleich zu Anfang klar – so schnell wie möglich fertig werden, denn er fühlte sich verantwortlich für jede Minute, die dieser unwürdige Saal das Ansehen der Familien trübte. Da sich beide Parteien dasselbe vorwarfen, waren die Anwälte, die als Hauptakteure auftraten, sowohl Ankläger als auch Verteidiger. Beide hielten zum Auftakt eine feurige Rede, um diesen Umstand auch dem Letzten im Raum einzuschärfen, vor allem aber den Geschworenen, von denen alles abhing. Die ersten zeigten sich bereits sichtlich beeindruckt vom Redetalent der beiden Anwälte, was vom aufmerksamen Richter bemerkt wurde; das bedeutete die ersten Striche, einen für jede Partei; die Kreide knarzte wie auch die Zähne der Anwälte.
Anwalt A fackelte nicht lange und verkündete pompös, den Arm zum Seiteneingang ausstreckend: „Ich rufe den ersten Zeugen in den Zeugenstand!“ Es folgte das übliche Prozedere zum Einlass: Die Diener trugen einen zweckentfremdeten, vierteiligen Raumtrenner aus dicken Leinwänden mit Holzrahmen zum Eingang, ließen den Zeugen eintreten und klappten die Trennwand um ihn herum, sodass er wie in einer Box, die mit ihm mitgetragen wurde, sicher verwahrt und ungesehen zum Zeugenstand gelangte. Schon ging das Getuschel los, noch während des trägen Ganges. Handelte es sich um einen Mann? Zeuge, hatte der Anwalt gesagt. Verdächtig langsam kam die Kiste voran. Trug also die Person darin womöglich Stöckelschuhe? Aber man hörte nichts. Gefilzte? Gab das Tempo Aufschluss über eine mögliche Selbstunsicherheit? Wie viel Glaubwürdigkeit könnte man also dem Zeugen oder der Zeugin zugestehen? Vielleicht lag die Trägheit aber auch an der mangelnden Kraft oder Unbeholfenheit der Träger. Eine eindeutige Einschätzung war noch nicht möglich. Seinen vorherigen Fehler anscheinend bemerkend sagte Anwalt A nun korrigierend: „Möge die bezeugende Person bitte ihre Aussage machen.“ Der Richter sah von einem rückwirkenden tadelnden Kommentar ab und schaute stattdessen gespannt auf den Zeugenstand, der inzwischen ganz vom Sichtschutz umzäunt war. Man hörte das Kratzen einer Feder. War es ein zügiges, bestimmtes Kratzen? Ein beschwingtes Führen der Feder, das eine spontane authentische Aussage bedeutete – oder vielmehr ein unaufrichtiges Abstottern einer einstudierten, vielleicht eingeflüsterten Lüge? Höchste Konzentration herrschte in der Zuschauerschaft, die Geschworenen hielten sich nach vorne gebeugt in ihren Sitzen. Das Papier schlitterte unter der Trennwand hindurch, ein Diener preschte hervor, verursachte dadurch einen Windstoß, der es fast in die Menge blies – alle drehten sich weg und hielten einander die Augen zu, wie man es mit Kindern tut, um sie zu schützen, einige heulten auf. Der Diener bekam die Aussage rechtzeitig zu fassen, las sie und reichte sie mit einem vielsagenden Augenschwenk dem Richter. Dieser beeilte sich, sie ungelesen in einem bereitstehenden Schredder verschwinden zu lassen, ganz nach Protokoll, ohne auch nur einen halbsekündigen Blick darauf zu werfen; das Schriftbild allein hätte ja schon etwas Falsches aussagen können. Dann, noch während der Zeuge in der Kiste und der Zeuge der Aussage abtraten, machte er sich unter Stirnrunzeln daran, den Augenschwenk des Dieners zu interpretieren. Gleichzeitig war wieder ein allgemeines Geflüster zu vernehmen: Es wäre doch auf der Leinwand die Silhouette des Zeugen zu sehen gewesen, und sie hätte doch Bände gesprochen; nein, das sei nicht wahr, zu dick sei die Leinwand, und das mit Absicht, das Gegenteil zu behaupten wäre ja die Andeutung von Inkompetenz, eine Verunglimpfung des Gerichtes. Diesem gefährlichen Geflüster ausgesetzt befahl der Richter verantwortungsbewusst einem Diener, ihm die Ohren zuzuhalten. Sodann vollendete er seine Gedanken und warf ein Nicken in Richtung Familie A. Die Kreide knarzte an der Tafel, Familie A schlug sich jubelnd die Fäuste, wohingegen Familie B drohende Blicke auf den Richter warf; er aber reagierte mit einem entschuldigenden Fingerzeig auf die Seitentür, durch welche die zwei Zeugen bereits hinausgegangen waren und vor der bloß noch ausgedient die entfaltete Trennwand stand.
Anwalt B hatte keine Zeugen, die seiner Anklage oder Verteidigung dienlich hätten sein können. Dafür hatte er aber Indizien und sogar Beweise. Zuerst die Indizien. Eines nach dem anderen wurde hereingebracht. Es war ein sonderbarer und ganz und gar unschuldiger Anblick: Zahlreiche kleine Objekte, die auf Tabletts getragen und wie ein Menü auf dem großen zentralen Eichentisch präsentiert wurden, alle zwar von unterschiedlicher Größe, aber keines so groß, dass es nicht in zwei Handteller gepasst hätte – und jedes Indiz war abgedeckt mit einem weißen Tuch von so dichtem Material, dass es keine Rückschlüsse auf die genaue Form des darunter ruhenden Gegenstands erlaubte. Die schiere Anzahl war beeindruckend, es hatten bereits ein paar Eifrige zu zählen begonnen, da sagte Anwalt B mit erhobenem Zeigefinger: „Sechsundzwanzig Indizien, werte Damen und Herren Geschworenen.“ Die Zahl wanderte von Mund zu Mund. Ein Strich für Familie B. „Sechsundzwanzig Indizien“, fuhr er fort, davon mehr als ein halbes Dutzend, welche die Angeklagten unmittelbar belasten.“
Anwalt A warf ein: „Unmittelbar belasten? Euer Ehren, ich bitte zu fragen“ – der Richter winkte es durch – „was tun denn dann die übrigen?“
„Sie belasten die Angeklagten indirekt“, sagte Anwalt B.
„Will heißen?“
„Euer Ehren –“, wollte Anwalt B protestieren, aber da erkannte er an der Reaktion der aufgewiegelten Menge, dass sie eine Antwort brauchte. Er fasste sich, schritt zum Tisch und ordnete die Gegenstände, dass sich acht Stränge ergaben. „Acht der Indizien, nämlich diese hier vorne, belasten die Angeklagten unmittelbar. Die restlichen bekräftigen die Indizien.“
„Sind also Indizien für die Indizien?“
„Sie sind mehr als das, Herr Kollege.“
„Also Beweise?“
„Zu den Beweisen komme ich gleich.“
„Dann verstehe ich nicht, was Sie uns hier auftischen.“ Anwalt A war gut in Form. Er war ungefähr eine halbe Generation jünger als Anwalt B, aber das genügte schon, um mit einem ganz anderen Geist groß geworden zu sein.
Ruhig erklärte Anwalt B: „Ich versichere allen Anwesenden sowie dem ehrenvollen Richter, dass die achtzehn sekundären Indizien die acht primären Indizien hervorragend bekräftigen und bloß vorsorglich als Versicherung mit vorgebracht wurden, falls die primären entgegen aller Vernunft in Zweifel gezogen würden.“
Anwalt A trat an den Tisch heran und zog die Augenbrauen hoch. „Auf mich wirken sie nicht sehr beeindruckend.“ Sein Finger schwebte kreisend über eines der Objekte, ein überaus kleines, doch wagte er nicht, es probeweise zu berühren.
„Mit Verlaub, Sie können es nicht wissen“, sagte Anwalt B.
„Das stimmt“, sagte Anwalt A. „Alles, was wir haben, ist Ihr Wort. Aber haben Sie sich denn selbst von der angeblichen Schlagkraft dieser Indizien überzeugen können?“
„Diese Indizien“, schnaufte Anwalt B, „wurden im Vorfeld bestätigt und als solche hier akzeptiert. Wenn Sie also Zweifel daran aussprechen, kommt das einer Beleidigung des hohen Gerichts gleich.“
„Wenn die Aussagekraft Ihrer Indizien dem Gericht bereits bewusst ist, warum hielten Sie es dann eben für notwendig, diese dem Richter zu versichern?“
Darauf konnte sich der Richter kaum in seinem Sitz halten; der Diener deutete sein Stöhnen und verzeichnete einen weiteren Strich für Familie A. Wütend warf das Oberhaupt der Anderen die Arme in die Luft, fügte sich aber mit einem Augenrollen. Anwalt B, der in starkes Schwitzen geriet, sah sich um auf der Suche nach Zuversicht, fand aber nur die angespannten Gesichter der Geschworenen, geschmückt mit Zeigefingern, die über halbgeöffnete Lippen strichen. Wie zur Beschwichtigung ließ er seine flachen Hände auf und ab wippen, dabei befand er, dass es Zeit sei für die Beweise. Selbst seinen Kollegen schien dieser Ankündigung, dieser Begriff mit Respekt zu erfüllen, er hielt sich vorerst zurück. „Man bringe den ersten Beweis!“, rief Anwalt B aus voller Brust, und herein trug ein Diener eine weiße quadratische Box, deren Seitenlänge vielleicht drei Handrücken betrug. Vorsichtig stellte er sie auf dem Tisch ab, wobei er streng nach Regel peinlichst darauf bedacht war, in keiner Weise durch seine Körperspannung ihr Gewicht zu offenbaren. Natürlich wurde der Beweis eingehend gemustert, auch der Richter konnte sich dieser Versuchung nicht erwehren, vor allem aber die Zuschauer und die Geschworenen verzerrten ihre Hälse: Um wie viel größer mochte die Box sein als das größte Indiz? Bog sich die Tischplatte unter ihr vielleicht ein kleines bisschen? Wie weiß war das Weiß der Box, war es etwa getrübt, und hätte das ein verstecktes Anzeichen des unbekannten Verpackers sein können? Anwalt A presste die Lippen zusammen, als Anwalt B mit Genugtuung und auch Erleichterung die Wirkung des Beweises studierte und die nächsten Beweise auf den Plan rief. Einer nach dem anderen wurde hereingetragen von einer kleinen Karawane an Dienern, Box um Box, eine größer als die andere, und je größer die Beweise wurden, desto kleiner wurde der gegnerische Anwalt. Familie B zeigte sich überwältigt von dem absehbaren Sieg, die Kreide überschlug sich an der Tafel, und schon lehnten sich die ersten Geschworenen wie nach getaner Pflicht in ihren Bänken zurück – da geschah ein schwerwiegendes Missgeschick. Der letzte Diener hatte gerade die letzte und größte Box abgestellt und wendete den Oberkörper zum Abmarsch, da stieß er sie versehentlich mit dem Ellbogen an. Ganze drei Fingerbreit verrutschte die verräterische Box. Alles schnappte nach Luft; der Gerichtsdiener an der Tafel erstarrte mitten im Strich; die Geschworenen, die sich schon im Feierabend gewähnt hatten, sprangen unwillkürlich auf; selbst die Angehörigen der Familie A schlugen sich ungläubig die Hände vor den Mund.
Anwalt A warf mit triumphaler Vorahnung das Kinn in die Höhe und trat langsam wieder vor aus dem Hintergrund, die Hände hinter dem Rücken. „Man hätte fast einen Beweis erwartet“, sagte er mit einem theatralischen Kopfschütteln, „für den die Größe der Verpackung angemessen ist. Fast.“
„Sie wissen ja gar nicht um seine Größe“, beeilte sich Anwalt B festzustellen.
„Meinetwegen sei er so groß wie die Box“, sagte Anwalt A. „Dann muss er aber leicht wie Luft sein. Ich denke, ich spreche dem Gericht aus der Seele, wenn ich sage: Ich fühle mich ein wenig getäuscht.“ Aus dem Publikum kam noch unsichere, aber gefährlich aufschwappende Zustimmung.
„Was haben Größe und Gewicht mit der Kraft des Beweises zu tun?“, rief Anwalt B. „Worin sollte denn die Täuschung bestehen?“
„Oh, ich weiß nicht, Herr Kollege, aber der Großteil der Anwesenden hat anscheinend etwas anderes erwartet, als diese riesige Box herangeschafft wurde, und Sie können uns nicht weismachen, derartige Erwartungen nicht vorhersehen zu können. Da Sie also um den zu erwartenden Eindruck wussten, den die Box machen würde, haben Sie ihn gleichsam forciert.“
Fast legte Anwalt B, der sich hinter die Box stellte, seine Hand auf ihr ab, hielt sie aber gerade noch um eine Haaresbreite darüber in der Schwebe. Er wiederholte stur seine Frage nach der Relevanz für die Kraft des Beweises.
Darauf rief Anwalt A: „Weniger stand der Beweis in Frage als vielmehr Ihre Aufrichtigkeit, Herr Kollege. Was für eine Glaubwürdigkeit haben Ihre vorgebrachten Beweise und Indizien, wenn Sie keine haben? Was Ihre Frage angeht, haben Größe und Gewicht natürlich nichts mit der Kraft, wohl aber mit der Natur des Beweises zu tun. Da Sie so darauf herumritten, könnte man meinen, Sie wüssten etwas über seine Natur.“
„Sie, Herr Kollege, sind darauf herumgeritten! Und worin lag nun meine Täuschung? Ich habe niemanden getäuscht.“
„Über seine Natur haben Sie uns getäuscht!“
„Das habe ich nicht!“
„Und woher“ – Anwalt A sprang dem unglückseligen Kollegen jetzt fast ins Gesicht – „wissen Sie das?“
Es herrschte eine plötzliche Stille, dann wurde es ungestüm im Saal. Der Gerichtsdiener rechts an der Tafel trat über zu seinem Kollegen auf der linken Seite. Anwalt B öffnete den Mund, stammelte etwas, aber es hörte schon keiner mehr. Zu riskant war es, noch weiter diesem Mann zuzuhören, man hätte sich ja verdorben, und darum gab es mit einem Mal nicht ein einziges Paar Ohren mehr, das nicht von einem Paar Hände zugepresst wurde. Auch dem Richter waren erneut die Ohren bedeckt, als er den Hammer hoch in die Luft erhob und machtvoll sprach: „Der Anwalt soll kein Wort mehr sprechen, denn er ist befangen. Was sagen die Geschworenen?“
Die Geschworenen erhoben sich und bellten einhellig: „Schuldig.“
Den Hammer auf das Pult schlagend rief der Richter: „Ich verurteile den Angeklagten zur Reinigung und erkläre den Prozess für beendet.“
Somit wurden die Kreidestriche halbherzig weggewischt und vereinten sich mit den halb verblassten Ergebnissen vergangener Prozesse. Während man dem noch so jungen Anwalt A gratulierte, die Oberhäupter sich die Hände reichten und das Gericht sich langsam auflöste, wurde der arme Anwalt B, nachdem man ihm am Ausgang ein weißes Laken übergeworfen hatte, von allen Blicken geschützt abgeführt. Es hatte lange kein Prozess in diesem alten Haus stattgefunden, und es sah nicht danach aus, dass sich das ändern würde; darum packte der Richter nach dieser Ausnahme seine Sachen und kehrte zurück zu den höheren Gerichten.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Philipp von Bose
Die kleinen Triebe
fast wie abdrücke der jungen jahre
liegen triebe zugewandt im wachstum meiner
hände
aus der nähe angesehn scheint ein lichter wald
(aus dem stumpf und all dem warten) kraftvoll aus sich selbst
zu gehen
selbst im schatten diesem kalten haus
treibt sie der wunsch von zeit geführt
die decke grün
dem licht zu geben
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at