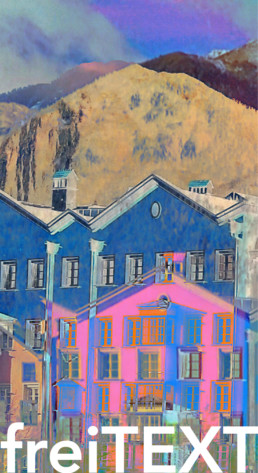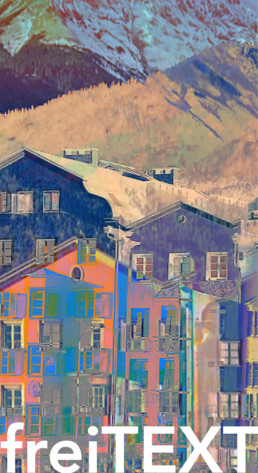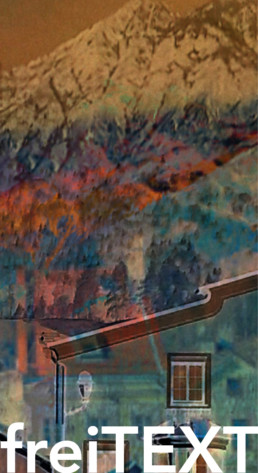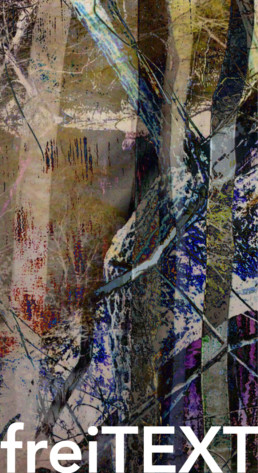freiTEXT | Ines Rössl
Gleichzeitigkeiten eines Frühjahrs
1.
Ich lernte in diesem Frühjahr, dass es den Ausdruck der „Angstblüte“ gibt: Die Bäume blühten dieses Jahr ungewöhnlich prachtvoll und üppig, sie geraten wegen der Klimakrise in Bedrängnis und bringen daher vorsichtshalber all ihre Fortpflanzungskraft auf. Blüten hingen und standen, sie wölbten sich uns entgegen, es war ein paradiesischer Anblick, jedes Mal, in jedem Park, und streifte man sie, verströmten sich ihre Gerüche.
Es ist Anfang Juni 2020. Ein Frühjahr ist vorüber. „Wie geht es dir in diesen Zeiten?“ hatten die Menschen einander monatelang in Textnachrichten und E-Mails gefragt. Der Plural war angebracht: Eine Vergangenheit griff nach uns, eine Schuld vielleicht auch, etwas, das gelernt worden war, das verlernt werden musste. Eine Zukunft drohte. Und eine Gegenwart beschwerte uns. Wir lebten in mehreren Zeiten. Wir versuchten, die Gegenwart auszusitzen. „Wenn dann das vorbei ist“, sagten die Menschen.
Die Pandemie und ihre Folgen verlangten, in Worte gefasst und eingeordnet zu werden. Ich kapitulierte. Glaubte ich, einen Anfang machen zu können, verlor er sich. Es war eine fiebrige, eine frustrierte Sprachlosigkeit.
Und dann war da noch eine andere Art der Sprachlosigkeit. Ich hatte zu Jahresbeginn ein Kind bekommen und bemerkte, dass es etwas an der Erfahrung von Elternschaft gibt, das sich der Mitteilung entzieht und im Moment des Erzählens vertrocknet in sich zusammenfällt. Wer will so etwas hören. Wie lässt sich so etwas überhaupt sagen. Mein Empfinden und Denken war ein Gehäuse, eine nach innen gestülpte Landschaft. Im Februar notierte ich: „Das hier ist eine rundum politische Erfahrung.“
2.
Auf irgendeinem Foto ein von einer Hauswand gehängtes Transparent gesehen: „LA ROMANTIZACIÓN DE LA CUARANTENA ES PRIVILEGIO DE CLASE!“ („Die Romantisierung der Quarantäne ist ein Klassenprivileg!")
Die Pandemie hatte die gesellschaftliche Verteilung von Lebensmöglichkeiten nachgezeichnet als Verteilung von Menschenkörpern im Raum. Vertikal, horizontal, 1 Meter Abstand, Park oder Keller, Dachterrasse, Mehrbettzimmer, Heim und Lager. Toilettensituation. Übergangsquartier.
Gesundheitspolitische Empfehlungen appellierten gleichzeitig an das soziale Gewissen wie auch an das wohlverstandene Eigeninteresse. „Schau auf dich, schau auf mich, so schützen wir uns“, hieß der Slogan. Zuhause bleiben wurde sowohl zur sozialen Aufgabe als auch zur Strategie individueller Risikominimierung. Es schien, als könnte für einen kurzen Moment das Interesse der Einzelnen wie von selbst mit dem Interesse aller zusammenfallen. Endlich. Der Traum jedes Gemeinwesens. Und der Glaubenssatz der Apologeten des freien Marktes.
Wer zuhause bleiben konnte, blieb zuhause. Wer nicht zuhause bleiben konnte, blieb nicht zuhause. Die Anordnungen der Regierung übersetzten sich in Anordnungen von Menschenkörpern im Raum. Die einen saßen auf Dachterrassen die Gegenwart aus, die anderen in Schlachthöfen. Das in den Pressekonferenzen vollmundig propagierte „Wir“ ordnete sich an. Und deutlich wurde: Es teilte sich auf.
Oben und unten ward oben und unten. So einfach. So banal.
Oben, auf den Dachterrassen, verbrachten jene, die Homeoffice machten, ein Frühjahr in luftiger Atmosphäre. Die Angst hatte sich breit gemacht, aber man lebte gut. Unten, fünf Stockwerke tiefer, liefen durch die Straßen Leute. Jene, die sich trotz Pandemie an ihren Arbeitsstellen einzufinden hatten, die nicht online einkaufen konnten, die eine Apotheke aufsuchen mussten, die nach Luft schnappten beim Gang um den Block. Gelegentlich stieg einer die Treppen hinauf zum Dach, gelegentlich nahm eine den Lift ins obere Stockwerk und überbrachte bestellte Waren. Den Wildschweinschinken aus österreichischer Bio-Produktion zwecks Unterstützung der lokalen Betriebe. Geld wechselte keine Hände mehr, gezahlt wurde mit Karte. Man wich einander aus. Die einen und die anderen. Ohnehin war man einander fremd.
3.
Maggie Nelson schreibt in „The Argonauts“ über das Gebären: „It’s easy enough to stand on the outside and say, 'You have to let go and let the baby out.' But to let the baby out, you have to be willing to go to pieces.“
Dass ich bei der Geburt auf irgendeine Art in Stücke gegangen sein musste, merkte ich in den ersten Wochen danach daran, dass ich den Menschen beim Reden nicht mehr in die Augen sehen konnte. Eine alte Schwäche, die nun plötzlich wieder da war, als wäre eine bereits verheilte Wunde wieder aufgeplatzt. Im Supermarkt, an der Kassa, verstand mich der Kassier nicht, ich musste mehrmals vernuschelt und mit gesenktem Kopf „Das sind die Äpfel der Sorte Elstar“ sagen. Die Pandemie war damals noch nicht bei uns angekommen. Ich schaffte es nicht, meine Worte an ein Gegenüber zu richten, sie verstreuten sich ziellos im Raum. Verlust von Meisterschaft. Ich konnte den Blicken der Menschen nicht standhalten, sie stellten mich zur Rede, sie ertappten mich in dem, was ich war. Und was ich war, war damals nicht so klar.
4.
In diesem Frühjahr kam eine überraschende Übersichtlichkeit und Ruhe in die Stadt. Die Pandemie brachte ihre eigenen Choreographien hervor:[1] Wenn sich die Wege von Menschen kreuzten, beschrieben sie umeinander einen Bogen. Saß auf einer Parkbank ein Mensch, war es immer nur einer. Duos spazierten mit zwei Armlängen Abstand. Die Wahrnehmung war geschärft: Biegt jemand um die Ecke? An Engstellen wartete man höflich. Dass die Gehsteige schmal waren, um den Autos keinen Platz wegzunehmen, fiel nun auch jenen auf, die weder Rollstuhl noch Kinderwagen manövrierten. Die menschlichen Interaktionen waren verlangsamt.
Grundbedürfnisse: Zeit und Raum.
Privilegien: Zeit und Raum.
Hätte man nicht gewusst, was der Anlass war, man hätte die Stimmung im öffentlichen Raum mit Beschaulichkeit verwechseln können. In Wahrheit hielten alle die Luft an. Man war einander unheimlich geworden. Man huschte aneinander vorbei, vermied nicht nur die Atemluft der anderen, man vermied jeglichen Blickkontakt.
Das Gefühl, das jede zufällige Begegnung auf der Straße oder im Treppenhaus begleitete, war nicht so sehr Furcht, sondern vor allem Scham. Dass man überhaupt atmete, schien obszön. Man war ertappt. Nur wobei? Dass jeder existierte als Körper voller Ausdünstungen und Ausflüssen? Dass man einander zur Gefahr geworden war? Dass es soweit gekommen war, einander wechselseitig als solche zu begreifen?
Oder schämten wir uns, weil wir bei jeder menschlichen Interaktion einem Teil von uns begegneten, der darauf bedacht ist, sich selbst zu retten?
5.
Krise als Chance: Bullshit (das ewige Lied: „in diesem System / muss es immer weiter geh'n“).
Todesrate unter marginalisierten Gruppen: besonders hoch. Keine Überraschung. Armut tötet.
Unbestimmte gesetzliche Bestimmungen: Die Polizei rückt aus und straft.
Regierungstechnik: Angstmachen. Es ist uns unwohl dabei, aber wir verstehen, dass Menschen Gewohnheitstiere mit Panikneigung sind und es diesmal schnell gehen muss, wie am Schnürchen. Wir verstehen, dass man uns regieren und steuern muss. Wie am Schnürchen. Wir fragen uns, ob wir auch ohne Angst und Konformitätsdruck in der Lage wären, vernünftig zu sein. Wir fragen uns, was wir wissen. Wir wissen nicht, worauf wir unsere Vernunft gründen könnten.
Solidargemeinschaft: Der Staat beweise sich endlich wieder als Solidargemeinschaft, sagen einige. Tatsächlich: Es gibt es einen – wenn auch nur kurzfristigen und teilweisen[2] – Stillstand zum Schutz von Leben und Gesundheit. Tatsächlich: Touristikbetriebe wollen die Solidargemeinschaft auf Verdienstentgang verklagen wegen der gesundheitspolitisch notwendigen, aber wirtschaftsschädigenden Maßnahmen.
Solidarität in aller Munde: Solidarität mit den Schwachen, mit den Alten, mit den systemerhaltenden Berufen. Von den Dachterrassen erklingt Applaus. Systemerhaltung. Gemeinschaft. Nationale Gemeinschaft. Schulterschluss. Und Kusch. Aus Polizeiautos schallt: "I am from Austria".
Manche Münder schreien lauter.
Andere Münder seufzen.
Münder sind intubiert. Und Münder röcheln.
Versammlungsfreiheit: Eingeschränkt. Aber: War sie denn je wirklich eingeschränkt in diesem Frühjahr? War das nicht nur geisterhaft? Hat man uns das nicht nur glauben machen? Was war real gewesen in diesem Frühjahr?
Die Feuilletons: quellen über. Der Ausnahmezustand. Regieren per Dekret. Resonanz wiederfinden in der Quarantäne. Entschleunigung. Wir sind schuld. Selber schuld. Die Fleischindustrie und die Abholzung der Wälder. Südamerika. Der Dschungel. Alles hängt zusammen. Für alles gibt es einen Zusammenhang. Möglicherweise. Die Intellektuellen widersprechen einander. Sie tun, was sie immer tun. Sie vertreten die Thesen ihrer zuletzt publizierten Bücher. Sie kommen nicht aus sich heraus.[3] Wir kommen nicht aus unserer Haut. Biopolitik. Verwaltung und Nutzung der Körper. Der benutzte Körper. Der abgenutzte Körper. Zunahme männlicher Gewalt gegen Ehefrauen, gegen Beziehungspartnerinnen. Zunahme psychischer Erkrankungen. Zunahme einsamen Sterbens.
Überraschen uns die Folgen der Pandemie? Nein. Wir leben schon immer so.
6.
Ein Wort verlässt mich in diesem Frühjahr nur selten: Meisterschaft. Im Englischen „mastery“ steckt der „master“ drinnen, der Herr, der anderes ist als nur ein Meister. Aber auch das deutsche „etwas meistern“ ist nicht unschuldige Anerkennung, einer Aufgabe gewachsen zu sein. Die Beziehung zur Welt, die damit beschrieben wird, ist klar: Die Welt als eine zu meisternde.
Ich bin so aufgewachsen. Unabhängigkeit und Meisterschaft gegenüber der Welt ist positiv. Meistere die Schwierigkeiten. Stark zu sein ist positiv. Es geht einem gut. Es geht einem dann besser. Die Umstände haben einen nicht im Griff. Lass dich nicht im Griff haben. Sei befähigt, dich den Würgegriffen rundum zu entziehen. Also: Sei nicht bedürftig, das würdest du bereuen. Es ist eine Frage des Lebensglücks: Wer will schon der Welt im Modus der Verletzlichkeit entgegen treten. Nimm dir, was dir gehört. Feilsche um den besten Preis. Gehe aufrechten Ganges durch die Welt. Begegne der Welt, sie meisternd. Sei der Souverän deines Lebens. Sei ein Ich. Sei du selbst. Bahne dir deinen Weg. Bleib nirgendwo hängen. Verliere deine Träume nicht. Sei nicht traumverloren.
Klar darfst du unsicher sein, aber Sicherheit ist gut, Sicherheit wäre besser.
Klar darfst du schwach sein, wir sind ja nach '68, aber wenn du es bist, dann ist etwas falsch.
Für alles gibt es eine Lösung, sagt man. Wenn du nur willst, sagt man. Das war schon eine Challenge, sagt man. Herausforderungen, sagt der Bundeskanzler:[4] Es gibt keine Schwierigkeiten, nur Herausforderungen. Wir haben Lösungskompetenz, wir haben Entscheidungsmacht, wir sind krisenfest.
Mit fast patziger Stimme verteidige ich in diesem Frühjahr meine Schwäche und die Affirmation meiner Schwäche, verteidige, dass es „schwierig“ ist, „schwierig“ sein darf, dass nichts daran falsch ist. Dass in der Verletzlichkeit kein Versagen liegt. Dass ich nun einmal vorübergehend in der Situation bin, von einem Kind ausgesaugt zu werden und dass das Kind und ich einander ausgeliefert sind. Dass daran nichts zu verharmlosen ist, aber auch nicht gerüttelt werden muss. Es ist gut, wie es ist.
Wir beschreiben das gemeinhin in der Sprache des Verlusts: Ich gehöre mir nicht mehr allein. Ich frage mich, ob der dramatische Unterton, der diese Verlustsprache trägt, einem Missverständnis entspringt. Die Verkitschung von Mutterschaft hingegen tut so, als ob es diesen Verlust gar nicht gäbe oder als ob hier nicht ganz real etwas verloren ginge, das Wert hat: Autonomie.
7.
In diesem Frühjahr kursierte die Rede davon, es wäre in der Zweiten Republik noch nie so weitreichend in Grundrechte eingegriffen worden. Zeichen eines Privilegs: Das so einfach sagen zu können. Die diesen Befund aussprachen, konnten sich zumindest der Theorie nach (die Theorie ist nicht alles, aber sie ist auch nicht nichts) als demokratische Subjekte und somit als Autor*innen der Grundrechtseingriffe begreifen. Die den Zweck der Grundrechtseingriffe kritisierten, konnten nicht von der Hand weisen, dass es zumindest um Zwecke ging, mit denen sie etwas zu tun hatten, etwa um die eigene Gesundheit.
Jene, die seit Jahrzehnten systematisch festgehalten und inhaftiert werden, weil sie aus den falschen Weltgegenden kommend eine Grenze überschritten haben, müssen wohl lachen ob der Rede vom beispiellosen Grundrechtseingriff. Sie kennen den Grundrechtseingriff nur zu gut, er ist ihnen vertraut. Aber ihnen tritt eine Staatsgewalt gegenüber, mit der sie nichts zu tun haben. Sie sind nicht Subjekte dieses Staates und die Zwecke ihres Freiheitsentzuges sind nicht die ihren. Nicht zu ihrem eigenen Schutz werden sie eingesperrt, nicht zu ihrer eigenen Sicherheit dürfen sie ihre Familien nicht sehen, nicht zu ihrem eigenen Wohl dürfen sie keine politischen Versammlungen anmelden. Ihr Freiheitsentzug dient irgendetwas anderem, das zu ihnen und ihrem Leben in keiner Beziehung steht.
Das Neue in diesem Frühjahr: Es wurde flächendeckend in Grundrechte von Personen eingegriffen, die sich bisher weitgehend unbehelligt von staatlicher Gewalt bewegen konnten. Zeichen eines Privilegs. Da war man kurz verblüfft.
Opfern wir die Freiheit der Sicherheit, wurde gefragt. Man fragte auch, ob das eine falsche Gegenüberstellung ist. Reaktionär ist, wer auf die eigene Freiheit pocht und sich nicht um die Folgen für andere schert.[5] Reaktionär ist auch, wer blindlings die Freiheit an den Nagel hängt, um sich einem Sicherheitsparadigma und den damit zusammenhängenden Herrschaftstechniken (wie Überwachung und Rückzug ins Private) zu unterwerfen. Wer zu den Reaktionären zählte, war in diesem Frühjahr nicht immer klar.
Dies lag auch an einem Mangel gesicherten Wissens über die Pandemie. Dass trotz mangelndem Wissen politische Entscheidungen getroffen werden müssen, ist nichts Neues, wurde jedoch in diesem Frühjahr schmerzhaft offensichtlich. Wir tun ja meistens so, als wüssten wir. Wenn die Gerichte abwägen, ob ein Grundrechtseingriff zulässig ist, müssen sie fragen, ob er denn notwendig und darüber hinaus auch geeignet ist, den damit angestrebten Zweck zu erreichen. Notwendigkeit und Zweckeignung – in diesen Begriffen sind faktenbasierte Einschätzung und normative Bewertung so verflochten, dass sie kaum zu entwirren sind. Dennoch: Auf Begriffe wie Notwendigkeit und Zweckeignung überhaupt Bezug nehmen zu können, setzt die Annahme voraus, man könnte Aussagen über Kausalitäten oder zumindest über Wahrscheinlichkeiten treffen. Letztgültiges aber gibt es auf diesem Feld nicht. Die Entscheidungsgrundlagen sind also mehr oder weniger brüchig. Das ist ein ungemütlicher Zustand. In der Pandemie wurde er für alle spürbar.
Als brüchig offenbarte sich auch der gern gebrauchte Satz, dass die Freiheit der einen dort endet, wo sie anderen schadet. Denn plötzlich kann schädlich sein, was wir immer für sozialadäquates Verhalten gehalten haben.[6] Nichts am menschlichen Umgang ist mehr harmlos. Ist es also folgerichtig, die Bestattung der Toten im Familienkreis zu verbieten und den Besuch der Alten im Pflegeheim? Darf man uns die gegenseitigen Umarmungen verleiden, weil sie nicht mehr harmlos sind?
Es ist notwendig zum Schutz von Leben, sagen die einen. Das ist ein nichtssagender Satz, sagen andere. Denn das Leben könnte sonst alles rechtfertigen. Man müsste das Autofahren verbieten zum Schutz von Leben.[7] Unser Leben ist voll von erlaubten Lebensgefahren.
Aber, so lautet der Einwand, es wäre doch furchtbar, in einer Gesellschaft zu leben, in der einem nicht geholfen werden kann, wenn man schwer krank wird, weil die Intensivstationen aufgrund von Überlastung niemanden mehr aufnehmen können! – Eben. Es wäre furchtbar, in einer Gesellschaft zu leben, in der man sich nicht darauf verlassen könnte, dass ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem sich um einen sorgte. Unabhängig davon, ob man überlebt. Es geht also nicht nur um die Erhaltung von Leben als quantifizierbarer biologischer Größe. Sondern es geht zumindest auch um die Frage, wie gelebt wird, unter welchen Bedingungen und mit welchen Gewissheiten. Es geht darum, worauf wir uns verlassen können wollen.
Angesichts dessen gerät die juristische Abwägungslogik, die Grundrechtseingriffe gegenüber ihren Schutzzwecken (wie etwa dem Leben) abwägt, ins Straucheln.[8] Was genau ist es, das man in die Waagschale wirft? Das Leben als Schutzzweck schien so klar, ein Totschlagargument. Wenn es aber ums Wie-Leben geht, ums gute Leben, zu dem auch ein gutes Sterben gehört,[9] was haben wir dann argumentativ in der Hand, worüber sind wir uns da überhaupt einig? Wägen wir im Grunde verschiedene dystopische Szenarien gegeneinander ab? Die völlige Abschaffung des öffentlichen wie des intimen Raumes gegenüber dem Sterbenlassen der Schwächeren (wer das ist, stellt sich übrigens immer erst im Nachhinein heraus) und dem Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitssystems? Müssen wir angesichts der Pandemie ein bisschen von allem ertragen, um die jeweilige Dystopie sich nicht auswachsen zu lassen?
Hier stecken wir also fest. Und so wird die Zeitfrage alles. Wie lange darf mit dem Feuer der einen oder anderen Dystopie gespielt werden? Wie lange dürfen Isolierungsmaßnahmen dauern? Wie lange behält das Argument gesundheitspolitischer Notwendigkeit Gültigkeit? Wann müssen wir dem Tod ins Auge sehen, um nicht mit dem Leben zu bezahlen? Was wäre, wenn die Impfung erst in fünf Jahren kommt? Oder nie?
8.
Auf einmal mit Vehemenz am Leben bleiben wollen.
"Ich möchte dich aufwachsen sehen.“
9.
In diesem Frühjahr redete man immerhin über das Leben und auch über das Sterben. Man redete darüber, ob die Solidargemeinschaft das Sterben an der Pandemie verhindern soll. Wir wollen nicht sterben an einer Pandemie. Der Rest ist uns nicht so wichtig. Das Leben ist uns mal mehr wert und mal weniger. Situationselastisch. Das Leben mancher ist mehr wert als das Leben anderer. Personenabhängig. Dass schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen das Leben verkürzen, gilt gemeinhin nicht als Lebensrisiko, vor dem uns die Solidargemeinschaft zu bewahren hat. Der Sozialstaat hat es nur so weit gebracht, dass die Solidargemeinschaft die Kosten des langsamen Sterbens übernimmt. Wir haben uns daran gewöhnt. Daher haben wir vorgeblich keine Angst. Wir krepieren dennoch. Aber das schweigen wir tot.
10.
Von welchem Wir spreche ich.
11.
Im deutschen Sprachraum ist sogar das Können ein Beherrschen. Man sagt: Ein Instrument beherrschen. Man sagt: Eine Sprache beherrschen. Welch Missverständnis. Als wäre dies möglich. Als wäre es nicht umgekehrt. Aber der Anspruch ist da. Der Herrschaftsanspruch. Und das falsche Selbstbild.
Man sagt: Die Beherrschung verlieren.
„Endlich die Beherrschung verlieren!“, könnte man ausrufen.
12.
Hierzulande ist die sogenannte erste Welle der Pandemie vorbei. Die Frage stellt sich immer noch, wie weitermachen mit jenen Tätigkeiten, die der körperlichen Nähe bedürfen, des direkten Kontakts, die ohne diesen nichts sind. Darstellende Kunst zum Beispiel. Gilt das nicht für alles, könnte man nachhaken: Dass alles nichts ist, ohne direkten Kontakt. Und jemand würde antworten: Nein.
Wenn man geeignete Tools entwickelt, kann das meiste online und per Videoschaltung stattfinden, die Pandemie hat es in Ansätzen gezeigt, man kann vieles adaptieren. Wir können online Besprechungen und Unterrichtsstunden abhalten, wir können Einkäufe erledigen und Abstimmungen durchführen. Wir müssen einander ja nicht die Hände schütteln, wenn wir aufeinander treffen. Es ist gesellschaftlich nicht notwendig. Wir müssen nicht in Kinosälen sitzen. Clubs und Wirtshäuser sind keine Notwendigkeit. Der öffentliche Raum muss nicht zwingend aus Körpern im Raum bestehen. Öffentlichkeit lässt sich online herstellen. Wir müssen einander nicht berühren können, wenn wir einander fremd sind. –
Ich will das nicht glauben.
Oder anders, genauer: Ich will nicht glauben, dass wir diejenigen werden wollen, die wir unter diesen Bedingungen wären. Ich will nicht glauben, dass wir eine solche Gesellschaft, die angesichts der Isolierungsmaßnahmen während der Pandemie denk- und vorstellbar geworden ist, wollen.
Aber warum genau nicht?
Warum genau halten wir das Aufeinandertreffen von Körpern für konstitutiv für eine Gesellschaft, für ein politisches Gemeinwesen? Was ist es, das wir andernfalls verlören?
Ich bin nicht an dem Kitsch interessiert, der sich als Antwort aufdrängt (wahrscheinlich hat der Kitsch sogar einiges an Wahrheit für sich). Ich bin an jenem Punkt interessiert, an dem klar wird, dass sich nicht alle gesellschaftlichen Fragen in Gerechtigkeitsfragen übersetzen lassen. Es ist der Punkt, für den es keine Lösung gibt.
13.
In dem Einpersonenstück „The Encounter“, das auf einem Buch von Petru Popescu basiert und dessen Aufzeichnung man sich in diesem Frühjahr online ansehen konnte, ruft der Schauspieler Simon McBurney, den Fotojournalisten und Amazonas-Reisenden Loren McIntyre verkörpernd, aus: „I was never part of nature!“
Es ist ein wütender, aufbegehrender Ausruf gegen die immersive Kraft des brasilianischen Dschungels, in dem McIntyre beinahe für immer verloren geht.
14.
Was wird noch kommen, fragte man sich in diesem Frühjahr, was soll nur aus uns werden.
Wir wissen, dass unsere Art, der Welt zu begegnen, indem wir uns als von ihr getrennt vorstellen, in Unterwerfung mündet. Wir wissen um unsere Interdependenz mit allem. Wir gehören uns nicht allein. Wir wissen das.[10]
Aber wir kommen nicht aus unserer Haut. Wir wollen, jeder für sich, ein Ich sein (wer will das nicht!), wir wollen uns in die Welt setzen, wir wollen uns zur Welt in ein Verhältnis setzen, wir wollen die Satzung vorgeben, wir wollen Herr und Meister sein. Wir beziehen uns auf die Aufklärung, auf ihre Prinzipien der Autonomie und Mündigkeit. – Wir brauchen nochmal sowas: Einen neuen Referenzpunkt. Eine Neubestimmung des Menschen im Verhältnis zu sich selbst und zur Welt.
Es lässt sich leicht darüber reden, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur neu zu denken, um die Zerstörung zu beenden. Aber sind wir denn dazu bereit? Können wir uns eine Aufgabe oder zumindest ein Schrumpfen unseres Egos denn überhaupt vorstellen? Wäre das nicht ein untröstlicher Verlust? Verlust von Meisterschaft? Wer wären wir denn dann?
Es ist eine Verschiebung in unserem Selbst- und Weltverhältnis, die ansteht. Wie lange wird sie dauern? Hundert Jahre? Wieviel Zeit haben wir dafür noch?
Es ist ein tiefgreifender Verlust, der uns bevorsteht.
Denn in der Tat, uns selbst aufgeben müssten wir.
Und es ist fraglich, ob wir – als die, die wir heute sind – wollen können, was wir wollen müssten.
15.
In den ersten Tagen im Krankenhaus hatte der Umgang mit dem Baby interessante Wirkungen auf meine Selbstwahrnehmung. Stand ich unter körpereigenen Drogen? War ein durch die Geburt getriggertes Mutterschaftsprogramm gerade dabei, einen neuen Baustein Empathie in meinen Organismus einzubauen? Handelte es sich um einen biologischen Trick, um mich an mein Kind zu binden, um sicherzustellen, dass ich es nie verlassen würde? Jedenfalls: Lag ich zusammengerollt in meinem Krankenhausbett, sah ich mich von außen, von oben, genauer gesagt. Der Raum, in dem ich untergebracht war, hatte hohe Wände. Ich wurde zu einem Kippbild, mal war ich ein ausgewachsener Mensch, mal ein Baby. Die Mimik, die ich an meinem Kind beobachtet hatte, war die meine. Seine hilflos sich schließenden Finger waren die meinen. Es war, als hätte das Baby nur die äußere Form gewechselt und sich eine erwachsene Hülle umgestülpt.
.
.
[1] Gia Kourlas, How we use our bodies to navigate a pandemic, 31.3.2020, New York Times
[2] Lukas Oberndorfer, Der Neoliberalismus als Zombie. Von seinem Fortleben in Zeiten von Covid-19 und der Notwendigkeit einer öko-sozialistischen Biopolitik, 18.6.2020, Bildpunkt
[3] Marcus Quent, Selbstversicherungsseuche, 31.3.2020, Textem
[4] Drehli Robnik, Eine nationale Herausforderung, 27.5.2020, Tagebuch
[5] Benjamin Opratko, Die Kultur der Ablehnung, 28.6.2020, Tagebuch
[6] Alexander Somek, Liberalism at rest, 2.4.2020, coronajournal
[7] Oliver Lepsius, Vom Niedergang grundrechtlicher Denkkategorien in der Corona-Pandemie, 6.4.2020, Verfassungsblog
[8] Alexander Somek, Die neue Normalität, 6.5.2020, Verfassungsblog
[9] Charles Eisenstein, The Coronation, März 2020, https://charleseisenstein.org/essays/the-coronation
[10] Kay Sara/Milo Rau, „Against Integration“: Dieser Wahnsinn muss aufhören, Eröffnungsrede der Festwochen 2020, 16.5.2020 DerStandard
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Anne Büttner
Das größte Glück
"Das Essen ist gleich schon wieder kalt." Anscheinend hatte seine liebe, gute Frau ihn zuvor schon einmal, mag sein auch öfter, über die Möglichkeit der Aufnahme warmer Speisen in Kenntnis gesetzt. Dass er diese, sicherlich von Zärtlichkeit und Verständnis getragene Information nicht mitbekommen hatte, lag einzig an der neuerlichen Abgabefrist, die ihn drängte. Dabei hatte er, wie stets, frühzeitig mit der Arbeit begonnen. Frühzeitig genug also für täglich fünf Mahlzeiten mit seiner lieben, guten Frau und ihren entzückenden Sprösslingen, von denen sie, wie sich durch einfaches Zählen feststellen ließ, drei ihr Eigen nennen durften.
Eine reizende Bande. Wie alt diese bezaubernden Geschöpfe wohl inzwischen sein mochten? Man hat sich ja so schnell verschätzt. Gerade bei Menschen diesen Alters, das zwischen fünf und beschränkt geschäftsfähig einzugrenzen er sich gestattet. Da es sich nicht schickt, die drei selbst nach dem Alter zu fragen, will er sich dem Erkenntnisgewinn bestmöglich diskret nähern und seine, liebe, gute Frau - wenn er sich nicht vertat, dritte – alsbald um deren Geburtsurkunden bitten. Wenn er dann schon einmal dabei wäre, anhand der Akten das vermutete Alter der bezaubernden Nachkommenschaft zu konkretisieren, würde er gleich noch sein Gedächtnis deren Namen betreffend auffrischen. Soweit er sich erinnerte, hatten er und seine liebe, gute Frau da weder an Originalität noch an Anzahl gegeizt. Die nötige Ruhe vorausgesetzt, bekam er sie zwar fast mühelos zusammen, aber trotzdem. Zudem ließe sich so nochmal vergegenwärtigen, welchen Geschlechts die drei waren. Gerade beim, wie er ohne Aktenkenntnis annimmt, Erstgeborenen, machen ihn Kleidungsstil, Habitus und der noch zu verifizierende zweite Rufname zweifeln. Selbstverständlich blieben Gesundheit und Glück auch jenes Wunschkindes von primärem Belang - ganz gleich, welchen Geschlechts es auch sei. Obschon er sich dahingehend zu etwa fünfzig Prozent, also durchaus respektabel, sicher ist, wüsste er als liebendes Elternteil seine Vermutung doch gern bestätigt.
Zudem erwartet seine liebe, gute Frau wohl ohnehin, und das ganz zu Recht, dass er nicht nur das Alter der Kinder sondern auch ihres aus dem Stegreif weiß. Was sich ohne Akteneinsicht zugegeben etwas schwierig gestaltet, ist sie doch eine jener lieben, guten Frauen, die dahingehend nur schwer zu schätzen ist. Ganz sicher sieht sie deutlich jünger aus, als sie ist - als sie sein muss. Das ist mathematisch gar nicht anders möglich. Unwiderlegbarer, gleichwohl schönster Beweis ist zweifelsohne der gemeinsame Kindersegen. Und die für den Eingang eines solchen, wunschkindergekrönten Bündnisses unabdingbaren Gefühle sind natürlich nicht einfach hoppladihopp da; die müssen sich selbstverständlich erst entwickeln, sich erarbeitet und verdient werden. Das wird ja auch seine Zeit gebraucht haben. Jünger als er ist sie aber. Das zumindest weiß er auf Anhieb ganz sicher. Als Mann der Prinzipien, der sich nie für Frauen seines Alters, immer nur für die jüngeren interessiert hatte, wird er da schon drauf geachtet haben, als sie einander kennenlernten; etwa zu jener Zeit, da ihn gerade seine letzte liebe, gute Frau verlassen und er sich wohl in einem emotionalen Zustand befunden haben dürfte. Schließlich sind Trennungen nie frei von Trauer. Und als gefühliger Mensch wird er also etwas entsprechendes, dem Anlass Angemessenes, gespürt haben, als er dennoch die Stärke aufbrachte, sich auf seine neue liebe, gute Frau einzulassen - sie sogar zu ehelichen.
Vermutlich aus Liebe. Sollen andere doch aus anderen Gründen heiraten, solang diese nur redlich sind. Da gibt es absolut gar nichts dagegen zu sagen. Nur für ihn kommt das eben nicht in Frage. Und da möge es ihm doch bitte auch vergönnt sein, einzig aus einem Gefühl von Liebe zu heiraten. Natürlich wird das Motiv wohl kaum auf der Eheurkunde vermerkt sein. Aber wozu auch? So etwas fühlt man ja. Das ist ja da. Das bleibt ja, ob es dort geschrieben steht oder nicht. Sollte er aber doch mal einen Blick auf jenes Dokument werfen, dann nur, um den Tag des Freudenfestes mit seinem kalendarischen Gedächtnis abzugleichen. Also, um da wirklich sicher zu sein. Am besten wäre es, zeigte seine liebe, gute Frau ihm den Verwahrort aller im Familienbesitz befindlicher Urkunden. So böte sich gleich noch die Möglichkeit eines Hausrundgangs. Das wollte er ohnehin mal wieder gemacht haben: sich ihre gemeinsame Stätte ansehen. Ihr Nest. Ihren Hafen. Nannten sie nicht sogar eine Sonnenterrasse ihr Eigen? Einen Teich auch? Er konnte es kaum erwarten, das traute Heim zu erkunden. Am meisten jedoch freute er sich auf die Zeit mit den Seinigen. Das ist ja doch das größte Glück für ihn.
Er wird sich darum bemühen. Um all das. Aber erst einmal gilt es, sich wieder an die Arbeit zu machen. Die Kunst ist eine Gnadenlose und erfordert, dem Wohlstand und Wohlergehen der Liebsten wegen, Verzicht. So sehr ihn dieser auch schmerzt, so abwegig die Vorstellung, verzichtarmen und damit gleichwohl belanglosen Dienst zu leisten: Kaum zu erahnen seine Seelenqualen, wäre er zu kunstbefreiter, allem Schöngeist entsagender Lohnarbeit gezwungen. Was nutzte er seinen Lieben dann? Was hätten sie dann von ihm? Zurück zöge er sich. Nähme keinen, allenfalls spärlich Anteil an deren Leben. Säße, wenn überhaupt einmal, dann von Mimik und Haltung weitgehend befreit, mit ihnen bei Tisch, löffelte wortlos seine Suppe, tunkte gedankenverloren Brot, zerfurchte appetitlos Püree, spießte der Ordnung halber Rosenkohlröschen auf oder was auch immer seine liebe, gute Frau zum Löffeln, Tunken, Zerfurchen oder Aufspießen zubereitet hatte.
Um ihnen solch' teilnahmsloses, entzweiendes, ihm gänzlich widerstrebendes Leben zu ersparen, genau deswegen gilt es, und zwar unter allen Umständen, die Abgabefrist zu wahren. Hohe Kunst erwuchs eben nicht aus dem Nichts. Natürlich erleichtern ihm sein unbestrittenes Sprachgefühl, seine kaum zu verheimlichende Originalität und die ihm eigene, im Allgemeinen eher rar gesäte Fähigkeit, zu fabulieren, den Schaffensprozess. All das, darum wusste er nur zu genau, nutzte jedoch nichts ohne die Disziplin, die wahre Kunst unabdingbar einfordert, die aufzubringen er aber ebenso willens wie fähig ist, um auch dieses Mal ein seinen - und damit den höchsten - Ansprüchen genügendes Werk zu vollenden. Wo war er? Ach ja: “Nun alles verrühren und vorsichtig das Eiweiß unterheben."
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stefan Sommer
Erinnerungen an Zitronen und Flughäfen
Als das Licht erlischt, wünscht er sich von Herzen, ein Blitz hätte das Haus getroffen. In sehnlicher Erwartung einer höllischen Katastrophe harrt er im Dunklen, harrt vergebens. Nicht mal ein beschissenes Erdbeben. Der Boden unter seinen Füßen teilt sich nicht, nicht ein klitzekleiner Riss. Nichts. Selbst einen Stromausfall, Feueralarm oder bewaffneten Überfall würde er nehmen, aber das Universum verweigert ihm auch das. Nichts will den Lauf der Dinge unterbrechen. Nichts. Nichts. Nichts. Zwischen den Stockwerken gestrandet wie ein Fisch an Land, hört er Holzdielen knarzen, Toilettenspülungen plätschern, Fernseher brüllen, Paare streiten, eine geschundene Seele mit einer Geige kämpfen. Alles wie immer. Leider. Kein Donner. Keine Sirene. Kein brechender Beton. Nichts. Die Einkaufstüte in der Hand zieht ihn in die Tiefe, als wäre sie mit Ziegelsteinen gefüllt.
„Mrs. Kelly!“, stößt er ertappt hervor, als über ihm plötzlich das Licht angeht und die alte Dame vor ihm steht. „How’s the kidney?“. Zu so später Stunde hat ihre Lordschaft aber keine Lust auf Plauderei: „Mr. Lutz, why are you standing in the stairwell? In the dark? At this time?“. Ohne seine Antwort abzuwarten, nestelt die Duchesse of Highsmith, wie sie von den anderen Parteien des Mietshauses in der Highsmith-Street gerne genannt wird, ihre Lesebrille aus dem Etui. „Don’t you feel well?“, bohrt sie nach und mustert ihn streng. Die Situation ist ihr nicht geheuer. So ein Verhalten duldet sie an ihrem Hof nicht. „Something’s wrong? You’re on drugs, son?“. „No, no, don’t be bothered. Everything is fine. No drugs! Not today!“, versichert er mit einem Zwinkern, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, er hätte sich bis eben noch gewünscht, eine Naturkatastrophe würde auf das Haus niedergehen und seine Probleme ins Jenseits verschieben. „Way ahead“ und „rough day“ murmelt er zusammenhangslos hinterher und flüchtet eilig die Treppe hinauf, bevor sie nach Sophia fragen kann.
Als er außer Sichtweite zu Atem kommt, die Echos seiner Schritte im Haus verschwinden, bemerkt er, wie idiotisch sein Vorhaben doch ist, wie vollkommen verblödet und verblendet, wie gaga, bescheuert, wie meschugge, lächerlich, albern, wie grunddämlich. Einer neugierigen Rentnerin mag er entlaufen, seinem Hirn nicht. Das kommt erst in Fahrt. Durch das Fenster sieht er die Sterne über dem dunklen Garten aufziehen und das Erlebte zerrt ihn durch die Glasscheibe, hoch in den Nachthimmel, über den Ozean, auf den alten Kontinent. Italien, ihr Baum, alles fällt ihm ein. Das Kopfsteinpflaster, Bologna, die Brunnen, ihr Kleid, der Rotwein, wie sie auf der Dachterrasse liegen, wie Sophia die italienischen Namen der Sterne ausspricht. Croce del Sud. Corona Australe. Idra femmina. Der Weg von der Universität zu ihr. Die Treppe. Die Dusche in der Küche. Das Porträt ihrer Eltern über dem Bett. Der Geruch von Sonnenmilch. Die Madonnen-Statue. Ihr Hals. Das Blitzlicht der Polaroid-Kamera im abgedunkelten Zimmer.
Wie ein Derwisch kramt er das Foto aus der Brieftasche, reißt darauf seinen Kopf aus ihrer Umarmung. Als zelebriere er im Treppenhaus einen Exorzismus, schließt er seine Augen und drückt sich die Fetzen auf die Stirn. Er drückt und drückt und drückt, aber es funktioniert nicht. Er vergisst sie nicht. Er vergisst Italien nicht. Er vergisst nichts. Er denkt er an ihr Gesicht, ihre Sommersprossen, ihre Lippen, an ihre aufgerissenen Augen, als sie in die Zitrone beißt, wie sie hinterrücks von ihrem Ast kracht, wie sie in der Notaufnahme mit Händen und Füßen erklären, was passiert ist und warum eine Zitrusfrucht die Schuld trage. Ihm fallen die Plastikstühle in den grellen Fluren des Krankenhauses ein, der Schokoriegelautomat, die Ventilatoren, die Latexhandschuhe an braungebrannten Händen, das Fußballspiel im Fernseher in der Ecke des Ganges, die blinkenden Monitore, wie sie endlich einschläft, wie er neben ihr Wache hält. Verzweifelt versucht er sich vorzustellen, wie der Baum zwischen den Palazzos der Altstadt in den Himmel wächst, heute andere auf ihn klettern, andere in seinen Wipfeln sitzen und auf die Lichter des Städtchen schauen. Es klappt nicht. Sein Smartphone vibriert.
Im freien Fall stürzt er aus dem Luftschloss durch den Kamin zurück in seinen Körper, zurück ins Treppenhaus. Es ist ihr Festnetzanschluss. Sie ist also noch wach. Sie steht in ihrer Wohnung im siebten Stock und wartet auf ihn. Er stellt sich vor, wie sie oben mit dem Phone in der Hand durch die Küche tigert und von allem, was hier unten in ihm vorgeht, von allem, was mit ihrem gemeinsamen Leben passieren wird, keine Ahnung hat. Panisch streckt er den Kopf über das Geländer, vergewissert sich, dass sie ihn nicht beobachtet. Tut sie nicht. Sie läuft, vermutet er, wie immer das Telefon am Ohr und eine Zahnbürste im Mund vom Bad ins Wohnzimmer, um den Sessel, in die Küche, ins Bad, ins Wohnzimmer, um den Sessel, in die Küche, wieder ins Wohnzimmer, um den Sessel und immer so weiter. Der Empfang reicht nicht bis auf den Balkon und nicht ins Treppenhaus.
Als sie oben auflegt, glotzen ihn unten vier achsoverliebte Augen von seinem Smartphone an. Ist er das? Ist sie das? Als wäre das Gerät plötzlich aus tonnenschwerem Stahl bricht er mit der Last in seiner Hand wie ein Amboss durch die Decke und landet drei Jahre jünger in hohem, buschigen Küstengras. Es dauert damals bis sie dieses Selfie hinbekommen. Der Wind auf der Klippe ist so stark, dass es Sophias Locken vor ihre Gesichter weht. Er erinnert sich, wie die Spitzen in seinen Augen kitzeln, wie sie ihm aus ihren Haaren einen Schnurrbart flechtet, wie Böen ihre T-Shirts zu Luftballons aufblähen. Sie sind zum ersten Mal in Irland, um Weihnachten mit ihrer Familie zu feiern. Die Eltern Judie und David. Lehrerin und Optiker. Drei Brüder. Marvin, Dave, Joshua. Katholiken. Zwei Hunde. Toby und Jake. Golden Retriever Mischlinge. „It’s a wonderful life“ an Heiligabend. „Home alone“ am ersten Weihnachtstag. Bier am Flughafen. Bier im Wintergarten. Bier vor der Messe. Bier zum Lunch. Bier zum Dinner. Bier zum Tee. Er erinnert sich an den permanenten Kater, an ekligen Fisch zum Frühstück, den geschmückten Tannenbaum, das NYSNC-Poster über dem Bett in ihrem alten Kinderzimmer. Sein Smartphone vibriert.
Ein Sturm weht ihn durch die Ritzen in den Mauern zurück in seinen Körper, zurück ins Treppenhaus. Es ist die Mobilnummer. Auf dem Display das Bild aus Amalfi. Sie mit Taucherbrille. Badeanzug. Türkises Meer. Einen Seestern und eine Fanta-Dose in Händen. Wellen, die gegen das Land schlagen. Sonnenbrand. Zimmer mit Klimaanlagenfernbedinungen. Das Herz rutscht ihm in die Magengegend ab wie im Flugzeug, als er die Uhrzeit in der oberen Ecke des Bildschirms liest. In spätestens fünfzehn Minuten wird sie seinen Weg zum Laden abgehen und ihn entdecken. Und dann? Wird er es ihr sagen? Was ist, wenn er sich irrt? Menschen irren sich. Er irrt sich. Ständig. Dauernd. Quasi immer. Warum nicht auch jetzt? In seinem Kopf ist alles wirr und furchtbar und kalt. Seit er unten die Tür aufgeschlossen hat, ist dieser eine fatale Gedanke wie ein Weisheitszahn in sein Bewusstsein durchgebrochen und jetzt bekommt er ihn nicht mehr los. Was soll er tun? Auf den beschissenen Blitz warten? Ein beschissenes Erdbeben? Den beschissenen Feueralarm? Einen beschissenen Überfall? Nichts, nichts, nichts, nichts, nichts, nichts, nichts wünscht er sich mehr, als dieses Hirngespinst von ihr fern zu halten, zu fühlen, was er fühlen will.
Als er widerwillig in ihr Stockwerk schleicht, wartet sie schon im Türrahmen. Küstenwind, der aus dem Inneren der Wohnung in das Treppenhaus bläst, wirbelt die Locken dramatisch vor ihrem Gesicht auf und ab und hin und her. Sie trägt das Kleid aus Bologna und eine Taucherbrille. Durch die kleinen Bullaugen schaut sie ihn ängstlich an, sagt aber kein Wort. Wie frisch aus der Notaufnahme hat sie einen Arm verbunden. Von der Schulter bis zu den Fingerspitzen reicht der schwere, weiße Gips. Die andere, unverletzte Hand hält eine angebissene Zitrone. Als sein schelmisches Herz unverhofft munter wird, bemerkt er, wie sich Tränen hinter den Brillengläsern sammeln, die Kammern vor ihren Augen langsam volllaufen. Er stellt die Einkaufstasche auf den Boden, heilfroh, dass es nicht gewittert.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Avy Gdańsk
Augenwischerei
Wieder wird eine Ladung Süßstoff vom Kuchenschiff abgehoben, verschwindet im Sahnehafen. Der Gabelstapler kehrt leer zurück. Das Schiff schon buglos, eine marzipanerne Galionsfigur sitzt noch obenauf. Ihr geht es als nächstes an den Kragen.
Zwischen der Frachtvernichtung, die Ronja vom ganzen Nachmittag am besten gefällt, plaudert ihr Gegenüber. Sie wünschte, er würde nichts anderes tun als essen und dann gehen, gerne würde sie ihm den Mund stopfen mit Kirschteilchenknebeln oder Ball-Gag-Berlinern. Eine Verstummelung, süßes Verschweigen.
Mit Zucker hat sie nichts zu tun, er sieht das anders. Weil er offenbar blind ist. Sie hat augenblicklich eine Zeile aus einem Mötley Crüe-Song im Kopf:
Well it’s no surprise, ‘cause you’ve got one-way eyes!
Einweg-Augen. In vielfacher Hinsicht.
Sie trinkt ihr Schwarzes und sagt, sie möge Bewegung, vor allem Wandern. Er mampft, meint Hättest du das nicht dazu gesagt, wäre es sexy gewesen.
Er wiederum könnte einfach gar nichts sagen, was ihn für sie sexy machen würde. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Taubstumm ist Platin. Aber selbst das würde bei ihm nicht helfen.
Das Gespräch ist keines, vielmehr ein Monolog. Alles daran ist mono, besonders der Ton. Sein Ton. Tonfiguren, er und all diese Männer, sie unterscheiden sich kaum voneinander. Ronja kennt sie schon, die Muster und Maschen, mit denen die Konversation vorgestrickt wurde. Er bedient sie alle. Schade, denn er ist die letzte Chance, die sie dem Sprechen gibt.
Durch kakaokrümelgeschwärzte Zähne bahnen sich Aussagen, und wo sie zu abgekaut sind, bläst die Stimme sie auf. Sätze, die immer beim Ich beginnen, der Versuch einer Selbstverwirklichung durch Worte. Ich denke nicht in Mustern. Und wenige Sätze später Ich bin keiner von diesen Eyeliner-Sensibelchen. Da ist ja schon der erste Widerspruch. Auch dieser Kerl: trampelfad. Erschafft die Welt nach seinen Maßstäben. Ronja aber hat Mehrweg-Augen, die das Seemannsgarn mit Nadelblicken heraustrennen. Wird gerne zum Überzeugungstöter.
Die Allgemeinwissensdusche lässt sie ins Leere rieseln. Oberflächlichkeiten. Außerdem weiß ich das schon alles. Nur das Darunter zählt. Und ehe er einen schlüpfrigen Witz machen kann, wie sie es von seinesgleichen gewohnt ist: Was du weißt, will ich nicht wissen. Was in deinem Kopf hängt, wenn du nach innen sinkst, das schon. Wie du empfindest, wie du wahrnimmst. Nur das Verletzliche zählt. Schäl, wenn du sprichst, das Gefühl.
Der Kuchenverlader, unfähig zum Entkernen, bläst kurz die Gebäcktaschen auf, holt zur Gegenoffensive aus. Eine billige, die Ronja längst kennt – diese Typen gleichen sich wirklich wie ein Schokonikolaus dem anderen: Sie sind alle hohl und brechen nach der ersten bissigen Bemerkung zusammen.
Während ihm aus dem klaffenden Vollmilchschlund schlechte Vergleiche und Reste seiner Zulänglichkeit bröckeln, mit denen er ein unschmeichelhaftes Dessertportrait von ihr hinschmiert, wird Ronja unfassbar müde.
Müde von den Deutungshoheiten, die sich mit eigenen Worten krönen. Ihr Mundwerkzeug nur dazu da, sich die Umwelt untertan zu machen, konsumierbar – während sie Ronja auf Diät setzen wollen. Immer gleiche Schnittbewegungen und Schnittmuster, aber auf Einzigartigkeit pochend: Du wirst mich nie etwas machen sehen, weil es gerade angesagt ist. Es ist die Artigkeit, die bei all diesen Sätzen übrigbleibt. Sprache bleibt nur Trimmaufsatz, reine Oberflächenbearbeitung.
Vom Verborgenen mag Ronja gar nicht erst anfangen, von dem, was sie hinter den Dingen entdeckt. Mit Geheimlehren kannst du mich jagen. Er sieht sofort Esoterik darin. Dabei geht es gar nicht darum. Aber das kann nur erkennen, wer ein feines Gespür dafür besitzt, was unter dem Sichtbaren liegt. Hier ist alles Tunnelblick. Einwegaugen.
Wo sind die Gesprächspartner hin verschwunden, die packenden Zuhörer, denen es nicht darum ging, sich selbst zu inszenieren? Die mit Ronja suchten und irrten, Zugänge zueinander legten mit vorsichtigen Worten, mit zweifelnder, brechender, bewegter Stimme? Mit denen man Gemeinsames erschuf im Reden, unter die Zungen tauchte, wo die Gedankenströme zusammenflossen? Ronja vermisst sie, verzehrt sich danach, wie sie einander die Augen wuschen, jeder Rausch ließ den Blick aufklaren. Ganz anders als jetzt.
Sie wischt gelangweilt mit den Fingern über die Cremigkeit des Tellers, fährt anschließend damit über die Pupillen ihres überraschten Begegners, dreht sie nach hinten. Zwei liegengebliebene Schattenmorellen drückt sie auf das vollkommene Weiß, fruchtig-erfrischendes Weltbild.
Die Gäste im Café erwachen aus ihrem Nachmittagsdösen, als sie mit dem Löffel die Zunge des Kuchenmanns abschabt, um ihr eine neue Glasur zu geben, einen Belag aus Aprikosenaufstrich für schmackhaftere Gespräche.
Blut und Konfitüre, eine noch unverbrauchte Mischung. Der Nachtischler spuckt kleine Töne nun, kauernde Zwischentöne, während Ronja sich den Kehlkuchen schmecken lässt.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martin Dost
Das letzte Tier
Alte Männer erzählen, dass alte Männer erzählen - von der Vergangenheit. Sie sind weiß und verhornt. Sie denken, sie sind die letzten ihrer Art und mit ihrem Tode sterben sie aus. Jedoch werden sie nur vergessen.
Ich erinnere mich an den kalten Novembermorgen. Es gab Frost, der Boden war hart und schwere weiße Wolken bedeckten den Himmel, eine bewegungslose Masse, doch blieb es trocken und kein Regen fiel herab. Mitten im Hof stand der Traktor zum Hissen des toten Tieres. Ich stellte mich neben das massige Gerät und wartete auf den Fleischhauer. „Schlachten ist schwere Arbeit“, sagte mein Großvater. In seinen Händen hielt er zwei Flaschen. Korn und Kümmel. „Hol die Schubkarre!“, sagte er. Als ich zurückkam, sah ich, wie er aus einer der Flaschen trank. „Das beruhigt!“
Die Schlachtstraße befand sich zwischen Stall, Scheune und Garage. Mein Großvater führte den Ochsen, er hatte keinen Namen, heraus, vom Stall zum Scheunentor, vorbei an dem weißen Kastenwagen des Metzgers und hielt ihn fest. Er fuhr noch einmal mit der flachen Hand über den Hals des Tieres. Ein dunkelbraunes Fell, das zum Kopf hin heller wurde und an der Stirn ganz weiß war.
Der Schlachter kam mit einem Bolzenschussgerät, setzte es auf den Ochsenkopf und drückte ab. Es gab einen Knall, einen Rückstoß und der Ochse sackte, so schnell wie der Schuss, in sich zusammen. Die Beine in der Luft fiel der schwere massige Körper dumpf zu Boden. Mein Großvater, der unentwegt auf den Traktor sah, ganz so, als ob er an dessen Leistung zweifelte, ließ die Leine los und wand sich an mich. „Er ist nicht tot. Das Herz schlägt noch“, sagte er. Seine Stimme war rau und brüchig: „Jetzt muss es schnell gehen!“
Der Schlachter zog eine Kette um die Beine des Ochsen und befestigte das andere Ende an der Gabel des Traktors, während mein Großvater den Motor startete. Er zog das Tier in die Höhe, bis es schwebte und schwankte. Ich sah seine Hände zittern. Schnell griffen sie in die Innentasche seiner Jacke und holten eine Zigarettenpackung hervor. Mit glimmendem Stängel stellte er sich neben den Fleischhauer, sah noch wie jener das Messer zog und kurz bevor er zustach, wendete er den Blick ab. Ich sah dem Ochsen beim Ausbluten zu. Das tote Tier taumelte an der Kette leicht hin und her und das dickflüssige und tiefrote, fast schwarze Blut wurde in einem Bottich aufgefangen.
Auf den ersten Akt wurde angestoßen. Der Schlachter und mein Großvater kippten den Korn und atmeten schmackhaft aus. Ich kauerte auf der Treppe zum Scheunendachboden und sah ihnen dabei zu. In der Luft stand der Geruch von Heu, Ochse und Zigaretten. Von irgendwo, weit hinten, erklang eine Säge, ein Rattern, Schnurren und Brummen.
Meinen Vater, der mit einer Kamera auf der Schulter in die Scheune trat, zeichnete das Geschehen auf. Ein kleiner roter Punkt leuchtete und signalisierte den Aufnahmemodus. Er hielt auf die Männer, er hielt auf die Stelle am Hals des blutenden Tieres.
„Schenk uns mal nach“, sagte mein Großvater. Ich nahm die Flasche aus seiner Armbeuge, schüttete den Korn in kleine polierte Gläser. Mein Vater filmte den Traktor, die Gabel und Kette. Er umrundete die Männer und neben seinem zugekniffenen Auge blinkte die kleine rote Signalleuchte. Alles wurde festgehalten.
Der Ochse war ausgeblutet und tot. Der Schlachter ging um das Tier herum und drückte auf den Augapfel. „Keine Reaktion“, sagte mein Großvater. Er ließ den leblosen Körper herunter, langsam senkte sich die Gabel und der Metzger trennte die Hinterhufe ab, legte die Hinterbeine von der Haut frei und justierte die Kette an der Stelle oberhalb des Knies neu. „Komm her!“, sagte mein Großvater und stieg vom Traktor. Ich kletterte auf den Sitz und er zeigte mir, wie man den Diesel vorglühte, anließ und die Gabel nach oben manövrierte. „Hoch!“, rief er. Das Tier begann von Neuem zu schweben und der Schlachter hielt es fest, bis es nicht mehr schwankte. Dann zog er weiter die Haut ab und es folgten routinierte Bewegungen. Er schnitt, zog, schnitt und zog und die Haut hing wie in Lappen am nackten Tier zu Grunde.
Mein Großvater schaltete den Motor ab, zog den Zündschlüssel und ging in Richtung Stall davon. Unterdessen filmte mein Vater jeden Schnitt des Fleischhauers, jeden Moment des zweiten Aktes. „Früher hatten wir mehr Rinder“, sagte mein Großvater. Er saß vor dem Stall auf einem Holzstuhl und rauchte. „Da haben wir an einem Tag bis zu drei Viecher geschlachtet. Die Arbeit möchte ich heute nicht mehr machen.“ Es folgte eine Pause. „Mein Vater hatte auch noch selbst geschlachtet. Klar gab es Metzger und jede Menge Lehrlinge, aber er wollte es selbst machen. Mein Alter war verbissen“, sagte er und zog den Korn mit dem kleinen Glas hervor. Er reichte mir die Flasche und ich schenkte ihm ein. „Halt mal noch!“, sagte er, trank das Glas mit einem Schluck leer und verlangte ein zweites. „Die Karnickel, die wir gezüchtet haben, musste ich schon als Kind beim Schlachten festhalten. Ich habe mir die Viecher zwischen die Beine geklemmt und mein Alter hat mit einem Knüppel draufgeschlagen. Einmal hat er mir fast die Kniescheibe zertrümmert. Aber schlimmer waren die schrillen Schreie. Wenn das Tier erkennt, dass es stirbt.“ Er stand auf, spuckte auf die Zigarette in der Hand und steckte die Flasche in die Innentasche seiner Jacke. „Schau mal nach, ob der Kopf schon runter ist“, sagte er. Der Metzger rang noch immer mit der Haut. Weißer Dampf umschwebte den warmen nackten Körper des toten Ochsen und ich sah, wie auch der Dampf den Metzger umgab. Ich wartete, bis er den Kopf abschnitt, ihn auf die Schubkarre bugsierte. Dann winkte ich meinem Großvater. „Ab damit“, sagte er. Er nahm die Schubkarre und fuhr den Kopf zur Garage. Ich sah, wie er schwitzte, unter seiner Schiebermütze glänzte und sich mit dem Handrücken über die Stirn fuhr.
Der dritte Akt begann mit einem weiteren Korn. Die Flasche war bereits weit über die Hälfte geleert und die Männer leckten sich die Lippen. „Ein guter Korn“, sagte mein Großvater. Mein Vater trank nicht. Er filmte still.
Als der Metzger das Messer am Bauch des Tieres ansetzte, begann der hängende Körper plötzlich zu zucken. Eine Hautpartie nahe dem Vorderlauf vibrierte und ich erschrak. „Das sind nur die Nerven“, sagte mein Großvater. Ich sah auf das Messer des Schlachters. Er machte einen länglichen Schnitt und riss die Bauchdecke auf. Mein Großvater wies mich an, die Schubkarre direkt unter das Gehänge zu schieben und mittig zu positionieren. Jetzt griff der Fleischhauer beidhändig in das aufgeschlachtete Tier, grub mit Bedacht seine Finger hinein zwischen Muskelfleisch und Innereien bis die Arme schon nicht mehr zu sehen waren. Ein Torso von einem Schlachter und ganz nah waren sich nun Mensch und Tier.
Der Fleischhauer trug lange gelbe Handschuhe, eine Schlächterschürze, am Gürtel die Messer in einem Köcher mit Wetzstahl. Vorsichtig zog er die Eingeweide heraus, trennte sie ab. „Die Milz oder der Darm dürfen jetzt nicht verletzt werden“, sagte mein Großvater. Er blickte auf das Rad der Schubkarre: „Da kommt jetzt einiges an Gewicht zusammen. Das Ventil muss halten.“ Die Innereien dampften stärker noch, als das nackte Muskelfleisch. Überall war nun der Geruch von Tod und Gedärm, kein Heu mehr, keine Zigaretten. Die Schlachtabfälle luden wir vorerst auf dem Mist nahe dem Hof und bedeckten sie mit Stroh. „Das vergraben wir später“, sagte mein Großvater. „Fahr die Schubkarre zurück!“ Er lief neben mir und deutete auf die Felder, die sich in geraden parallelen Formen hinter dem Hof erstreckten: „Bis dahin hat mich der Alte getrieben. Die Felder rauf und runter“, sagte er und deutete auf den Horizont. „Misten, Gülle fahren, im Sommer Heu machen, im Herbst die Erntezeit und kurz vor Weihnachten über vierzig Gänse schlachten. Mit der Mutter. Das ganze Federzeug haben wir verkauft. Gab nicht viel, aber weggeschmissen wurde eben auch nichts. Mein Alter konnte mich jagen, aber unter den Tisch gesoffen, habe ich ihn. Der hat nichts vertragen. Der konnte malochen den ganzen Tag, doch am Kümmel war er ein halber Mann.“
Er lachte und rauchte. „Jetzt trinken wir noch einen und dann geht es ans Zerteilen.“ Mein Großvater und der Metzger leerten die Flasche zum vierten Akt. Sie lachten. Der Ochse war nichts mehr als weißrotes Muskelfleisch, schwere Knochen und eine Abstraktion von einem Tier.
„Wir bugsieren die Teile. - Pack mit an!“, sagte mein Großvater. Der Schlachter schnitt große Stücke ab, die wir mit der Schubkarre zur Garage fuhren. „Dein Vater hatte Glück. Erst Polytechnische Oberschule, danach eine abgeschlossene Lehre und weg war er“, sagte er. „Ein Händchen für Technik, dafür aber zwei linke Pfoten, wenn es um richtige Arbeit geht. - Ich wäre auch gegangen, wenn ich gekonnt hätte. Aber wie?“ Ich sah, wie mein Vater den Akku seiner Kamera wechselte und sie auf einem Stativ positionierte. Aus einem Karton zog er zwei Baustrahler hervor und hängte sie an die eigens dafür installierten Haken an der Decke auf. Alles wurde hell und die gekalkten Wände reflektierten das weißblaue Licht. „Lass den mal filmen, da stört er nicht. Und wenn hier mal alles platt ist, gibt es immer noch die Aufnahmen“, sagte mein Großvater. „Los – alles auf die Schlachtplatten!“
Der Tierarzt war pünktlich. Er kontrollierte die Schlachtung, beschaute das Fleisch und nahm Proben. „Trichinenschau“, sagte mein Großvater. „Jetzt geht der Ochse unter das Mikroskop.“ Die Untersuchung war abgeschlossen und der Arzt nickte. Die großen Stücke konnten nun portioniert werden. Der Metzger kam in die Garage und zusammen mit der Großmutter, die der Großvater gerufen hatte, wurde das Fleisch zerteilt, klein gehackt und verpackt. „Hier beginnt die Küchenarbeit“, sagte er. Er zündete sich eine Zigarette an, fuhr mit der Schubkarre ein letztes Mal zur Scheune und beseitigte alle übriggebliebenen Tierreste. „Hol heißes Wasser und wisch den Boden!“ sagte er.
Das rote Wasser rann über den grauen Betongrund der Scheune, über den Hof zum Feld hinaus. Es war bereits Mittag und die weißen Wolken begannen sich allmählich zu bewegen, leicht zu werden und auszudünnen. Da stand der alte Mann, der mein Großvater war, der das Töten nie gelernt hatte. „Feierabend“, sagte er. „Geschafft!“ Ich sah sein Profil und wie er eine neue Flasche, den Kümmelschnaps, aus der Jacke zog und in der Hand hielt. „Das war das letzte Tier.“ Er schaute auf das rote Rinnsal, wie es ganz dünn im Felde verlief, setzte an und trank. „Was ein Mann ist, trinkt. Immer schön die Rübe hinunter. Dein Großvater ist ein Trinker, kein Bauer. Bauern gibt es nicht mehr.“ Er begoss den fünften und letzten Akt. Es war vorbei.
Die alten Männer, sie fürchten sich. Sie sind grau und schwach. In ihrer Angst steckt das Erkennen der Gegenwart und während sie an ihren Tod denken, vergessen sie, dass sie längst vergessen wurden.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Kerstin Nethövel
Die Kreiselegge
Ein Spaziergänger kam an einem Feld entlang und sah einen Mann am Rand des Ackers quer zur Pflugrichtung rücklings am Boden liegen. Seine Kleider waren zerrissen, und die Haut war aufgeschürft und zerkratzt. „Was ist passiert?“, fragte der Spaziergänger. „Nichts“, sagte der Mann, der am Boden lag. „Nicht viel jedenfalls. Ich habe das Feld bestellt und bin dabei nicht weit gekommen.“ „Und warum liegst du da?“ „Ich sagte dir doch, ich wollte den Boden für die Aussaat vorbereiten. Und bei der Arbeit bin ich unter die Egge geraten.“ „Aber du kannst doch da nicht liegen bleiben“, sagte der Spaziergänger. „Warum denn nicht?“ „Wenn es regnet, wirst du nass, in der Nacht ist es zu kalt, und wenn die Sonne brennt, wirst du geblendet. Außerdem staubt es dann zu sehr. Ich werde dich unter deinem Arbeitsgerät hervorholen.“ „Tu das nicht“, sagte der Mann, der am Boden lag, „Ich habe mich schon vor langer Zeit zwischen den Zinken eingerichtet und eine Position gefunden, in der sie mir nicht weh tun können. So lässt es sich aushalten, wenn ich mich nicht bewege. Ich spüre nicht mehr, dass ich nass werde. Ich spüre nicht mehr die Kälte, und ich werde auch nicht geblendet. Ich liege schon zu lange hier. Der Regen wäscht mich, die Sonne wärmt mich, die Nacht deckt mich zu. Geh einfach weiter. Ich habe mich mit meiner Situation abgefunden, also finde du dich auch damit ab.“
Der Spaziergänger aber blieb weiter stehen und sah auf den Mann hinunter und überlegte, wie er ihn am besten aus den Krallen dieses Gerätes herauslösen könne. „Denk gar nicht erst darüber nach“, sagte der Mann am Boden. „Wir wollen alles dabei belassen, wie es ist.“ Der Spaziergänger ließ nicht locker, machte einige Schritte nach vorn und sank in die weiche Erde des Ackers ein. „Komm nicht näher. Vergiss es.“ „Doch. Ich will dir helfen, und ich werde dir helfen. Ich kann dich doch so nicht zurücklassen“, sagte der Spaziergänger und ruckelte an dem Bodenbearbeitungsgerät herum. Der Mann am Boden unterdrückte einen Schrei. „Jetzt hast du mich geschnitten.“ Er deutete auf den Blutfaden, der seitlich an seiner Hüfte herunterrann und in die Erde tropfte. „Ich sagte dir doch, du sollst weitergehen. Lass mich in Ruhe. Die Zacken sind eingerastet. Sie lassen sich nicht von der Stelle bewegen. Du kannst nichts dagegen tun. Und ich, ich kann es aushalten in dieser Position, wenn ich mich nicht rühre. Du kannst mir nicht helfen.“ Der Spaziergänger aber gab keine Ruhe und beharrte darauf, den, der am Boden lag, aus den krakenähnlichen Griffen des Gerätes zu befreien. Er dachte, wenn ich all meine Kraft aufbiete, kann ich es beiseite bewegen. Und er griff mit den Händen fest zu und biss die Zähne aufeinander und zog und zerrte, und je mehr er zog und zerrte, desto mehr bohrten und gruben sich die Zinken der Kreiselegge in den Körper dessen, der am Boden lag, und rissen das Fleisch von seinen Knochen. Als der Spaziergänger das Gerät endlich ein Stück beiseite geschoben hatte und sah, dass von dem Mann fast nichts übrig geblieben war, setzte sich die Egge langsam in Bewegung und kam auf ihn zu.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Angela Regius
als es anfing mit dem zu hause bleiben hatte ich angst dass es wieder so sein würde wie damals mit dem essen und dem essen und dem . die mangelnde struktur teil des problems und arbeit eine antwort mit ihren prozessen und räumen die standardisiert sind wegen gesundheitlichen erkenntnissen und den kernarbeitszeiten. never change a running system aber was läuft denn überhaupt und was ist bloße kompensation ein anderes ventil für etwas das tiefer sitzt das nicht zu lösen ist sondern abgearbeitet werden muss mit am besten antrainierter methodik. ich esse und esse nicht sondern liege auf dem sofa aktualisiere kaue an den nägeln fahre mit den fingern durch haare und fühle mich oft als wäre aufstehen eine unstemmbare angelegenheit. ich esse und esse nicht aber ob das so wäre wenn du nicht hier wärst mit mir in einer wohnung ob ich tatsächlich stärker geworden bin oder einfach nur das bild aufrecht erhalte weil da jemand ist der es sieht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Viviane Kern
Die Entsorgung
I
Von meiner Wohnung zur Straße sind es 137 Schritte und 52 Stufen, ich zähle jedes Mal genau, um die Länge meiner Schritte einschätzen zu können und brauche meist exakt diese Anzahl. Habe ich mehr Schritte, ist dies ein handfestes Indiz dafür, dass ich gedankenversunken durch die Welt laufe und dies meine Beine hemmt, habe ich weniger, besteht die Gefahr, dass ich mich zu sehr durch den Tag hetze.
Kaum betrete ich die Straße, versuche ich leblose Dinge in hierarchische Kategorien einzuordnen und überlege, was diese in mir auslösen. Ein Mistkübel steht auf der gedanklichen Leiter weiter unten als vergleichsweise ein Auto, bedingt durch die Assoziation mit Schmutz, Ekel und Abfall. Dass in Mülleimer all jene Dinge gestopft werden, die man nicht braucht, deprimiert mich. Zugleich entfacht der Anblick die Neugier in mir, was wohl alles darin stecken könnte. Eine Ode an die Freude singe ich innerlich, wenn ein Mistkübel ungewollt aufgegangen ist und der ganze Müll wüst und entblößt auf der Straße liegt. Der halb ausgetrunkene Kaffee vermischt sich mit dem Papier, das die Flüssigkeit absorbiert, gepaart mit nicht identifizierbaren Essensresten und einem bunten Berg aus Plastik, das den rinnenden Kaffee nicht aufsaugen kann. Plastik ist beständig, nimmt nichts auf, manchmal sehne ich mich danach. Mülleimer müssen geleert werden, irgendwann platzen sie aus allen Nähten und bereits ein kleines Teilchen würde sie zum Überlaufen bringen. Leert man die eigenen Mülleimer nie, geht man von alleine daran kaputt. Kaum verlasse ich meine Wohnung, sehe ich Menschen, deren Mülleimer so groß sind, dass man es ihnen von außen bereits ansieht.
Zu den Mülleimern gehört auch das Wort entsorgen, das ich schön finde. Ich werde entsorgt, von meinen Sorgen befreit, ich kann diese abschütteln und loswerden, sie werden entleert – einfach so - für mich. Es ist befreiend, etwas in den Mistkübel zu werfen und nie wiederzusehen. So setze ich Fuß für Fuß vor mich, spüre wie meine Sohle den festen Grund berührt, wieder emporgehoben wird und gegen die Luft ankämpft, die kein Gewicht hat.
An der Ecke eines Wohnhauses verdorren Blumen vor lauter Hitze und fehlendem Wasser, die Stängel werden bereits leicht braun und beginnen sich zu verbiegen. Die Blumen werfen ihre Blüten ab und versuchen verzweifelt, sich das Leben zu retten. Blumenstiele sind für mich saftig, die Blüten sollen duften, Farbe tragen, um der Welt einen Hauch von Schönheit zu verleihen. Ein Mann lehnt an einer Hauswand und zieht an einer Zigarette. Das Papier verwandelt sich mit dem Tabak in Asche und kleine Teilchen davon fliegen durch die Luft. Der Mann hält den Rauch kurz in seinen Lungen, bis er diesen genüsslich ausstößt, den Rhythmus der Stechuhr für einige Zeit durchbrechend. Der Rauch treibt aufwärts, als wäre er nie hier gewesen, in den Kondensstreifen-freien Himmel, die Luft ist sehr trocken.
Ich gehe die Straße entlang weiter, zähle meine Schritte, alle Geräusche, die zu mir hervordringen, nehme ich intensiv wahr: Stimmen, Motoren und ich sehne mich nach Wasser und Kälte. Der Schweiß tropft mir von der Stirn auf meine Schulter und rinnt den Oberarm langsam herab, ich kann spüren wie er kurz innehält, bevor er auf den Asphalt tropft und in diesem Moment ein kleiner Fleck auf dem Gehsteig hinterlässt. Er wird aufsteigen und verdunsten. Was wohl alles diesen kleinen Teil des Gehsteigs schon berührt hat? Ein Mann, der hinter mir geht, steigt genau auf meinen akkurat hinterlassenen Fleck und verwischt meine Spuren.
II
Ich setzte mich in das Kaffeehaus, in dem ich immer sitze. Zweiter Tisch von links genau der rechte Stuhl, hier kann man das tägliche Geschehen gut beobachten. Ich betrachte die einzelnen Gesichter, die vorbeieilen und obwohl es die Geschwindigkeit der passierenden Leute nicht wirklich möglich macht, mehr als einen flüchtigen Blick auf deren Ausdruck zu werfen, habe ich das Gefühl, man könne Jahre darin lesen.
Verharrend in meinem Beobachten passiert etwas Suspektes, fast Bedrohliches, mit dem niemand gerechnet hat: Ein Mann schaut in alle Richtungen und versucht sich vor einem Mistkübel zu positionieren, dass sichergestellt ist, dass niemand seinen verdächtigen Vorgang sieht. Unter seiner Jacke holt er, sein Plan wirkt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr penibel durchdacht, den wer trägt bei dreißig Grad im Schatten eine Jacke, ohne die Intention, etwas verbergen zu wollen, einen Sack hervor, der zu groß ist um in die kleine Öffnung des Mistkübels zu passen. Während er sich halb auf die Mülltonne legt und sich gegen den Sack stemmt, kommt sein Blut in Wallung und sein Gesicht errötet. Der Sack will nicht hineinpassen, als wäre ihm bewusst, hier geschieht eine tätliche Entgleisung.
Der Mann beginnt sein Gesicht zu verziehen, ich meine sogar zu erkennen, dass er vor sich hinmurmelt. Er blickt wieder nach links und rechts, um ja unentdeckt zu bleiben. Jetzt beginnt das ganze Geschehnis zu eskalieren und trägt sich wie folgt zu: Dem Mann ist bewusst, dass sein Sack nicht in die Öffnung passt, legt diesen bedächtig am Boden, fast zärtlich, um dann viermal fest mit dem Fuß auf eine genaue Stelle zu steigen. Er hebt den Sack wieder auf, greift hinein und versucht den Inhalt zu zerreißen, doch die Kohäsionskraft des Gegenstandes trotz ihm. Er presst den Inhalt kraftvoll zusammen, dieser scheint jedoch gummiartig wieder in seine alte Position zu springen. Noch einmal fordert er den Mistkübel heraus und probiert den Sack durch die Öffnung zu befördern, erfolglos. Jetzt beginnt er richtig wütend zu werden und stößt einen Schrei aus, es hört sich an wie:
„Scheiß Mistkübel“, und tritt dagegen.
Einmal mit dem Fuß und da dies nicht zu reichen scheint, schlägt er mit beiden Fäusten oben auf den Deckel.
Was jetzt passiert, war vorherzusehen: Der Mistkübel öffnet sich und entleert die Schwere, die an ihm haftet. Freude, schöner Götterfunken! Wie angewurzelt steht der Mann da, als er merkt, was sein Wutausbruch für Konsequenzen hat. Er eilt so schnell er kann mit seinem Sack davon.
III
Erst jetzt merke ich, wie die Wespen einen Festschmaus vor meinen Augen genießen: Meine bestellte Limonade, ich habe noch keinen Schluck getrunken. Ich bezahle und mache mich auf den Heimweg, von der Straße zu meiner Wohnung sind es 137 Schritte und 52 Stufen, ich zähle sie pedantisch genau. Lange denke ich an diesen Mann und hoffe, dass er irgendwann diese Last des Sackes loswird, die er sich von der Seele reißen wollte. Manchmal sehe ich Menschen, deren Mülleimer so groß sind, dass man es ihnen von außen bereits ansieht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Olav Amende
Olav Amende - Mittag. Fügnis.
Der 12-Uhr-Glockenschlag weitet sich in der Stadt. Vom Friedhof bis zur Seniorenresidenz, die der stilvoll gekleidete Gruftie-Altpunker mit Sisters of Mercy im Ohr zum Beginn seiner Schicht betritt; von der Kleingartenanlage, in der der ehemalige Vorstand die beiden fremden Spaziergänger auf sicherer Distanz hält, bis zum Wasserturm, auf dessen Gesims sich ein weißes Täubchen niederlässt und dabei von niemandem erblickt wird. Der 12-Uhr-Glockenschlag schwebt über den versteinerten Wellen des Marktplatzes und auf diesem steht heute eine Gulaschkanone in Grün. Betrieben wird die grüne Gulaschkanone von einer Rentnerin – einstige Köchin in einer Oberschule oder einem Kindergarten oder in einem VEB-Großbetrieb, der Papiersackfabrik vielleicht. Unterstützt wird sie von ihrer Enkeltochter. Gerade ist Pause. Das Mädchen übt sich im Radschlagen. Sie schlägt die Räder quer über den gesamten Marktplatz, so lange, bis ihr schwindelt und sie in Folge dessen aufs Hinterteil fällt. Da hupt ein von rechts kommendes Auto einem Kontrahenten von links hinterher und bremst nicht ab. Morgen wird das in den „Groitzsch-Pegauer Nachrichten“ nachzulesen sein, wenn es diese noch gäbe. Im Blumenladen haben sich die alten Frauen zum Schwatzen versammelt, während der Florist das Kleingeld zählt, das sie ihm in die Tasche seiner Schürze stecken und eine ihrer Freundinnen nebenan beim Metzger an der Theke zur Aufbesserung ihrer Rente Metthalbbrötchen zubereitet, sehr zur Freude zweier junger Männer. Am Rathaus klopft ein Lehrling Steine – ein Quadratmeter ergibt eine Stunde, schätzt er und blickt auf das Trassierband in zwanzig Meter Entfernung. In der Zwischenzeit ruft sein Großvater zwei durch die Anlage des Kleingartenvereins „Naturfreunde 1907“ e. V. streifenden jungen Männern entgegen: „Was gibt es hier Interessantes?“ Die Stille, die zwischen dieser Frage und der Gegenfrage: „Was gibt es für Sie Interessantes?“ klafft, ist das Echo des 12-Uhr-Glockenschlags, der Moment, in dem sich das Täubchen auf das Gesims des Wasserturms niederlässt oder sich von diesem erhebt, der Gruftie-Altpunker aus seinem Ledersakko in den weißen Kittel schlüpft, die ehemalige Großköchin den Kanoneninnenraum umrührt, ein Besucher der Groitzscher Buchhandlung hinter einer Reihe Schulpflichtlektüre ein verstecktes Buch entdeckt und das Mädchen ein Rad zu viel schlägt.
Zwei Arbeiter der Stadtreinigung sitzen in ihrem Wagen und schlürfen Erbsensuppe. Das Mädchen stellt sich an den Rand der Dreierstufen und lunzt zu den Schreibenden auf der Parkbank. Einer der beiden schaut mal hin, mal weg, mal hin, bis er endlich begreift, dass das Mädchen darauf wartet, dass er ihr zuguckt, wenn sie über die Stufen jumpt. Gut, schaut er eben wieder hin. Das Mädchen grinst, beugt sich zurück, der Lehrling erhebt den Fäustel, die Arbeiter pusten auf ihre Löffel, das Mädchen springt. Der ehemalige Vorstand des Kleingartenvereins „Naturfreunde 1907“ verschließt seinen Schuppen und murmelt, während sich das Täubchen in die Luft erhebt, der Pfleger über die Hand eines alten Mannes streicht, sich einer der beiden jungen Männer auf der Bank eine Faser Mett aus den Zähnen zieht, und das Mädchen auf dem Bauch landet. Es feixt. Die Großmutter rührt noch einmal die Kanone um.
Im Buchladen holt einer der beiden Schreibenden Prousts „Auf der Suche nach der usw.“ hervor. Die Verkäuferin tritt heran und sagt: „Ach, der. Der ist hier hängengeblieben.“ Der 12-Uhr-Glockenschlag verhallt, das Weiß der Taube löst sich ins Weiß der Wolken und die ehemalige Großköchin reicht ihrer Enkeltochter eine Schüssel mit Erbsensuppe.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Magdalena Maier
Glück
Ich stehe vor meinem Teich und stell mir vor, er wär das Meer. Also voll Salz und Fische und mit Sand am Rand. Wenn jemand die Blätter vom Apfelbaum mit Booten oder Wellen austauschen würde, wäre die Transformation perfekt. Was will man sonst von einem Meer? Wasser, Salz, Boote, Fische, Wellen, Strand.
Leider ist mein Teich kein Meer. Gestern war der Himmel grau, heute ist er blau und mein Teich spiegelt die Wolken, weil er glaubt, er sei ein Spiegel. Mich spiegelt er nicht. Die Katze vom Nachbarn fällt durch die Hecke und landet trotzdem auf allen Vieren. Dass ich regelmäßig stolpere und hinfalle, rechtfertige ich dadurch, dass ich nur zwei Beine habe. Mit zwei als Back-up würde ich auch nicht stürzen. Die Katze vom Nachbarn kitzelt inzwischen meine Waden mit ihrem Schwanz. Die Katze ist schwarz. Ich stell mir vor, dass das Glück bringt.
Aus Reflex trete ich das Tier, als es mich zu Kratzen beginnt. Das Geräusch, das dem kleinen Körper entflieht, würde bei einem Menschen tief unten aus der Kehle kommen. Ein Fluch fällt mir aus dem Mund und jagt die Katze in die Flucht. In meiner Haut ist eine Linie, die rote Perlen aufzufädeln beginnt. Ich stelle mir vor, es wären Rubine. Leider schmelzen sie unter meinem Blick und rinnen in meine Socken.
Egal, die muss ich sowieso waschen, weil ich jetzt einen Schritt in den Teich hinein mache. Dass das Wasser in der Wunde nicht brennt, verunsichert mich. Ist das nicht normalerweise so bei Salzwasser? Meine Schuhe werden vom erdigen Boden verschluckt und ich sehe sie nicht mehr. Der zweite Schritt fällt mir schwer, weil sie im Morast eingesunken sind und mit dem anderen Fuß bleibe ich stecken, stolpere, würde auf allen Vieren landen, wenn ich nur 4 Beine hätte. Aber so klatsche ich mit meinem ganzen Körper in den Teich hinein.
Mein Gewand ist schwer an meiner Haut, bewegt sich träge vor Nässe, klebt an mir und gleichzeitig schwimmt es von selbst. Meine Schuhe sind aus blei und erschweren meine Brustschwimmbewegungen. Fast kann ich es nicht glauben, also ich schon nach kürzester Zeit am anderen Ende des Teichs angekommen bin. Ist das Meer nicht größer?
Die Sonne scheint an diesem Ufer. Der Sand ist ziemlich grobkörnig und manch einer würde behaupten, es wäre Kieselsteine, die ich letzten Sommer hier aufgeschüttet hätte, aber ich weiß, dass es Meeressand ist. Weil man am Strand nicht mit nassen Kleidern steht, ziehe ich das T-Shirt aus und werfe es ins Wasser. Dann die Schuhe, schließlich die Socken. Die Hose geht unter, als ich sie nachschmeiße, die Unterhose schwimmt. Die Brise, die in dieser Bucht weht, ist kühl, aber sie trocknet die Wassertropfen an meinem Körper. Nur die Haare bleiben länger nass und kleben als Coolpack an meinem Nacken.
Die Hecke zum Nachbarn ist hoch. Die Fenster vom anderen Nachbarn sind mit Rollläden verschlossen. Obwohl sie beide immer zu Hause sind, sehen sie mich nie, wenn ich hier nackt stehe. Kein Wunder, ich bin ja auch am Meer. FKK-Bereich, da schaut man nicht hin. Die Katze sitzt am anderen Ufer und beschnuppert meine Unterhose, die es dort drüben angeschwemmt hat. Bringt meine Unterhose jetzt Glück?
Bis meine Haare trocken sind, dauert es noch eine Weile. Ich setze mich in den Sand und beginne eine Burg zu bauen. Manch einer würde sagen, es sei eine Kieselpyramide, aber manch einer würde auch sagen, die Luft würde hier nicht nach Meer schmecken. Manch einer würde so einen blauen Himmel wegen der Rollläden gar nicht bemerken. Er würde nicht sehen, dass im Sonnenschein heute ein Meer in meinem Garten rauscht. Er würde seine Wäsche waschen und die dunklen Wolken am Nachmittag argwöhnisch beäugen, bevor er die Wäscheständer über Nacht doch lieber wieder ins Wohnzimmer stellt. Er würde im Regen von Morgen die Gartentür nur zum Stoßlüften öffnen und wenn er aus dem Fenster im ersten Stock schauen würde, würde er seufzen. Seufzen über den seltsamen Nachbar, der wieder und wieder einen Handstand vor dem Teich versucht und wieder und wieder scheitert und im Wasser landet.
Was der Nachbar nicht weiß, ist, dass ich Morgen eine Schnitzelgrube in meinem Garten finden werde. Dass es regnet, macht das Ganze ein wenig unangenehm, aber einen Handstand wollte ich immer schon lernen. Die Katze leistet mir an Regentagen selten Gesellschaft und so langsam frage ich mich, ob sie tatsächlich Glück bringt, oder ob sie mir das nur von ihrem Besitzer leiht. Weil dann müsste ich es ja irgendwann zurückgeben. Und darauf habe ich keine Lust.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at