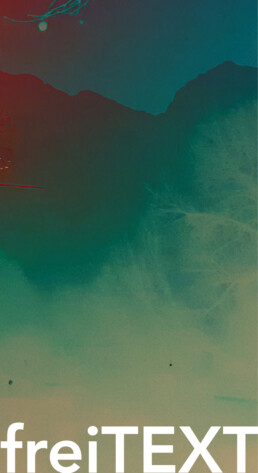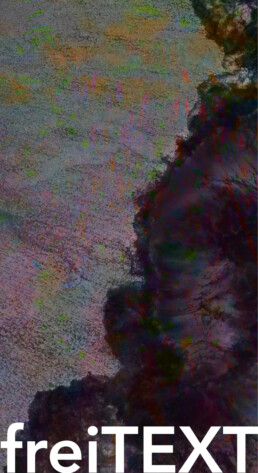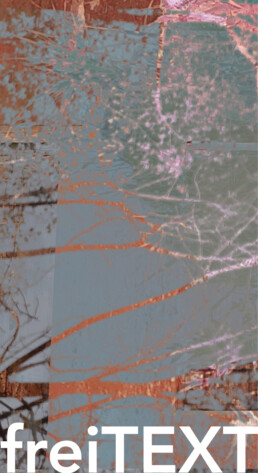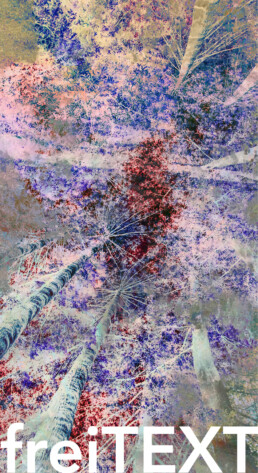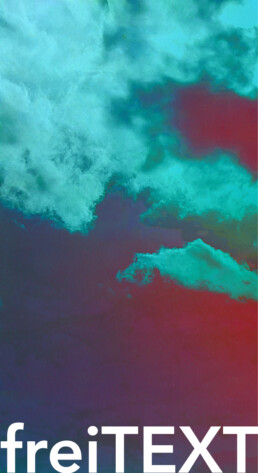freiTEXT | Lukas Leinweber
Kleine Vergehen
1.
Als unbescholtener Staatsbürger stehe ich viel zu selten in Kontakt mit der Polizei unseres Landes, wie mir an diesem Morgen an der Kreuzung in der Innenstadt auffällt. Die Ampel ist rot, aus der Seitenstraße biegen ein Haufen Autos, von der Autobahn kommend, in den Weg ein, der vor mir liegt. Ich sehe im Rückspiegel den herannahenden Transporter mit der unverkennbaren blau-silbernen Musterung. Langsam hält er auf die Kreuzung zu und lässt die letzten Meter ausrollen. Ich gucke weiter in den Rückspiegel, sehe, dass die Farbe Rot immer noch aus der Ampelanlage mahnt und fasse mir ein Herz. Wenn ich jetzt voll beschleunige und über die Kreuzung rase, dann sind sie alarmiert, das können sie nicht durchgehen lassen, sie werden, ja sie müssen mich dann verfolgen. Ich kenne mich in diesem Teil der Stadt nicht aus. Überall haben sie ein Dreißiger-Tempolimit festgelegt, wegen des Lärms, wie sie sagen. Wenn die Verkehrsbehörde der Stadt „Klimaschutz“ auf das Schild unterhalb des Dreißiger-Symbols geschrieben hätte, erschiene mir das einleuchtender. Im Augenblick pfeife ich auf Geschwindigkeitseinschränkungen. Es wird eine wilde Verfolgungsjagd werden, aber ich weiß nicht, ob ich in dieser Ausnahmesituation in der Lage sein werde, die Kontrolle über den Wagen zu behalten. Doch sind das Fragen, die ich auch während des Fahrens beantworten kann. Ich lege den Gang ein, die Start-Stopp-Funktion aktiviert den Motor, ich gebe mit durchgedrücktem Pedal kräftig Gas, denke an die beschleunigenden Spurts in den „Fast and the Furious“-Filmen, schalte schnell in den zweiten, dann in den dritten Gang, wo mein lachhaft PS-schwacher Skoda am besten anzieht und rase über die Kreuzung, direkt den anderen Autos hinterher. Das Lenkrad halte ich steif und fest umklammert, ich bohre, soweit das mit gestern schief geschnittenen Nägeln möglich ist, meine Finger regelrecht in das Leder und blicke dabei mit drastisch erhöhtem Adrenalinspiegel in den Rückspiegel, zur Vergewisserung auch noch in die beiden Seitenspiegel, die ungenügend auf meine Sitzposition eingestellt sind. Aber hinter mir tut sich nichts. Außer mir fährt keiner an. Die Autos stehen vorbildlich in Reih und Glied. Sie warten ordnungsgemäß auf das grüne Signal, selbst ohne Blitzer. Was folgt, ist kein Hupen, kein Blaulicht, erst recht keine Sirene. Der Transporter steht weiterhin hinter der Haltelinie und macht keine Anstalten, mir zu folgen. Betrübt schließe ich zu den vor mir fahrenden PKWs auf und bringe den Wagen auf dreißig Sachen.
2.
Ich laufe am Abend durch eine gering frequentierte Fußgängerpassage und wundere mich, dass mich ein weißer SUV, vermutlich ein G-Klasse-Mercedes, viel zu knapp mit überhöhter Geschwindigkeit überholen darf. Die Passage ist doch frei, ich laufe extra am Rand bei den Geschäften, damit die Radfahrer, die dem Namen nach hier ebenfalls nichts verloren haben, mit viel Platz durchfahren können. Wieso also fährt er so dicht an dem einzigen Fußgänger weit und breit vorbei? Will er der dunkelgrauen Drohung des Himmels davonfahren? Der einzige, der einen nachvollziehbaren Grund zur Beeilung hätte, weil er schnellstens nach Hause kommen will, um dem angekündigten Gewitter zu entgehen, bin ich. In diesem monströsen Gefährt sitzt man dank Herrn Faraday sicher vor Regen, Donner und Blitz. Der Wagen braust vorbei und hält ruckartig etwa sechzig Meter vor mir auf derselben Seite an. Zum Glück ist hier nichts feucht, sonst wäre ich garantiert vollgespritzt worden. Der Fahrer, ein übergewichtiger, glatzköpfiger Mann mit hellblauem Jackett, das durch seinen mediterranen Teint besonders gut zur Geltung kommt – es steht ihm ehrlich gesagt ausgezeichnet – steigt für seine Körpermasse flink aus dem Auto und hastet zu einem Eingang. Er schließt auf und verschwindet hinter den Wänden zu meiner Rechten. Die Fahrertür steht weit offen und ragt in die Mitte des gepflasterten Wegs hinein. Ich höre beim Näherkommen, dass der Motor noch läuft. Früher ein Anlass für mich, die Leute anzusprechen und sie zu fragen, warum sie den Motor laufen lassen. Ausreden, in denen sie bekräftigen, sie wollten nur eben schnell dieses oder jenes tun, ließ ich nie gelten. Man kann den Motor immer abschalten. Aber heute reagiere ich entspannter, ich bin es müde, die Menschen auf leicht zu umgehende Versäumnisse hinzuweisen. Da kommt mir ein vergnüglicher Gedanke: Ich könnte einfach in den Wagen steigen und losfahren, wenn der Mann den Zündschlüssel hat stecken lassen und davon gehe ich aus. Ich würde mit diesem benzinschluckenden Straßenpanzer losbrettern und ungehemmt durch die Stadt rasen. Muss ein geiles Gefühl sein, sich ohne schlechtes Gewissen rücksichtlos zu verhalten. Ich habe den schicken Wagen fast erreicht, bin voller Tatendrang und Entschlossenheit, wirklich einzusteigen und loszufahren, noch dazu wo ich sehe, dass es sich bei dem Laden, in dem der Mann verschwand, um ein Juweliergeschäft handelt. Meine rechte Hand hat bereits die schwarze B-Säule fest umgriffen, damit ich mich mit einem kurzen Schwung auf den Fahrersitz befördern kann. In letzter Sekunde, obwohl mein rechter Fuß bereits auf dem Einstieg steht, breche ich mein Vorhaben abrupt ab. Auf dem Beifahrersitz sitzt eine herrisch wirkende alte Dame in teuren Markenklamotten. Trotz Sonnenbrille blickt sie angewidert auf ihre Armbanduhr und direkt darauf in Richtung Ladentür. Sie hat mich bislang nicht bemerkt, obwohl ich sie anstarre und fast eingestiegen wäre. Mit dieser angsteinflößenden Vogelscheuche möchte ich meinen Lebensabend nicht verbringen – auch nicht in einer protzigen G-Klasse. Ich nehme meine Hand von der B-Säule, setze zügig den Fuß auf den Boden, drehe mich unauffällig um neunzig Grad nach links, weiche der hervorstehenden Autotür aus und laufe weiter. Im Weitergehen höre ich eine krächzende, diabolische Stimme zetern: „Was hat denn da so lange gedauert? Es könnte jemand einsteigen und losfahren, weil du immer den Schlüssel stecken lässt. Dabei bin ich völlig wehrlos und jeder sieht es.“ Ich laufe triumphierend weiter.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Wolfgang Fortmüller
Überleben
Ich führe eine Handvoll Überlebender durch den erbarmungslosen Winter. Der zähe Marsch nach Süden nimmt kein Ende, keine Besserung des Wetters ist in Sicht. Wir stoßen nahe eines Waldes auf eine große Senke, schlagen unser Lager auf und bleiben. Im Zentrum dieser Grube errichten wir den Kohlegenerator. Ein massiver zylindrischer Kessel aus Stahl, einer Lokomotive nicht unähnlich. Die Räder abmontiert, in die Senkrechte gebracht und verankert im harten Erdreich. Der Generator ist das Herzstück, die Lebensversicherung, der Gott unserer kleinen Ansiedlung. Die Stahlrohre auf seiner Außenhaut dampfen in der Kälte, Tag und Nacht, er hält uns warm. Arbeiter errichten ringsum Unterkünfte und Werkstätten, sammeln Ressourcen aus der Umgebung. Am Rand des Lagers Kohlegruben, in den Wäldern Holz und Wild. Die Siedlung wächst, wir bauen und beheizen ein Gewächshaus, das Feuer des Signalturms führt weitere Überlebende ins Lager. Doch das Wetter wird mit jeder Woche schlechter, die Temperaturen sinken immer tiefer, die Bewohner verlieren langsam Zuversicht. Die Gebäude weiter draußen sind schwer warm zu halten, es wird zu kalt in ihnen, um dort Arbeiten zu verrichten.
Der Kohlegenerator muss übersteuert werden, um dort Radiatoren und Feuerstellen installieren zu können. Die Schichten werden verdoppelt, damit es schnell geht, bevor der Heizkessel unter der dauerhaften Überlastung in Flammen aufgeht. In der dritten Nacht nach Verdoppelung der Schichten randaliert in der Nähe der Unterkünfte eine Handvoll übermüdeter Ingenieure und liefert sich eine Schlägerei mit der Ordnungswache. Ein großer Tumult bricht aus, die Wachen erhalten Schießbefehl, die Lage beruhigt sich wieder. Am Morgen wird ein Kind am Rand der Siedlung aufgefunden, tot im Schnee. Ich veranlasse gerade eine Ermittlung, da geht der in Vergessenheit geratene Generator in Flammen auf. Mit ihm brennt alles nieder, die ganze Siedlung, so ist das Spiel designt.
Das ist bitter, denn beinah sechs Stunden am Stück war ich nun an dieser Kampagne dran, jetzt ist das Spiel verloren. Der Schriftzug am grauen Himmel über den verkohlten Resten meines Werks erscheint. Nun einen vorherigen Zwischenstand zu laden, um den Fehler auszubügeln, den Heizkessel rechtzeitig wieder herunterzufahren, das kommt Cheaten gleich und reizt mich nicht. Was solls, ich strecke mich und gehe in die Küche. Der Himmel vor den Fenstern ist so düster wie im Spiel, die Wolken hängen tief über der Stadt, als wollten sie gleich Ballast abwerfen. Der Raum ist unheimlich kalt. Die Heizung ist seit Tagen defekt, die einzigen beiden Elektro-Radiatoren in der Wohnung stecken am Verteiler in meinem Zimmer. Sie laufen stundenlang, damit ich in der Nacht nicht frieren muss. Ich mache Instant-Kaffee und stelle den Wasserkocher an, die Wohnung ist verlassen. Die ganze WG gehört über die Weihnachtsferien mir. Die Uhr über dem Türstock zeigt jetzt neun Uhr. Das Kalenderblatt ist seit Tagen nicht mehr abgerissen worden, es hängt noch der 23. Dezember, aber ich weiß sehr wohl, welcher Tag ist. Morgen muss ich für den Heizungstypen aufmachen. Zurück am Schreibtisch melde ich mich im Onlineportal der Universität an, und von der Prüfung kommende Woche ab. Schon zu knapp, ich bin erleichtert, mit einem Klick entkommen zu sein. Es wäre nichts geworden, das nächste Mal muss ich mehr Zeit einplanen. Ich bekomme Lust auf das Spiel, in dem man durch dieses riesige Alien-Meer taucht, Robinson-Crusoe im Weltall. Ich doppelklicke, sehe den Titelbildschirm aufleuchten und höre das Ozean-Ambiente. Wellen, die zusammenschlagen, ferner Horizont vor dem zwei Sonnen untergehen und die mystischen Laute einer exotischen Fauna in der Dämmerung. Nach einigen Momenten in Starre schließe ich es in einem Anflug von Lustlosigkeit wieder, zu anstrengend und nervenaufreibend wäre das jetzt. Lieber einen neuen Run im Ice-Survival starten, ich habe jetzt dazugelernt. Zuerst lüfte ich und stelle die beiden Radiatoren noch etwas höher. Aus dem Hinterhof dringt ein Schaben und Kratzen, ich sehe hinunter, Schnee von gestern wird geschaufelt. Ich hoffe, dass es gleich wieder schneit, dass die Sonne sich den ganzen Tag nicht zeigt. Morgen der Heizungsmann also. Die Gastherme reparieren. Das kommt davon, wenn man allein ist, man muss sich selbst um alles kümmern. Wäre es vertretbar, im Zimmer vor dem Computer hocken zu bleiben, während er hier ist? Was soll ich sonst tun. Danebenstehen und dem Typ auf die Finger schauen, wie er werkelt, das kommt nicht in Frage. Im Wohnzimmer ausharren und auf dem Küchentisch mit geöffnetem Laptop so tun, als würde ich etwas Wichtiges erledigen, auch lächerlich. Ich könnte ihm sagen, ich gehe gegenüber einkaufen. Falls er fertig ist, bevor ich zurück bin, soll er anrufen, oder einfach die Rechnung am Tisch liegen lassen. Die Tür fällt eh ins Schloss. Ich könnte einen kleinen Winterspaziergang im verschneiten Park die Straße runter machen. Zurück an den Bildschirm. Im nächsten Durchlauf die Gebäude näher aneinander setzen, dann ist das Überleben garantiert.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Olav Amende
Spiegel
Stimme 1, Stimme 2, STIMME 1 & 2
I
Man sagt, es gibt im Leben eines Menschen immer wieder Momente, in denen ist der Mensch mit sich allein. / Und gleich, wie vielen anderen Menschen man nahe steht, / von wie vielen anderen Menschen man geliebt wird, / und wie viele andere Menschen man selbst zu lieben imstande ist, man ist, / so heißt es, / in diesen Momenten / ganz allein. //
Wir kennen diese Momente nicht. / Wir sind nie allein. / Wir haben uns. / Wir kennen uns / und spüren uns / so gut, wie keine zwei anderen Menschen / sich kennen / und spüren. / Mehr noch: / Wir kennen und spüren uns so gut / und intensiv, / wie kein einzelner Mensch / sich selbst spüren und kennen könnte. / Wir sind äußerlich und innerlich einander identisch! / Eins! / Wir benötigen keinen Spiegel. / WIR SIND DER SPIEGEL DES ANDEREN. //
Man nennt Zwillinge zwei Geschwister, / auf die Sekunde zur selben Zeit geboren, / die sich ähnlich oder aber, / – man nennt sie dann eineiig – / auf das Haar gleich sehen. / Wir sehen uns auf das Haar gleich. / Mehr noch: / Im Schnee hinterlassen wir dieselben Spuren. / Unsere Fingerabdrücke sind dieselben. / Unsere Iris ist dieselbe. / Und nähme man von uns DNA-Proben, / so geriete man in Bedrängnis: / WER IST WER? //
Betrachten wir uns das Wesen eines Menschen: / Wie tickt er? / Wie blickt er auf die Welt? / Was ist es, das ihm an ihr gefällt? / Und was nicht? / Was spricht aus seinem Gesicht, wenn er spricht? / Worin übt er sich in Verzicht, indem er spricht? / Und worin nicht? / Wie verhält sich sein Körper beim Laufen? / Wie beim Einkaufen? / Wie beim Erklettern / einer Eibe? / Wie beim Zerschmettern / einer Scheibe? / Wir dürfen sagen, in all diesen Momenten verhalten wir uns gleich, / spiegelbildlich, / identisch! / Ich weiß / und spüre, / wann sie den kleinen Finger ihrer / linken Hand / hebt. / Dann hebe ich ihn / und dann senke ich ihn. / Ich weiß / und spüre, / wann sie die Gabel / mit roten Linsen / zu ihrem Mund führt. / Dann führe ich die Gabel zum Mund. / Die Anzahl der roten Linsen, die sie auf ihrer Gabel transportiert, / entspricht / EXAKT / der Anzahl roter Linsen, die ich auf meiner Gabel / – unserer Gabel! – / transportiere. / Und wenn sie dann zur Toilette eilt, / eile auch ich zur Toilette. //
Es gibt Vieles, das darf die Außenwelt nicht wissen. / Nicht einmal unsere Eltern, / die wir sehr lieben, / dürfen das wissen. / Für diese vielen Momente haben wir uns eine Sprache ausgedacht, / die außer uns kein dritter / – kein zweiter! – / versteht. Das Prinzip ist simpel: / Wir nehmen uns einen Satz zur Hand, / picken uns dessen Vokale heraus / und sprechen allein mit diesen. / „e i e e i e o“ heißt: / „Dem Himmel erfriert der Mond.“ / Und „e i e e i e o“ heißt: / „Der Giebel brennt lichterloh.“ / Manches Mal / – in gewissen Situationen, in denen es gilt, nicht aufzufallen – / ist uns nach einer anderen Sprache zumute. / Auch ihr Prinzip ist simpel. / Wir nehmen uns einen Satz zur Hand, / picken uns dessen Vokale heraus und / formen mit diesen einen neuen Satz; / einen Satz jedoch, den wir nicht meinen. Wir sagen: / „Auf der Spitze des Berges ist’s nie still“, doch wir meinen: / „Trau‘ den finsteren Wegen in dir nicht!“ / Und wir sagen: „Fehlgeburt“, / doch wir meinen: „Engelsturz“, / doch wir meinen: „Erwähl‘ uns!“ / doch wir meinen: „Herr, trenn‘ uns!“!
II
Keiner versteht diese beiden Sprachen außer uns. / Das führt uns näher zusammen. / Und es schließt uns nach außen ab. / Uns erreicht keiner. / Und wir erreichen keinen. / „Ihr seid zu langsam“, / sagen sie. / „Gehen wir mit euch aus, so schafft ihr in derselben Zeit gerade einmal die Hälfte unserer Strecke“, / sagen sie. Und es ist exakt die Hälfte ihrer Strecke, die wir zurücklegen, nachdem wir gemeinsam starteten. / „Wenn wir mit euch gemeinsam am Tisch sitzen / und essen, / so habt ihr nur die Hälfte gegessen, / während wir schon fertig sind“, / sagen sie und meinen exakt die Hälfte. / „Und wenn wir mit euch Volleyball spielen, / so heben und senken sich eure Arme mit der Hälfte der Geschwindigkeit, mit der unsere Arme sich heben und senken.“ / „Ihr verfehlt alle Bälle!“, sagen sie. / „Und wer will da noch mit euch spielen?“, fragen sie. / Was sie nicht sehen: Unsere Arme heben und senken sich auf exakt dieselbe Weise! / Und wenn man unsere Geschwindigkeiten miteinander addiert, / so ergibt dies doch ihre Geschwindigkeit! / Seht ihr nicht: Wir zu zweit bilden eine Person! / Ich bin ihre Hälfte. / Und ich bin ihre Hälfte. //
WIR SIND DER KERKER DES ANDEREN … / Sie kann von mir gehen. / Und doch bekommt sie zu spüren, / was ich tue. Sie ist mir dann / ein amputiertes Bein, / das man spürt, / obwohl es einem abgenommen ist. / Gleich auch, was ich tue, / es berührt immer mich, / immer mich … / uns! / Wenn ich dich sehe, / sehe ich mich. Und wenn ich mich sehe, / sehe ich dich. / Immer nur dich! / Immer nur dich! / Ich sehe mich, / doch ich sehe mich. //
Wir wollten keinen Spiegel mehr. / Wir stellten ihn in die Ecke und schlossen den Raum ab. / Ich sperrte sie ein. / Und ich sperrte sie ein. / Doch es nützte nichts. / Wir bewaffneten uns mit Nägeln / und mit Steinen, / den Spiegel des anderen / einzuschmeißen. / Es schmerzte sehr. / Doch es brachte uns nichts. Was mich schmerzte, / schmerzte mich. / Verwundete ich mein Gesicht, / so verwundete ich mein Gesicht. / Ich schrie sie an! Ich schrie: / „Es gibt kein du!“ / „Es gibt nur mich!“ / „ES GIBT NUR ICH!“ //
Wir wollten uns einander behaupten: / Wer gibt zuerst nach, wer / ist die erste, die die Gabel / zum Mund führt, wer / ist die zweite, die / beim großen Volleyballturnier / die Arme hebt und senkt und wer / ist die erste, die / sich verlieben würde / IN EINEN ANDEREN MENSCHEN!
III
Wir mussten uns voneinander unterscheiden. / Wir mussten es versuchen. / Mit aller Kraft und Gewalt! / Mit der Liebe für dich! / Mit der Liebe für dich! / FÜR UNS! / FÜR MICH! / Wir begannen so: / Wie gewöhnlich gingen wir miteinander aus. / Wir trugen malvenfarbig / geblümte weiße Kleider und silbrige / Neun-Loch-Chucks. / Und nun gingen wir die Straße entlang und eine von uns beiden / blieb plötzlich stehen! / Und sie bückte sich! / Sie bückte sich, um etwas aufzuheben. / Einen Mantelknopf / oder ein dreibeiniges Plastiknashorn. / Während die andere nicht stehen blieb / und sich nicht bückte, / sondern weiterging, / einfach weiterging, bis auch sie dann, / einen Meter / oder zwei von ihrem Zwilling, / MEINEM ZWILLING!, / entfernt ebenfalls stehen blieb / und zu ihrem gebückten Zwilling blickte. //
Anderentags / unterhielten wir uns miteinander in der Öffentlichkeit / in eurer Sprache und widersprachen dabei einander. / Wir sagten immer exakt das Gegenteil des anderen. Wenn sie „Ja!“ sagte, / sagte ich „Nein!“. Sagte ich / „Schwarz!“, / sagte ich „Weiß!“ und so fort. / Wir sahen ein: / Mit dem Gegenteil auf den Satz des Gegenübers zu reagieren, / führt zu keiner Trennung. / Im Gegenteil: / Es bindet uns nur noch fester / aneinander. //
WIR MUSSTEN GETRENNTE WEGE GEHEN. / Also vertratest du dir die Beine im Garten / und du wandeltest mit einem Eis in der Hand in den Passagen. / Wir trugen schwarze Kurzblazer / und bronzefarbene Hosen. / Beide gingen wir barfuß. / Doch sie war / hier und ich / war hier. / Das erste Mal in unser beider Leben / konnten wir uns nicht sehen. / Doch auch ihr konntet uns nicht sehen, / DAS HEISST, / ihr habt uns gesehen – / mich und / mich – aber ihr saht in uns keine Zwillinge mehr! //
„Hat sie nicht auch eine Schwester?“, / fragten sie sich, als sie / dich in der Passage trafen. / Und als sie dich dann im Garten erblickten, / fragten sie sich: / „Wie mag es ihr wohl gehen, sie, / die ganz ohne einen Bruder / und ohne eine Schwester / auszukommen hat?“
IV
Ist dieser Stich zu verwinden? / Zerreißt allein der Gedanke daran dir nicht, / mir nicht, / die Stirn? / Die Brust? / Das Herz? / Das Herz? / Der Schmerz, der dich sticht, sticht mich doppelt. / Er sticht dich und damit sticht er mich. / Und damit sticht er mich. / Er sticht mich vierfach, / achtfach, / unendliche Male. / Denn voneinander getrennt sind wir Hälften einer Kugel, / die sich vierteln, / achteln, / zu nichts auflösen. //
Ihr lebt euer Leben auf der Suche nach eurer Hälfte. / Ihr findet sie oder ihr findet sie nicht. / Wir aber wurden im Angesicht unserer Hälfte geboren. / Und noch bevor wir auf die Welt kamen, blickten wir in unseren Spiegel. / Wir wussten / und wir spürten / unseren Puls in unserem Gegenüber schlagen. / Und wir wussten / und wir spürten: / Wir werden in zwei Körpern leben / als ein Mensch. / Wer könnte uns da noch trennen! / Zwischen diese beiden Körper passt kein Lufthauch. / Und zögen auch zwei Reiterarmeen an unser beider Enden, / sie müssten sich an uns verschwenden. //
i au o, ee! / e iu, aiu u! / i au! / aiu, iu! / E E U. / E E U.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Xaver Rohracher
Sauerstoffzufuhr
Atme, Monika, atme.
Atme ein.
Inhaliere den Tabakrauch, inhaliere Feinstaub, Nikotin. Die Röstaromen des Sommers: Tannennadel, Fichtenkonus, Buchenblatt, Rasenhalm, Kastanienschale. Mondhölzer. Inhaliere Personen, Verkehr unten auf der Straße. Die Eile der Passanten, die Hitze des Asphalts, Abrieb, hartgummischwarze Nachricht auf der Fahrbahn. Das Geschwätz des Verkehrs: Hupen, Bremsen, Drohen, Dröhnen. Dräuen dunkler Wolken über dir am Himmel. Vor der Ruhe kommt der Sturm, Winde ziehen fliehende Gardinen aus dem Fenster.
Atme, atme ein, Monika.
Inhaliere Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendiox-, -monoxid, Kohlenwasserstoffe, N-H, C-H, C-O, zwei Kinder im Zimmer, eine Mutter im Nacken, ziehen ihre Kreise.
Ohne Mond gäbe es kein höherentwickeltes Leben auf der Erde. Erst die Entstehung ihres natürlichen Satelliten verlieh der Erde ausreichend Masse, um eine Atmosphäre an sich zu halten. Ohne Atmosphäre kein Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein Energiestoffwechsel, ohne Energiestoffwechsel kein Leben.
Monika weiß nichts davon.
Aber sie hat gesehen, wie der Mond in diesem Weltraumfilm alle Luft abgesaugt hat, als er der Erde zu nahe kam.
Die Mutter kreist in ständiger Begleitung. Die Mutter ist natürlicher Satellit. Zetert, kreißt, liefert zündelnd Ideen. Sei eine gute Gattin, sagt sie. Sei eine gute Mutter, sagt sie. Sei eine gute Hausfrau, sagt sie. Sei eine gute Schwester, sagt sie. Sei eine gute Tochter, sagt sie. Lieb, verwöhn ihn, hilf, besorg’s ihm – lehr, versorg, erzieh sie, prügle – koche, putze, wasche, bügle – bück, verzichte, erb, ein bisschen – hege, pflege, hör auf mich!
Hör auf –
Klaus. Das ist ein Kerl, der raubt dir den Atem. In der Bank hochangesehen. Der wird’s noch zu was bringen. Brauchst du einen Kredit? Er besorgt ihn dir. Günstige Konditionen, keine Frage, mein Freund. Wieso nicht gleich noch leasen, er hat das beste Angebot. Und vergiss nicht, vorzusorgen! Unfall, Pension, Leben – es gibt nichts, was er dir nicht versichert.
Ja-ja, versichert er Monika, heut’ ist er nicht so spät daheim.
Nein-nein, versichert er Monika, ein Bier, höchstens zwei, mehr trinkt er heute nicht.
Doch-doch, versichert ihm Monika, sie kommt derweil schon ohne ihn zurecht.
Nina, die Jüngere, ist ein unkompliziertes Kind. Nur die Ältere, Leonie, braucht ständig Hilfe. Das kleine p kann sie immer noch nicht gleichmäßig schreiben, ständig rutscht sie unter die Zeile, und wenn man sie darauf hinweist, schweben die nächsten drei Buchstaben wie kleine Heißluftballons darüber. Nicht einmal Monikas Schläge auf die Finger wollen helfen.
Mütterliche Tadel hängen in töchterlichen Ohren, während Monika das Abendessen macht. Für Klaus, wenn er heimkommt.
Er kommt, polternd und stinkend in die dunkle Wohnung. Dreiviertel eins. An Essen kein Gedanke. Die Mädchen schlafen, die Schwiegermama schläft, die Gattin wird notgedrungen geweckt, wohin sonst mit seiner angetrunkenen Geilheit. Ihr wird wohl nicht lieber sein, wenn er den Schlaffen in der Not einer anderen zwischen die Beine drängt. Es röchelt an ihrem Ohr, irgendwann Schnarchen. Seine Ausdünstungen hängen im Raum. Ein atemberaubender Kerl, der Klaus.
Atme, Monika.
Atme am Fenster die Nacht ein, die Stille der Töchter, die Milde der Mutter, die Ohnmacht des Gatten. Die Glut der Zigaretten glüht. Glüht und frisst. Es frisst den Sauerstoff, es frisst ihn dir weg, Monika, zerfrisst dir die Lunge, zerfrisst dir das Herz.
Monika atmet. Flach.
Jeder Atemzug begleitet von einem pfeifenden Keuchen in der Kehle. Kürzeste Züge ziehen den Rauch ein, kühl auf ihrem Rachen. Luft kitzelt im Hals, sie hüstelt, sie versucht, tief durch die Nase Luft zu holen, ihre Kehle schnürt sich zu. Sie will atmen. Atme! Aber wie? Weiß nicht wie. Wie steuern, was immer von selbst funktionierte. Öffnen und Schließen der schlaffen Lippen. Nutzlos. Japsend vornübergebeugt, lehnt sich aus dem Fenster, nach draußen, wo die Luft sein muss, wo ist die Luft?
Sie hat noch immer die Zigarette in der Hand. Und eine chronische Obstruktion in der Lunge.
Das Klimpern der Flaschen echot durchs Stiegenhaus. Klaus der Vorsorgeberater hat vorgesorgt: ein Tragerl Bockbier, zwei Flaschen Roten, ein Flascherl Wodka und Jägermeister im 9er-Pack. Zigaretten sind auf Lager. Auf ins Kellerabteil.
Das Klimpern der Flasche echot durchs Stiegenhaus. Sauerstofflieferung für Monika. Ein neuer Satellit, Luft spendend statt Luft raubend.
Atme, Monika, atme.
Die Tage verbringt Monika am Fenster, wie früher. Nimmt einen Zug aus dem Sauerstoffbehälter, einen Zug von der Zigarette. Die Nächte verbringt Monika unter einer Maske. Überdruck hält Atemwege offen, die sich im Schlaf ohne Unterstützung verschließen.
Im Schlaf, unter der Maske, kann Monika frei atmen.
Klaus, wenn er aus dem Keller kommt, Rauch in den Kleidern, Rausch im Blut, schnüffelt sich indes an Monikas Sauerstofftank ins Delirium.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Carlotta Voß
Kerstin‘s.
Die Eier kommen um sechs, die Brötchen eine halbe Stunde später.
Eier: Sechs mal sechs, Bodenhaltung, direkt vom Hühnerbaron, der eigentlich ein Graf ist und ein Vermögen gemacht haben soll mit seinen Hochleistungshennen. Brötchen: In fünf großen Tüten vier Sorten, dazu Laugenstangen; oft sind sie noch warm: die Backstube ist gleich am Ortseingang.
Die Eier werden von Männern gebracht, die ständig wechseln, aber immer aus Osteuropa sind. Sie springen schnell aus dem Lieferwagen, die Fahrertür lassen sie offen, Kerstin hat das Geld schon bereitgelegt. Die Brötchen bringt Heiner, der seit zwanzig Jahren für Bäckerei Soltau ausfährt; er kauft immer auch den Tagesanzeiger und die BILD und dann stützt er sich auf ihrem Tresen auf und sie reden eine Weile, bevor er sich erst an den Kopf tippt, dann an die Tür klopft und seine Fahrt fortsetzt.
Kerstin schaltet dann das Radio ein und wischt die Krümel von gestern aus der kleinen Brötchenauslage. Sie prüft, ob alle Eierpackungen sechs weiße Eier enthalten, und fährt mit dem Staubwedel über die Ware in den Ladenregalen. In der Morgensendung reden sie über das Wetter und man kann Tickets zu einem Konzert gewinnen, wenn man anruft. Kerstin füllt das Bier im Kühlschrank auf. Er brummt an diesem Morgen besonders laut; sie rammt ihn kräftig mit ihrer Schulter. Manchmal verstummt er dann, heute nicht. Sie kann ihn nicht leiden; er verstopft ihr den Laden und blockiert die schmalen Wege, auf denen sie sich früher durch den Raum bewegt hat. Günstig aber war es, dieses eckige Monster; sie hat es von der Tankstelle Reimers übernommen. Die Leute tanken heute alle an der Autobahn.
Um sieben Uhr dreißig kommen die Grundschulkinder, denen kein Pausenbrot geschmiert worden ist. Sie sind noch still und verschlafen zu dieser Uhrzeit. Die Riesenrucksäcke auf den Rücken geschnallt, taumeln sie durch die Morgenluft wie ausgesetzte Astronauten. Sie kaufen hoffentlich die Mohnbrötchen und die Laugenstangen auf.
Wenn der letzte Nachzügler davongetrottet ist, raucht Kerstin die erste Zigarette. Sie steht dabei in der Ladentür und bläst den Rauch in die Morgenluft, die heute mildsommerlich ist, aber so frisch, wie sie es nur in Meeresnähe sein kann. Der weiß-schwarze Kater, der niemandem gehört, läuft über die Straße, auf der nur manchmal ein Auto fährt.
Kerstin holt sich einen Kaffee von oben und setzt sich auf ihren Stuhl; er hat über die Jahre die Form ihrer Schenkel angenommen. Sie hört noch einmal die Nachrichten, sieht im Laden umher, macht Rechnungen, geht auf Facebook. Sie hat sechs Benachrichtigungen seit gestern; sechsmal ein Like für ihr neues Foto, dreißig Likes sind es jetzt insgesamt für ihre neue Frisur, und außerdem ein Emoji mit Herzchen-Augen.
Kerstin hat kurze, graue Haare. Vor sieben Jahren, da schloss Bei Ute, der Friseur im Dorf, hat sie mit dem Färben aufgehört; davor war burgunderrot. Alle zwei Wochen musste nachgefärbt werden, sonst sah es unordentlich aus, nein, als habe sie lichtes Haar, denn aus der Entfernung scheint der weiß-graue Ansatz weiche Kopfhaut zu sein, die unter dem falschen Burgund hervorschimmert. Das verletzt Kerstins Stolz. Sie hat kräftiges Haar. Es war ihr bestes Pfund. Das ist dein bestes Pfund, hatte ihre Mutter immer gesagt, wenn sie ihr mit festem Strich die Haare bürstete und zu Zöpfen flocht.
Manchmal packt Kerstin die Lust auf Farbe, oft im tiefsten Winter oder im späten Sommer, dann lässt sie sich eine bunte Strähne färben, ein Farbtupfer im Grau. Er macht ihr gute Laune, wenn sie sich morgens im Spiegel ansieht. Seit drei Tagen hat sie eine neue Strähne und die Frisier-Azubine hat ein Foto von ihr gemacht, das Foto, das jetzt auf Facebook Likes sammelt.
Die Schwiegertochter von Frahms, die im letzten Jahr plötzlich sehr dick geworden ist, kommt herein und kauft Eier. Auf Facebook postet der Bestatter ein neues Gedicht. Es steht in weißer Schrift auf einem roten Sonnenuntergang über schwarzen Bergen. Der Bestatter dichtet viel und immer Trauriges, heute geht es um den Spätsommer und den Herbst, der kommen wird.
Die alte Maria von gegenüber holt drei Brötchen und eine Dose Sauerkraut mit Speck. Sie muss kurz verschnaufen und erzählt, dass ihre Tochter am Wochenende zu Besuch kommt. Als Maria weg ist, raucht Kerstin noch eine Zigarette; vom Schulhof her kommt Geschrei, es ist große Pause.
Kerstin spielt ein bisschen Karten am Computer. Dann fährt der Pastor in seinem kleinen roten Dienstwagen vor; er bringt, zusammengerollt, das Plakat für das Sommerfest der Kirche. Sie kleben es zusammen an die gläserne Ladentür, zwischen Tesa-Reste, die bunten Ecken längst abgerissener Aushänge und die Suchanzeige für den Kater von Familie Wolters, für den es wahrscheinlich zu spät ist. Der Pastor hat es eilig, weil er zu einem achtzigsten Geburtstag muss.
Um halb eins ist die Schule aus und der Ansturm kommt. Schnaufend stolpern die Kinderkörper in den Ladenraum; die Riesenrucksäcke stoßen an Türrahmen, Regale, gegeneinander, und branden schließlich gegen ihren Tresen. Dahinter, an der Wand, gestapelt auf drei langen Brettern, da ist das süße Gummizeug in milchigen, runden Plastikdosen.
Kupfermünzen verlassen mühsam Kinderhände; Kerstin pult Deckel ab, greift mit der linken Hand nach den weißen Papiertüten, mit der rechten nach ihrer kleinen silbernen Zange und los geht es: Drei Cola-Kracher, zwei Schlümpfe, eine weiße Maus, eine Schaumerdbeere, nein, doch nicht, kann ich doch lieber die Lakritzschnecke haben?
Manchmal beschweren sich Mütter, die Süßigkeiten würden nach Zigarettenrauch schmecken. Die Kinder beschweren sich nie. Sie verschwinden mit den weißen Tüten in der Hand in Paaren und Horden in den Sommernachmittag. Kerstin fegt den feinen Zucker zusammen, der auf den Tresen gerieselt ist, dann dreht sie das Schild an der Tür von Offen auf Geschlossen, zieht ihren Kittel aus und geht durch den Lagerraum nach oben. Manchmal nimmt sie sich eine der Dosensuppen aus dem Laden mit. Früher ist sie in der Mittagspause oft zum Friedhof gegangen. Jetzt zupft sie ein bisschen Unkraut im Garten. Vielleicht liest sie den Stadtanzeiger.
Vor zwei Jahren wurde der Laden dreißig Jahre alt, da gab es im Anzeiger einen großen Artikel. Der Journalist kam vorbei und stellte ein paar Fragen und machte ein paar Fotos. Zwei Wochen später sah sie sich selbst in schwarz-weiß entgegen: die Fäuste auf dem Tresen aufgestützt lehnt sie den Körper der Kamera entgegen; sie lächelt wohl ein wenig, kampfeslustig mehr als freundlich. Je länger sie das Bild ansah, desto mehr gefiel es ihr. Im Text drumherum ist von ihr als Manemann die Rede; der Nachname wurde ihr im Lesen sehr fremd, sehr gewichtig. Manemann eröffnete den Laden im Frühjahr 1989 nach dem Tod ihres Ehemannes. Er hatte vorher in den Räumlichkeiten Artikel für den Heimwerkerbedarf verkauft. Und: Bei Manemanns „Kerstin’s“ findet jeder, was er braucht: Batterien für die Taschenlampe, ein frisches Brötchen zum Frühstück, Zucker für den Kuchen, Zahnbürsten und Putzmittel. Auch der neue Bürgermeister kommt zu Wort: Er sagt, dass ,Kerstin’s‘ eine Institution ist, dass ihr Laden zur DNA unseres schönen Dorfes gehört und das ist, was Dorf ausmacht: Ein Raum der Begegnung. Kerstin hat den Artikel ausgeschnitten und gerahmt und im Laden aufgehängt.
Um halb vier kommen die Bauarbeiter von der Neubausiedlung, wo Häuser mit glänzenden blauen Dächern und weißem Putz entstehen. Die Bauarbeiter zahlen immer in bar, mit gefalteten Scheinen aus der Hosentasche, genau wie die Freiwillige Feuerwehr. Mit Karte zahlen die Mütter, die eine Stunde später Zucker oder Eier brauchen, weil das Kind gestern vergessen hat zu sagen, dass es morgen einen Kuchen in die Schule mitbringen soll, Jetzt wird es eben nur ein schneller Rührkuchen. Haben Sie Vanillin?
Kerstin hat Vanillin und Backpulver und Tütenhefe und Schokodrops und diese kleinen gläsernen Aromakapseln in der Sorte Bittermandel von Dr. Oetker, und auch geringelte Aufsteckkerzchen und ein paar Röllchen Zuckerperlen, rosa und gold. Backsachen verderben nur langsam und es macht großen Spaß, sie einzukaufen und sie im Laden anzusehen; Kerstin hat sie gegenüber von ihrem Platz aufgestellt, sodass ihr Blick darauf fällt, wenn sie aufschaut.
Manchmal nehmen die Mütter noch passierte Tomaten mit oder eine Buchstabensuppe aus der Tüte. Vor einiger Zeit fragte eine von ihnen: Haben Sie Kuskus?
Beim Frauenfrühstück in der nächsten Woche – einmal im Monat ist Frauenfrühstück im Gemeindehaus –, sagte Kerstin zu Christa, jemand habe bei ihr Kuskus gewollt. Sie erzählte eigentlich nur davon, um die Stille zu füllen, die immer eintritt, wenn man neben Christa sitzt; Christa sagt zu allem Ach, das ist ja interessant mit ihrer weichen Stimme, aber eigentlich scheint sie sich für nichts zu interessieren, nicht für Klatsch, nicht für die Nachrichten, nicht für Urlaub oder Gartenarbeit, nur für Fußball ein bisschen; sie geht mit ihrem Mann ins Stadion. Auch der Kuskus war für sie interessant, aber interessierte sie nicht weiter, doch zu Kerstins Glück hatte Helga alles mitangehört, und sie beugte sich weit über ihren Kaffee und sagte, Kuskus, das esse ihre Tochter manchmal, so als Salat, mit Gurke und Tomaten. Und Pfefferminze ist auch drin. Das soll ganz gesund sein.
Am nächsten Morgen googelt Kerstin Kuskus. Couscous oder Cous Cous, steht da, ist ein Grundnahrungsmittel der nordafrikanischen Küche. Die Grundlage besteht aus befeuchtetem und zu Kügelchen zerriebenem Grieß aus Hartweizen, Gerste oder Hirse.
Grieß also, sagt Kerstin laut in den Laden hinein, zu den rosa Zuckerperlen. Das ist ja bloß Grieß. Grieß sollte sie noch dahaben. Sie kramt im Nudelregal, und wirklich, ganz hinten findet sich eine Packung Grieß, der Karton ist ein wenig verblichen, die darauf abgebildeten Nockerl in klarer Brühe sehen gräulich aus. Kerstin blickt auf das Ablaufdatum; der Grieß läuft im nächsten Monat ab. Sie nimmt ihn mit zu ihrem Tisch und verpasst ihm ein rotes Etikett und stellt ihn in die große Kiste mit der reduzierten Ware. Da liegt er bis zu seinem Ablauftag und Kerstin wirft ihn weg. Am selben Tag fährt sie auf Einkaufstour in den großen Supermarkt in der Stadt. Er ist gerade neu gemacht und vergrößert worden; alles glänzt und die gläsernen Türen der Kühlschränke öffnen sich automatisch, wenn man sie antippt, und schließen sich wieder von selbst. Kerstin denkt, dass die alten Leute sich hier doch kaum noch zurechtfinden können; dasselbe hat sie dem Journalisten gesagt.
Der Kuskus steht in der Ecke für ausländische Lebensmittel. Auf den Verpackungen mancher Marken reiten Männer auf Kamelen unter Palmen in eine Wüstenlandschaft hinein. Kerstin studiert die Zutatenliste, auf der nur Hartweizengrieß steht, und geht weiter. Der richtige Grieß ist wie immer beim Mehl; die fotografierten Nockerl sehen gelb und appetitlich aus und sind mit gehackter Petersilie garniert. Kerstin nimmt zweimal Grieß und schiebt den Wagen an die Kasse. Die Schlange ist sehr lang, an allen Schaltern stehen die Leute weit in den Gang hinein und lange geht es nicht vorwärts. Kerstin sieht auf ihre Grießpackungen und denkt an den Kuskus. An Kasse eins hat die junge Frau hinter der Kasse ein technisches Problem und die Kollegen von Kasse zwei und drei unterbrechen ihre Arbeit, um ihr bei der Lösung zu helfen. In den Schlangen seufzt man. Kerstin seufzt und kaut an ihrem Daumennagel. Verstehen Sie sich als Unternehmerin?, hat der Journalist gefragt. Da hat sie gezögert und dann Ja gesagt. Im Artikel ist davon nicht mehr die Rede gewesen. Unternehmerin-Sein heißt natürlich: mit der Zeit zu gehen. Aber es heißt doch auch: auf Bewährtes setzen.
Grießnockerlsuppe, das gab es zu ihrer Konfirmation, vor dem Braten. Manfred, glaubt sie, hat gerne Grießnockerlsuppe gegessen, aber vielleicht irrt sie sich. Ihr fällt ein, dass sie niemanden fragen kann, ob sie sich richtig oder falsch erinnert, weil da niemand ist, der sich besser daran erinnern könnte als sie oder sich überhaupt noch an Manfred erinnert.
Es ist zu warm in dem Supermarkt und aus den Lautsprechern kommt zum sechsten Mal dieselbe Werbesingle, und weil sie alles in diesem Moment lieber täte, als auf ihren schweren Beinen zu stehen und auf diese Petersiliensprenkel auf den Grießpackungen zu blicken, lässt Kersten ihren Wagen in der Schlange stehen, die sich ja ohnehin nicht vorwärtsbewegt, und geht zum Regal für ausländische Lebensmittel. Wir öffnen Kasse fünf für Sie, heißt es da plötzlich aus den Lautsprechern und also wird nun Bewegung in die Schlangen kommen; Kerstin greift dreimal Kuskus und dann ist sie zurück bei ihrem Wagen, der natürlich schon beiseite geschoben worden ist; sie schwitzt und stößt ihn mit ihrem Körper nach vorne, in das kakophone Kassen-Piepen.
In ihrem Laden ist es still und kühl. Sie räumt ein, den Kuskus als letztes; sie stellt ihn neben die Nudeln. Drei Packungen, sonnengelb, mit buntbemaltem Tontopf darauf. Sehr ordentlich, sehr leuchtend stehen sie da und werden für viele Wochen von niemandem bemerkt.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leon Zechmann
Mach's gut (Das Ende der Welt)
Am letzten Tag der Erde wache ich auf und schneide mir die Nägel. Ich habe dutzende Nachrichten bekommen, von allen Menschen, die ich je gekannt habe. Es hat sich angefühlt, wie alle Feiertage zusammen. Und zusätzlich vermissen dich, plötzlich, all deine Ex-Partner gleichzeitig. Entfernte Familie will Geld von dir und deine spielsüchtigen Freunde wollen in ihrem Kinderzimmer auf dem alten, brüchigen Nintendo DS mit dir spielen. Nur schreiben sie alle nicht das, was sie dann eigentlich schreiben würden. Sie schreiben alle dasselbe: „Mach's gut“. Jeder schreibt das, überall. Irgendjemand hat sich das als Motto des Weltendes ausgedacht.
Nachdem ich mir die Nägel geschnitten habe, laufe ich barfuß durch die Wohnung. Das ist mein Mindestanzeichen von Weltuntergangsstimmung. Ich hatte mir eimerweise Wasser aus dem um die Stadt fließenden Fluss geholt. Mitten in einem umliegenden Dorf war, weiß Gott wieso, noch ein Café geöffnet, die Dame dort wollte Wucherpreise für Gebäck. Also habe ich mir eine Kugel Eis geben lassen, und im Eis waren Marshmallow-Stücke. Es war relativ grässlich. Aber es hat den Trip über die Bahnschienen verfeinert, später mit den Eimern unterm Arm.
Ich wasche mir den Becher von gestern nicht mehr ab. Das passt doch auch in die Weltuntergangsstimmung, oder? Und den letzten Rest Wasser kippe ich in die Badewanne. Es ergibt sich kaum mehr als eine Pfütze. Es ergibt sich gar nichts. Ich hatte vergessen, den Abfluss zu verschließen. Ich schlage mir die Hände über den Kopf zusammen. Das kann doch nicht wahr sein. Mehr wollte ich doch gar nicht vom Ende der Welt, außer in einer modrigen Pfütze zu sitzen. Ich war bei meiner letzten Powerbank angekommen, ich hatte meine letzten Akkuprozente perfekt vorausgeplant. Ich hätte heute Musik gehört, die ich vor einem Jahrzehnt heruntergeladen habe, gesungen, mich abgeschrubbt. Vielleicht finde ich noch irgendwo zeit- und ortsnah Wasser.
Ich kann nicht genau erklären, wieso ich genau vor ihrer Wohnungstür stehe. Ich weiß gar nicht genau, ob sie da ist. Aber ich klopfe ziemlich sicher laut genug. Dann knarzt die Tür auf. Als sie vor mir steht, fällt mir auf, dass sie mir gar nicht geschrieben hatte, heute. Obwohl wir uns nie besonders geliebt oder gehasst haben. Es war eben einfach nichts zwischen uns. Am Ende bin ich vermutlich nur hier, weil wir nah beieinander wohnen.
„Wieso hast du mir nicht geschrieben?“, frage ich sie.
Sie fängt an zu prusten, so richtig, mit Spucke, so lacht man, wenn die Welt untergeht. Wir begrüßen uns trotzdem, während ich mindestens mitgrinsen muss.
„Ich hab keinen Akku mehr, seit zwei Tagen, und zu mir nach Hause fährt buchstäblich gar nichts mehr. Selbst wenn ich mit einem dieser provisorischen Nachtzüge fahren würde, würde ich nirgendwo ankommen.“
„Wieso fragst du dann nicht mich?“
„Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber wann haben wir bitte das letzte Mal miteinander geredet?“
„Fair, aber ist es nicht irgendwie so ein bisschen das Ende der Welt? Leute machen krassere Sachen, als sich gegenseitig nach Strom zu fragen.“
Ich bringe ihr meine allerletzte Powerbank, auch wenn ihr das kaum mehr bringen sollte als 50%. Sie hat noch überschüssige Wasserflaschen gebunkert, die nehme ich zu mir mit rüber. Das Mobilfunknetz scheint bis zum Ende nicht abzubrechen, während aus den Buchsen in der Wand seit ein paar Tagen keine Meldung mehr kommen will. Wer auch immer die Kommunikation im Land aufrechterhält, muss ein wirklicher Gutmensch sein. Das Ende der Welt passiert planmäßig gegen 22 Uhr, was mir noch etwa eine halbe Stunde gibt, um mich mit zwei Wasserflaschen abzuwaschen. Ich kaure mickrig am Badewannenrand. Es ist einfach nur kalt.
Dann fangen die Anrufe an. Und als es am anderen Ende weint, weine ich mit. Ein Großteil meiner Familie hat es zum Schluss noch geschafft, zusammen zu sein. Aber genauso wie meine großzügige Wasserspenderin bin ich viel zu weit weg. Außer Apokalypsen-Reichweite. Wäre ich direkt mit der Ankündigung nach Hause gelaufen, hätte ich es auch nicht geschafft. Wer noch angefangen hat zu reisen, hatte genauso verloren wie die, die alleine geblieben sind.
Und dann weint meine Mutter. Ich hatte mir nie vorstellen können, dass ich am Ende allen Seins in mehrere Decken eingewickelt auf meinem Schreibtischstuhl sitzen würde, dutzend Meter in der Wohnung über dem Boden, auf die kahle Stadt starrend, die mir vereitelt, mit meiner Familie zu sein, und dann weint sie, und sagt mir mit ihren beinahe letzten Atemzügen, dass sie immer stolz auf mich war, aber damals Recht damit hatte, dass ich nicht so weit hätte wegziehen sollen, und ich bin gar nicht sauer auf sie wegen des Seitenhiebes. Ich muss einfach nur weinen. Ist das eine Scheiße. Das ist der größte, der größte, gottverdammte Blödsinn, den ich je gehört habe. Wer so etwas schreiben würde, will nur, dass Leute leiden.
Es klopft an der Tür, beinahe zeitgleich mit dem 22-Uhr-Schlag. Wir verabschieden uns. Ich höre zum letzten Mal, wie meine Familie, geteilt, in ihrem komischen Dialekt ins Mikrofon brüllt, und das Tränenfließen hört nicht mehr auf. Mein Magen verkrampft sich, ich muss mir an die Brust fassen, weil mein Atmen stückig wird. So stolpere ich zur Tür, vor der sie steht, mit der Powerbank in der Hand, die, die ich ihr gerade erst gegeben hatte.
Ich glaube, es ist eine Eigenschaft des Menschen, zu weinen, mit Schnodder und Grunzen, wenn die Erde untergeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide uns vorher nicht im Entferntesten je umarmt hatten. Aber man hält sich eben gegenseitig fest, wenn es zu Ende geht.
„Bei dir ist die bessere Aussicht“, stellt sie fest, „und ich wollte dir die Powerbank wiedergeben.“
„Also, ich wollte einfach nicht alleine sein.“
Am Ende ist nur Feuerwerk.
Es ist ziemlich sicher kein Feuerwerk, es ist viel zu viel zu laut. Meine Ohren klirren. Es kommt grell durch die Fenster ins dunkle Zimmer. Wir zerfließen in die Schatten, die es wirft. Auch wenn ich die Worte hasse, die alle sagen, und sie glaube ich auch, tragen sie uns davon.
Sie ziehen sich durchs schemenhafte Sterben hindurch.
„Mach's gut.“
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jonas Galm
aus einem leeren Mund kann man nicht flüchten, auch einen leeren Mund gilt es zu fürchten
Szenario eins.
Die Suppen: gelöffelt — jegliche Sorten von Suppe: legierte Suppen, Samtsuppen, kalte Suppen. Gebundene Suppen, Pürree. Eintöpfe. Menge, Zutatenliste, Reihenfolge ablesbar an den ehemals weißen Hemden der Tischgemeinschaft.
Hier wird gekleckert, nicht geklotzt.
Systematisch.
Infragestellung und Verfeinerung der Suppe: check.
Ist es noch eine Suppe, wenn niemand sie an- oder umrührt.
Wenn eine Suppe kein Schüsselchen findet, wohin verschwindet sie dann.
Monokel, plansch.
Die Sitte (veraltend, verhalten) verlangt es, klare Suppen — Kraftbrühen —
werden in Tassen, gebundene Suppen — püriert — dagegen in tiefen Tellern serviert,
die Sitte forciert es, die Sippe
kennt es nicht anders, hier Suppen in vorgewärmtem Geschirr und jenseits der Fingerkuppen, in Vogelschwärmen, Geschwirr,
vor dem Fenster fallen unbemerkt Schwalben aus unseren Himmeln, stupide, verstummt.
Good news: hier stellt ein Anheben der Suppenteller zur Vollendung der Speise keinen Verstoß gegen die Tischsitten dar.
Hallelujah.
Allein das heftige Pusten ist gemeinhin zu unterlassen, dagegen sollte man — zuliebe der Witterung unterer Atemwege — die Speise leicht mit dem Löffel, dem kleinen, mittleren Finger bis zum vollständigen Eintritt in den Zustand der abgekühlten Verzehrbarkeit rühren. Rührend,
um ein Verkleckern je nach Bedarf zu verhindern oder herbeizuführen, empfiehlt sich die Miteinbeziehung der Tischplatte, präzise Gewalteinwirkung auf dieselbe, Tremor, Tremolo, Crescendo, da capo!, das große Finale — die Kleckerei, endlich: das Plustern
hat sein ertrinkendes Ende gefunden,
Tischdecke, Vorhang.
Schluss.
Szenario zwei.
inmitten der Suppenverspeisung
Stromausfall —
Der Teller glüht. Der Löffel glüht. Die Zähne glühen.
Jemand erkundigt sich, ungefragt, nach Ursprung und Form
der Vergangenheit,
schlürfend. Die Tasse glüht.
Ich hab die Verpackung weggeschmissen,
ich habs mir geschworen, die Sitten erlauben es — Störungen, Überflutungen
zulassen. Schütter,
mit wallenden Kerzen such ich den Sicherungskasten, durchwühle den Plastikmüll, die Notversorgung ist bereits eingeschaltet,
die Lichter brennen bereits, der Müll ist bereits Suppe, dampfend,
Die Suppe hat mich verspeist.
Ich erwarte ihre Verdauung, letzte Hoffnung — carry on phenomenon —
die Gottheit in der Not, mein
last resort: Metabolismus.
Die Suppe wird selbst zum Refugium.
So war das,
so könnte das gewesen sein.
Man hat mir gesagt: ich hoffe, wir sehen uns bald wieder
mir gefällt dein Unterton, — ohne zu zwinkern
oder Ironie,
und ich war nackt.
Man hat mir gesagt:
Sonnenuntergang, du stöhnst sehr schön
— ein Gesicht, das zurückschaut —
wie traurig, dass nichts davon bleibt, oder nicht? (ich wollte dem weder zustimmen noch widersprechen)
Schön, dass es nun zu Ende sein muss,
J'ai faim
— aime-moi, alors!
Das ist viel leichter, als ein Gedicht zu schreiben, das nicht stupide und kurzsichtig und wahnsinnig unterkomplex gerät, trotz aller Sperrigkeit. Aime-moi, alors. Alors, warum auch nicht.
Ich habe Hunger —
Man hat gesagt,
heute schlaf ich nackt,
Oder: ich wünsche ihnen viel Gesundheit und ein interessantes Leben,
woanders, sehr nah: man ist am Ende natürlich allein,
aber ich hoffe, du vergisst trotzdem nicht: du bist nicht allein,
man muss sich verbünden.
jemand: der Rest sei ja vollkommen wurscht —
So war das.
nett.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Chris Lauer
Der Gebetsbaum
Wenn Marion in ihrem Schlafzimmer steht, sieht sie auf einen Innenhof hinaus. Der Innenhof gehört zu einem anderen Haus, oder vielleicht auch zu keinem, das weiß Marion nicht. Der Boden ist uneben und die Mauern krumm; Marion stellt sich den Innenhof immer vor wie eine Zahnkrone, die man auf den Kopf gedreht und zwischen die Häuser gesteckt hat, damit der herunterhängende Himmel nicht blank da steht. Irgendwann hat ein Baum angefangen, in der Mitte des Innenhofs zu wachsen. Im Frühling ist dieser Baum ein Ostereierbaum, im Sommer ein Papiergirlanden- oder Weißewäschebaum, im Winter ein Lichterkettenbaum, nur im Herbst hat der Baum, der seine Blätter verliert, keinen Namen. Um dem Baum auch im Herbst einen Namen zu geben, haben Menschen begonnen, Gebete an den Baum zu hängen. Die Gebete flattern als bunte Stoffstreifen im Wind. Marion hört sie bei geschlossenem Fenster, wenn sie in ihrem Schlafzimmer steht, mit hellen Stimmen durcheinander reden. Ein Wort hat Marion noch nicht verstanden. Sie sieht nur, dass je leichter der Baum durch das Verlieren seiner Blätter wird, desto schwerer wird er an Gebeten. Beim ersten Schnee ist der Baum dann so schwer an Gebeten, dass er gekrümmt da steht und kein Vogel mehr Platz hat, um sich auf einen seiner Äste zu setzen. Dann kommt jemand vorbei und sammelt die Gebete ein. Manchmal ist es eine Frau und manchmal ein Mann. Die Frau oder der Mann knoten jedes Gebet einzeln wieder auf und verstauen es in einer Tasche. Für die Gebete, die an den oberen Ästen hängen, müssen sie oder er auf eine Leiter steigen und mit ausgestreckten Armen das Gebet vom Ast entfernen. Nie aber wird dabei ein Gebet zerschnitten. Marion fragt sich, wohin die Gebete verschwinden, was eigentlich mit den Gebeten passiert, die gesprochen werden, wenn der Baum kein Gebetsbaum, sondern ein Ostereier-, Papiergirlanden-, Weißewäsche- oder Lichterkettenbaum ist. Vielleicht fühlen diese Gebete nicht den Wind, der sie immerzu in Bewegung hält, vielleicht sind sie nicht bunt, vielleicht können sie nicht über die Haut gleiten, wie Stoff über die Haut gleitet, und vielleicht sprechen sie nicht mit hellen Stimmen durcheinander. Vor allem müssen diese Gebete einfachere sein, denkt Marion, denn sie brauchen nicht eine Zeit lang angebunden zu werden, so wie man einen störrischen Hund anbindet, bevor man ihn frei laufen lassen kann.
Gerade hängt der Baum wieder voll mit Gebeten und Marion entscheidet sich in diesem Augenblick dazu, zwei weitere anzubringen. Eins für den Baum, denn irgendwann ist Marion klar geworden, dass der Baum zwar die Gebete vieler anderer Leben trägt, er aber nie ein eigenes wird hinzufügen können. Das andere Gebet möchte sie für sich selbst dort anknoten. Marion ist sich unsicher, ob es gegen die Regeln des Gebetsbaums verstößt, aber für ihre Gebete möchte sie keine Stoffstreifen benutzen, sondern ihre beiden Schnürsenkel. Die Schnürsenkel sind mintgrün und viel länger als die anderen Stoffstücke, die an dem Baum hängen, obschon ihre Gebete kurz sind. Da Marion ihre Schnürsenkel nicht entzweischneiden möchte, entschließt sie sich dazu, mit ihnen Schleifen zu binden. Warum Marion keine Stoffstreifen, sondern ihre Schnürsenkel zum Befestigen der Gebete benutzt, hat einen einfachen Grund: Marion trägt den Kampf, den sie mit sich ausficht, in den Beinen. Zunächst hat ihr das erlaubt, ihren Alltag zu ordnen. Einmal morgens und einmal abends, dann dreimal, viermal, fünfmal am Tag. Wenn es Marion nicht gut ging, weil sie essen wollte, ihr dieser Wunsch aber große Angst machte, meldeten sich ihre Beine. Ihr Beine sagten ihr, dass sie gerne laufen würden. Und Marion hielt das für eine gute Idee, denn anstatt dass sie mit sich selbst zusammenarbeitete, ließ sie einfach ihre Beine zusammenarbeiten. Das ging am besten, wenn die Beine ihre Aufgabe ganz schnell und ohne Pause ausführten. Dann bekam Marion das Gefühl, dass überhaupt kein Kampf mehr da war; dass so wie ihre Beine zwei und doch eins waren, auch sie zwei und doch eins war. So lief Marion eine Runde nach der anderen im Park. Sie lief so viele Runden im Park, dass die Muskeln in ihren Beinen anschwollen und mehr Platz in ihren Ober- und Unterschenkeln da war. Sie konnten jetzt nicht mehr nur Marions Kampf, sondern auch ihren Verstand aufnehmen. Dann musste Marion gar nicht mehr nachdenken, wo sie abzubiegen und welche Strecke sie zu laufen hatte, das ging dann ganz von alleine. Aber nach langer Zeit merkte Marion, dass ihr Alltag gar nicht mehr dadurch geordnet wurde, dass sie Runden lief, und dass der Hunger nicht dadurch verschwand. Trotzdem konnte Marion gar nicht mehr aufhören mit laufen. Sie lief Schuhpaar um Schuhpaar kaputt, bis sie plötzlich fürchtete, auch sich selbst kaputtzulaufen. Deswegen fädelt Marion gerade ihre Schnürsenkel aus und geht nach draußen. Eine kalte Brise wirbelt Blätter auf; die Gebete schnalzen laut mit der Zunge, sonst bleiben sie still. Marion schaut in den Himmel hinauf. Er hängt durch, als ob jemand sich in ihn wie in eine Hängematte gelegt hätte. Da sagt sie sich: Diese Nacht wird es Schnee geben. Sie bindet zuerst den ersten Schnürsenkel fest, dann den anderen. Sie braucht gar nicht lange dafür. Dann geht sie zurück ins Haus. In der Nacht steht sie in ihrem Schlafzimmer und schaut hinaus. Sie fragt sich, wie viel Schnee es braucht, um den ganzen Innenhof einzuschneien. Vielleicht so viel, wie es Gebete braucht, um eine Hängematte zu füllen, denkt sie. Dann schläft sie ein. Als sie am nächsten Morgen erwacht, sind die Rollladen noch hochgezogen. Es hat geschneit. Mintgrün.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Leonie Höckbert
Junimond
Janni träumt von der perfekten Trennung. Sie träumt davon, dass alles ganz unkompliziert sein kann. Wie in Filmen und Serien. Wo Paare, die jahrelang zusammen waren, sich einfach eines Abends an den Küchentisch setzen können und sagen können: Das war’s. Und dann geht einer von beiden und die andere bleibt am Küchentisch zurück und gießt sich ein Glas Wein ein und trinkt es nachdenklich, aber nicht unbedingt todtraurig, aus. In manchen Filmen, besonders in französischen, findet Janni, besprechen die in Trennung befindlichen Paare sogar ganz am Ende noch ganz Wesentliches, sagen dem Anderen nochmal ein paar ernste Worte über die Persönlichkeit oder das Verhalten oder das Leben und Beziehungen im Allgemeinen und dann entsteht daraus gar kein Streit oder tiefe Verletzung und Beleidigung, sondern ein wertschätzender Austausch, an dessen Ende sich die Trennung wie der ganz richtige Schritt für beide anfühlt. So soll das für Janni sein. Ohne Tränen. Wenigstens, bis die Szene im Film vorbei ist. Sie sehnt sich nach dem Moment nüchterner Klarheit, in dem beide Parteien zugleich erkennen: Aus uns wird nichts mehr. Wir sollten nachts kein Bett mehr teilen. Wir sollten morgens keinen Kaffee mehr füreinander machen. Die Formulierung eine Szene machen erscheint Janni sinnlos. Eine Szene nach ihren Vorstellungen wäre gerade das Gegenteil von dem, was gemeint ist.
Ihre Trennungsgeschichte hat in der fünften Klasse angefangen und ihre Standards gleich zu Beginn hoch angesetzt. Jonas aus der Parallelklasse hatte ihr in der großen Pause ein KitKat Chunky White gekauft. In der nächsten großen Pause hatten sie Händchen gehalten und sich nach der Schule darauf geeinigt, miteinander zu gehen. Ungefähr drei Wochen lang hatten sie Händchen gehalten und Schokoriegel geteilt, bis Jonas nach der Schule sagte, er wolle nicht mehr zusammen sein. Seine Freunde fänden, sie sollten sich küssen, aber er habe keine Lust da drauf. Janni hatte auch eigentlich keine Lust da drauf und genug Taschengeld, um sich selbst KitKat zu kaufen. Sie sagte okay, wir machen Schluss, und Jonas rannte zu seinen Freunden und mit ihnen zum Bus. Statt Enttäuschung hatte Janni eine gewisse Erleichterung gefühlt.
Eine Beziehung überhaupt anzufangen, ist die entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Trennung, deswegen sucht Janni immer wieder auf Dating-Plattformen nach Männern, von denen sie sich trennen kann. Jannis erste Beziehung im Studium ging zwei Jahre lang und als sie sich trennte, war es furchtbar, voller Tränen und Vorwürfe, Gemeinheiten und Selbsterniedrigung. Danach nahm sie sich vor, zu üben.
Sie betrachtet sich selbst auch als eine Art Trainingseinheit für ihre Kurzzeitpartner. Wie ein Kurs im Fitnessstudio oder bei der Volkshochschule. Wer mit ihr fertig ist, oder besser – mit wem sie fertig ist, der kann sich als weitergebildet betrachten und ist dementsprechend gewappnet für die nächste Beziehung. Dass eine Beziehung bestenfalls nicht vom Ende her anfängt, kommt Janni nicht in den Sinn. Heiraten ist für sie nur der Auftakt zu einer Trennung mit mehr Schritten.
Sie probiert verschiedene Methoden aus. Eine Trennung über Textnachricht kommt ihr zwar nicht so moralisch verworfen vor wie immer behauptet, ist aber auch nur die Fälschung des Gefühls, nach dem sie sucht. Sie hat es probiert und obwohl das für sie ruhig und überlegt abgelaufen ist, fehlt ihr die Perspektive des Verlassenen, der natürlich trotzdem völlig verzweifelt sein könnte. Die Trennung muss im Gespräch passieren. Am besten spontan, nicht von langer Hand geplant. Aus einem Impuls heraus, der den Partner auch ganz plötzlich erkennen lässt, dass sie wirklich nicht zusammenpassen. In einem nachlässig im Schlafzimmer versteckten Notizbuch dokumentiert Janni ihre Versuche. Es liegen immer einige Monate oder wenigstens Wochen zwischen den einzelnen Einträgen, um überhaupt einen gewissen Spannungsaufbau für die Trennungsübung sicherstellen zu können. Trotzdem sind zwei Versuche mit der etwas peinlichen Notiz versehen, dass die Internetbekanntschaft, der Janni die Trennung unterbreitete, bei diesem Anlass überhaupt das erste Mal davon gehört hat, dass sie zusammen gewesen wären.
In inzwischen einigen aktiven Jahren Forschung und Proben brachte sie es auf ungefähr zwölf ernstzunehmende Datensätze. Davon war genau eine Trennung auch nur in die Nähe einer soliden Filmszene gekommen. Da waren sie zu zweit nach sechs Monaten regelmäßiger Treffen in einem gerade aufblühenden Sommer in den Park gegangen und hatten so lange schweigend auf einer Parkbank gesessen, dass unumstößlich klar geworden war, dass alle weiteren Treffen drückende Stille wären, sie hatten sich nach sechs Monaten einfach nichts Neues mehr zu sagen. Er sagte, es wäre nicht unangenehm, mit ihr zu schweigen, aber er würde dabei auch nichts Besonderes fühlen. Janni bestätigte. Sie nahmen sich an der Hand und schwiegen noch, bis es dämmerte. Danke, dass du es angesprochen hast, sagte Janni, bevor sie in verschiedene Richtungen aufbrachen. Danke, dass du keine Szene gemacht hast, sagte der Mann, der in sechs Monaten anscheinend gar nichts über Janni gelernt hatte.
Einer ihrer Partner hat gefleht, sie solle ihn nicht verlassen. Drei haben sich von ihr getrennt, bevor sie ihre letzten Worte gut sortiert hatte. Zwei haben sie nach einigen Monaten geghosted und so ein auf andere Art besonders unbefriedigendes Ende geschaffen. Einem Mann hat sie zuvor von ihrer Sehnsucht nach der perfekten Trennung erzählt und als sie es dann versucht hat, hat er sich an das Gespräch erinnert und ist zynisch geworden. Die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht, die Orte sind falsch oder die Dinge, die gesagt werden, unpassend; das Gefühl von entromantisierender Ernüchterung ergibt sich nicht, wird oft überschattet von Jannis Erleichterung, eine ihr längst unbequem gewordene Übungsbeziehung endlich ihrem Zweck zuführen zu können. Viel zu oft wurde geweint. Das ist besonders falsch, dieser Schmerzausdruck, der eine unmittelbare Schuldzuweisung enthält. Wer sich gegenseitig nichts vorhält, sollte nicht heulen, findet Janni.
Auf der Arbeit klickt sie sich den ganzen Tag durch Excel-Tabellen. Neben ihr auf dem Schreibtisch liegt ihr Handy, stummgeschaltet, und leuchtet immer wieder auf, wenn sie eine Nachricht von Tinder oder Bumble bekommt. In der Phase nach einer Trennung wirft sie Netze in alle Richtungen aus, unterhält vier, fünf Konversationen parallel. Erst seit ein paar Wochen arbeitet sie in der Datenanalyse, es ist ihr erster Vollzeitjob, sie lernt viel für ihre eigenen Daten und notiert sich oft Analyseverfahren für den Privatgebrauch. Der Job ist ruhig genug, um nebenher fast identische Nachrichten an mehrere potentielle Trennungsübungspartner zu schicken.
Als der Chef sie Montag morgens ins Büro ruft, ist es das erste Mal, dass Janni den Raum wieder betritt seit ihrem Bewerbungsgespräch. Der Chef bietet ihr einen Kaffee an und einen der Stühle am Schreibtisch, keinen der gemütlichen Sessel in der Ecke. Als der Kaffee vor ihr steht, vor ihm nur ein Espresso, klappt er seinen Laptop zu und sagt, er wolle nicht drumherum reden. Ob sie sich bei ihnen in der Firma wohlfühle? Janni nickte, etwas überrascht von der Frage. „Wir haben nicht den Eindruck“, sagt der Chef und nippt am Espresso. „Sie bringen sich wenig ein und scheinen Schwierigkeiten mit dem Teamgeist unserer Einrichtung zu haben.“ Wer ist eigentlich „wir“, denkt Janni, während sie nichts sagt. „Leider muss ich ihnen mitteilen, dass wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Stellen in ihrem Arbeitsbereich einsparen müssen. Das bedeutet, dass wir uns von Ihnen verabschieden müssen, so leid es mir tut.“ Er trinkt seinen Espresso in einem Zug leer. „Können Sie das nachvollziehen?“ „Ja“, sagt Janni, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Sie sind noch in der Probezeit. Daher gilt ihre Kündigung fristlos. Ich möchte Sie bitten, ihren Platz aufzuräumen.“ Er steht auf und reicht ihr die Hand. „Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Weg.“
Janni lässt ihren Kaffee unberührt stehen und geht zurück zu ihrem Platz, wo ihre letzte Aufgabe noch auf dem Bildschirm offen ist. Es dauert nur wenige Minuten, ihr Handy, ihren Thermosbecher und ihre wenigen anderen privaten Gegenstände in ihre Tasche zu packen und alle privaten Daten vom Rechner zu löschen. Ihre Kollegen scheinen in Mittagspause zu sein, jedenfalls nickt Janni auf dem Weg raus nur der Empfangsdame zu, die als einzige auf ihrem Platz sitzt. Es ist alles ganz unkompliziert. Die perfekte Trennung, denkt sie anerkennend. Und wartet mit den Tränen, bis sie auf der Straße steht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sonja Kittel
Approximation
Sie sitzt mit angezogenen Knien auf einem Stuhl und wartet. Der Hund hat sich am Boden eingerollt und schließt sich dem Warten an. Zwei Feuerkäfer krabbeln an seiner Schnauze vorbei. Einen Moment bleibt sie noch sitzen, hofft, dass doch ein Einfall kommt, ein Anfang. Stattdessen tippt sie etwas in die Suchmaschine, verliert sich in den Nachrichten des Tages. Bald klappt sie den Laptop zu, geht ins Haus und beginnt die Abendroutine. Nicht verhasst, nicht einmal unangenehm, nur Routine, die sie ein weiteres Mal nicht durchbrechen kann.
Markus lief die Treppe hinunter und raus aus der Tür. Er drehte sich nicht um, blieb nicht stehen, wurde nicht langsamer. Er hatte sich viel vorgenommen für diesen Abend. Schon am Anfang der Woche hatte er begonnen sich vorzustellen, wie es ablaufen würde. War Dialoge in seinem Kopf durchgegangen und Musik, die sie hören würden, hatte die Begrüßung in verschiedenen Varianten durchgespielt. Ein Händedruck oder eine Umarmung, die ein bisschen zu lang dauert.
Die ersten Sätze sind geschafft. Der erste Absatz fertig. Plötzlich ist er aus ihrem Kopf gepurzelt. Weitere fügen sich unaufgefordert hinzu. Sie hat eine vage Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Es fühlt sich nicht euphorisierend an. Es ist kein Flow. Viel mehr ermahnt sie das Trommeln und Schnaufen der Waschmaschine, dass sie bald geleert werden will.
Markus hatte Robert vor zwanzig Jahren kennengelernt. In einer Vorlesung über „Approximation“. Sie hatten begonnen sich kleine Zahlenrätsel zu stellen. Markus hatte das Papierkügelchen-hin-und-her-schieben an seine Schulzeit erinnert und die Vorlesung war fast zu schnell vorbei gewesen. Sie hatten sich in die Mensa gesetzt und gemeinsam Mittag gegessen – Kohlrabicremesuppe, Lasagne, Erdbeerkuchen – gefolgt von stundenlangem Austausch über gute und schlechte Entscheidungen im Leben. Dieser Tag war der Anfang einer Freundschaft gewesen, die sie durch das Mathematikstudium trug.
Fast eine Woche hat sie nichts geschrieben. Jetzt legt sie dem Hund das Geschirr an und geht mit ihm raus. Durch den Wald, an der Kletterwand vorbei, die heute einsam da steht, und weiter bis zur kleinen Kapelle. Dort setzt sie sich auf eine Bank. Der Hund bleibt stehen und hechelt. Die Schwarzkiefern knacksen und krachen unter der Hitze des Sommertags. Sie wollte immer schreiben. Es ist das, was ihr am meisten Spaß macht. Es ist das eine Kontinuum, das sich durch ihr Leben zieht. Sie zwingt sich, an den Text zu denken.
Sie wohnten zusammen, sie radelten zusammen, sie reisten gemeinsam nach Andalusien und wanderten durch die Sierra Nevada. Sie betranken sich am Ende jeder missglückten Beziehung und stießen auf jede neue Liebe an. Sie gingen auf Tocotronic-Konzerte, brüllten „Hi Freaks“ in die Nacht hinaus und dann war plötzlich alles vorbei. Der Abschluss des Studiums riss ihre Welt auseinander und teilte sie in zwei neue, deren Umlaufbahnen einander nicht tangierten. Robert zog nach Zürich, wo er als Doktorand an der Technischen Hochschule forschte. Markus entschied sich fürs Lehrerdasein, lange Sommerferien und geregelte Tage. Am Anfang telefonierten sie noch ab und zu, dann begann die Verbindung immer loser zu werden, bis sie irgendwann riss.
Sie hat ihr Notizbuch herausgenommen und schreibt schnell ihre Gedanken auf. Lange waren die Seiten leer geblieben. Sie jetzt mit Buchstaben, Worten, Sätzen zu füllen macht sie glücklich. Sie streichelt dem Hund über den Kopf, steckt das Büchlein ein und geht weiter. Ein leichter Wind kommt auf. Die Luft knistert. Der Hund beginnt zu zittern. Er spürt das nahende Gewitter. Erst im Alter hat er begonnen Angst davor zu haben. Heute dreht er hechelnd und zitternd seine Runden, wenn der erste Donner grollt. Sie geht schneller, läuft schon fast. Als sie das Gartentor öffnet, landen die ersten Regentropfen. Sie setzt sich auf den Teppich und krault den Hund. Sie klappt den Laptop auf und schreibt.
Acht Jahre hatten sie nichts voneinander gehört. Dann war da diese Feier. Das Geburtstagsfest einer gemeinsamen Freundin. Markus wollte gar nicht hingehen, hatte sich aber nach zwei einsamen Bier auf seinem Balkon doch einen Ruck gegeben. Als er den Garten des Heurigen betrat, berührte ihn die Szenerie. Bunte Lampions erhellten die gerade eintreffende Nacht. Die Gäste saßen dicht nebeneinander auf den Bänken, Weingläser, Zigaretten, Gesten zwischen den Händen. Es spielte ein Lied, das er einmal geliebt hatte, und er quetschte sich zwischen die feiernden Körper und ließ sich mitreißen in eine längst vergessen geglaubte Vergangenheit. Dann sah er ihn. Robert saß zwischen zwei ehemaligen Kommilitoninnen und lachte. Ein Lachen, das er so oft gehört hatte, dass es ihm zu einer zweiten Heimat geworden war. Jetzt verursachte es ein brennendes Ziehen zwischen seinen Rippen.
Sein erster Impuls war, sich zu ducken, zwischen den Tischen und Bänken hindurch zu krabbeln, unbemerkt zu entkommen. Doch schon hatte Robert ihn entdeckt, stand auf und ging zu ihm rüber. Er nahm ihn in den Arm, zog ihn neben sich auf die Bank. Er war vor ein paar Tagen nach Wien gekommen. Hatte gehofft, Markus hier zu treffen. Die anfängliche Befangenheit wich schnell dem intensiven Gespräch, das sie von Anfang an verbunden hatte. Die Bänke leerten sich, doch Markus bemerkte es nicht, weil er fokussiert war auf einen Menschen, den er so lange nicht mehr gesehen hatte und der ihm trotzdem sofort nah war, näher als zuvor.
Sie öffnet ihr E-Mail-Programm und ordnet Mails in verschiedene To-Do-Ordner. Neben sich sieht sie den Stapel Briefe liegen, der darauf wartet bearbeitet zu werden. Sie öffnet einen nach dem anderen. Der Hund legt sich brummend auf die Seite und streckt sich. Als sie nichts mehr davon abhalten kann, wendet sie sich wieder dem Bildschirm zu und schreibt.
Markus und Robert redeten die ganze Nacht. Sie schlossen nahtlos an das an, was sie gehabt hatten. Gute und schlechte Entscheidungen in ihrem Leben, Zahlenrätsel, „Hi Freaks“. Als sie auseinandergingen, war trotzdem alles anders. Markus konnte nicht aufhören, an Robert zu denken. Alles in ihm zog auseinander. Er wollte zurück in diese Nacht, zurück an die Seite von Robert, zurück in das Gespräch.
Markus lag auf der Couch und starrte sein Handy an. Wartete auf eine Nachricht, verzehrte sich nach einer Nachricht. Doch es kam nichts. Er schaltete den Fernseher an. Zappte von Programm zu Programm. Schaute wieder aufs Handy. Nichts. Er tippte ein paar Worte in sein Telefon, löschte sie wieder. Er schloss die Augen, versuchte, zu verstehen, was passiert war. Dann schrieb er doch eine Nachricht: „Hey, war schön gestern. Wie lang bist du noch da?“ Erst ein Häkchen, dann zwei, dann blau. Keine Antwort. Markus wurde wütend. Er schaltete das Handy aus und ging unruhig in seiner Wohnung hin und her. Aus seinem Verlangen wurde Zorn. Er hasste Robert. Er hasste ihn dafür, dass er damals weggegangen war. Er hasste seine Forschungsambitionen, sein Fernweh, sein Lachen.
Als er abends das Handy wieder einschaltete, war die Antwort da. „Ja, war schön. Bin noch bis Ende der Woche da. Komm doch Freitag vorbei. Ich koche was.“ Die Wut war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war. Seine Finger kribbelten, sein Gaumen kitzelte. Markus biss sich auf die Zunge, um dem ein Ende zu setzen, das er sich nicht erklären wollte. Er zwang sich dazu, nicht gleich zurückzuschreiben. Fünf Minuten später machte er es doch. Er käme gerne. Er freue sich. Er setzte sich an den kleinen Tisch auf seinem Balkon, rauchte eine Zigarette und begann sich vorzustellen, wie es ablaufen würde.
Der Hund kratzt an der Tür. Sie lässt ihn in den Garten, setzt sich gleich wieder an ihren Text. Die Push-Nachrichten auf ihrem Handy hat sie deaktiviert, später das Handy ganz abgeschaltet. Sie tut es endlich. Sie schreibt einen Text, sie hält eine Deadline ein. Sie weiß jetzt, dass sie es schaffen wird.
Die Tage vergingen zu langsam und viel zu schnell. Am Freitag machte Markus dann alles so, wie er es schon so viele Male in seinem Kopf durchgegangen war. Nach der Arbeit eine Runde laufen, duschen, das hellblaue Hemd mit Rundkragen. Ein Glas Wein für die Nerven. Er setzte sich in die Straßenbahn, lehnte den Kopf an die Scheibe und betrachtete die Menschen draußen. Bei Robert angekommen klingelte er, öffnete die Tür, als das Surren erklang, und stieg die Treppen hinauf. Mit jeder Stufe schlug sein Herz schneller.
Die Tür stand offen. Robert rief ihm aus der Küche zu, er solle es sich schon mal bequem machen. Das Essen – Kohlrabicremesuppe, Lasagne, Erdbeerkuchen – begleiteten Gespräche über Roberts Forschungsprojekte und Markus‘ Alltag als Lehrer. Markus bat Robert um ein bisschen Musik. Er schaltete das Radio ein. Sie gingen auf den Balkon eine rauchen, schauten auf die gegenüberliegende Hauswand, konnten das Gespräch zum ersten Mal nicht am Laufen halten. Markus ging ins Badezimmer und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er schaute sein Spiegelbild an und versuchte, ihm und sich Mut zu machen.
Als er aus dem Badezimmer trat, stand Robert vor ihm. Er hatte Markus Jacke in der Hand. Er wolle ihn nicht rausschmeißen, aber morgen müsse er früh raus. Der Rückflug nach Zürich, vorher das Apartment räumen. Markus nahm seine Jacke wie in Trance. Er zog seine Schuhe an, öffnete die Tür und stand schon auf dem Gang, als Robert ihn nochmal zurückzog. Einen kurzen Moment zögerten beide und schauten sich an. Dann drückten sie sich kurz. Schön war es gewesen, ihn wieder zu sehen, und er solle doch ab und zu etwas von sich hören lassen. Markus lief die Treppe hinunter und raus aus der Tür. Er drehte sich nicht um, blieb nicht stehen, wurde nicht langsamer.
Sie klappt den Laptop zu, es ist geschafft. Für heute hatte sie sich die Deadline gesetzt. Entweder du schreibst diese Geschichte fertig, oder du vergräbst deinen Traum in einem tiefen Loch und holst ihn nie wieder hervor. Am Abend wird sie ihren Geburtstag feiern. Sie hat viele Menschen eingeladen, einige davon hat sie schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Als sie den Garten des Heurigen betritt, berührt sie die Szenerie. Bunte Lampions erhellen die gerade eintreffende Nacht.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at